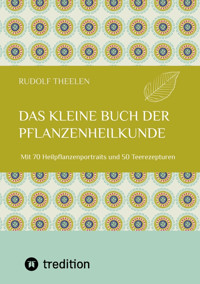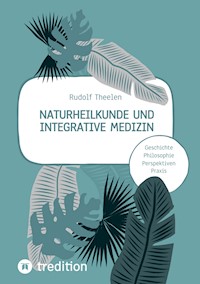
Naturheilkunde und integrative Medizin - Grundlagen einer ganzheitlichen Heilkunde E-Book
Rudolf Theelen
8,99 €
Mehr erfahren.
In diesem Buch geht es um die positiven Auswirkungen einer im ursprünglichen Sinne humanen Heilkunst. Den Menschen als Ganzes zu betrachten, alle seriösen Formen der Heilkunst integrativ zu nutzen und die elementaren Naturkräfte als Grundkonstanten menschlicher Existenz zu respektieren, ist das Anliegen der Traditionellen Naturheilkunde. Die Frage, was Gesundheit sei, kann und sollte dabei auch geschichtlich betrachtet werden. Dann wird sie zu einem Spiegelbild der jeweils herrschenden Weltanschauung, die unseren persönlichen Überzeugungen notwendigerweise zu Grunde liegt. Die Betrachtung philosophischer und medizinischer Ansätze, die auch heute noch das naturheilkundliche Weltbild prägen, befähigt zu einer umfassenderen und tieferen Wertschätzung unserer eigenen Gesundheit und der Gesundheit von Natur und Umwelt. Denn nur eine gesunde Natur besitzt noch jene Mittel und Reize, die unseren Organismus zur Selbstheilung aktivieren können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rudolf Theelen
Naturheilkunde und integrative Medizin
Rudolf Theelen
Naturheilkunde undintegrative Medizin
Geschichte • Philosophie • Praxis • Perspektiven
Der Autor
Rudolf Theelen, geboren 1966, konnte als Heilpraktiker in eigener Praxis umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Traditionellen Naturheilkunde sammeln. Aktuell ist er Inhaber und Leiter eines renommierten Lehrinstituts zur Ausbildung von Heilpraktiker*innen mit dem Schwerpunkt der integrativen Medizin. Zusätzlich zu einer fundierten Ausbildung in Naturheilkunde studierte er Philosophie und Medizingeschichte an der LMU München. Als Autor hat er Bücher zu verschiedenen naturheilkundlichen Themen veröffentlicht.
www.hpl-lotz.de www.rudolf-theelen.de
Impressum
Bitte beachten Sie: Die medizinische Entwicklung schreitet permanent fort. Neue Erkenntnisse, was Medikation und Behandlung angeht, sind die Folge. Der Autor hat größte Mühe walten lassen, um alle Angaben dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung anzupassen. Dennoch sind alle Leser*innen aufgefordert, die beschriebenen medizinischen Behandlungsverfahren eigenverantwortlich zu prüfen, um eventuelle Abweichungen festzustellen. Im Zweifelsfall ist immer der Rat von Ärzt*innen oder Heilpraktiker*innen einzuholen.
© 2023 Rudolf Theelen
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Softcover 978-3-347-79981-3
Hardcover 978-3-347-79982-0
E-Book 978-3-347-79986-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Vorwort 7
1 Geschichtliche Grundlagen 11
1.1 Krankheit und Gesundheit im Wandel der Zeit – Ein Überblick 11
1.2 Der Asklepios-Kult – Ganzheitliche Heilkunst in der Antike 19
1.3 Von Hippokrates bis Kneipp - Eine kleine Geschichte der Heilkunde 28
2 Philosophische Grundlagen 61
2.1 Medizin und Weltbild - Was Heilung mit Philosophie zu tun hat 61
2.2 Der Mensch im Mittelpunkt - Humanismus als Leitbild 86
2.3 Der Mensch in Beziehung - Humanistische Psychologie 106
3 Naturheilkundliche Grundlagen 113
3.1 Feuer, Wasser, Luft und Erde - Über die Natur der Dinge 115
3.2 Elemente und Säfte - Die Typenlehre in der Humoralpathologie 139
3.3 Zwei Jahrtausende - Über die Bedeutung der Humoralpathologie 154
4 Integrative Medizin 159
4.1 Das integrative Konzept - Kooperation zum Wohle des Patienten 159
4.2 Was uns gesund macht - Die Vielfalt therapeutischer Methoden 163
4.3 Medizinische Ethik - Eid des Hippokrates und Genfer Gelöbnis 201
5 Beispiel Burnout-Syndrom 205
5.1 Burnout-Syndrom - Definition einer „Mode-Erkrankung“ 206
5.2 Ausgebrannt - Ursachen und Hintergründe des Burnout-Syndroms 209
5.3 Integrative Medizin in der Praxis - Ganzheitliche Burnout-Therapie 214
6 Perspektiven 233
6.1 Die Palliativmedizin - Ein aktuelles interdisziplinäres Modell 233
6.2 Der Heilpraktiker - Ein ganzheitlich orientierter Heilberuf 239
6.3 Die Natur - Über Nachhaltigkeit in der Heilkunde 245
Literatur 250
„Dem Ganzen sollten sie (die Heilkundigen) ihre Sorge zuwenden, denn dort, wo das Ganze sich übel befindet, kann unmöglich ein Teil gesund sein.“
(Platon)
Vorwort
Die Kunst des Heilens hat eine sehr lange Geschichte, die sowohl von glanzvollen Höhepunkten großartiger Entdeckungen als auch von dunklen Zeiten des Vergessens geprägt ist. Vielleicht hat die Heilkunde dort ihren Anfang genommen, wo unsere Urvorfahren das auffällige Verhalten kranker Tiere beobachtet und dann im Sinne von „try and error“ imitiert haben. Vielleicht wurde die Heilkunde aber auch im Sinne der traditionellen und spirituell ausgerichteten alten Medizinsysteme von mythischen Vorfahren überliefert. Auf jeden Fall hat die Kunst des Heilens spätestens seit der Antike einen hohen Stellenwert und das zu Recht. Denn einerseits stellt körperliche, seelische und geistige Gesundheit für die meisten Menschen mit Abstand das höchste Gut dar und andererseits ist die Kunst, diese individuelle Gesundheit aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen, besonders anspruchsvoll und verlangt einem heilend tätigen Menschen großes Können und Einfühlungsvermögen ab.
Von Ärzt*innen, Heilpraktiker*innen, Psychotherapeut*innen und auch allen anderen behandelnd Tätigen erwartet die Mehrheit der Patient*innen ein hohes Maß an ethischer Verantwortung und nützlicher Lebenserfahrung, vor allem aber eine erfolgreiche Behandlung, die zu einer möglichst raschen und gleichzeitig nachhaltigen Genesung führt. Wie Heilung entsteht und auf welchen geschichtlichen, weltanschaulichen und therapeutischen Säulen eine ganzheitliche Heilkunde steht, bleibt dabei heutzutage meist unberücksichtigt. Der fehlende Wille zu einer tiefer gehenden Auseinandersetzung mit den Grundlagen medizinischen Denkens und Handelns führt, wie wir heute sehen können, zu einer oft unüberbrückbar scheinenden Diskrepanz zwischen „Schulmedizin“ und „Alternativ- und Komplementärmedizin“.
Die Wurzeln unserer europäischen Medizin gehen auf die griechische Antike zurück, die ihrerseits wiederum von Einflüssen aus Mesopotamien, Ägypten und auch Indien gespeist wurde. In der Medizingeschichte finden wir diagnostische und therapeutische Ansätze, die wir heute noch bestaunen und in moderner Form umsetzen. Aus der Geschichte kann man immer lernen, sie ist wie ein Bilderbuch, das man Seite für Seite aufschlägt, die Höhepunkte menschlichen Schaffens bewundert und über die Irrtümer und Sackgassen die Stirn runzelt oder schmunzelt. So ist zum Beispiel die Humoralpathologie des Hippokrates von Kos aus dem 5. Jahrhundert vor Christus nicht - wie uns so mancher Vertreter der modernen Schulmedizin glauben machen möchte - überholt und ungültig geworden, sie ist vielmehr sehr lebendig und kann in unserer heutigen Zeit sehr wertvolle Anregungen geben. Auch das jeweils herrschende Weltbild bestimmt in hohem Maße, wie wir mit uns und unserer Umwelt umgehen. Ein Blick in die Geschichte der letzten 2500 Jahre zeigt uns, wie sehr wir im Blickwinkel philosophischer Weltanschauungen leben und uns dessen eher selten bewusst sind.
Die Errungenschaften der letzten 150 Jahre Medizingeschichte sind überwältigend und haben vor allem der Medizintechnik eine neue Dimension eröffnet. Diesem Erfolg aus der Sicht der schulmedizinischen Behandler*innen steht leider oft ein Vereinsamungs- und Entfremdungsgefühl der Patient*innen gegenüber, deren Bedürfnis nach Mitgefühl und Anteilnahme in diesem System nicht erfüllt werden kann. Nehmen wir als Beispiel den modernen Klinikalltag: wenn man das Glück hat, in oder in der Nähe einer deutschen Großstadt zu leben, erscheinen die Möglichkeiten apparativer Diagnostik nahezu unbegrenzt. Alle Formen bildgebender Verfahren stehen in einer großen Dichte zur Verfügung und werden von ausgewiesenen Fachleuten vorgenommen und interpretiert. Es braucht also heute kein Geheimnis mehr zu sein, worunter ein*e Patient*in im körperlichen Bereich leidet, wenn er/sie bereit ist, sich einem ambulanten oder stationären Klinikaufenthalt zu unterziehen.
Auf der anderen Seite fehlt aber Zeit, sich um das seelische und geistige Wohlergehen der Patient*innen zu kümmern. Diese Diskrepanz ist vor allem ökonomischen Zwängen geschuldet, beruht aber auch auf einem modernen Selbstverständnis der universitären Medizin. Dass es auch anders geht, zeigen die anthroposophisch ausgerichteten Kliniken in Deutschland, in denen die Patient*innen neben der schulmedizinischen Versorgung auch naturheilkundlich behandelt und seelisch-geistig betreut werden. Dabei erfahren die Patient*innen eine menschliche Zuwendung, die sie die Freude am Leben spüren lässt - was erfahrungsgemäß entscheidend zur Heilung beiträgt. Man braucht aber kein Anthroposoph zu sein, um den Ansatz der integrativen Medizin zu verstehen. Es geht vielmehr darum, sich keiner Richtung einseitig zu verpflichten, sondern alle diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten intelligent miteinander zu verbinden und dabei das Wichtigste, nämlich den kranken und hilfebedürftigen Menschen, in den Mittelpunkt zu stellen. Die integrative Medizin verfolgt einen humanistischen Ansatz, der dazu führt, die individuellen Befindlichkeiten und Bedürfnisse wirklich ernst zu nehmen. Der Mensch bleibt als Patient keine „Nummer“ im anonymen Medizinbetrieb, sondern tritt als Individuum mit seiner persönlichen Biografie und seinem ihm eigenen Erleben in Erscheinung. Nur auf dieser Grundlage kann echte Heilung stattfinden.
Den Menschen als Ganzes zu betrachten, alle seriösen Formen der Heilkunst integrativ zu nutzen und die elementaren Naturkräfte als Grundkonstanten menschlicher Existenz zu respektieren, ist mein persönliches Anliegen. Die Aspekte der Ganzheitlichkeit und der Integration sind für mich Grundvoraussetzungen für eine im eigentlichen Sinne humane Heilkunst. Der Aspekt der Naturverbundenheit, vor allem der Respekt vor den elementaren Naturkräften, spielt für mich eine wesentliche Rolle und bietet die Grundlage für einen konstruktiven Beitrag zum Thema ökologische Verantwortung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und nachhaltige Gesundheit in einer lebenswerten Welt.
Rudolf Theelen
Kaltental im Januar 2023
1
Geschichtliche Grundlagen
1.1
Krankheit und Gesundheit im Wandel der Zeit
Ein Überblick
In allen Hochkulturen des Altertums galt körperliche, seelische und geistige Gesundheit als unabdingbare Voraussetzung für ein glückliches und im weitesten Sinne erfolgreiches Leben. Daran hat sich bis heute nichts verändert, wenn sich auch die Ansichten zur Praxis der Gesunderhaltung im Laufe der Zeit gewandelt haben. Jeder von uns wünscht sich eine stabile gesundheitliche Verfassung, die Grundlage ist für ein energievolles und möglichst langes und glückliches Leben. In der Regel zögern wir auch nicht, unseren Mitmenschen Gesundheit zu wünschen, wenn sie sich von diesem Zustand entfernt haben sollten. Doch wie oft verwenden wir die Frage: „Wie geht´s?“ lediglich als Phrase? In der Regel meinen wir es mit dieser Frage kaum ernst und erhoffen als Antwort ein kurzes: „Danke, gut!“ und sind irritiert, wenn unser Gegenüber die Frage zum Anlass nimmt, sich über sein Befinden tatsächlich in aller Ausführlichkeit auszulassen.
Dass sich diese Floskel in unserer alltäglichen Kommunikation derart eingebürgert hat, bestätigt eindrucksvoll, dass Gesundheit einen prominenten Platz in der Rangliste existentiell wichtiger Bedürfnisse einnimmt. Gesundheit ist auch stets ein zentrales Thema in Medien und Politik, im Gespräch mit dem Nachbarn, in der Auseinandersetzung mit unseren Freunden und der eignen Familie und nicht zuletzt mit uns selbst. Was aber ist Gesundheit? „Gesundheit ist ein Zustand von umfassendem körperlichen, geistigen und sozialen Wohlgefühl und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Befindlichkeitsstörungen“, heißt es übersetzt in der Präambel zur Satzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Darüber hinaus wird in der gleichen Satzung der für ein Individuum beste erreichbare Gesundheitszustand als eines der fundamentalen Menschenrechte bezeichnet.
Dass alle Menschen dieser Erde von diesem Recht Gebrauch machen können, davon sind wir weit entfernt. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber einer der wichtigsten ist sicher die beständig fortschreitende Ungleichheit der Verteilung von Kapital und Wohlstand. Woran denken wir, wenn wir von Gesundheit sprechen? An Heilung oder an die Vermeidung von Krankheiten oder an Ärzte, Kliniken, Krankenkassen, Beitragssätze etc.? Ist jemand, der von einer Krankheit geheilt ist, gleichzeitig auch gesund? Krankheiten sind, dies scheint uns selbstverständlich, mehr oder weniger schwer, und sie sind ganz, teilweise oder gar nicht heilbar. Gesundheit dagegen wird in der Alltagssprache meist als etwas Absolutes dargestellt, ausreichend definiert durch die Abwesenheit von Krankheit und daher keiner Differenzierung bedürftig. Es ist aber offensichtlich, dass Gesundheit viele Aspekte jenseits des Fehlens von Krankheit besitzt.
Ein wesentlicher Aspekt lässt sich schon im Vorhinein benennen: Gesundheit ist eine Sache der persönlichen Wahrnehmung und daher objektiv nur schwer fassbar. Das „Gesundsein“ ist also meistens identisch mit dem „Sich-Gesund-Fühlen“ – wenigstens aus der Sicht des Betroffenen. Und ob ein Mensch sich gesund fühlt, hängt in beträchtlichem Maße von Faktoren ab, die sich der Ratio und einer Beurteilung von außen entziehen und darüber hinaus von Mensch zu Mensch verschieden sind. Dieser subjektiven Wahrnehmung steht die objektivierende Beurteilung des Behandelnden gegenüber, der die Entscheidung darüber fällt, ob ein Mensch als gesund oder krank zu gelten habe.
Zu den Aufgaben der Heilberufe in Deutschland zählen die Diagnose und Behandlung von Krankheiten, aber auch die Verhütung derselben durch individuelle Gesundheitsberatung, ein Bereich, der in den letzten Jahrzehnten zunehmend von anderen Berufsgruppen übernommen wurde. Gesundheitsberatung ist nötig, denn Gesundheit ist ständig gefährdet, man kann sie schnell verlieren, sie ist nicht selbstverständlich, sie muss im Gegenteil mit besonderer Aufmerksamkeit gepflegt und geschützt werden.
Diese Erkenntnis ist nicht neu, sie wurde schon in der Antike in einer Weise berücksichtigt, von der wir lernen können. In der Antike lag der Schwerpunkt ärztlicher Gesundheitsberatung in den Empfehlungen, welche die Lebensführung, griechisch diaita, betrafen. Im Laufe der Zeit wurde aus der griechischen diaita als Kunst der Lebensführung die Diät im Sinne einer mehr oder weniger individuellen Reduktions-, Schon- oder Krankenkost. In mehr als zwei Jahrtausenden haben sich die Grundlagen der Diätetik kaum verändert, wurden aber den jeweiligen Epochen entsprechend interpretiert und sowohl den herrschenden Wertvorstellungen als auch dem jeweiligen Wissensstand angepasst.
Zu Beginn der antiken Diätetik standen vorwiegend hochrangige Persönlichkeiten – Könige, Stadträte, Patrizier, Adlige – im Mittelpunkt der ärztlichen Einzelberatung. Erst im Laufe vieler Jahrhunderte drang das diätetische Wissen zu den breiteren Volksschichten durch und wurde dann in Form von Lehrgedichten, Kalendern oder Schulbüchern weitergegeben. Herophilos von Chalkedon schrieb im 5. Jhdt. v. Chr.: „Wenn die Gesundheit fehlt, kann sich Weisheit nicht zeigen, die Kunst nicht offenbar werden, aller Reichtum nicht nützen … Gesundheit ist das höchste Gut und die Heilkunst die vornehmste aller Künste.“
Dies war eine der wesentlichen Grundüberzeugungen der Antike, in der der Mensch als Träger der Gesundheit noch mit all seinen Anteilen im Mittelpunkt stand. Gesundheit wurde verstanden als ein harmonischer Fluss, in dem alle Lebenskräfte sich im Gleichgewicht und alle Körpersäfte in ausgeglichener Mischung befanden. Dementsprechend wurden alle Bewegungen, die von diesem „Idealzustand“ wegführten, als krankmachend bezeichnet. Aber nicht die Behandlung der krankhaften Zustände stand im Mittelpunkt der antiken Heilkunst, sondern die Erhaltung des harmonischen Gleichgewichts, heute würden wir sagen: die Prävention. Um in der Einzelberatung passende Anweisungen geben zu können, musste der Arzt individuelle Faktoren wie Konstitution oder persönliche Verhaltensformen sowie allgemeine Faktoren wie Klima, Umwelt und Gesellschaft beachten.
Hippokrates von Kos (ca. 46–370 v. Chr.) gilt auf Grund eben solcher genauer Beobachtungen von auslösenden Faktoren, die man als kritisch-analytische Diagnostik bezeichnen könnte, und seinen rationalen Beschreibungen von Krankheitssymptomen als Begründer der wissenschaftlichen Medizin der Antike. Nach hippokratischer Denkart war eine Regel für alle gleich wichtig: die des richtigen Maßes. Auf der Basis der hippokratischen Erkenntnisse entwarf der Arzt Diokles von Karystos im 4. Jhdt. v. Chr. für eine vermögende Persönlichkeit einen idealen Tagesablauf und wurde damit zum Begründer der ganzheitlichen ärztlichen Diätetik.
Bei den Römern galt die Auffassung, zur Gesundheit gehöre neben dem leiblichen Wohlbefinden ein gesunder Geist. Der römische Dichter Juvenal (ca. 60–140 n. Chr.) hat es in einem berühmt gewordenen Satz beschrieben: „Orandum est ut sit mens sana in corpore sano“, übersetzt: Es wäre zu wünschen, dass in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohnen möge. Die Allgemeinheit der römischen Bevölkerung vertrat allerdings die Meinung, dass der gesunde Mensch weder Diät noch ärztliche Beratung brauche, sondern Gymnastikübungen und ausgiebige Bäder. Der bedeutendste Arzt der römischen Antike, Galen (129–199 n. Chr.), entwarf ein Schema der Heilkunde, in welchem er zwischen dem Bereich der Gesundheit und dem der Krankheit einen dritten, nämlich den der Lebensführung anordnete. Mit Galen erreichte die Diätetik ihren Höhepunkt, sein Konzept blieb verbindlich für die europäische Heilkunst vieler Jahrhunderte.
Um das Jahr 1050 erschien in der arabischen Welt ein Gesundheitsbuch des Arztes Ibn Butlan mit dem Titel „Taqwin al-sihha“, der darin das gesamte medizinische Wissen seiner Zeit darlegte, vergleichbar mit dem „Quanun al-Tibb“ (Kanon der Medizin) von Avicenna. Im 13. Jhdt. entstand eine lateinische Version dieses Werkes mit dem Namen „Tacuinum Sanitatis“ und im 16. Jhdt. erschien eine reich bebilderte Ausgabe in deutscher Sprache, die „Schachtafelen der Gesuntheyt“. Auf vierzig Tafeln werden die wichtigsten Gesundheitsmaßnahmen, in Übereinstimmung mit Galenos Empfehlungen zur Lebensführung, kurz und prägnant dargestellt. Hier konnte sich der gesundheitsbewusste Leser reichhaltig informieren, welche Maßnahmen nötig waren, um sein körperliches und seelisches Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Offensichtlich wurde der Ernährung die größte Bedeutung zugemessen, denn Speisen und Getränke besetzen den größten Anteil der Tafeln. Ein Abschnitt über Luft erläutert Umweltbedingungen wie Klima und Jahreszeiten, ein weiterer über Wasser beschreibt dessen Heil- und Reinigungskraft in Form der Badekultur. Über Beischlaf wird berichtet, Leibesübungen sollen den Körper stärken. Das rechte Maß blieb verbindlich bei den Leidenschaften, bei Freude und Zorn, bei Musik und Gesang und sogar im Zustand des Schlafes.
Eine beliebte medizinische Literaturgattung im Mittelalter war das so genannte „Regimen sanitatis“: Gesundheitsregeln nach dem Vorbild der diätetischen Briefe an hochgestellte Persönlichkeiten in der Antike. Solche Gesundheitsbücher umfassten die sechs traditionellen Punkte der Diätetik, doch der Schwerpunkt lag auch hier auf der Ernährung: Beschaffenheit, Zusammensetzung und Zubereitung der Speisen wurden ausführlich besprochen.
Um 1500 wurden Merkkalender populär, die mit allerlei Rezepten, Lebens- und Gesundheitsregeln sowie medizinischen Ratschlägen versehen waren. Oft basierten die Anweisungen auf astrologischen Vorstellungen, nach denen der Mensch als Teil des Kosmos von den Gestirnen beeinflusst war. Von Bedeutung waren dabei die Sternbilder des Tierkreises, die Mondphasen und die Planetenbewegungen.
Im 18. Jhdt. wurde die Gesundheit schließlich zum Gegenstand der Politik und rückte immer weiter in das Zentrum des staatlichen Interesses. Der Staat als übergreifende Instanz begann die Bedeutung gesunder Lebensführung zu erkennen, da nur ein gesunder Bürger seine Pflichten zur Zufriedenheit des Staates erfüllen konnte. Die Gesundheitsreglementierung lag bei den Ärzten, die damit dem Staat ihre Dienste leisteten. Die Ärzte waren Befürworter eines öffentlichen Gesundheitswesens und gleichzeitig Verfechter einer individuellen Gesundheitserziehung: Jeder sollte sein „eigener Arzt“ sein. Zur Zeit der Aufklärung war die Gesundheitsbildung weitester Volkskreise ein besonderer moralischer Auftrag der Mediziner, sie galten als „Hüter und Wächter über die Gesundheit“. Hinzu kam eine christlich-ethische Gesinnung, die den Menschen vor Augen hielt, „dass wir unsere Leiber als nicht unser, sondern Gottes Ebenbilder in Ehren halten sollen“. Weiterhin standen Lehrbüchlein hoch im Kurs, die über die Beschaffenheit des Körpers, seine Pflege wie Waschen, Baden, Zahnreinigung, Schlafen, Bewegung und Ernährung Auskunft gaben und zwar in einer Form, die man sich gut merken konnte.
1794 publizierte der Arzt Bernhard Christoph Faust einen „Entwurf zu einem Gesundheits-Katechismus zum Gebrauch in Schulen und im häuslichen Unterricht“, der als idealtypisch für Anweisungen zur Gesundheitspflege in der Zeit der Aufklärung gelten kann. Eine stärkere Rückbesinnung auf die Heilkunst der Antike erfolgte durch den philosophisch-medizinischen Ansatz der Makrobiotik, der Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Vor allem die Makrobiotik des Arztes Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1832) wurde zum Dauerthema des aufstrebenden Bürgertums, das mit der eigenen gesunden Lebensführung zugleich Sorge trug für die Gesundheit der Nachkommen und sich damit den Fortbestand sichern wollte.
Im Zuge der industriellen Revolution wurden die Vorstellungen von Gesundheit und Prävention stark und nachhaltig verändert. Die naturwissenschaftliche Forschung eröffnete ungeahnte Möglichkeiten zur Erkennung und Behandlung von Krankheiten und ließ den Arzt zunehmend zum Experten für Krankheit werden. Bis dahin vertraute Begriffe änderten sich oder verloren ihre Bedeutung. Die Diätetik, ursprünglich als ganzheitliche Lebensführung verstanden, wurde auf Ernährungslehre reduziert, die Hygiene, in der Antike Ausdruck für körperlich-seelisch-geistige Reinheit, wurde zur Sauberkeit, die Gesundheit als Begriff verschwand schließlich aus dem medizinischen Vokabular.
Das entstandene Vakuum wurde bereits im 18. Jahrhundert von der naturheilkundlichen Laienbewegung ausgefüllt, die mit Prießnitz, Schroth, Kneipp und Künzli geistige und therapeutische Vorbilder bekam. Auch die historischen Wurzeln für den Berufsstand des Heilpraktikers liegen in der Erfahrungs- und Laienheilkunde. Heute wird sie durch Angebote und Dienstleistungen bereichert, die allgemeine Lebensberatung und Gesundheitsförderung zum Ziel haben.
Die Frage, was Gesundheit sei, kann und sollte auch geschichtlich betrachtet werden: dann wird sie zu einem Spiegelbild der jeweils herrschenden Weltanschauung, die unseren persönlichen Überzeugungen notwendigerweise zu Grunde liegt. Die genauere Betrachtung philosophischer und medizinischer Ansätze, die auch heute noch das naturheilkundliche Weltbild prägen, befähigt in jedem Fall zu einer umfassenderen und tieferen Wertschätzung unserer eigenen Gesundheit und der Gesundheit von Natur und Umwelt. Nur eine gesunde Natur besitzt noch jene Mittel und Reize, die unseren Organismus zur Selbstheilung aktivieren können. Deshalb kann die Naturheilkunde als Spektrum gesundheitsfördernder und –wiederherstellender Behandlungsmethoden nicht losgelöst von ökologischen und sozialen Gegebenheiten betrachtet werden. Fazit: Nur in einer gesunden Umwelt kann auch ein gesunder Mensch leben!
1.2
Der Asklepios-Kult
Ganzheitliche Heilkunst in der Antike
Das Heiligtum von Epidauros liegt in einem Hochtal über dem modernen Ort Néa Epidauros zwischen sanften Hügeln der Peloponnes. Noch heute strahlen die weitläufigen Ruinen zwischen Pinien und Zypressen, einst einer der bedeutendsten Kurorte des Altertums, viel Ruhe in lieblich-herber Landschaft aus. Griechen und Römer verehrten hier viele ihrer Götter, allen voran aber den Heilgott Asklepios (römisch: Äskulap), einen Sohn des Apollon. Blinde, Lahme, Taubstumme oder psychisch kranke Menschen pilgerten zu Apollon und Asklepios und deren Priestern und versprachen sich von diesem Besuch Heilung. Sie mussten sich zuerst an der Quelle reinigen, im Tempel ein Opfer bringen und bestimmte Rituale in einem marmornen Rundbau vollziehen.
Noch heute sieht man die Ruinen der 75 Meter langen Halle, Abaton genannt, in denen die Kranken schliefen. Der gesamte Tagesablauf der Patienten war von Heilschlaf, Traumdeutung, Suggestion, mildem Klima, Ruhe, warmen und kalten Bädern, reinem Trinkwasser und Kräutermedizin bestimmt. Besonders wichtig war der Besuch der Theateraufführungen für Geist und Seele, verschaffte er den Kranken doch Ablenkung von ihrer eigenen Situation, indem man sich das tragische Schicksal der unglücklichen Protagonisten auf der Bühne ansah – und so wenigstens kurze Zeit entrückt war.
„Die Krankheiten“, so schreibt der archaische Dichter Hesiod im 6. Jhdt. v. Chr., „kommen von selbst zu den Menschen, schweigend, da ihnen der kluge Zeus die Stimme genommen hat.“ Krankheiten müssen den antiken Menschen sehr unheimlich und viel weniger fassbar als uns vorgekommen sein. Sicher einer der Gründe, warum die Heilkunst des Asklepios nicht nur den Namensgeber überlebte, sondern sich in der großen griechischen Welt ausbreiten konnte. Sein Symbol, die Schlange, wurde weltberühmt und ziert heute medizinische Zeitschriften, Wappen, Buchtitel, Verbandslogos etc., wohl vor allem wegen ihrer Eigenschaft, das Alte und das Kranke abzustreifen und sich quasi dadurch zu verjüngen – ein Bild der Genesung und Gesundheit.
Asklepios war der uneheliche Sohn des Apollon und der Koronis, welche, um die Illegitimität ihres Kindes zu vermeiden, jemanden anderen zu heiraten beabsichtigte. Apollons Rache ereilte sie, sie wird getötet, doch kurz vor der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen rettet Apollon seinen ungeborenen Sohn durch Kaiserschnitt. Der Säugling Asklepios wird ausgesetzt, von einer Schäferhündin genährt und schließlich von Apollon dem Zentauren Chiron übergeben. Dieser lehrt ihn die Heilkunst, worin er es so weit bringt, sogar Tote zum Leben zu erwecken – auf diese Weise gerät er mit dem Ratschluss der Götter in Konflikt und deshalb tötet ihn Zeus durch einen Blitzschlag. Es existierten also auch damals schon die Probleme der Kompetenzüberschreitung und der unangemessenen Bestrafung!
Nach seinem Tod jedoch wird Asklepios als Gott in den Olymp aufgenommen und kann durch Epiphanie heilen, d.h., er kann den Menschen im Traum oder als Vision im Wachzustand erscheinen. Dafür musste er sich entsprechend heilige Orte auf der Erde – d.h. in der Welt der Griechen – aussuchen. Dem heilenden Gott Asklepios werden Tempel mit Bildern aus Gold und Elfenbein errichtet, er erscheint in Statuen, thronend oder stehend, wie ein freundlich blickender Zeus, doch unverkennbar dank seines Stabes, um den sich die Schlange ringelt. In seinen Heiligtümern wurden lebende Schlangen – wahrscheinlich handelte es sich dabei um Äskulapnattern – gehalten.
„Asklepios-Gesundheitszentren" entstehen in der Folge in der gesamten antiken Welt, nach der Pest auch in Athen (420 v. Chr.). Später wird der Asklepios-Kult Teil einer institutionalisierten Religion, und selbst Sokrates bittet kurz vor seinem Gifttod den Kriton, Asklepios einen Hahn zu opfern (nachzulesen in Platon´s Phaidon). Nach dem zunehmenden Erfolg der verschiedenen „Rehabilitationszentren der Asklepios-Kette" wurde dann in Epidauros in der Argolis, 12 km oberhalb des Hafens und 2 Tagesreisen von Korinth entfernt, um 500 v. Chr. das dortige Heiligtum und Behandlungszentrum errichtet. Der Bau allein stellte bereits alle anderen derartigen Einrichtungen in den Schatten. Durch geschickte Werbung wurde auch der Geburtsmythos des Asklepios letztlich an den Ort Epidauros gebunden, was die Attraktivität des Ortes für Scharen von Schaulustigen, aber auch von Patienten weiter erhöhte. Epidauros wurde zum Wallfahrtsort. Als ständige Werbeausstellung standen im Bereich des „Reha-Zentrums“ Steintafeln, auf denen die Heilerfolge des Gottes ausführlich beschrieben und ausgestellt waren.
Durch die legendären Erfolge entwickelte sich die Finanzlage des kleinen Ortes so erfreulich, dass im 4. Jhdt. v. Chr. Epidauros über eines der prächtigsten Gesundheitszentren der damals bekannten Welt verfügte. Pausanias berichtete in seiner Reisebeschreibung durch die Peloponnes ausführlich von der mythologischen Einbindung des Asklepios-Kultes in die Landschaft und beschreibt ausführlich die Einrichtung und künstlerische Ausstattung der Einrichtung: „Die Kultstatue des Asklepios ist halb so groß wie die des Zeus in Athen und aus Elfenbein und Gold gemacht… Dem Tempel gegenüber ist der Ort, wo die den Gott um Hilfe Bittenden schlafen." Weiter wird eine herrliche Kunsthalle mit Exponaten erwähnt sowie die Säulen, auf denen die Heilungen beschrieben sind. Von diesen Säulen sind über 100 erhalten zusammen mit Metallplastiken, die geheilte Körperteile darstellen. Wie sollte man heute eine solche Dankbarkeit bei Reha-Patienten erreichen können?
Das Theater in Epidauros war zwar nicht das prächtigste und nicht das größte seiner Zeit, aber es wird von Pausanias als unübertrefflich hinsichtlich Ebenmaß und Schönheit beschrieben. Ein Stadion für Sportveranstaltungen, eine moderne Wasserversorgung, Tempel, ein Hospiz für unheilbar Kranke und eine geburtshilfliche Einrichtung vervollständigten das Gesundheitszentrum Epidauros. Die Finanzierung erfolgte ganz ohne staatliche Subventionen, also rein privatwirtschaftlich, und wurde durch Aufnahmegebühren der Patienten, Honorare für ärztliche Behandlung und großzügige Schenkungen und Stiftungen bestritten. Erwähnenswert sind auch die damals üblichen Trinkgelder für Bademeister und Masseure. Dagegen verfolgte die Einrichtung eher keine mildtätigen oder barmherzigen Ziele. Kostenlose Behandlungen kamen praktisch nicht vor, wenn auch kleinere Geldgeschenke und Speisen an Bedürftige ausgegeben wurden. Allerdings erschien eine wesentliche Besserung für den Kranken fast sicher, entweder durch direkten Einfluss des Gottes im Heilschlaf oder durch therapeutische Anweisung für nachfolgende Bewegungsmaßnahmen, Trinkkuren, Bäder und Ernährungsvorschriften.
Die eigentliche Heilmethode war der therapeutische Schlaf, die so genannte Inkubation (lat. incubatio, griech. enkoimesis), verbunden mit einer Opferhandlung am Vorabend und einem Dankopfer am folgenden Morgen. Vor allem diagnostisch wichtig waren die Träume des Patienten. Therapeuten im Nachtdienst untersuchten die Kranken während des Schlafes und halfen bei der Auslegung der Träume, die oft Hinweise auf die angemessenen Heilmittel und Methoden enthielten – der hohe Stellenwert der psychologisch-seelsorgerischen Betreuung ist unübersehbar! Auch stellte das Konzept der Asklepios-Medizin die Individualität des Hilfesuchenden im Gegensatz zu den anderen damals vorherrschenden Ansätzen besonders in den Vordergrund und erreichte dadurch einen besonderen Stellenwert. Die spirituelle Seite der Heilung wurde entgegen dem allgemeinen Trend der Aufklärung wahrgenommen und unterstützt: „In Asklepios findet der leidende Mensch einen Gott, der mit ihm fühlt.“
Neben dem zentralen „analytischen und psychosomatischen" Ansatz der Asklepios-Heilkunde entwickelten sich im Laufe der Geschichte Ernährungs-, Bewegungs- und Balneotherapie als besondere Behandlungsformen. Das Quellwasser war wichtiger Bestandteil der Riten, noch heute wird die Qualität des Wassers von Epidauros erwähnt. Daneben gab es Fastenzeiten für die Patienten. Bei den Ausgrabungen wurden Feuerbecken zum Verbrennen duftender Kräuter und Gefäße für Medikamente gefunden. Insgesamt zeigt sich das Bild eines ausgefeilten ganzheitlichen Heilungskonzeptes mit psychosomatischem Schwerpunkt.
Mit beißender Kritik allerdings verspottet Aristophanes in seiner Komödie „Ploutos" (= Reichtum) den kultischen „Rummel" um die nächtlichen Heilungen, die nach seiner wohl eigenen Beobachtung während der (narkotisierenden?) Heilkräuterinhalation ganz profan durch ärztliche Eingriffe geschahen und nicht – wie am Morgen verkündet – auf übernatürliche Weise. Das Spannungsfeld zwischen rationaler Medizin und ganzheitlichem Heilungsanspruch hat auch damals schon in aller Schärfe bestanden!
Die Beschreibung der Heilungserfolge ist mehr als umfangreich. Praktisch jede Behinderung und Erkrankung ist angeblich vollständig und dauerhaft beseitigt worden: von der Erblindung über die Herzinsuffizienz bis zum Haarausfall und Läusebefall. Später wurden auch Patienten erfolgreich operiert, und die erhaltene Sammlung ärztlicher Instrumente spricht für ein der Zeit entsprechend hohes ärztliches Niveau. Ein dankbarer Patient namens Markos Julios Apellas hat seine gesamte Epikrise (Krankheitsdokumentation) in Stein hinterlassen, aus der nicht nur der Name des Arztes und der Grundkrankheit – in dem Fall waren es Verdauungsstörungen – hervorgeht, sondern auch die Therapie im Einzelnen aufgeführt wird: Vermeiden von Aufregungen, vegetarische Diät aus Brot, Käse, Sellerie und grünem Salat, Einzelbäder, Gymnastik, Laufübungen, viel barfuß gehen, Zitronenwasser trinken, kräftige Hautabreibungen im Wasser, Lehmpackungen, Weingüsse, Einnahme von Milch und Honig, Fenchel- und Ölanwendungen gegen Kopfschmerzen, Heilschlaf mit anschließender Besprechung, Gurgeln mit kaltem Wasser gegen Mandelentzündung – und das alles in etwa 10 bis 12 Tagen!
Zu den Inschriften derer, die durch göttliches Wirken gerettet wurden, soll Diogenes einmal bemerkt haben: „Es wären noch viel mehr, wenn man die Tafeln derer, die nicht gerettet wurden, zählen könnte!" Das gilt es auch hier zu bedenken. Aber es bleibt die Tatsache, dass viele geheilt wurden. Was ist also die Erklärung? Was hat die Kranken dazu bewogen, hierher zu reisen? Was haben sie hier erlebt? Wie ging die Heilung vor sich? Die Steine und Texte allein vermögen darauf keine ausreichende Antwort zu geben. Historische Fantasie ist gefordert, die das dürre Gerippe der Fakten zu einem Bild ergänzt, das die Geschehnisse nachvollziehbar macht.
Wir verfolgen dazu den Weg eines gewissen Hermodikos, der im 4. Jahrhundert v. Chr. in Lampsakos lebte. Er litt, wie eine Inschrift berichtet, an einem Geschwür auf der Brust und war an den Händen gelähmt. Zunächst wird er bei den Ärzten Hilfe gesucht haben, die nach den Regeln der gängigen Medizin praktizierten. Irgendwann gelangte er zu der Überzeugung, dass nur noch ein Gott ihm helfen könne und dass Asklepios dieser Gott sei. Das nächstgelegene Asklepeion befand sich in Pergamon, einige Tagesreisen entfernt im Westen Kleinasiens, ein weiteres auf Kos, einer Insel in der Nähe der kleinasiatischen Küste. Wenn er sich zu einer etwa zehntägigen Seereise in die Peloponnes entschloss, dann kann der Grund nur darin liegen, dass das Heiligtum von Epidauros ein besonderes Prestige genoss. Seereisen galten im Altertum, nicht zu Unrecht, als gefährlich. So wird Hermodikos glücklich gewesen sein, als er den idyllisch gelegenen natürlichen Hafen der Stadt Epidauros erreichte. Das Heiligtum selbst lag außerhalb der Stadt, etwa 15 Kilometer entfernt in der unzivilisierten Natur. Wer bei Asklepios Heilung suchte, musste den vertrauten Bereich verlassen, sich hineinbegeben in eine andere Welt.
Nachdem Hermodikos die letzten Kilometer seiner Reise hinter sich hatte (zu Fuß, in einem ungefederten Wagen auf holpriger Straße oder in einer Sänfte), kam er zur Grenze des heiligen Bezirks, den er durch eine Toranlage (Propylon) betrat. Er schritt über eine Rampe, kam vorbei an einer Kolonnade von sechs ionischen Säulen und befand sich dann in einem Innenraum, der von einem Kranz korinthischer Säulen beherrscht wurde. Damit war der Punkt des Übergangs von der gewöhnlichen Welt zum Témenos, dem heiligen Bezirk des Gottes, besonders markiert. Er verließ diesen Raum wiederum über eine Rampe und kam zu einem Brunnen, der wohl zur rituellen Waschung diente. Beim Eingang befand sich auch eine Inschrift: „Rein muss der sein, der in den weihrauchduftenden Tempel eintritt. Reinheit heißt: reine Gedanken haben".
Der Témenos befand sich in einem Hain, in einer Landschaft also, die besonders mit der Aura des Sakralen umgeben war. Weitere Vorschriften dienten dazu, diese Welt vom profanen Bereich abzugrenzen: Hier durfte man weder gebären noch sterben und selbst der Verzehr des Opferfleisches, normalerweise ein fester Bestandteil des Opferrituals, war verboten. Kein Zweifel: Wer nach langer Reise in Erwartung eines göttlichen Wunders diesen Bezirk betrat, begab sich in eine abgesonderte Welt, in der viele Regeln des gewöhnlichen Lebens außer Kraft gesetzt waren.
Dies ist der Boden, auf dem sich das Wunder, das eben nicht-alltäglich und ungewöhnlich ist, ereignen kann. Wie lange Hermodikos warten musste, bis er sich in Erwartung des Wunders in der heiligen Halle zum Schlaf niederlegen konnte, wissen wir nicht. Die nötige Infrastruktur für die Beherbergung zahlreicher Gäste war jedenfalls vorhanden: Die außerhalb des Témenos liegende Herberge umfasste 160 Zimmer. Während er wartete, konnte er sich im Schatten der Bäume auf den Ruhebänken entspannen und die Inschriften lesen, die von den unzähligen wunderbaren Heilungen berichteten, die der Gott an diesem Ort bewirkt hatte. Schließlich konnte er sich nach einer langen Reihe von Opfergaben weiß gekleidet im Schlafsaal, welcher Abaton („das Unbetretbare") genannt wurde, zum Heilschlaf niederlegen und darauf warten, dass der Gott ihm im Traum erscheine und ihn heile. Die Bezeichnung des Ortes, die Opfer und die ungewöhnliche Kleidung, dies alles bewirkte eine weitere Steigerung der Sakralität. Dann endlich ereignete sich das Wunder. Was mit Hermodikos geschah, ist in einer der inschriftlichen Sammlungen von Heilungswundern erzählt: Als er im Tempel schlief, heilte ihn der Gott und befahl ihm, hinauszugehen und einen so großen Stein, wie er nur konnte, zum Tempel zu bringen. Der Mann brachte einen Stein, der noch heute vor dem Abaton liegt.
Für die Menschen der Antike waren die Götter allgegenwärtig, nicht nur in den Tempeln, sondern in ihrem Wirken im Guten wie im Bösen – und im Traum! Nicht nur, dass der Traum als genauso real empfunden wurde wie tatsächliche Ereignisse, er galt als die einzige direkte Kontaktmöglichkeiten mit den Göttern und die Menschen waren davon überzeugt, dass die Träume Botschaften der Götter sind. Wie jede Krankheit, egal, ob körperlicher oder seelischer Natur auf eine göttliche Wirkung zurückzuführen war, so konnte sie wiederum nur durch Göttliches oder einen Gott geheilt werden. Im Abaton war es das alleinige Vorrecht des Asklepios, den Heilsuchenden zu erscheinen und Botschaften zu übermitteln. Falls der Patient nicht transportfähig war, konnte dieser Schlaf auch stellvertretend durch einen Priester des Heiligtums oder durch den Sklaven (!) des Patienten erfolgen.
Bestimmend für Götter wie Asklepios war letztlich ein Ausspruch des Apollo-Orakels zu Delphi: „Der verwundet hat, der heilt auch“. Der Hintergrund dieses Orakelspruchs ist eine Begebenheit aus dem trojanischen Krieg: der Myser-König Telephos, durch einen Lanzenwurf des Achilles am Bein verwundet, ist – wie auch die verwendete Lanze – nach Griechenland zurückgebracht worden, wo er zehn Jahre an dieser Verletzung laborierte. Zwei Schüler des Asklepios hatten vergeblich versucht, ihn zu behandeln, als schließlich das delphische Orakel befragt wurde. Seinen Spruch, „wer verwundet hat, heilt auch", interpretierte Odysseus dahingehend, dass als Heilmittel der abgeschabte Rost der verwundenden Lanzenspitze zu verwenden sei. Es ist nicht überliefert, in welcher Form dieser Rost appliziert worden ist (Rostlösung eingenommen, auf die Wunde aufgelegt, oder beides); jedenfalls soll der Patient prompt genesen sein. Dass sich der Gedanke, Ähnliches sei durch Ähnliches zu heilen, der sich bei Paracelsus finden lässt und dann in der Homöopathie bei Samuel Hahnemann seinen Höhepunkt erreicht, aus antiken Erfahrungen entwickelt hat, ist sicher keine reine Spekulation.
Eine letzte – besonders drastische – der vielen Dankes-Inschriften in Epidauros lautet: „Arate von Lakonien. Wassersucht. Für diese schlief ihre Mutter, während sie selbst in Lakedämon war, und sieht einen Traum: Ihr träumt, der Gott schneide der Tochter den Kopf ab und hänge den Körper auf mit dem Hals nach unten; als viel Flüssigkeit ausgeflossen, habe er den Körper abgehängt und den Kopf wieder auf den Hals aufgesetzt. Nachdem sie diesen Traum gesehen, kehrt sie nach Lakedämon zurück und trifft ihre Tochter gesund; diese hatte denselben Traum gesehen.“
1.3
Von Hippokrates bis Kneipp
Eine kleine Geschichte der Heilkunde
Die Geschichte der abendländischen Medizin nimmt ihren offiziellen Anfang mit der Gründung der Ärzteschule von Kos im 5. Jhdt. v. Chr., hat aber ihre Wurzeln weit früher in der Zeit der Sumerer, Babylonier und Ägypter. Es ist durch Hinweise in den ältesten Schriften hinreichend belegt, dass es schon im 3. Jahrtausend v. Chr. einen regen Austausch an Handelsgütern und Wissen zwischen den Völkern des Vorderen Orients und des Abendlandes gab. Es ist sogar zu vermuten - und in einzelnen Fällen belegt -, dass Ärzte schon damals in fremden Ländern Medizin studiert und ihr Wissen zurück in ihre Heimatländer gebracht haben. Von Pythagoras zum Beispiel ist überliefert, dass er eine Ausbildung in Ägypten genossen hat und wahrscheinlich auch in Indien war.
Auch wenn die alten griechischen Ärzteschulen gerne ihr Wissen auf den Heilgott Asklepios zurückführten und sich ihre Mitglieder deswegen Asklepiaden nannten, so kann man heute mit Sicherheit sagen, dass ihre medizinischen Kenntnisse vor allem auf den Einsichten und Erfahrungen älterer Kulturen aufbauten. So gesehen ist es sicher kein Zufall, dass sich die ersten kulturellen Zentren der griechischen Welt vor allem in den kleinasiatischen Gebieten und in der Ägäis entwickelten, die geographisch eine Nähe zum Zweistromland und zu Ägypten hatten. Trotzdem kann die erste griechische Medizinbewegung als der Beginn einer neuen Epoche betrachtet werden, denn zum ersten Mal wurden naturphilosophische Erkenntnisse und empirische Beobachtungen zu einem in sich geschlossenen Diagnose- und Behandlungskonzept vereint.
Die Erfolgsgeschichte der griechischen Medizin beginnt mit Hippokrates von Kos. Seine Sichtweise und seine Ansprüche haben die Medizingeschichte für Jahrhunderte, wenn nicht für Jahrtausende maßgeblich geprägt, auch wenn es bereits zu seiner Zeit konkurrierende Ärzteschulen gab, die ganz andere Ansichten vertraten. Die berühmteste davon war die Ärzteschule von Knidos, deren Vertreter alle Krankheiten auf nachweisbare Fehler im Gewebe der Patienten zurückführen wollten, die Ursache also immer dort suchten, wo sich auch das Übel befand. Folgerichtig wurden die Krankheiten geheilt, indem das kranke Gewebe medizinisch bearbeitet oder sogar entfernt wurde. Hippokrates vertrat eine ganz andere Meinung, die sich schließlich auch durchsetzen konnte. Parallel dazu konnten sich aber die Erkenntnisse der knidischen Ärzteschule weiterentwickeln und spielen bis in unsere Zeit hinein eine bedeutende Rolle.
Hippokrates von Kos (460-377 v. Chr.)