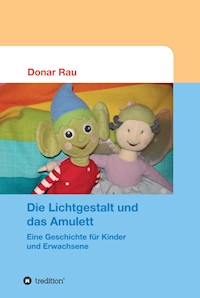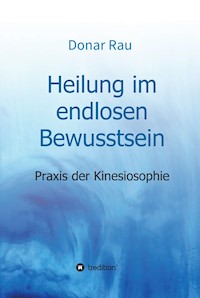
6,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch vermittelt einen Einblick in die Heilmethode der Kinesiosophie und deren Implikationen. In einer gut verständlichen Sprache werden dem Leser schrittweise die verschiedenen Aspekte der energetischen Therapie dargelegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Donar Rau
Heilung im endlosen Bewusstsein
Praxis der Kinesiosophie®
© 2017 Dr. Donar Rau
Verlag und Druck: tredition GmbH, Grindelallee 188, 20144 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-2321-8
Hardcover:
978-3-7439-2322-5
e-Book:
978-3-7439-2323-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Dem unbegreiflichen Gott
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Grenzen des Vorstellbaren
2. Weltgedächtnis und wissende Felder
3. Ebenen des Verstehens
4. Karma und das universale Gesetz des Ausgleichs
5. Fernheilung und der nichtlokale Raum
6. Lebensenergie und energetische Therapie
7. Persönliches Energiefeld und Fremdenergien
8. Imagination, Suggestion und Gebet
9. Heilung und Selbstheilungskräfte
10. Bewegungen der Seele, Kinesiosophie
Quellen- und Literaturverzeichnis
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, mit dem vorliegenden Buch möchte ich Sie mit der Heilmethode der Kinesiosophie vertraut machen. Es handelt sich hierbei nicht um ein wissenschaftliches Buch. Für eine Analyse sind die Bereiche, in denen die Kinesiosophie wirkt, nicht geeignet. Selbst eine erklärende Darstellung ist nicht ganz unproblematisch, weil es bei dieser Form der Therapie primär um psychoenergetische Prozesse geht. Aufgrund des metaphysisch bedingten Arbeitsbereiches dieser Heilmethode werden wir es im Verlauf der folgenden Kapitel durchweg mit heiklen Themen und anspruchsvollen Begriffen zu tun haben.
Da es mir persönlich wichtig erscheint, bei meinen Leserinnen und Lesern ein Verständnis für besagte Problematik zu schaffen, möchte ich deshalb gleich im ersten Kapitel etwas differenzierter über die Begrenzungen unserer Erkenntnisfähigkeit reflektieren.
Im Anschluss daran werde ich in den einzelnen Kapiteln Schritt für Schritt die Bereiche thematisieren, die Bestandteil der kinesiosophischen Heilarbeit sind. Um die Begriffe, mit denen wir es in diesem Buch zu tun haben werden, besser verstehen zu können, greife ich auf verschiedene Autoren zurück und werde deren Begrifflichkeit in meine Betrachtungen mit einbeziehen.
Die Kinesiosophie ist eine Heilmethode, die primär im Bereich der Seele agiert. Der Begriff der „Seele“ ist jedoch schwer zu definieren. Obgleich ich in meiner therapeutischen Arbeit die Wirkungen der Seele deutlich wahrnehmen kann, gerate ich in Erklärungsnot, wenn ich versuche, sie mit sprachlichen Mitteln klar und präzise zu beschreiben.
Die Entstehung dieses Buches wurde von dem Wunsch getragen, die Kinesiosophie und deren Implikationen möglichst präzise mit sprachlichen Mitteln darzustellen. Dass meine Darlegungen trotz aller Bemühungen unzureichend bleiben, hat mit der Welt des Übersinnlichen zu tun. Es ist keine einfache Aufgabe, über etwas zu sprechen, das sich nicht wie ein räumlicher Gegenstand beschreiben lässt. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn es mir trotzdem gelänge, Ihr Interesse für diese unkonventionelle Heilarbeit zu wecken und Sie Freude am Lesen dieses Buches hätten.
Es ist meine feste Überzeugung: Eine tiefgreifende und nachhaltige Heilung kann nur im Bereich der Seele erzielt werden. Wer heil sein will, muss sich mit diesem, den Menschen überschreitenden, endlosen Bewusstsein auseinandersetzen. Wer die Seele leugnet, wird weder heil noch vollkommen gesund sein können. Denn sie ist die Hüterin all unserer Verletzungen sowie karmischer Verstrickungen. Und nur in ihr kann die Heilung unseres Schmerzes und unserer Leiden gefunden werden. Hierfür steht die Kinesiosophie.
1. Grenzen des Vorstellbaren
Vieles, was unsere Wirklichkeit bestimmt, liegt außerhalb unseres Vorstellungsvermögens. Die Dominanz des Materialismus in den Wissenschaften hat unsere Weltsicht und unser Menschenbild einseitig geprägt. Für den Menschen, der primär der von den Naturwissenschaften bestimmten öffentlichen Meinung folgt, ist es schwer vorstellbar, dass neben der sinnlich wahrnehmbaren Welt auch noch eine feinstoffliche Wirklichkeit existiert. Wer mit dieser Dimension noch keine persönlichen Erfahrungen gemacht hat, wird Schilderungen darüber in den Bereich der Phantasie verweisen.
Es ist das Verdienst von Ludwig Wittgenstein, diese Problematik aus sprach-philosophischer Sicht explizit gemacht zu haben. In seinem Frühwerk „Tractatus logico-philosophicus“ hat er minuziös aufgezeigt, in welchem Verhältnis unsere Sprache zur Wirklichkeit steht. Unsere Sprache ist ein Mittel, die Wirklichkeit darzustellen. Mit Worten und unter Verwendung grammatikalischer Regeln bilden wir die Sachverhalte unserer Lebenswelt ab. Das Substantiv vertritt den Gegenstand, und Verben bezeichnen die Tätigkeiten. „Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit.“ (T, 4.01)
Nehmen wir als Beispiel folgenden Aussagesatz: „Das Buch liegt auf dem Tisch.“ Das Substantiv „Tisch“ repräsentiert das im Raum vorhandene dreidimensionale Objekt, das in der Regel mit einer Platte und vier Beinen ausgestattet ist. In der Sprachphilosophie nennt man diesen räumlichen Gegenstand Referenzobjekt. Die in einem Umschlag gefassten und gebundenen, rechteckigen Papierseiten sind also das Referenzobjekt des Wortes „Buch“. Das Entscheidende bei diesem Beispiel ist die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der Aussage. Der Satz „Das Buch liegt auf dem Tisch.“ ist dann wahr, wenn ein Referenzobjekt gegeben ist, das dem Bild der Aussage entspricht. „Das Bild stimmt mit der Wirklichkeit überein oder nicht; es ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch.“ (T, 2.21)
Worauf Wittgenstein in seinem „Tractatus“ hinaus will, ist, eine klare Unterscheidung zwischen sinnvollen und unsinnigen Aussagen zu finden. Für ihn ist ein Satz sinnvoll, wenn man ihn verifizieren kann, das bedeutet, wenn man ihn mit einem Referenzobjekt vergleichen kann. „Die Wirklichkeit muss durch den Satz auf ja oder nein fixiert sein.“ (T, 4.023) Wittgenstein glaubte, mit dem „Tractatus“ die Probleme der Philosophie endgültig gelöst zu haben: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ (T, 7)
Auch wenn Wittgenstein zwanzig Jahre später in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ von dem Radikalismus seines Frühwerkes abweicht, besteht seine hervorragende Leistung darin, das Verhältnis zwischen sprachlich bedingten Konstruktionen und der Wirklichkeit auf eine unvergleichlich präzise Art und Weise thematisiert zu haben. Wovon ich mich jedoch mit aller Entschiedenheit distanzieren möchte, ist Wittgensteins viel zitierte These: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (T, 5.6) Ich denke, dies ist ein ziemlich reduziertes Menschenbild. Wollte man die Fähigkeiten des Menschen darauf beschränken, was sprachlich sag- und verifizierbar ist, wäre dies eine armselige Welt. Es besteht kein Zweifel, man hat es mit Grenzen zu tun, wenn man den Versuch unternimmt, über Dimensionen zu sprechen, über die man aus erkenntnistheoretischer Sicht keine verifizierbaren Aussagen machen kann. Und wenn man nicht, wie Wittgenstein postuliert, darüber schweigen will, begibt man sich auf wackeliges Terrain.
Die Bereiche, mit denen ich es im Rahmen meiner therapeutischen Arbeit zu tun habe, sind durchweg immaterieller Natur. Wenn ich im Folgenden beispielsweise von „Weltengedächtnis“, „wissendem Feld“ oder „Karma“ spreche, dann fehlt mir die Möglichkeit, meine Aussagen anhand eines fassbaren Referenzobjektes verifizieren zu können. Den Wahrheitsgehalt meiner Aussagen kann ich nicht prüfen, indem ich diese mit der sinnlich wahrnehmbaren Welt vergleiche. Es handelt sich bei all dem, was ich thematisiere, nicht um dreidimensionale Objekte wie Tische oder Bücher, um bei meinem Beispiel zu bleiben.
Das einzige Kriterium, das ich als Prüfstein für meine Darlegungen nennen kann, ist die Erfahrung. Man muss Erfahrungen im Bereich der geistigen Welt gemacht haben, um deren Dimension und Wirken begreifen zu können. Allerdings kann man die entsprechenden Erfahrungen nicht einfach so ohne weiteres machen. Um Erfahrungen in der feinstofflichen Wirklichkeit machen zu können, muss man seinen Wahrnehmungsapparat entsprechend ausgebildet haben. Rudolf Steiner war einer der ersten, der diese Thematik Anfang des 20. Jahrhunderts in den deutschsprachigen Raum eingeführt und einen konsequenten Schulungsweg beschrieben hat. In seinem Buch „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?“ beschreibt Steiner Übungen, die darauf abzielen, die eigenen Sinne derart zu sensibilisieren, dass man in die Lage versetzt wird, Phänomene der geistigen Welt wahrnehmen zu können. „Wie im Leibe Auge und Ohr als Wahrnehmungsorgane, als Sinne für die körperlichen Vorgänge sich entwickeln, so vermag der Mensch in sich seelische und geistige Wahrnehmungsorgane auszubilden, durch die ihm die Seelen- und die Geisteswelt erschlossen werden. Für denjenigen, der solche höheren Sinne nicht hat, sind diese Welten finster und stumm, wie für ein Wesen ohne Ohr und Auge die Körperwelt finster und stumm ist.“ (Steiner, 2012: 81)
Man muss jedoch betonen, dass Steiners Lehren keine neuen Erkenntnisse liefern. In vielen indigenen Kulturen, im Schamanismus und in den unterschiedlichsten Priesterkasten der östlichen Welt sind übersinnliche Phänomene und die Schulung der dazugehörigen Fähigkeiten Bestandteil des alltäglichen Lebens. In Deutschland gibt es in dieser Hinsicht keine Tradition. Die Inquisition der katholischen Kirche dürfte ein Grund dafür sein, weshalb Praktiken im Bereich des Übersinnlichen nicht tradiert wurden.
Obgleich die Akzeptanz für Steiners Thesen seitens der Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht groß gewesen sein dürfte, hat er den Mut gehabt, mit der Anthroposophie in Deutschland ein Menschenbild zu etablieren, das dem von den Naturwissenschaften geprägten Bild des Menschen geradezu diametral entgegenstand. In Zeiten des Internets und der mit ihm einhergehenden Informationsflut kann man sich diese Diskrepanz kaum mehr vorstellen. Interessant ist die Tatsache, dass sich die Vorurteile aus den vergangenen Jahrhunderten weitestgehend erhalten haben, obwohl wir uns heute für so aufgeklärt halten. Übersinnliche Phänomene werden nach wie vor von den Wissenschaften ignoriert.
Vielleicht gibt es Hoffnung, dass sich der Mensch irgendwann daran erinnert, dass er mehr ist als das Modell, das die Naturwissenschaft liefert. Fest steht, aufgrund unserer einseitigen Fixierung auf die linke Hirnhälfte haben wir uns selbst einiger Fähigkeiten beraubt. Jeder Einzelne von uns hat nun die Wahl, sich diese Fähigkeiten zurückzuerobern. Nicht schweigen, wie Wittgenstein fordert, sondern verstehen, dass wir Menschen mehr sind als das, was uns unser logischkausales Denken zu bieten hat. Die Begrenzungen des Vorstellbaren lassen sich nur dadurch erweitern, dass wir unseren Wahrnehmungsapparat beziehungsweise unsere Sinne schulen und in den genannten Bereichen vorurteilslos Erfahrungen sammeln.
2. Weltgedächtnis und wissende Felder
Zu den Dingen, die unser Vorstellungsvermögen aufs äußerste herausfordern, zählt ein Phänomen, das von einigen Geisteswissenschaftlern und Philosophen mit den unterschiedlichsten Begriffen bezeichnet worden ist. In der frühen indischen Philosophie hat man dieses mit dem aus dem Sanskrit stammenden Begriff „Akasha“ belegt, was so viel wie Himmel, Raum oder Äther bedeutet. Gemeint ist mit diesem Begriff eine Art Weltgedächtnis, ein universeller Speicher, der nicht etwa wie die Hardware unseres Computers zu lokalisieren wäre, sondern im kosmischen Raum seine Informationen trägt. Rudolf Steiner hat in diesem Kontext viel geforscht und eine ganze Reihe von Vorträgen hinterlassen, in denen er die Geschichte unseres Planeten und der Menschheit beschreibt. Das Besondere an diesen Vorträgen ist, dass er, wie er selbst betont, die Inhalte derselben aus der „Akasha-Chronik“ gelesen habe. In einem Vortrag vom 1. Juli 1904 („Lesen in der Akasha-Chronik Wolfram von Eschenbach“) gibt er zu verstehen, „dass alle Ereignisse, welche geschehen sind, in einer gewissen Weise aufgezeichnet sind in einer ewigen Chronik, in dem Akasha-Stoff, der ein viel feinerer Stoff ist als die Stoffe, welche wir kennen.“ Synonym bezeichnet Steiner die Akasha-Chronik in diesem Vortrag auch als „universellen Weltgeist“.