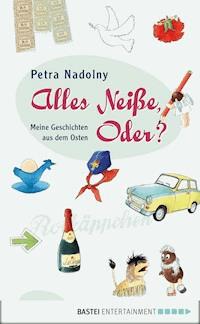9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Petra Nadolny ist Heimatwechselprofi. Das dachte sie jedenfalls - hat sie doch mit ihrer Ausreise aus der DDR bereits ein ganzes Land hinter sich gelassen und in ihrer Hofgemeinschaft im Rheinland schnell einen festen Platz gefunden. Aber auf einmal ziehen alle aus - und plötzlich ist es weg, das heimische Gefühl. Wie kann man es zurückholen - und wie viel davon brauchen wir in unserer immer mobiler werdenden Welt überhaupt? Sollen wir das Leibgericht aus der Kindheit kochen, alte Fotos durchwühlen oder gar Hirschgeweihe in die Wohnung hängen? Auf ihrer Suche entdeckt Petra Nadolny altmodische, einfallsreiche und überraschende Heimatvorstellungen - und eine neue für sich...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Petra Nadolny
Heimat to go
Von der Kunst, sich immer zu Hause zu fühlen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Birte Meyer
Titelillustration: © Manfred Esser, Bergisch Gladbach,© shutterstock/Kjpargeter; Thinkstock
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Innenillustrationen: Karla-Jean von Wissel, Köln
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-4519-0
Sie finden uns im Internet unter www.luebbe.deBitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Für Nadja und Thomas
Inhalt
Die Letzte macht das Licht an
Wie ich mich auf die Suche nach einem Gefühl von Zuhause machte
Von guten Gefühlen in guten Stuben
Über Erinnerungen und Menschen, mit denen wir uns heimisch fühlen
Heimat ist Heimat
Warum wir uns auch fern vom Wiegenstandort wohlfühlen können
Humptata, Humptata
Wie wir versuchen, echtes Heimatgefühl zu erzeugen
Dieser Duft von frischem Heu
Warum Heimat auch mal ein Stück heile Vergangenheit sein darf
Eine wie keine
Warum jeder seine eigene Heimat finden muss
Lupo und die Notfallbox
Was man gegen Heimweh tun kann
Jarmen zum Gotterbarmen
Wie sich Heimat mit der Zeit verändert
Heilbutt versus Currywurst
Warum Deutschland kein einig Heimatland ist
Die glückliche Legende von Paul und Paula
Was man braucht, um überall zu Hause zu sein
Drehen Sie hier ’nen Film?!
Warum die Arbeitswelt auch Heimat sein kann
Vom Staube befreit sind Hirsch und Rehlein
Wie wir Heimat früher sahen und heute neu entdecken
Mit Kuckucksuhren die Zeit anhalten
Warum es darauf ankommt, sich selbst eine Heimat zu sein
Wasserbomben sind auch keine Lösung
Wenn wir liebgewonnene Plätze gegen Eindringlinge verteidigen
Von Rentnern, Regen und Regalen
Wie es sich mit typisch deutschen Eigenschaften leben lässt
Volkstheater en vogue
Warum wir uns Heimat inzwischen gern wieder ansehen
Ich brauch endlich ein Zuhause!
Warum Mobilität Segen oder Fluch sein kann
Schwarzbraun ist der Haselnusskuchen
Wozu wir Rituale brauchen und warum wir sie ändern können
Wer keine Wurzeln schlägt, dem wachsen auch keine Flügel
Was passiert, wenn Heimat fehlt oder man ihr keinen Platz einräumt
Dä Sultan hät Doosch!
Wieso auch in der Heimat Dinge nerven dürfen
Immer wieder ankommen
Warum es von Vorteil ist, die Heimat in sich zu tragen
Heimatgruß und Heimatdank
Die Letzte macht das Licht an
Wie ich mich auf die Suche nach einem Gefühl von Zuhause machte
Wo ist nur meine bergische Idylle hin? Mein Zuhause erscheint mir wie gefleddert, denn fast alle, die mir lieb und teuer sind, sind in den vergangenen Monaten weggezogen. Nicht nur Haus und Hof kommen mir seitdem leer vor – auch in mir fühlt es sich so an. Fast habe ich den Eindruck, meine Heimat hier im Bergischen Land ist ein Kuchen, von dem ich meinen Freunden bei jedem Auszug ein Stück als Reiseproviant eingepackt und mitgegeben habe. Und jetzt ist nicht mehr viel davon übrig.
Das ist natürlich Unsinn, aber von Umzügen und Abschied nehmen habe ich inzwischen wirklich genug. Jörg und Silke haben unsere Hofgemeinschaft mit ihren beiden Söhnen bereits Anfang des Jahres verlassen, nach Karneval gingen dann meine langjährigen Freunde Christoph und Nicole mit Sohn, und zu guter Letzt zieht jetzt auch noch meine Tochter Anna nach Berlin.
Unsere verschworene Gemeinschaft hatte an Jahren, Erlebnissen und Zusammenhalt einiges aufzuweisen. Christoph und ich haben vor über zwanzig Jahren diesen freistehenden Fachwerkhof entdeckt und uns hier niedergelassen. Jeder von uns hatte einen Flügel des Anwesens übernommen. Vor zwölf Jahren ist dann Jörg dazugestoßen und hat die bis dahin unbewohnte Nordseite des Gebäudes mit Leben gefüllt. Wenn man so lange so dicht beieinander wohnt, weiß man, wie der andere tickt. Und ich weiß auch: Leichten Herzens ging keiner von beiden mit ihren Familien und neuen Plänen im Gepäck. Alle hatten triftige Gründe.
Ich bleibe. Aber irgendwie ist nichts mehr wie zuvor. Ein komisches Gefühl macht sich breit. Zum ersten Mal spürte ich es, als mir meine Freunde von ihren Auszugsplänen erzählten, irgendwann im vergangenen Jahr. Da versetzte es mir kurz einen kleinen Stich in der Brust. Und je konkreter die Auszugsvorhaben wurden, umso üppiger fing dieses Gefühl an zu wuchern – genau wie das Indische Springkraut auf unserer Wiese. Wer das kennt, weiß, dessen wird man irgendwann nicht mehr Herr.
»Unsere« Wiese kann ich nun auch nicht mehr sagen! Vor allem aber weiß ich jetzt nichts mehr mit ihr anzufangen – außer das Springkraut zu rupfen. Langsam frage ich mich, ob meine Freunde im Eifer des Gefechts meine Heimat ebenfalls in irgendeine ihrer tausend Umzugskisten gepackt haben.
Als Jörgs Umzugstag Ende Januar bevorstand, schien es fast so, als hätte das Schicksal Mitleid mit mir und würde alles tun, um den Abschied hinauszuzögern. In der Nacht davor fegte der Sturm so laut und unheimlich über das Bergische Land, dass ich aufwachte, Kopfkissen und Decke nahm und aus meinem Bett unter dem Dach auf die Couch ins Erdgeschoss wechselte. Hier hörte ich den Wind immer noch heulen, hatte aber keine Sorge mehr, er könne das Dach abdecken. Gerade als ich mich hinlegen wollte, sah ich, wie das Hoflicht anging, und hörte, wie sich nebenan eine Tür öffnete. Ich machte das Fenster auf.
»Weltuntergang!«, rief Jörg und zog an seiner Zigarette. »Hätte doch noch bis morgen Nacht warten können.«
Wie jetzt? Sollte das heißen: Nach ihm die Sintflut?
Am nächsten Tag erwachte ich durch Jörgs lautes Fluchen und Türenknallen, weil der nächtliche Sturm nicht nur Äste abgebrochen, sondern ganze Bäume umgerissen hatte, von denen nun einer die Fahrt seines bestellten Umzugswagens auf unserer schmalen Zufahrtsstraße durch den Wald blockierte.
Wenig später rückte er mit Bauer Heinrich aus. Beide trugen schwere Kettensägen, um den dicken Stamm einer Fichte zu stückeln und an den Straßenrand zu rollen, damit der Laster endlich passieren konnte.
»Zwei Stunden Verspätung«, raunte der Fahrer des Umzugswagens schlecht gelaunt, als die drei schließlich im strömenden Regen vor unserer Haustür standen. »Zwei Stunden. Das bezahlt mir doch keiner!«
»Doch, ich«, antwortete Jörg. »Ich werd dir das schon bezahlen.«
Der Fahrer kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn. »So ’n Scheißwetter aber auch«, schimpfte er und ließ sich im Haus zeigen, was alles mit auf die Reise gehen sollte.
Beim Einladen stand Jörg auf seinem angestammten Rauchplatz neben der Eingangstür und koordinierte angestrengt, wohin Christoph, Nicole und ich die Kartons verfrachten sollten. Seine Frau Silke hatte mit den zwei Kleinen zu tun. Und während wir anderen zusammen mit dem Spediteur die Habseligkeiten im Hänger stapelten und auf dem Weg von der Haustür zum Laster nicht nur mit den Kilos seines Inventars, sondern auch noch mit dem Nass von oben kämpften, rauchte Jörg, durchgeregnet und mit den Nerven am Ende, eine Zigarette nach der anderen. Er stand dabei wie angewurzelt, als wäre es ihm unmöglich, seine Lieblings-Suchtecke zu verlassen.
Nachdem alles verstaut war, trockneten wir unsere klitschnassen Sachen auf der Heizung und kochten einen großen Topf Spaghetti mit Gemüse und Tomatensoße, unser Hof-Leibgericht – und unsere letzte gemeinsame Mahlzeit.
»Das ist ja mal was«, freute sich der Spediteur. »Sonst gibt’s nur Kaffee, wenn’s hoch kommt, Brötchen!« Seine Stimmung hellte sich bei dem warmen Essen sichtlich auf, obwohl er dadurch noch mehr in Verzug geriet. »Auf eine Stunde mehr oder weniger kommt’s nun auch nicht mehr an«, verkündete er und verlangte Nachschlag.
Doch auch unsere Hof-Spaghetti konnten es nicht verhindern: Viel zu früh für mein Empfinden rauschte der Umzugstrupp mit Jörgs Familie und ihren sämtlichen Besitztümern davon.
Wind und Regen legten sich kurz darauf wie von Geisterhand, und es folgte eine fast gespenstige Stille. Ohne uns abzustimmen, begannen wir »Hinterbliebenen« ebenso still und jeder für sich, die heruntergefallenen Äste rund um unsere kleine Fachwerkhaussiedlung wegzuräumen. Ich verspürte wieder diesen seltsam starren Druck im Bauch, der in den Brustkorb wanderte und mich zwang, tiefer durchzuatmen als gewohnt.
Nur wenige Wochen später verabschiedeten sich auch Christoph, Nicole und Tim aus unserem bisher unzertrennlichen Drei-Familien-Gespann. Mit dem Unterschied, dass sich ihr Auszug über Monate hinzog, weil Mutter und Kind sofort an den neuen Wohnort übersiedelten, während Christoph Wochenende für Wochenende mit vollgeladenem VW-Bulli den Rest des Hausstandes abtransportierte.
Der Winter schien zu dieser Zeit wie festgefroren, ein Ende war nicht absehbar. »Von wegen Klimaerwärmung!«, murrte Christoph einmal, während er mit einer CD-Hülle, auf deren Cover Helge Schneider das Katzenklo pries, das Eis von den Autoscheiben kratzte. »Seitdem darüber geredet wird, haben wir die härtesten Winter.«
Am nächsten Tag besorgte ich ihm einen blau-weißen Eiskratzer aus dem örtlichen Baumarkt.
»Von wegen Klimaerwärmung!«, sagte ich.
Dieser Ausspruch wurde von da an zu unserem Morgengruß, und bald war mir klar, dass ich diese Art des vertrauten Miteinanders sehr vermissen würde. Unsere Hofgemeinschaft pflegte fast eine eigene Sprache – in langen Beziehungen entwickelt sich so etwas wohl zwangsläufig. Wenn von »Freunde der Sonne«, der »Partei der Guten«, wie wir uns bei politischen Diskussionen nannten, oder einem sommerabendlichen »Sundowning« die Rede war, wusste jeder, was gemeint war und welches Ritual sich damit verband.
Wir waren wie eine Familie. Entspannend fand ich das; man musste sich nicht mehr dauernd erklären, sondern konnte sogar gut zusammen schweigen, ohne dass gleich einer fragte: Ist was?
Als es dann doch endlich wärmer wurde, war der Tag gekommen, an dem Christoph die letzten seiner Siebensachen in den Transporter verlud. Nachdem wir uns Lebewohl gesagt hatten, wanderte ich wie eine Fremde durch mein eigenes Haus. Es kam mir alles so leer vor. Nicht, weil hier jetzt weniger Möbel standen, sondern weil es mir darin auf seltsame Weise an Vertrautheit mangelte.
Diese grüne Couch im Wohnzimmer zum Beispiel: Ein Erbstück von Opa Franz. Ohne meine Freunde schien sie mir nur noch ein etwas in die Jahre gekommenes Möbelstück zu sein. Wie oft hatten wir hier gesessen, die tiefschürfendsten Gespräche geführt, die blutigsten Tarantino-Filme geguckt und die reichhaltigsten Desserts genossen! Noch vor einem Jahr hatte der kleine Tim von nebenan darauf mit Hochhopsen das Beine-Durchdrücken geübt, um endlich die ersten Schritte wagen zu können, immer und immer wieder, bis die Federn sich aus ihrer Verankerung lösten und die Sitzgelegenheit an einer Seite durchkrachte. Ist, wie gesagt, ein altes Erbstück, haben wir wieder repariert. Aber was, bitte schön, soll ich jetzt allein auf dieser restaurierten, doofen, grünen Couch?
Als ob das nicht schon genug wäre, zieht nun auch noch meine Tochter Anna aus! Das ist schlimmer als alles andere. Vielleicht weil sie meine Tochter ist, vielleicht aber auch, weil es der letzte von all diesen Abschieden ist.
Dabei ist es nicht so, als träfe mich ihr Auszug komplett unvorbereitet. Anna war bereits seit ein paar Jahren zum Studieren in anderen Städten unterwegs. Nun hat sie ihren Abschluss in der Tasche und bricht im Bergischen endgültig alle Zelte ab, um in Berlin neu anzufangen.
Mein Blick bleibt an ihren Obi-Kisten hängen, die gepackt in unserer Wohnküche stehen, direkt neben der Haustür. Anna kommt mit dem letzten Karton die Treppe herunter und hievt ihn auf den Stapel.
»Puh, ist das ’ne Menge«, sagt sie mit Blick auf ihr verstautes Hab und Gut. »Ich dachte, ich hätte hier gar nicht mehr so viel.«
Sie schaut an mir vorbei durchs Fenster. »Oh nee, es regnet!«
Klar, dass an einem solchen Tag der Himmel noch einmal alles gibt: Regen, Schneeregen sogar. Am ersten April. Leider kein Scherz. Inzwischen kommt es mir fast vor, als gehöre scheußliches Wetter zu Umzügen einfach dazu.
Anna setzt sich zu mir an den Frühstückstisch, und wir beobachten, wie die weißen Bindfäden gegen das Fenster fallen. Sie beißt gedankenverloren in ihr Käsebrot und googelt nebenbei die Wetterprognose auf ihrem Smartphone.
»Glob ick’s denn, in der Hauptstadt scheint die Sonne«, stellt sie erfreut fest. »Sieben Grad!«
»Klar, Berlin«, antworte ich. »Da ist ja alles schöner, sogar das Wetter.«
»Glaub mir, Mama, das Hoch kommt diesmal aus der neuen Heimat und zieht dann rüber in die alte.«
Ratsch! Der Kopf meines Frühstückseies fällt nach einem sicheren Hieb mit dem Messer zur Seite. Was höre ich da? Neue Heimat – alte Heimat. Kann man sein Zuhause so einfach ablegen?
»Wie du Eier köppen kannst, Mama!«, sagt Anna bewundernd, ohne offenbar meine Irritation bemerkt zu haben. »Bleib mal so. Ich mach ein Foto.«
»Zur unvergesslichen Erinnerung an deine Mutter«, konstatiere ich und stelle mich mit Ei und Messer in Pose.
Klick, macht das Handy.
Draußen quietschen Reifen. Annas Freund Lukas hält mit einem Sprinter vor der Tür. Jetzt ist es so weit.
»Na endlich!«, ruft meine Tochter.
Wir werfen unsere Anoraks über und laufen hinaus. Ich ziehe das Kapuzenband meines »Schabrackenmantels« – auch so eine eigene Hof-Wortschöpfung – enger. Hier peitscht der Ostwind. Immerhin hat der Regen aufgehört, und es sieht beinahe so aus, als würde die Sonne rauskommen. April eben.
Lukas nimmt Annas Anweisungen gut gelaunt entgegen. Ich begutachte kritisch die Reifen seines Transporters.
»Mama, wir fahren trotzdem«, sagt meine Tochter, noch bevor ich Bedenken wegen möglicher mangelnder Verkehrssicherheit loswerden kann. »Auf den Autobahnen liegt kein Schnee«, weiß sie und wechselt dann schnell das Thema. »Ach, ähm, und das Regal, das aus der Wohnküche, das nehme ich dann doch mit.«
Ach, gestern noch wollte sie es doch nicht haben! Nichts hatte geholfen, sie davon zu überzeugen, wie gut sie ihre Sachen darin würde abstellen können. Vehement hatte sie sich gewehrt, weil es ihr zu alt und sperrig sei.
»Das ›olle Ding‹ willst du jetzt also doch mitnehmen?«
»Na ja«, meint sie und schaut grinsend zu mir herüber. »Irgendwie hab ich dann noch was, das mich an dich erinnert, falls ich Heimweh kriege. Sozusagen ein Stück Heimat to go.«
Was soll das denn heißen? Heimat zum Mitnehmen? Zum Immer-mit-dabei-haben?
Wie auch immer. Soll sie dieses Regal haben, ich werde sicher auch gut ohne das alte Schätzchen auskommen. Von meiner Rührung lasse ich mir nichts anmerken. Ich lächele nur in mich hinein, als wir es auseinandernehmen und nach draußen zum Wagen tragen.
Zwei Stunden später sind die Kartons und die wenigen Möbel verstaut.
Ich beginne, Fenchel in Streifen zu schnippeln, um einen Auflauf zu machen, eines ihrer Lieblingsgerichte.
»Mama, jetzt nicht noch essen. Lass uns los!«
»Wie ihr wollt. Kein Problem.«
Aber irgendwie ist es doch ein Problem, dieses Loslassen. Immerhin sind wir Mutter und Tochter. Mir fällt es jedes Mal wieder schwer, sie gehen zu lassen. Obwohl ich mich natürlich für sie gefreut habe, als es vor fünf Jahren mit dem Studium in Maastricht klappte. »Meine Tochter studiert in Holland. Auf Englisch!«, hatte ich verkündet, stolz wie Bolle, und war wirklich sehr froh über ihre frühe Selbstständigkeit und ihren ganz natürlichen Umgang mit dem, was wir »global« nennen. Ein Studium im Ausland. Toll! Ich beneidete sie fast um die Erfahrungen, die sie dabei machen würde. Bachelor und Master, diese neuen Begriffe klangen verheißungsvoll. Trotzdem tat es weh, als sie ihre Koffer packte.
Natürlich finde ich es jetzt auch gut, dass sie in Berlin arbeiten und leben wird. In dieser Stadt, der ich mich allein durch die Lage verbunden fühle – im Osten Deutschlands, wo ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe. Ich selbst habe zwar nur für kurze Zeit, für Praktika und ein paar Jobs, dort gelebt und die Stadt nie wirklich zu meiner machen können, weil wichtigere Gründe mich immer fernhielten. Dennoch ist sie für mich die anziehendste, ungewöhnlichste und lebendigste deutsche Großstadt. Das weiß Anna.
Meine mir seit vielen Jahren treue, aber manchmal etwas zu esoterisch angehauchte Freundin Amely behauptet, Anna hole nach, was ich versäumt hätte, und ich solle mal nicht neidisch sein. So ein Quatsch! Sie macht einfach ihr Ding. Und das soll sie auch.
Wie schade, dass Amely noch bis morgen auf einem Seminar ist. Sonst wäre sie sicher vorbeigekommen, um mir beizustehen. Nun muss ich da allein durch.
Es ist so weit. Anna steht mit Umhängetasche und Mantel bereit zum Abschiednehmen. Ich komme mit raus.
»Auf in die Welt!«, sage ich.
»Pass auf dich auf, Mama!«
Das ist eigentlich mein Spruch. Spielen wir ab jetzt verkehrte Welt?
»Sieh zu, dass du hier schnell wieder nette Leute reinholst«, meint sie mit einem Blick auf die ehemaligen Wohnungen von Jörg und Christoph.
»Mach ich, mein Schatz.«
Beim Umarmen versuche ich ein optimistisches Lächeln. Als Schauspielerin sollte ich das doch hinbekommen!
Mit lautem Knall fliegt die Wagentür ins Schloss. Lukas hat schon den Motor angelassen. Schnell ist der Sprinter hinter dem Hügel verschwunden.
Ich winke immer noch, so sind Eltern.
Meine eigenen haben mich fortwährend in dem unterstützt, was ich machen wollte. Selbst als ich unsere gemeinsame ostdeutsche Heimat verlassen wollte, standen sie hinter mir. Was für ein schwerer Abschied das erst war: ein unwiderruflicher, der eine Trennung auf unbestimmte Zeit bedeutete. Denn wer sich entschloss, der sozialistischen Diktatur den Rücken zu kehren, wurde bekanntermaßen neben allerlei Stasi-Schikanen auch damit bestraft, nicht wieder einreisen zu dürfen. Nicht einmal zu einem Familienbesuch. Niemand konnte Mitte der Achtziger ahnen, dass sich zum Glück schon bald die Grenzen öffnen und die Verhältnisse ändern würden.
Mein Weggehen brachte meine Eltern damals ziemlich durcheinander. Zum einen wegen des Abschiedsschmerzes, aber auch, weil sie begannen, sich viele Fragen über diesen Staat zu stellen, über die sie sich in ihrem Mecklenburger Dorfidyll sonst vielleicht keine Gedanken gemacht hätten.
Was ist dagegen der Umzug meiner Tochter nach Berlin! Viereinhalb Stunden Fahrt mit dem Zug von Köln.
Der Himmel hat sich verfinstert, als ich durch den matschigen Schlamm, in den sich die gestern noch gefrorene Erde durch Schneeregen verwandelt hat, zurück zum Haus stapfe. Ich atme tief die kalte Luft ein, die sich immer noch nicht zwischen Winter und Frühling entscheiden kann, und öffne die Eingangstür.
Drinnen ist es düster.
Ich finde den Schalter rechts neben der Tür, ohne hinzusehen, und muss schmunzeln.
»Der Letzte macht das Licht aus«, hatte mein Vater zur Ausreisewelle gesagt und damit deutlich seine Verbitterung darüber zum Ausdruck gebracht, dass alles in diesem Land den Bach runterging. Mir wird mal wieder klar, dass sich in Deutschland einiges verändert hat.
Genau wie in meinem Leben. Vor über sechsundzwanzig Jahren bin ich aufgebrochen, um im Westen neu anzufangen. Das ist mir gelungen. Nun verlassen mich vertraute Menschen, und plötzlich fühle ich mich an dem Ort, den ich eben noch als meine Heimat bezeichnet hätte, nicht mehr geborgen. Alles gerät durcheinander. Ich versuche, neuen Mut zu fassen, und treffe einen Entschluss: Ich will herausfinden, was dieses Gefühl von Heimat alles ausmacht. Und dann hole ich es mir zurück, jawohl!
Die Letzte macht das Licht an.
Von guten Gefühlen in guten Stuben
Über Erinnerungen und Menschen, mit denen wir uns heimisch fühlen
Unter dem grellen Licht der Küchenlampe sehe ich leider nicht, wo sich mein verlorenes Heimatgefühl wiederfinden lässt, nur dass das von Anna und mir benutzte Geschirr dringend in die Spülmaschine gestellt werden sollte.
Der helle Schein hebt auch die Konturen hervor, die das mitgenommene Regal an der Wand hinterlassen hat. Ist die letzte Renovierung tatsächlich schon so lange her? Zehn Jahre vielleicht. Jedenfalls war Jörg da noch mit seiner Freundin Mary zusammen, die es hier allerdings nicht lange aushielt. In dieser Einöde leben, nee, schönen Dank auch, da höre sie ja die Flöhe husten – so ihre offizielle Begründung.
Mary half mir damals beim Streichen, und als wir nach getaner Arbeit ein paar Gläschen zusammen tranken, verriet sie mir, dass es eher die Liebe sei, die nicht reiche, wurde sehr traurig, füllte sich schnell und immer wieder Rotwein nach und trank, bis sie schwankte. Ein paar Wochen später war sie weg. Jörg suchte danach oft meine Nähe, um dieses Verlassenwerden zu verstehen, und diese offenen Gespräche haben uns sehr vertraut gemacht.
Als ich zum Tisch gehe, stolpere ich über die Obstschale, die ursprünglich im Regal stand und nun auf dem Fußboden auf einen neuen Platz wartet. Sie ist ein Geschenk von Anna. Geformt, gebrannt und mit blau-schwarzen Schlieren bemalt im VHS-Kinder-Kurs »Kreatives Gestalten mit Ton«, zu dem ich sie eine Zeit lang einmal die Woche nach der Grundschule in die nahegelegene Kleinstadt gefahren habe. An einer Seite ist sie etwas schief geraten, und innen haben sich Annas Fingerkuppen verewigt. Auch heimatlos geworden, was!, denke ich und schaue mich nach einem neuen Platz für die Schale um. Ich stelle sie auf den großen Küchentisch neben den Kerzenständer aus Messing. Der ist ein Geschenk von Christoph als Dankeschön für das Blumengießen während seiner Indien-Reise vor zwei Jahren.
Überall Erinnerungen.
Und Schmutz. Zwanzig Kartons hoch- und runterschleppen, Möbel abbauen und hinaustragen, das hinterlässt Spuren. Spinnweben und Wollmäuse, die sich bis dahin unter den Wandbrettern versteckt hatten, kommen nun zum Vorschein, Schmutz ist auf den Holzdielen breitgetreten. Ich hole den Staubsauger. Vielleicht schluckt der nicht nur den Dreck, sondern auch diesen Stein in meiner Brust. Brrrrr. Jedenfalls dröhnt er, was das Zeug hält. Staubsaugen hilft gegen beklommene Stille.
Nach knapp einer Stunde ist mein Putzwerk vollbracht, nun sieht es auch in Annas altem Zimmer fast aus wie immer, nur dass ein Schrank und ein paar Bilder an der Wand fehlen. Ich gehe die Wendeltreppe hinunter ins Erdgeschoss, und mein Blick streift dabei die Wohnküche. Ordentlich stehen die acht Stühle um den ovalen Esstisch gruppiert. Soll ich jetzt an diesem Riesenmöbel Platz nehmen und an einem Eckchen Quark mit Kartoffeln essen? Oder besser gleich ins Möbelhaus fahren, mich neu ausstatten, passend für mein Leben allein? Alles frei machen für neue Geschichten? Wie wenn man nach einer Trennung zum Friseur rennt und sich auch gleich noch einen neuen Kleidungsstil zulegt? Ratlos setze ich mich auf eine Treppenstufe.
Das Telefon klingelt, ich laufe los und stoße dabei den Staubsauger von der Treppenkante. Mit lautem Knall fliegt er auf den Boden. Na toll, jetzt hat er einen Riss im blauen Plastikbauch.
»Mist!« Ich greife mit ausgestrecktem Arm zum Hörer auf dem Schreibtisch: »Anna?«
»Tante Hedwig hier.«
»Äh. Ja?« Ich bin völlig verdattert.
»Ja!«, sagt sie bestimmt.
»Ach so, ja, richtig, wir wollten Samstagnachmittag miteinander telefonieren«, fällt mir schließlich ein.
»Hörst dich so durcheinander an. Was ist denn, Kind?«
Für Tante Hedwig, mit vierundneunzig die gute Seele der Familie mütterlicherseits, bin ich mit vierundfünfzig immer noch Kind, und klar, sie erkennt an der Stimme, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich erzähle.
»Ach Gottchen«, sagt sie, »das beruhigt sich wieder. Ihr könnt euch ja besuchen. Berlin ist doch nicht weit. Andere gehen in die USA. Das ist weit. Und was Heimat betrifft, die kann gar nicht verloren gehen, die hat man doch immer bei sich, die ist doch in dir drin.«
Ich bin erstaunt. Dass Tante Hedwig mit sich im Reinen ist, wusste ich längst, aber dass sie diese Einstellung hat, ist mir neu.
»Bei mir ist an der Stelle gerade ein Loch«, gestehe ich.
»Dann füll das mal schnell wieder auf, und komm endlich deine alte Tante besuchen! Wir haben uns ja ewig nicht gesehen.«
Ehe ich dazu etwas sagen kann, holt sie aus, um die nicht zum ersten Mal vorgetragene Geschichte ihrer Flucht aus Ostpreußen und über die Stationen ihres Lebens zu erzählen.
»… weißt du, ob nun Dullen, Wilhelminenthal, Berlin oder Recklinghausen … Ich habe mich überall zu Hause gefühlt«, endet sie schließlich.
Ich habe ihren runden Tisch vor Augen, der als Mittelpunkt in jeder ihrer »guten Stuben« stand und um den sich immer noch, wenn auch in größeren Abständen, unsere vielköpfige Familie mit Tanten, Onkeln und Enkeln versammelt.
Das Ritual ist bis heute das gleiche geblieben. Tante Hedwig hat den Tisch bereits mit gestärktem weißem Damasttuch gedeckt, einer von uns darf helfen, das Blümchen-Sonntagsgeschirr und das Silberbesteck »für gut« aus dem Eichenbuffet zu holen und aufzutischen. Dann wird eine Kerze angezündet, und sie holt den gedeckten Apfelkuchen mit dicken Streuseln aus »guter« Butter und Zimt nach altem Rezept aus ostpreußischen Zeiten. Sie meint es wirklich gut mit uns.
Mit zittriger Hand verteilt sie Stück für Stück auf unsere Teller, und während wir uns den Kuchen schmecken lassen, erzählt jeder, was bei ihm in letzter Zeit los war. Tante Hedwig ist der Mittelpunkt unserer Familie. Bei uns zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern erfüllte ihre Schwester, meine Oma, diese Funktion, und nach ihrem Tod haben wir nicht nur sie, sondern auch diese Zusammenkünfte vermisst.
In den letzten Jahren hat sich bei Tante Hedwig noch ein weiteres, lustiges Ritual etabliert. Wenn der letzte Kuchenkrümel von ihrer Platte verputzt ist, holt einer von uns die Backtüten von Merzenich, Kamps & Co. hervor, die wir eigentlich gekauft hatten, um ihr das Backen zu ersparen. »Wollt ihr mir meinen Job wegnehmen?«, entrüstet sie sich dann jedes Mal und schüttelt den Kopf. »Wie kann man für Plunderteilchen nur so viel Geld ausgeben!« Wir gehorchen brav und lassen unseren »Plunder« wieder in der Tasche verschwinden, denn nun stellt sie ihren Sandkuchen, marmoriert durch Kakao, auf den Tisch. Zusammen imitieren wir sie im Chor: »So einen hat man doch immer in Reserve!« Wir wälzen noch die große und die kleine Weltlage, überreden die Tante schließlich, wenigstens den Abwasch erledigen zu dürfen, bevor wir uns mit den von ihr in der Zwischenzeit aufgeteilten Kuchenresten und kleinen Geschenken im Gepäck wieder nach Hause aufmachen.
Es gibt viele Fotos von solchen Nachmittagen. Aus welcher Zeit sie stammen, kann man am besten daran erkennen, wer nicht mehr oder neu mit am Tisch sitzt.
»Nächsten Sonntag back ich wieder«, schließt Tante Hedwig unser Telefongespräch und fordert: »Dann komm mal nicht so spät. Gegen zwei ist mir recht.«
In ihrer resoluten, positiven Art ist sie einfach nicht zu toppen. Dabei hat sie in ihrem Leben schon so ziemlich alles durchgemacht: Krieg, Vertreibung, Abschiede und Tod geliebter Menschen – und dabei vier völlig unterschiedliche Gesellschaftsordnungen erlebt.
Ihre lebensfrohe Einstellung hat ihr sicherlich immer wieder geholfen, in so verschiedenen Gegenden wie Ostpreußen, Mecklenburg, Berlin und seit vielen Jahren im Ruhrgebiet Fuß zu fassen. Sich heimisch zu fühlen verlangt eben auch, sich aktiv auf die neue Umgebung einzulassen, auf ihre Besonderheiten und natürlich auf die Menschen. Nur so lassen sich neue Wurzeln schlagen und Bande knüpfen, damit heimatliche Gefühle überhaupt entstehen können: Geborgenheit, Zugehörigkeit und Halt.
Tante Hedwig scheint zu wissen, wie das geht. Die Treffen in ihrer »guten Stube« samt Apfelkuchen, der für sie so vertraut nach erster Heimat duftet, und den sie für uns auf den bekannten runden Tisch stellt, gehören auf alle Fälle dazu.
Das Gespräch mit ihr hat mich aufgemuntert. Ich blicke schon viel versöhnlicher auf meinen eigenen Tisch in der Wohnküche. Am Straßenrand von Oldenburg habe ich ihn vor mehr als zwanzig Jahren an einer Sperrmüllecke unter Regalbrettern und wackelnden Stühlen entdeckt, als ich von einem Theatergastspiel nach Hause fuhr. Ich erinnere mich, wie ich die Länge seiner ovalen, dunkel gebeizten Platte mit Schritten grob abgemessen habe und dabei auf mehr als stattliche zwei Meter gekommen war. Das fand ich bemerkenswert und konnte mir sofort eine gemütliche große Runde daran vorstellen. Im Gras daneben lagen die abgeschraubten Beine, konisch zulaufend und rund. Der Tisch musste aus den Sechzigern stammen. Für die Halde fand ich ihn viel zu schade, deshalb lud ich seine Teile in den Transporter und baute sie später in meiner Wohnküche wieder zusammen. Er passte perfekt. Seitdem steht er hier.
An seiner Tafel ist eine Menge passiert, seine Macken und Kratzer erzählen viele Geschichten. Hier wurde nicht nur im Familienkreis und mit Freunden geschlemmt, gefeiert und getrunken, sondern hier wurden auch Entscheidungen besprochen und getroffen, die wichtig für mich waren und die die bergische Scholle erst zu meiner gemacht haben. Hier haben wir überlegt und geplant und gestritten, wie wir dieses drei Jahrhunderte alte Fachwerkhaus restaurieren und so umbauen, dass es unseren Vorstellungen entspricht. Hier wurden Theaterstücke geschrieben und Texte gelernt.
Ich setze mich an meinen Stammplatz, blicke durch die Fenster auf die weiten Wiesen und sanften Hügel der vertrauten Landschaft und empfinde mit diesem Fleckchen Erde so etwas wie Verbundenheit.
In vierzehn Tagen ist Ostern. Das sollten wir feiern! Gerade als ich Stift und Papier hole, klingelt es an der Tür. Anna? Hat sie etwas vergessen?
»Amely! Ich dachte, dein Seminar geht bis morgen?«
Sie schüttelt den Schneeregen aus ihren langen braunen Haaren. »Stimmt. War so geplant. Aber der Dozent ist krank geworden. Und da dachte ich mir, ich fahre gleich weiter zu dir. Anna ist schon weg, was?«
Ich nicke und kann mir ein paar Tränen nicht verkneifen.
Amely umarmt mich, und ich drücke mein Gesicht an ihren nach kalter Winterluft duftenden Trenchcoat.
»Oh, jetzt mache ich dich auch noch nass!«, sagt sie und nimmt mich bei den Schultern.
»Macht nix«, entgegne ich und drücke meine Freundin noch einmal ganz fest.
»Wir kriegen das hin«, tröstet sie mich.
Amely weiß, wovon sie spricht. Ihr Sohn Jakob ist bereits vor zwei Jahren ausgezogen. Seitdem lebt sie allein in Köln.
»Auch ohne Bachblütentherapie?«, frage ich und hebe meinen Kopf.
Wir müssen beide lachen. »Du bräuchtest sowieso etwas anderes!«, sagt sie.
»Was denn?«
»Das müssen wir herausfinden. Mach uns erst mal einen Tee!«
Sie legt ihren Mantel über die Heizung und zündet den Kaminofen an, während sie mir zuhört. Von der Idee, schon zum Osterfest alle Freunde wieder zusammenzuholen, ist sie begeistert.
»Wir sollten in den Einladungen ankündigen, was wir vorhaben«, meint sie. »Zur Vorfreude.«
Während das Holz Feuer fängt und knistert, setzt sie sich an den Tisch und beginnt zu zeichnen. Das kann sie gut, sie ist ja auch Kunstlehrerin. Mit wenigen Strichen entfacht sie ein Osterfeuer, um das ein paar Männchen tanzen. Dieses Ritual zelebrierten wir Jahr für Jahr auf dem dafür angestammten Feuerplatz auf der Wiese. Oder, zweiter gezeichneter Vorschlag daneben: Ostereier bemalen und von den Kindern im Garten suchen lassen. Dann skizziert sie einen Spaziergang durch den Wald, von dem wir uns Birkensträuße für die Vase mitbringen. Ich habe die Idee, die Frühlingssaison mit einem ersten Fußballspiel, windgeschützt hinter dem Haus, zu eröffnen. Aber vielleicht müssen wir uns eher mit Brettspielen vor dem Kamin versammeln, weil das Schmuddelwetter immer noch kein Ende genommen hat? Vielleicht backen wir einen Kuchen? – Sechs kleine Bildchen hat Amely gezeichnet und auch noch Platz für weitere Ideen gelassen. »Sehr schön«, lobe ich und kopiere das Blatt zwölfmal. Bin gespannt, wer alles kommen kann.
Während ich die Adressen auf die Briefumschläge schreibe, durchströmt mich ein warmes Gefühl. Wenn ich die Situationen erinnere, in denen ich mich heimisch gefühlt habe, fallen mir immer zuerst die Menschen ein. Gleichgesinnte, mit denen es sich gut anfühlte, in einer Stadt wie Leipzig, Recklinghausen oder auf diesem bergischen Hügel anzukommen. Die Familie und Freunde machen wohl den wichtigsten Teil meines Heimatgefühls aus. Deshalb fehlen mir meine »Ausgewanderten« jetzt auch so.
Amely hat es sich inzwischen im Sessel vor dem Kamin bequem gemacht und blättert in Backbüchern. Gedankenverloren kräuselt sie die Stirn. »Wir sollten dieses Mal wirklich laktosefrei und mit Vollwertmehl backen.«
»Meinetwegen gern«, antworte ich, unterbreche kurz meine Suche nach Briefmarken und schaue zu ihr hinüber: Ungestört liest sie weiter. Wie schön, dass sie heute zu mir gekommen ist.
Irgendwie scheint das mit der Heimat so zu sein wie mit allen guten Sachen. Solange sie da sind, denkt man gar nicht über sie nach. Bis jetzt war meine Heimat für mich so selbstverständlich wie die bergische Luft, die mir hier um die Nase weht. Erst seitdem ich etwas vermisse, kreisen meine Gedanken um sie. Dabei bin noch nicht einmal ich es, die fortgegangen ist.
Was ist dann Heimat eigentlich? Ein gutes Gefühl in guten Stuben? Der Duft von Apfelkuchen mit Zimt? Oder ein Abschied mit Schneeregen am ersten April?
Das Gespräch mit Tante Hedwig und der Besuch von Amely beflügeln mich, das herauszufinden.
Zeit, um auf Heimatpirsch zu gehen.