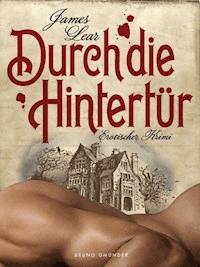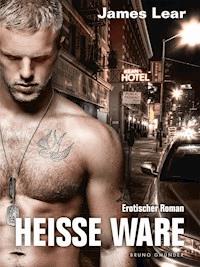
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruno Gmünder Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Nach zwölf Jahren im US Marine Corps hält sich Dan Stagg als Türsteher eines New Yorker Clubs gerade so über Wasser - bis er auch diesen Job verliert. Da taucht plötzlich ein geheimnisvoller Fremder mit einem mysteriösen Auftrag in seinem Apartment auf: Stagg soll den jungen Sekretär eines mächtigen Immobilienspekulanten unter höchster Geheimhaltung sicher von New York nach New Hampshire geleiten. Der zähe Ex-Marine ist zwar misstrauisch, lässt sich aber auf das Vorhaben ein. Eine Entscheidung, die ihn in ein Geflecht aus Intrigen, Sex und Verbrechen manövriert. Denn die zu schützende Ware ist heißer, als er dachte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
1 | Die Schlägerei
New York City in einer schmutzig-warmen Sommernacht im Juli ist nicht gerade mein Lieblingsort. Ich wäre am liebsten woanders, irgendwo anders: am Strand in Connecticut oder in den Bergen von Vermont, oder auch in einem der anderen Länder, die ich bereist habe – die meisten davon Kriegsgebiete. Hauptsache, ich habe dort nicht das Gefühl, dass mir gerade jemand auf die Schuhe gekotzt hat. Aber ich bin nun mal in New York, und sollte nicht ein Wunder geschehen, dann bleibt das auch so. Die Temperaturen nähern sich der Dreißig-Grad-Marke (mit dementsprechender Schwüle), während ich allmählich auf die vierzig zugehe und mich frage, was eigentlich mit mir passiert ist. Vor ein paar Jahren noch hatte ich einen ordentlichen Beruf mit ordentlichem Gehalt, Ansehen und Respekt und ein Ziel vor Augen. Jetzt arbeite ich nachts für einen mickrigen Lohn in einem beschissenen Nachtclub im East Village. Ich verfüge nicht mal über eine Uniform; der Sicherheitsdienst, für den ich arbeite, ist derart knauserig, dass ich selbst für meine Arbeitskleidung aufkommen muss. Also trage ich schwarze Polyesterhosen, ein schwarzes T-Shirt und die schwarzen Schuhe meiner früheren Ausgehuniform, die ich immer noch auf Hochglanz poliere – alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen. Ich sehe aus wie ein Einbrecher, mit dem Unterschied, dass man mein Gesicht sehen kann. Nur sieht mir niemand je ins Gesicht, wenn man mich nicht gerade anschreit oder an besonders lebhaften Abenden anspuckt. Heute ist einer dieser Abende.
Unter der Woche ist es im ›Panther Club‹ in der East 9th Street alles in allem eigentlich ganz nett – es ist nicht so viel los, und die meisten Besucher sind junge Leute aus der Umgegend, die tagsüber im Büro arbeiten und abends Hipster spielen, trinken und sich DJs und Bands anhören, die drittklassigen Art-Rock auftischen und ihre 15 Minuten im Rampenlicht genießen. Die Wochentage sind nicht das Problem: Das Geld ist leicht verdient, und niemand flippt zu sehr aus – der nächste Tag ist ja schließlich ein Arbeitstag. Die Freitage und Samstage sind das Problem, wenn die ganzen Provinzler in die Stadt strömen, um am Wochenende mal so richtig den Freak raushängen zu lassen, und das geht natürlich nur, wenn man sturzbesoffen ist. Und gerade dann muss ich meine paar Kröten pro Stunde verdienen.
Diese Freitagnacht fing eigentlich an wie alle anderen. Bis neun Uhr war es ruhig, nur die üblichen Deppen, die im Dunkeln Sonnenbrillen tragen, an der Bar rumstehen oder vor der Tür rauchen, bis der Rauch wie Nebel in der Luft hängt und sich unter der Markise sammelt, wo ich stehen muss – dort beißt er mir dann in den Augen und lässt meine Klamotten stinken. Ich hasse die Nichtraucherschutzgesetze. Warum gestattet man den Rauchern nicht einfach, sich im Club selbst langsam umzubringen? Dann könnten wir Türsteher stattdessen ein paar gesunde Autoabgase einatmen. Wie auf ein geheimes Signal hin traten dann zwei Minuten nach neun die Arschlöcher auf den Plan. Sie kamen in Zweier- und Dreiergruppen die Straße entlang; sie sind immer im Rudel unterwegs. Es waren vor allem Typen, mit ein paar Tussis im Schlepptau, und alle stolzierten sie herum wie auf dem Schulhof, als wären sie die Herrscher des Weltalls und Leute wie ich stünden auf einer Stufe mit Ratten und Kakerlaken. Um halb zehn war der Club voll, Drinks wurden verschüttet, die Atmosphäre wurde allmählich unangenehm. Auf der Straße bildete sich eine Schlange – es erstaunt mich immer wieder, dass Leute tatsächlich anstehen, um in ein mieses Loch wie den ›Panther Club‹ zu kommen –, und die Aggression lag in der Luft wie ein billiges Parfüm. Ich habe nichts gegen Aggression an sich. Nach zwölf Jahren im U.S. Marine Corps halte ich sie sogar für wichtig. Ich mag es, wenn ein junger Mann bestimmt auftritt, wenn er weiß, was er tut. Aber diese Typen waren einfach nur besoffen und sauer auf den Rest der Welt; sie suchten Zoff, um einen Kick am Freitagabend zu haben. Sollten sie unterwegs noch keine Schlägerei angezettelt haben, dann versuchten sie es eben mal mit dem Trottel in der Polyesterhose, der am Einlass stand.
Ich weiß ja nicht, wo Security-Firmen der Meinung des durchschnittlichen Provinzlers nach ihre Mitarbeiter rekrutieren. Vielleicht glaubt er, wir seien ehemalige Schullehrer oder arbeitslose Bibliothekare. Tatsächlich aber waren die meisten von uns früher beim Militär, und das heißt, dass wir aller Wahrscheinlichkeit mehr Leute umgebracht haben, als er flachgelegt hat. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Leben ich beendet habe. Manche habe ich erschossen. Manche fielen von mir abgefeuerten Raketen zum Opfer. Ich habe aber auch einige – zwanzig, vielleicht mehr – mit bloßen Händen getötet. Ich weiß ganz genau, wie das geht. Ich kann ein Genick mit der Präzision eines Chiropraktikers brechen – einfach nur ein Ruck und ein Knacken, und die Sache ist erledigt. Also, wenn man freitagnachts im East Village nach Streit sucht, sollte man um den ›Panther Club‹ vielleicht einen Bogen machen.
Und so fing es an: Es war fast elf, im Club war die Hölle los. Die Schlange reichte um den halben Block – es scheint heutzutage kaum noch anständige Clubs in New York City zu geben –, die Band sollte gleich auftreten, und die harten Jungs aus den Vorstädten wurden unruhig. Wegen der Brandschutzbestimmungen konnte ich immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten hereinlassen. Ginge es nach mir, könnten sie den Club gerne bis zum Dach vollstopfen und mit Benzin überschütten, ich würde dann liebend gern das Streichholz anzünden. Aber ich muss ja schließlich meine Miete zahlen. Ich stand vor der Tür, die Arme vor der Brust verschränkt und die Beine einen Meter weit gespreizt – in der Sprache der Türsteher heißt das so viel wie »Bleibt, wo ihr seid«. Ich sehe die Leute nicht feindselig an, weil das nichts bringt, aber ich wirke immer noch genug wie ein Marine, um allen außer den größten Trotteln einen gewissen Respekt einzuflößen.
Und da war auch schon einer von der Sorte.
22 oder 23 Jahre alt. 1,80 Meter groß, um die 90 Kilo, kurzgeschorene blonde Haare, gebrochene Nase, in einer Jeans, die er schon zerfetzt gekauft hatte, einer billigen Lederjacke und – natürlich – einem Ramones-Shirt. Er war das Alphamännchen seines kleinen Rudels, und er wurde immer wütender. Seine Freundin knatschte Kaugummi und zog eine Schnute; sie mochte es nicht, in der Schlange zu stehen. Sie war der Meinung, ein echter Mann würde dem Türsteher etwas ins Ohr flüstern, und schon dürften sie rein. Also stand unser Blondschopf vor der Wahl: Entweder zog er eine Schau ab, oder er verlor das Gesicht.
Er zog eine Schau ab.
»Hey, Mann, lass uns schon rein.«
»Keine Chance.«
»Lass uns rein, verdammt noch mal.«
Ich gab keine Antwort, sah ihm einfach nur in die Augen. Unter anderen Umständen hätte ich den kleinen Punk nur zu gern in die Knie gezwungen und sein hübsches Gesicht in meinen Polyester-Schritt gedrückt. Der Gedanke gefiel mir, und ich lächelte anscheinend.
»Was ist denn so komisch, Arschloch?«
Er war ein paar Zentimeter größer als ich, aber ich bewegte meinen Arm und ließ ihn meine Muskeln sehen. Ach Süßer, dachte ich, komm wieder runter und benimm dich.
»Was ist dein Problem?«
»Im Moment«, sagte ich, »sind Sie mein Problem.«
»Hey!« Den Gangsterakzent hatte er sicher nicht von seiner Mama gelernt. »Mach mich nicht von der Seite an, du Scheißer.«
Das Blut strömte ihm in Hals und Wangen. Er konnte wie ein harter Bursche reden, aber langsam wurde er nervös.
»Ich mache Sie von jeder Seite an, die mir gefällt, Sir.« Ich sprach leise und kontrollierte meine Atmung. Nach dem Kosovo und dem Süden Afghanistans ist der ›Panther Club‹ keine allzu große Herausforderung mehr.
»Ach ja?« Er sah sich nach Unterstützung um. Die Leute in der Warteschlange schauten gespannt zu; das hier war ebenso gut wie eine Vorgruppe. »Nur zu.« Er stand direkt vor mir und hüpfte von einem Fuß auf den anderen. Eine Bewegung nur – eine Hand, die zupackt wie eine Schlange, eine rasche Drehung, ein fürchterliches Knacken, und seine Freundin wäre noch vor der Hochzeit Witwe.
»Sir«, sagte ich und klang dabei wie ein Roboter, »bitte reihen Sie sich wieder in der Schlange ein. Es geht gleich weiter mit dem Einlass.«
»Ich mag deine Art nicht, Glatzkopf.« Die Pupillen waren erweitert, auf der Stirn zeichnete sich eine Ader ab.
»Ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen.«
»Leck mich.«
Passanten blieben stehen, um zuzuschauen. Ich machte einen Schritt nach vorn, kam ihm nahe genug, um die Hitze unter der billigen Lederjacke zu spüren. Es wäre eine Schande, ihn übel zuzurichten, aber er sollte sich auch nicht über den Haarausfall anderer Leute lustig machen. Mir gehen die Haare aus, seit ich Mitte zwanzig bin; mittlerweile ist nur noch ein dunkler Kranz hinten und an den Seiten übrig, den ich ganz kurz halte.
»Hey, Freundchen«, sagte ich, »warum gehst du mit deinen Kumpels nicht irgendwo spazieren?«
»Zwing mich doch dazu, Schwuchtel.«
Ich spürte ein kleines Feuer in meiner Magengrube auflodern, ließ mir aber nichts anmerken. Ich behielt den Blickkontakt bei und sagte: »Für Sie immer noch Herr Schwuchtel, Sir.«
Keine sonderlich originelle Antwort, aber offenbar eine wirkungsvolle. Ich erwischte den Blondschopf auf dem falschen Fuß und nahm ihm so die Gelegenheit zu einer schlauen Entgegnung. Die Leute in der Schlange lachten, sogar seine Freunde. Eine Passantin, eine alte Frau mit langen grauen Haaren, die ich jede Nacht zwanzigmal die East 9th Street auf und ab gehen sah, kicherte wie eine Hexe. »Wuhu!«, schrie sie und winkte mit den Händen über dem Kopf wie eine durchgedrehte Predigerin, »zeig’s ihm, Süßer! Mach ihn fertig!«
Das passte mir überhaupt nicht. »Ma’am, mischen Sie sich bitte nicht ein.«
Zu spät. Der Blondschopf sah ein, dass er sich den falschen schwulen Glatzkopf ausgesucht hatte, und suchte sich eine neue Zielscheibe. »Ich mach dich fertig, Schlampe«, sagte er und stapfte auf die alte Frau zu. Die zuckte nicht zurück und kicherte weiter vor sich hin.
»Ach, Kleiner«, sagte sie mit einer Hand auf der Hüfte und der anderen an ihrem Einkaufswagen, »du würdest doch einem harmlosen alten Mädchen wie mir nichts zuleide tun, oder?« Sie hatte einen Südstaatenakzent, und das S zischte sanft durch die Zahnlücken.
»Halt’s Maul, du Mumie«, sagte Blondschopf, »sonst brech ich dir den dürren Hals.« Er ballte die Fäuste und musste unbedingt etwas schlagen, aber er hatte sich schon wieder das falsche Opfer ausgesucht.
»Ach ja?«, sagte die alte Dame, und ehe ich mich versah, schwang sie ihren Einkaufswagen am Griff durch die Luft und schlug ihn dem Blondschopf an den Kopf. Suppendosen rollten auf das Pflaster und blieben an der Stelle liegen, wo Blondschopf auf dem Boden lag. Aus einer Schnittwunde an seiner Schläfe strömte Blut.
Scheiße. Das konnte ich nun ganz und gar nicht gebrauchen. Die Oma gackerte wie ein Huhn und tanzte in ihren abgetragenen Leinenschuhen herum, und ihr Batikrock bauschte sich um ihre Beine. Blondschopf sprang auf und ballte wieder die Faust.
Das reichte jetzt. Ich packte sein Handgelenk, drehte ihn um die eigene Achse wie einen Balletttänzer und drückte ihm den Arm so fest auf den Rücken, dass ich ihm beinahe die Schulter ausrenkte. Er war komplett hilflos und zappelte einen Moment lang wie ein Fisch an der Angel. »Das reicht für heute«, sagte ich und lockerte meinen Griff gerade genug, damit er wieder Luft bekam. »Brave kleine Jungs sollten um diese Zeit längst zu Hause sein.«
Dann geschah etwas, das ich nicht erwartet hatte – ich hätte es kommen sehen müssen, und das hätte ich auch, wäre ich nicht von der Vorstellung einer angenehmeren Version dieser Begegnung abgelenkt gewesen. In einem echten Gefecht konnte ein solcher Lapsus Leben kosten; hier, auf der East 9th Street an einem beschissenen Freitagabend, kostete er mich nur meinen Job.
Blondschopf brachte jedes Quäntchen Wut und Trotz auf, um wieder auf die Beine zu kommen, sich unter meinem Arm zu ducken und sein Handgelenk meinem Griff zu entwinden. Er war echt flink, das musste ich ihm lassen – flink genug, um die Haltung eines Kickboxers einzunehmen und mit dem rechten Bein einen äußert effektiven Roundhouse-Kick zu versuchen.
Ich war allerdings schneller. Ich parierte seinen Tritt mit dem Unterarm, drehte mich um und verpasste ihm einen Stoß in die Richtung, in die er austrat. Statt mich zu treten, flog er nun durch die Luft und landete erneut auf der Straße, nur hatte er dieses Mal das Bein schmerzhaft abgeknickt und nichts, um den Fall zu dämpfen. Er knallte mit dem Gesicht auf den Beton.
Seine Freundin schrie, als wäre sie gerade Zeugin eines Mordes geworden, und seine Kumpels, vier Kerlchen voller Bier und Testosteron, stürzten sich auf mich. Mit denen hatte ich leichtes Spiel – erst ging einer zu Boden, dann der zweite, und die übrigen beiden packte ich am Schlafittchen und hielt sie schreiend in der Luft. In der Warteschlange war die Hölle los.
Und genau in diesem Moment kam der Manager des Clubs raus und rief die Polizei.
Ich will niemanden mit den Einzelheiten des ›Gesprächs‹ in seinem Büro langweilen – meiner halbherzigen Beteuerung, dass ich doch nur meinen Job gemacht hätte –, jedenfalls verließ ich den Club ohne Arbeit und fragte mich, was ich nun tun sollte. Meine winzige Ein-Zimmer-Wohnung in der 109th Street war nicht gerade das Ritz, kostete aber ungefähr so viel.
Ich verließ den Club durch den Notausgang, hing kurz der Fantasie nach, den Ausgang zu versperren und ein Feuer zu legen – es ist derart einfach, Hunderte von Menschen zu töten, wenn man nur weiß, wie –, und ging dann weiter. Vor der Tür stand bereits ein anderer Trottel in Polyesterhosen, noch ein Ex-Soldat mit Narben und Muskeln und einem Kopf voll schlechter Erinnerungen. Typen wie ich sind leicht zu ersetzen.
Na toll – jetzt war ich arbeitslos, und wenn ich nicht schnell etwas dagegen unternahm, war ich bald auch noch obdachlos. Zeit, die Stellenanzeigen zu lesen, zum Telefon zu greifen und sich auf dem Markt feilzubieten. Aber stattdessen ging ich in eine Bar. Ich wollte mich betrinken und dann flachgelegt werden, und zwar in dieser Reihenfolge. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal nüchtern Sex hatte. Dabei kann ich das durchaus, und der Schmerz, den diese Erinnerung auslöst, ist einer der Gründe, weshalb ich trinke.
Ich bin wahrscheinlich der letzte Mann in New York City, wenn nicht gar in der ganzen westlichen Welt, der noch in Bars geht, wenn er nach Sex sucht. Alle anderen benutzen ihren PC oder ihr Smartphone oder was auch immer – da drücken sie dann die richtigen Knöpfe, um ihre Lieferung frei Haus zu ordern. Das ist nichts für mich; diesen ganzen Kram gab es noch nicht, als ich mit 21 ein Marine wurde, und danach hatte ich alles, was ich brauchte. Die Welt hat sich verändert, und als ich aus dem Dienst entlassen wurde, kam ich mir vor wie Rip Van Winkle, der sich nicht mehr in seinem Dorf zurechtfindet. Ich kann einen Angriff auf ein terroristisches Trainingslager irgendwo in der Wüste planen und ausführen, ich kann verschiedene Kampfsportarten mit Todesfolge praktizieren, aber ich kriege es kaum hin, ein Handy zu bedienen, geschweige denn, dass ich mir damit jemanden suchen kann, der mir den Schwanz lutscht. Ich ging also nicht nach Hause, sondern ins ›Downtown Diner‹, eine heruntergekommene Kaschemme unweit vom Union Square, wo ich schon öfter Erfolg gehabt hatte. Das Teil ist eigentlich seit Langem kein richtiges Diner mehr – wenn man etwas zu essen bestellt, heißt es immer, dass sie das heute Abend nicht mehr vorrätig hätten –, aber es gibt Bier, die Beleuchtung – und die Stimmung – ist gedämpft, und in der Regel hängen hier ein paar Typen wie ich herum: einsam, unglücklich, geil und auf der Suche nach etwas Gesellschaft.
In letzter Zeit wurde das ›Downtown‹ von Hipstern auf der Suche nach dem alten New York ›entdeckt‹; in einer Zeitschrift war ein Artikel erschienen, und seitdem wimmelte es in der Bar vor smarten jungen Berufstätigen, die ein Abenteuer erleben wollten. Und genau das wollte ich heute Nacht: einen eleganten Zivilisten mit Geld in der Tasche und einer Vorliebe für raue Kerle. Und was könnte rauer sein als ein arbeitsloser Ex-Marine?
Ich besorgte mir ein Bier und nahm auf einem Barhocker Platz, wo ich so auffällig wie möglich wirkte – ich hätte auch gleich ein rotes Licht über mir aufhängen können.
Na los schon, verdammt noch mal, dachte ich, ich bin immer noch nüchtern und will nicht ins Nachdenken kommen. Ich will mich nicht erinnern, wie ich hierher gelangt bin – ein Schritt nach dem anderen, unausweichlich, als würde man mich anschieben. Ich will mich nicht an den Tod und die Trauer und das Zerwürfnis erinnern, an die gedämpften Diskussionen mit meinen Vorgesetzten an langen, auf Hochglanz polierten Tischen, alle trugen wir Medaillen, alle redeten im Kreis herum, bis man mich fragte und ich die Wahrheit sagte, und auf einmal saß ich in einem Flugzeug in Richtung Heimat, die Entlassungspapiere in meiner Tasche.
Ich will mich nicht an Will erinnern.
Und halleluja, gerade als ich anfing, durch die feuchten Ringe auf der Theke hindurchzusehen und Wills Gesicht sich vor mir abzeichnete, als ich gerade ins Loch fallen wollte …
»Ist der Platz frei?«
Grauer Anzug, locker sitzende, dunkelrote Krawatte, weißes Hemd mit offenem Kragen, vielleicht 27, 28.
»Nur zu.«
Er zückte seine Brieftasche, ein aufwendiges Teil mit Monogramm, und winkte damit dem Barkeeper. »Ein Bier bitte« – und dann, als wäre es ein ganz spontaner Einfall: »Möchtest du auch was, Kumpel?«
»Klar doch.« Ich drehte mich zu ihm um und spreizte die Beine. »Scotch.«
Der Barkeeper hob eine Sekunde lang die Augenbraue, als er mich ansah, und die Sache war geritzt. Er goss immer ziemlich großzügig ein, wenn solche Typen die Zeche bezahlten.
Ich nahm einen tiefen Schluck. Der Whiskey brannte in meiner Kehle.
»Durstig?«, fragte der Typ und nippte an seiner Bierflasche. Er war wohl eher an edle Weine aus Kristallgläsern gewöhnt, aber er wollte sich anpassen.
»Heiß heute«, sagte ich und stellte das Glas ab, um nicht alles in einem Rutsch zu kippen. Ich wollte ihm keine Angst einjagen; er hatte Geld und war genau das, was ich wollte: ein glatter, hübscher Yuppie mit Eigentumswohnung und einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio, der am Wochenende meistens mit seinem BMW an die Küste fährt. Vielleicht ist sein fester Freund, ein Designer, heute Abend nicht in der Stadt, also ist er ins ›Downtown‹ gekommen, um ein dringendes Bedürfnis zu stillen …
»Auf jeden Fall.« Er lockerte mit einem Finger seinen Kragen. »Darum brauchte ich ein Bier.«
Klar, und da bist du rein zufällig in diesem Aufreißschuppen gelandet. »Arbeitest du hier in der Gegend?«
»Nein.« Er nickte in Richtung Süden. »Im Financial District.«
»Dachte ich mir.«
»Wieso das?«
Ich nahm seinen Jackenaufschlag zwischen Daumen und Zeigefinger. »Du fällst hier schon auf.« Ich hatte noch meine Türsteherkluft an. »Warum ziehst du dein Jackett nicht aus?«
Er tat wie ihm geheißen. Sein Hemd war makellos und sah aus, als wäre es ihm auf den schlanken Torso geschneidert. Ich konnte mir gut vorstellen, was sich darunter verbarg – einer dieser vollkommenen, wissenschaftlich durchdesignten Körper, gestaltet von einem teuer bezahlten Personal Trainer. Er war mindestens zehn Jahre jünger als ich, und er hatte schon alles erreicht: Geld, Karriere, eine Zukunft …
Ich hatte allerdings auch etwas, das er wollte. Es war zwar dunkel im ›Downtown Diner‹, und ich trug schwarze Polyesterhosen, aber er konnte den Blick einfach nicht vom Ziel seiner Begierde nehmen.
»Also, was …« Er musste sich räuspern und einen Schluck Bier trinken. »Was machst du so?«
»Nichts.«
»Du meinst …«
»Ich bin arbeitslos.« Ich warf einen Blick auf die Uhr. »Seit ungefähr einer Stunde.«
»Das ist Pech.«
»Ja, das ist Pech.« Ich trank einen Schluck Whiskey; im Glas war nur noch ein kleiner Rest. Er bestellte mir einen zweiten, ohne mich vorher zu fragen. Smarter Junge. Er blieb bei seinem einen Bier. Noch smarter.
Der Scotch löste einen netten kleinen Rausch aus. Vom Hals aufwärts war alles betäubt, und vom Hals abwärts kribbelte alles – genau so wollte ich es.
»Und was hast du gemacht, wenn ich fragen darf?«
»Türsteher.«
»Mmm-hmm …« Er nippte an seinem Bier und runzelte die Stirn; vielleicht passte das nicht zu seinem Fantasiebild von mir.
»Und davor war ich zwölf Jahre bei der Marineinfanterie.«
»Echt?«
»Willst du meine Medaillen sehen?«
»Ich glaub dir auch so.«
Ich zuckte die Achseln. »Wie du möchtest.«
»Vielleicht kann ich dich zum Essen einladen?«
»Ich habe keinen Hunger.« Er wirkte unzufrieden. »Außer, dein Arsch steht auf der Speisekarte.« Er wirkte zufrieden.
»Kann schon sein.« Seine Lippen schlossen sich wieder um die Flasche. Die Glückliche. Ich schnappte mir seine Krawatte, zog ihn an mich ran und schob ihm mein Knie zwischen die Beine. Nicht gerade subtil, aber er war ja auch nicht hier, um Konversation zu betreiben.
»Hast du ’ne Bude?«, fragte er.
»Ja, ist aber ein ganzes Stück«, sagte ich. Wir würden dorthin fahren, wenn er fürs Taxi bezahlte. Offensichtlich hatte er keine Lust darauf, dass ich seine hellen Teppiche und seine Wildledertapete verschandelte, oder was Typen wie er heutzutage sonst so in der Wohnung haben. Vielleicht wollte er aber auch bloß nicht in seinem Ehebett vögeln.
»Okay.« Er kratzte sich am Kinn; seit der Morgenrasur war genug nachgewachsen, um ein knisterndes Geräusch zu machen. Allmählich wollte ich ihn ebenso sehr wie er mich; mit diesem Job würde ich nie meine Brötchen verdienen können, dachte ich. »Wie wär’s denn, wenn wir uns ein Zimmer nehmen?«
»Im Ernst?«
Er zuckte die Achseln. »Warum denn nicht? Ich lerne ja nicht jeden Tag Leute wie dich kennen.«
Zehn Minuten später befanden wir uns in der Lobby eines besseren Stundenhotels, und ich hatte den Eindruck, dass mein neuer Freund hier kein Fremder war. In einem abgenutzten Messingtopf stand eine schäbige Palme, in der Luft hing Zigarettenqualm und der Geruch nach Desinfektionsmittel. Der Typ an der Rezeption sah kaum auf, als er uns den Schlüssel gab.
»Wie heißt du?«
»Dan.« Ich hätte mir wohl einen anderen Namen ausdenken sollen, aber der Whiskey zeigte seine Wirkung. »Und du?«
»Scott.«
»Okay, Scott.« Wir hatten die Hälfte der Treppe erklommen. »Hast du ein paar Gummis in deiner Aktentasche?«
»Mm.«
»Viele?«
»Ja. Wieso?« Wir standen vor der Zimmertür.
»Weil ich deinen hübschen Arsch die ganze Nacht lang durchficken werde.«
Er wurde rot. »Ähm … gut.«
»Das willst du doch, oder?« Der Schlüssel war im Schloss.
»Klar. Nur … tu mir nicht weh, ja?«
Das fällt dir ein bisschen spät ein, dachte ich, als er die Tür hinter uns schloss. Du hast dir schließlich einen ehemaligen Marine aufgerissen. Ich packte ihn an den Handgelenken – ich war zwar betrunken, aber ich konnte mich immer noch blitzschnell bewegen – und drückte seine Hände über seinen Kopf auf die kitschige braune Lackierung der Tür. »Ich mache mit dir, was ich will, Scott.« Ich küsste ihn hart auf den Mund. »Du gehörst jetzt mir.«
Und die nächsten fünf Stunden gehörte er mir.
Er hatte in seiner Tasche nicht bloß Kondome bei sich, sondern – neben irgendwelchen Unterlagen und seinem iPad – auch Poppers und eine Flasche Wodka. Normalerweise rühre ich das Zeug nicht an, aber als er mir die Wodkaflasche reichte, die noch feucht von seinen Lippen war, nahm ich einen tiefen Schluck.
Und Scott bekam alles ab. All die Wut, die sich in mir aufgebaut hatte, seit diese blonde Rotznase vor dem ›Panther Club‹ den Streit angefangen hatte, all der Frust der letzten zwei Jahre, die ich als Türsteher arbeitete und wie ein Penner in einem Wohnklo in Harlem hauste, all die Scham darüber, meinen Job verloren zu haben, die Trauer, einen … Menschen verloren zu haben … All das pumpte ich ihm in seinen weißen Hipster-Arsch, und er nahm alles hin, jeden Zentimeter, jeden Stoß, jeden Klaps auf die Backen, jedes grobe Wort. Er nahm es auf dem Rücken, mit seinen Beinen auf meinen Schultern oder weit gespreizt in meinen Händen. Er nahm es auf allen vieren und streckte mir den Arsch entgegen, während ich gnadenlos zustieß. Er schmierte mir den Schwanz mit Gleitcreme ein, setzte sich drauf und glitt rauf und runter, als säße er auf einem Karussell. Ich habe zu meiner Zeit eine Menge Ärsche gefickt – es gab nie einen Mangel an Nachschub im USMC, ganz egal, was die blöden Gesetze sagen –, aber mir war noch nie ein Mann untergekommen, der sich so darüber freute, einen Schwanz in sich zu spüren. Ich schwöre bei Gott, hätte ich zwei Schwänze gehabt, dann hätte er beide in sich aufgenommen und immer noch mehr verlangt.
Ich brachte ihn einmal zum Höhepunkt, indem ich ihn wichste, als er mich ritt; er verspritzte seine Ladung über meinen behaarten Bauch. Er stieg ab, ging sich im Badezimmer den Arsch abwischen, legte sich wieder aufs Bett, warf die Beine in die Luft und steuerte mich rein. Auf diese Art und Weise brachte ich ihn zum zweiten Höhepunkt, und als ich spürte, wie sein Schließmuskel sich immer enger um mich schloss, spritzte auch ich ab – ich kam so heftig, dass ich Sterne sah. Selbst das reichte noch nicht. Er nahm mich mit unter die Dusche, warf das Gummi ins Klo und fing an, mir unter der heißen Brause einen zu blasen. Keine Viertelstunde später rollte er mir ein weiteres Gummi über den Schwanz und stützte sich an der Kachelwand ab, während ich ihn von hinten aufspießte. Wir schauten uns selbst in dem schmutzigen Spiegel zu, sahen meinen dicken, dunklen Schwanz, wie er seinen blassen, wohlgeformten Hintern pumpte. Sein Personal Trainer hatte gute Arbeit geleistet. Gemeinsam hatten sie die perfekte Fickmaschine geschaffen.
Nachdem ich zweimal und er viermal gekommen war – sein letztes Mal ohne Erguss, dafür aber mit einem Gesichtsausdruck, wie ich ihn bislang nur in einem Feldlazarett gesehen hatte –, lagen wir Seite an Seite auf dem Bett. Draußen wurde es schon hell. Es war ein gutes Gefühl, jemanden neben mir zu spüren, einen warmen Leib, dessen Brust sich hob und senkte, diese Intimität, die sich fast wie Liebe anfühlte, wenn man die Augen schloss und sich vorstellte, dass der Typ neben einem ein anderer wäre … einer, der sich was aus mir machte …
Ich hörte nicht, wie er das Zimmer verließ. Ich wachte erst auf, als jemand an die Tür klopfte und schrie: »Hey! Zimmerreinigung!« In meinem Kopf hämmerte es, meine Augen fühlten sich an wie gesprungene Glasmurmeln, und mir drehte sich der Magen um – zu viel Alkohol, zu wenig Essen.
»Schon gut! Eine Minute noch.«
Großer Gott, in dem Zimmer roch es wie im Schweinestall – sofern Schweine Alkohol tranken und Poppers schnüffelten. Mein Schwanz war hart, weil ich pinkeln musste, und das dichte, weiche Schamhaar war von Sperma verklebt. Keine Spur von meinem neuen Freund Scott, dem Mann, den ich ins Paradies gefickt hatte und neben dem ich eingeschlafen war.
Ich ging ins Bad und sammelte meine Kleider auf. Auf dem Nachttisch lagen vierzig Dollar: zwei Zwanziger, ordentlich unter einem Lampenfuß gefaltet. Vierzig lausige Kröten. Wie ich schon sagte, zum Callboy bin ich eher wenig geeignet. Ich steckte das Geld in die Tasche und fuhr mit dem Bus nach Hause.
2 | Der Job
Was für ein Freitagabend: Ich wurde in eine Schlägerei verwickelt, verlor meinen Job, riss mir einen Schwanz der Extraklasse auf, der mir mit seinem Kleingeld locker fürs nächste Halbjahr die Miete hätte bezahlen können, und wachte auf mit dem übelsten Kater meines Lebens, einem wunden Schwanz und der fürstlichen Summe von vierzig Kröten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!