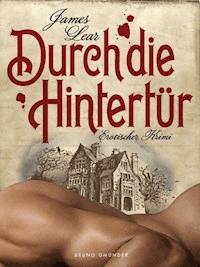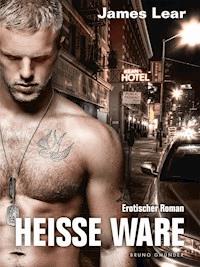Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruno Gmünder Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Ein Mordanschlag, Überfälle, erpressungen -die ehemalige US-Elitetruppe steht unter Beschuss. Wer hat es auf die Männer der geheimen Spezialeinheit abgesehen? Ex-Marine Dan Stagg ermittelt auf eigene Faust, um genau das herauszufinden. Auf der Suche nach den ehemaligen Kameraden kommt es zu einem verheißungsvollen Wiedersehen mit dem attraktiven Al Benson - damals Star des Marinekorps, heute ansehnlicher Ehemann mit dunklen Geheimnissen. Je tiefer Dan und Al in die Vergangenheit vordringen, desto offensichtlicher wird, dass Al mehr sucht als nur ein paar Antworten. Eine explosive Affäre beginnt, in der alle Beteiligten scharfe Geschütze auffahren und die Dan in eine längst verdrängte Vergangenheit zurückwirft …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
SCHARFE GESCHÜTZE
James Lear ist Experte für knisternd erotische schwule Krimis und historische Romane. Mit Durch die Hintertür, Der geheime Tunnel und Der letzte Akt (Mitch-Mitchell-Krimireihe) begründete er seinen Erfolg als internationaler Bestsellerautor. Scharfe Geschütze ist nach Heiße Ware der zweite Dan-Stagg-Roman. James Lear lebt in London.
James Lear
Erotischer Roman
SCHARFEGESCHÜTZE
Aus dem Englischen von Andreas Diesel
BRUNO GMÜNDER
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel»Straight Up« bei Cleis Press.
1. Auflage© 2015 Bruno Gmünder GmbHKleiststraße 23-26, D-10787 [email protected]
Originaltitel: Straight Up. A Dan Stagg NovalCopyright: © 2015 by James LearAus dem Englischen von Andreas DieselUmschlaggestaltung & Satz: Robert SchulzeAbbildung Umschlag: Michael Stokesmichaelstokesphoto.com
eISBN 978-3-95985-040-7
ISBN 978-3-95985-023-0
Mehr über unsere Bücher und Autoren:www.brunogmuender.com
01
Schon mal ein Fickverhältnis mit einem verheirateten Kerl gehabt? Falls ja, dann kennst du das: Er schreibt glühende E-Mails und SMS, trifft Verabredungen, wenn seine Frau nicht da ist, und wenn du dann Glück hast und er nicht in letzter Minute absagt, bekommst du eine Stunde unbeholfenen Sex, bei dem er dich nicht mal küsst oder dir auch nur in die Augen sieht. Danach redet er über seine Arbeit, Sport, seine Familie, sogar das Wetter – über alles, nur nicht darüber, was gerade passiert ist. Dann hörst du monatelang nichts von ihm, bis es ihm wieder im Schritt juckt, und wenn du dumm genug bist, lässt du dich wieder darauf ein. Wenn dich Unehrlichkeit scharf macht, wirst du eine Menge Spaß haben, aber wenn du dir aus dem Typen tatsächlich etwas machst, dann sitzt du in der Klemme. Ich habe in der Armee genug davon erlebt und mir wie alle eingeredet, dass ich das ja nur aus einer Notlage heraus mache. Im Zivilleben brauche ich so was nicht. Ich muss zugeben, dass es mir manchmal dennoch passiert. Manchmal kann ich einfach nicht widerstehen. Trotzdem: Das ist und bleibt reine Zeitverschwendung.
Und genau das dachte ich auch über diesen Fall – zumindest am Anfang.
Ich erhielt eine E-Mail von einem alten Kameraden der Marines – er hatte mich in einem dieser Foren aufgestöbert, in das Jody mich gedrängt hatte. »Du kannst deine Vergangenheit nicht einfach so auslöschen«, hatte Jody mich belehrt – ziemlich dreist für jemanden, der mit seinen 25 Jahren bereits fünf Identitäten hinter sich hatte. »Du musst mit ihr ins Reine kommen und mit Menschen in Kontakt treten. Das war schließlich ein Teil deines Lebens.« Und so bastelte ich mir mit seiner Hilfe mehr schlecht als recht ein Profil auf einer Website für Veteranen und schrieb so etwas wie »Ich würde mich freuen, von ehemaligen Marines zu hören«. Ich warf einen oberflächlichen Blick darauf, wer sonst noch auf der Seite angemeldet war, erkannte ein paar Arschlöcher von früher, die aller Wahrscheinlichkeit nach immer noch Arschlöcher waren, und vergaß die ganze Sache wieder.
Dann eines Tages: Sie haben eine neue Nachricht in Ihrer Vets-Web-Inbox. Klicken Sie auf diesen Link usw. usf. Ich klickte, und da war er: Alan Benson. Den Namen hatte ich nicht vergessen. Wir hatten beinahe zusammen die Ausbildung durchlaufen – ›beinahe‹ deshalb, weil Al Benson mir auf der Marineakademie ein paar Jahre voraus und dort so etwas wie ein Star war. Er war über eins achtzig groß, hatte breite Schultern, die kaum in die Uniform passten, sah aus wie ein Bauernbursche aus dem Mittleren Westen und hatte so rote Haare, dass es wirkte, als stünde er in Flammen. Die anderen nannten ihn die Karotte oder den Rotfuchs, aber nur hinter seinem Rücken. Ins Gesicht nannten sie ihn Red, wenn sie nicht Sir zu ihm sagten. Red Benson: Football-Held, Sportskanone, Alphamännchen, der große Bruder, den jeder sich gewünscht hätte. Natürlich war ich verrückt nach ihm, und natürlich nahm er mich kaum zur Kenntnis. Sein Körper, sein Aussehen, seine Haare, die milchweiße Haut voller Sommersprossen, bei den wenigen denkwürdigen Gelegenheiten unter der Dusche dann auch noch der hellrote Busch und der lange weiße Schwanz mit der abzweigenden blauen Ader … Ja, ich war ganz verschossen in ihn. Dann machte er seinen Abschluss, zeichnete sich in Kampfzonen rund um die Welt aus, wir dienten ein oder zwei Mal zusammen, und irgendwann verloren wir uns ganz aus den Augen. Meines Wissens hätte er auch längst tot sein können.
Das war er aber offensichtlich nicht.
»Hey, Dan.« Dan? So hatte er mich nie genannt. Lieutenant Stagg, ja, aber niemals Dan. »Wie geht’s dir, Alter?« Alter? Der will was, dachte ich, aber ich brauchte lange, bis ich wusste, was er wollte. »Und, wie kommst du im Zivilleben zurecht? Ich bin nächsten Monat geschäftlich in Boston, und es wäre toll, wenn wir uns mal treffen könnten. Ich lad dich auch zum Abendessen ein! Ciao, Al.«
Also gut, er wusste, dass ich in der Nähe von Boston wohnte und dass ich nicht mehr bei den Marines war – das konnte er meinem Profil entnehmen. Er wusste auch, dass ich knapp bei Kasse war, sonst würde er mich nicht zum Abendessen einladen. Und woher wusste er das? Hatte er von den Umständen meiner Entlassung aus den Marines gehört – die ehrenhafte Entlassung, um einen Skandal zu vertuschen, ein letztes bösartiges Zuschnappen des sterbenden Tieres namens »Don’t ask, don’t tell«? In Militärkreisen macht Klatsch schnell die Runde. Erinnerst du dich an Dan Stagg? So ein ruhiger Typ, dunkle Haare, Stirnglatze? Genau der. Du kommst nie drauf, was dem passiert ist. Er wurde mit runtergelassener Hose erwischt – ja, mit einem untergeordneten Corporal. Klar, er gab alles zu. Dann wurde er rausgeschmissen. Eine Schande, er war ein guter Marine. Hat’s immerhin zum Major gebracht. Aber man kann nie wissen, oder? Man kann nie wissen.
Das ist ein Aspekt der Geschichte – der Teil, von dem es mir egal ist, ob andere darüber Bescheid wissen oder nicht. Die Klatschbasen von Pendleton und Lejeune wussten schließlich nicht, dass besagter Corporal von einem Heckenschützen in Helmand erschossen wurde, dass Major Stagg unter seiner Trauer und seinen Schuldgefühlen zusammenbrach und dass es ihm scheißegal war, was seine Vorgesetzten darüber dachten. Er wollte es einfach nur hinter sich bringen und Will in den Tod folgen. Ohne jede Überlegung spülte ich einen makellosen Lebenslauf die Toilette herunter.
Ich durchlebte deswegen eine schlimme Phase, ganz so wie Tausende von anderen Veteranen. Posttraumatische Belastungsstörungen, verlorene Gliedmaßen, gescheiterte Ehen. Es ist nicht gerade leicht, sich an eine Welt anzupassen, in der man nicht mehr jeden Tag Menschen umbringt. Ich saß da und suhlte mich im Selbstmitleid, dann rappelte ich mich wieder auf – dank einem Typen namens Jody, der einen ganzen Haufen Probleme hatte, die sogar noch größer waren als meine, und dank Umständen, die noch irrer waren als alles, was ich im Kriegsdienst erlebt hatte. Und heute habe ich so etwas wie eine Beziehung und so etwas wie eine Zukunft, und ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken.
Was wusste Al Benson alles? Ich bin ein argwöhnischer Bastard, ich nehme nichts für bare Münze – eine Folge meiner Ausbildung als Marine –, und ich konnte keinen Augenblick daran glauben, dass er einfach nur in den guten alten Zeiten schwelgen wollte. Er wollte sich also entweder an meinem Unglück weiden, mich belehren, oder aber – ja, auch der Verdacht kam mir kurz – er wollte mir an die Wäsche. Aus Erfahrung weiß ich, dass selbst der abgebrühteste Heterosexuelle seine Geheimnisse hat. Vielleicht ja auch Red Benson, das Aushängeschild des US-Marinecorps. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Meine Faustregel dazu: Wenn man einen Schwanz zwischen den Beinen hat, ist alles möglich.
Ich schrieb Al eine Antwort im selben Tonfall. »Hey, Al. Schön, von dir zu hören. Ja, ich wohne in der Nähe von Boston. Teil mir deine voraussichtliche Ankunftszeit mit, dann müssen wir uns unbedingt treffen« – nein, das klang zu dringlich – »dann können wir uns treffen. Hier in Beantown gibt’s viele gute Restaurants. Viele Grüße, Dan Stagg.« Das sollte reichen. Eine ganz normale E-Mail zwischen Männern, nichts Schwuchteliges, keine Einladung ins Sinfoniekonzert oder ins Ballett oder in die Sauna. Was zu beißen, ein paar Biere. Zwei Veteranen, alte Kameraden, mehr nicht. Vielleicht ist er ja einfach nur ein netter Kerl – er hat gehört, dass ich in Schwierigkeiten stecke, und möchte mir eine helfende Hand reichen. Dafür sind solche Netzwerke ja da. Informelle Unterstützung, die auf Gegenseitigkeit aufbaut. Nun, damit kann ich immer etwas anfangen – vor allem, wenn es die Hand von Red Benson ist, Benson mit seinen Haaren und seinem Lächeln und seinen Sommersprossen. SENDEN. Und weg war die Mail, versendet und vergessen.
Es ist ja nicht so, dass ich nicht andere Dinge hätte, die mich beschäftigen. Ich muss zum Beispiel meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich versuche, die eingestürzten Brücken zu meiner Familie wieder aufzubauen und eine Fernbeziehung mit einem Typen zu führen, der nicht nur 15 Jahre jünger ist als ich, sondern auch so hübsch, dass jeder mit einem Puls ihn ficken will, und der selbst nicht gerade dafür bekannt ist, seine Finger (und andere Körperteile) bei sich zu behalten. Jody geht wieder auf die Schule, weil er die eine Sache tun will, die ihm so viel Spaß macht wie Sex: Er studiert Modedesign am Pratt Institute in Brooklyn und holt die Jahre nach, in denen er seine Brötchen mit seinem Hinterteil verdient hat. Er ist klug, er ist begabt, und nach allem, was er mir erzählt, scheint er sich dort prächtig zu amüsieren. Er ist mir dankbar: Ohne das schmutzige Geld, das ich von einer Bande Ganoven habe, die mir einen Mord in die Schuhe schieben wollten, könnte er sich die hohen Studiengebühren von Pratt nicht leisten. Mir macht das nichts. Ich hätte das Geld eh nicht für mich selbst ausgegeben. Da kann ich ebenso gut Jodys Zukunft finanzieren.
Aber es ist nicht gerade einfach, voneinander getrennt zu leben. Zum einen mache ich mir Sorgen um ihn: Als er sich von der Hirnblutung erholte, meinten die Ärzte, dass er später womöglich epileptische Anfälle erleiden könnte. Wenn so etwas passiert, dann bin ich nicht bei ihm, um mich um ihn zu kümmern. Zum andern steht die Frage im Raum, wo wir zusammen leben sollen. Jody liebt die Stadt, während ich nichts dagegen hätte, nie wieder einen Fuß nach New York zu setzen. Er hat ein Zimmer in einem Studentenwohnheim, das er sich mit einem anderen Modedesignstudenten teilt: zwei Einzelbetten, zwei Schreibtische und Unmengen an Magazinen, Stoffen und leeren Kaffeetassen. Ich habe ihn ein paarmal besucht, wenn sein Mitbewohner gerade weg war, und ihn so hart gefickt, dass die Nachbarn bestimmt den Hausmeister gerufen hätten, hätte ich Jody nicht den Mund zugehalten. Er hat mal den Vorschlag gemacht, dass wir uns zusammen etwas suchen sollten, das das Beste beider Welten vereint – eher ländlich, aber mit schneller Anbindung in die Stadt. Solange er aber nicht seine erste Kollektion an Saks Fifth Avenue verkauft oder ich im Lotto gewinne, ist das nicht sehr wahrscheinlich. Die Mieten in solchen Gegenden übersteigen meine Mittel. Ich wohne billig in einem Haus in Lowell, Massachusetts, das meinem Onkel gehört – in der Bude wurde seit den Siebzigern nichts mehr gemacht, es gibt keine Zentralheizung, und die Decke hat so viele Löcher, dass er es nicht mal mehr als illegales Drogenlabor vermieten könnte. Immerhin besser, als es als Schuppen zu benutzen, und für das schwarze Schaf der Familie reicht es allemal. Ich zahle ihm hundert Kröten im Monat, und dafür halte ich seine Versicherungsbeiträge niedrig und die Junkies und Hausbesetzer fern. Ein ziemlich einseitiger Deal, aber ich rede mir ein, dass es besser als ein Motel ist. Zumindest verleiht mir das die Illusion, bei meiner Familie zu leben.
Meine Eltern wohnen einige Kilometer weiter in Groton, einer hübschen kleinen Gemeinde, wo vom Kampf gezeichnete schwule Veteranen nicht so recht hinpassen. Ich besuche sie am Wochenende oder dann, wenn Dad Hilfe bei Dacharbeiten braucht oder Mom einen Baum im Hof weghaben möchte. Die Nachbarn halten mich wahrscheinlich für einen Tagelöhner. Als meine Eltern vor einigen Jahren hierhergezogen sind, um ihren Lebensabend friedlich zu verbringen und Kürbisse, Äpfel und Tomaten zu züchten, war von mir wohl nicht oft die Rede. Ich war nicht mehr der Held, der Sohn, auf den sie so stolz waren, dass sie in ihrem alten Haus Fotos von mir an die Fenster klebten. Ich kam als ein anderer zurück, und die Bilder verschwanden – selbst die gerahmten Fotos, die auf dem Kaminsims standen. Meine Schwester mit ihren Kindern ist noch da. Mein zweimal geschiedener Bruder ebenfalls. Ich nicht mehr.
Ich lasse ihnen Zeit. Ich habe jede Menge davon. Ich bin noch keine vierzig, und sie sind ja erst über siebzig – wir könnten das Thema noch gut zehn oder gar zwanzig Jahre umgehen, wenn ich es so einrichte. So sieht es also aus: Ich wohne in einem Drecksloch, arbeite in einem schäbigen Fitness-Studio in Lowell, das mir gerade genug zahlt, um die Miete zu begleichen und Essen zu kaufen. Der Himmel weiß, was passiert, wenn ich mal krank oder arbeitslos werde. Jody sagt immer, dass er sich um mich kümmern und mich nach Paris und Mailand entführen wird, sobald er ein berühmter Modeschöpfer ist. Das kann allerdings noch dauern. In der Zwischenzeit werde ich mir den Mut nehmen und sagen: »Mom, Dad, setzt euch, wir müssen mal über was reden.«
Irgendwie ist das aber bis heute nicht passiert. Ich habe feindliche Stützpunkte voller Knarren und Handgranaten erstürmt, ich habe mehr Männer umgebracht, als ich zählen kann, aber vor einem erwachsenen Gespräch mit meinen Eltern habe ich Angst.
Eine Woche später: Sie haben eine neue Nachricht in Ihrer VetsWeb-Inbox. Es war noch früh am Morgen, fünf Uhr, und ich musste das Studio für die Gäste öffnen, die vor der Arbeit trainieren wollten. In der Regel dusche und rasiere ich mich auf der Arbeit, weil ich dazu lieber heißes Wasser habe und mir das Bad nicht gern mit Kakerlaken teile. Ich trug noch die Jogginghose und das T-Shirt, in denen ich geschlafen hatte, war barfuß und verquollen. Ich prüfte rasch mein E-Mail-Postfach, ob Jody mir einen netten Morgengruß geschickt hatte. Manchmal ist es eine Uhrzeit für ein Skype-Gespräch. Manchmal ist es ein Foto. Wie die meisten Menschen hatte ich mir meine IT-Kenntnisse angeeignet, um mir einen runterzuholen. Aber nicht heute. Er war wohl zu beschäftigt damit, hübsche Kleidchen zu entwerfen.
Dafür gab es wieder eine Nachricht von Al Benson. »Komme morgen (Do Nachmittag) in Boston an. Wohne im Marriott, Back Bay. Sollen wir uns dort um 18.00 treffen? Al.«
Das las sich fast wie eine militärische Instruktion. Kein ›Alter‹ und kein ›Ciao‹. Eine Zeit- und eine Ortsangabe, und hätte er den letzten Satz nicht als Frage formuliert, wäre es ein Befehl gewesen.
Ich musste nicht erst in meinen Terminkalender schauen. Ich hatte heute Frühschicht, und wenn ich nicht auf der Arbeit bin, habe ich Zeit.
Ich schrieb »Sir, ja, Sir!« und schickte die E-Mail ab.
Ich hatte nur kurz Zeit, mich zu fragen, was genau Benson eigentlich wollte – einen Freund? Ein Fickverhältnis? Einen Auftragskiller? –, dann musste ich ins Auto springen. Mein Seesack steht immer bereit. Manche Angewohnheiten wird man einfach nicht mehr los.
Diejenigen, die mich schon kennen, haben bei der Bemerkung, dass ich in einem Fitness-Studio arbeite, sicher die Augen verdreht. »Ach was, Dan, ein Fitness-Studio. Ein Ort, wo Kerle sich ausziehen. Typisch.« Dafür müsste ich euch eine Abreibung verpassen, oder ich könnte sagen: »Ihr kennt mich ja nicht, ich bin jetzt in einer Beziehung, und so einer bin ich nicht«, und ihr würdet so tun, als schenktet ihr mir Glauben, weil euch eure Knochen lieb sind. Aber natürlich habt ihr völlig recht. Meine Arbeit im Strong Box – »Die erste Adresse in Lowell für Fitness und Kampfsport« (oder in anderen Worten: das einzige Studio in der Stadt) – ist die eines Einzeltrainers, spezialisiert auf Kickboxen und andere legitimierte Arten der Gewalt. Zwischen den Kunden, die spärlich gesät sind, sitze ich am Schalter, nehme Anrufe entgegen, sammle Handtücher in der Umkleide ein, wische den Boden und räume anderen Leuten ihren Dreck hinterher. Eigentlich ist es wie die Arbeit für Uncle Sam, nur ohne das Töten.
Natürlich gibt es Gelegenheiten, und ja, ich habe sie ergriffen. Nicht mit den Mitgliedern: Ich kann es mir nicht leisten, den Job zu verlieren, und im Vertrag steht, dass jegliche Intimkontakte mit den Kunden ein Grund zur fristlosen Kündigung sind. Vermutlich wurden ein paar scharfe Ehefrauen mit ihren Trainern in flagranti erwischt. Vor mir sind sie sicher, aber ihre Männer vielleicht nicht. Das muss niemand wissen. Ich bin an meinem Arbeitsplatz nicht geoutet. Im Arbeitsvertrag steht allerdings nichts von den Arbeitskollegen. In der Fitness-Branche gibt es eine Menge Fluktuation – selbst in einer kleinen Muckibude wie dem Strong Box wird dauernd das Personal ausgetauscht: College-Abgänger, die einen Fuß in die Tür kriegen wollen, ehemalige Leistungssportler, sogar ein paar frühere Militärs wie ich. Alle sind sie körperlich in Bestform, und grob geschätzt würde ich sagen, dass man rund vierzig Prozent von ihnen rumkriegen kann. Man fängt an, über Körper zu plaudern, man geht nach Ladenschluss noch mal unter die Dusche, man vergleicht die Bauchmuskeln oder den Deltamuskel oder sonst irgendeinen Muskel, und schon geht’s rund.
Als ich gerade den Schlüssel in die Zündung steckte, fiel mir ein, dass ich mir diese Schicht mit Lee teilen würde, einem jungen Briten, der einen Masterstudiengang in Sportwissenschaft in Boston belegte. Wie ich wohnte er billig in Lowell, wie ich bezahlte er seine Miete mit dem Job im Studio, und in seinen ersten paar Wochen lästerten wir zusammen über dies und das. Er war 21, zum ersten Mal im Ausland und auf sich allein gestellt, und er hatte Heimweh. Ich sollte wohl erwähnen, dass er groß und schlank war und in England Rugby spielte – er hoffte, eines Tages in der Landesmannschaft mitmachen zu können. Auf seinem linken Brustmuskel hatte er die englische Rose tätowiert. »Die will ich irgendwann auf meinem Trikot tragen«, hatte er gesagt, als ich ihn zum ersten Mal nackt gesehen hatte. Wäre es nach mir gegangen, würde er nie wieder Kleidung tragen, aber so nickte ich einfach nur und sagte etwas über Sport.
Er wartete bereits auf mich, als ich vor dem Studio hielt. Er lehnte sich an die Wand, trug Jeans, einen dicken Pulli und eine Wollmütze; es war September, die Tage waren noch warm, aber morgens war es eiskalt, ein Vorbote des Winters. Er hatte einen Fleck gefunden, auf den schwach die frühe Sonne schien, und sog die Wärme auf wie eine Eidechse. Sein Gesicht war eher markant als hübsch zu nennen, vor allem jetzt, wo der ausgeprägte Schatten die hohen Wangenknochen und die niedrige Stirn noch akzentuierten. Seine Augen standen dicht beisammen, sein Mund war groß; in dieser Haltung wirkte er wie ein Dummbrot. Das gefiel mir. Ich hatte meine militärische Laufbahn damit verbracht, Typen wie Lee Befehle zu erteilen, und für die Dummen unter ihnen hatte ich immer eine Schwäche gehabt. Als er hörte, wie ich aus dem Auto ausstieg, schlug er die Augen auf und lächelte.
»Dan!«
Er richtete sich auf, setzte die Mütze ab und fuhr sich mit der großen Hand über den Kopf. Seine Haare waren irgendwie verrückt geschnitten: an den Seiten ganz kurz, oben und hinten lang – eine Art abgewandelter Iro, der bei jedem über 22 ziemlich beschissen aussehen würde. In Lees Alter geht das gerade so noch durch. Seine Nägel waren bis aufs Nagelbett abgebissen, und am rechten Mittelfinger hatte er ein Pflaster.
Ich schüttelte ihm die Hand, warf dann einen prüfenden Blick auf seine Finger. »Was ist denn los, Lee? Kannst du dir kein richtiges Essen leisten und musst stattdessen deine Finger essen?«
Er entzog mir seine Hand und steckte sie in die Tasche. Er schämte sich für seine kindische Angewohnheit. »Ja, ich weiß.« Er murmelte öfter vor sich hin, was im Zusammenspiel mit seinem heftigen britischen Akzent und ungewöhnlichen Vokabular manchmal für eine interessante Kommunikation sorgte. »Wie geht’s dir, Kumpel?«
»Gut, und selbst?«
»Jepp.« Er lächelte nervös, stieß die Worte zwischen den Zähnen hervor. »Nur ziemlich kalt.«
»Dann wollen wir mal.« Ich sah auf die Uhr. »Noch ’ne halbe Stunde, dann kommen die ersten.«
»Ich muss unter die Dusche.« Er schnupperte an seiner Achselhöhle und verzog das Gesicht. »Ich stinke erbärmlich.«
Ich kratzte mich an meinen Bartstoppeln. »Und ich muss mich rasieren. Also los.«
Das Strong Box befand sich im Keller von zwei Ladenlokalen. In dem einen befand sich ein Geschäft für Outdoor-Klamotten, in dem anderen ein Laden für Anglerbedarf. In das Fitness-Studio gelangte man über eine Metalltreppe und ein winziges Foyer, in das ständig von draußen Müll hereinwehte. Unsere erste Aufgabe war immer, den Dreck der Nacht zu beseitigen.
»Ich kümmere mich drum«, sagte ich und öffnete die Tür; da ich schon länger dort arbeitete, waren die Schlüssel mir anvertraut. »Stell du schon mal das Wasser an.«
»Danke, Kumpel. Ich schulde dir was.«
Ja, und mir fallen auf Anhieb tausend Wege ein, um deine Schulden zu begleichen, dachte ich, als ich zusah, wie sein Arsch in der Dunkelheit verschwand. Ich scharrte den Müll mit den Füßen zu einem Haufen zusammen und warf ihn in die Tonne – hoffentlich war nichts Scharfkantiges dabei. Es handelte sich um den üblichen Kram: Burger-Schachteln, Zigarettenkippen, Dosen. Ich musste mir die Hände waschen.
Als ich hereinkam, hörte ich schon die Duschen laufen; braver Junge, hat seine Aufgabe erfüllt. Morgens dauerte es fünf Minuten, bis das Wasser eine erträgliche Temperatur erreicht hatte. Der Boiler machte ständig Probleme, was angefressene Mitglieder und müffelnde Mitarbeiter zur Folge hatte. Das Strong Box war nicht gerade ein Studio der Spitzenklasse.
»Lee?« Ich verstaute meinen Seesack in einem Schließfach. »Wo bist du?«
»Ich sitze auf dem Scheißhaus.« Mit seinem britischen Akzent klang selbst so eine Aussage irgendwie drollig.
Ich zog mein Shirt aus. Der billige Stoff knisterte, als ich ihn über den Kopf zog, und die Haare auf meiner Brust und meinem Bauch (davon gibt es eine Menge) standen ab.
»Verflucht noch mal, du siehst ja aus wie Bigfoot.«
Ich lachte, knurrte und zeigte ihm die Zähne. »Das hält mich im Winter warm.«
»Bei mir sieht das ganz anders aus.« Er zog seinen Pulli hoch und offenbarte einen so glatten wie flachen Bauch. »Wie ein Babypopo.«
»Du bist ja noch jung. Außerdem rasierst du bestimmt alles ab, wie alle jungen Männer heute.«
Er zuckte die Achseln. »Ja, ein bisschen.« Er rieb sich wieder den Kopf. »Mit einem Trimmer. Diese Salons kann ich mir nicht leisten.«
Ich zog die Hose aus. »Trimmer nützen bei mir nicht viel.« Lee betrachtete meine behaarten Beine, und er zog die Augenbrauen hoch, was seine Stirn in Furchen legte – genau der Gesichtsausdruck, den männliche Models und Popsänger immer auf Fotos bemühen.
»Du siehst aus wie unser Hund daheim.«
»Wuff«, sagte ich und fragte mich, was er wohl zu meinem Arsch sagen würde. Der sieht aus, als würde ich eine Unterhose aus Haaren tragen.
»Er fehlt mir so«, sagte er völlig aufrichtig. »So ein lieber alter Hund.« Fast dachte ich, ich könnte Tränen in seinen Augen sehen, doch dann zog er sein Shirt über den Kopf. Lees Haut war von der sehr blassen und glatten Art, die mich immer an die Marmorstatuen erinnert, die in den hochrangigen militärischen Einrichtungen herumstehen. Außer dem Tattoo, der Rose, die so breit war wie meine Handfläche, war er makellos. Große, rosafarbene Brustwarzen, die Muskeln ausreichend definiert, um ihn männlich wirken zu lassen, aber nicht so aufgeplustert wie bei manchen Freaks, die wie anatomische Studienmodelle aussehen. Ich leckte mir die Lippen und merkte, wie mein Schwanz sich regte; der war seit dem Aufstehen eh noch nicht komplett schlaff gewesen, selbst beim Müllsammeln nicht. Lee knöpfte seine Jeans auf und streifte sie über die Schenkel; darunter war nichts außer jungem Fleisch. Er setzte sich hin, um die Schuhe auszuziehen, und sah mich an.
»Was hast du denn am Wochenende so getrieben, Dan?«
»Meine Eltern besucht«, sagte ich. In bedrücktem Schweigen vor einem Abendessen gesessen, das niemand essen wollte. Die Regenrinnen gereinigt. Holz fürs Winter gehackt. Danach zu Hause allein Bier getrunken. »Und du?«
»Nix.« Er sah auf die Schuhe, weil er einen Knoten lösen musste. »Ausgehen kann ich mir nicht leisten.«
»Komm schon. Ein Typ in deinem Alter sollte sich doch amüsieren.«
»Ich kenne niemanden.«
»Was ist denn mit deinen Kommilitonen?«
»Die fahren in ihren Karren durch die Gegend. Sie fragen nie, ob ich mitwill.«
»Ich sag dir was, Lee.« Ich zog die Unterhose aus und war mir durchaus der Tatsache bewusst, dass mein Schwanz fast auf Halbmast war. »Nächstes Wochenende lädt Onkel Dan dich auf einen Burger und ein Bier ein.«
»Echt jetzt?«
»Klaro. Und jetzt los, wir müssen sauber sein, wenn die Kunden kommen.« Ich konnte nicht mehr da stehen und ihn ansehen, sonst würde ihm gleich was ins Auge stechen.
»Scheißteile«, sagte er und trat die Schuhe von sich, die Senkel immer noch verknotet. Er trottete mir nach unter die Dusche, wo der Dampf die Luft erfüllte.
Das Strong Box ist zum Glück eines der wenigen Fitness-Studios, die noch keine abgeschirmten Duschkabinen eingebaut haben. Es gibt bloß eine Wand mit fünf Brausen und ein Gully für das Seifenwasser. Keine Sauna, kein Dampfraum, nur fließendes Wasser und ein paar Haken für die Handtücher. Vor allem keine Hindernisse, die einen Blick auf die Mitduschenden versperren.
Wir ließen, wie es bei zwei Männern in einem solchen Duschraum üblich ist, einen Platz zwischen uns frei: nahe genug, um noch freundlich zu wirken, weit genug weg, um Intimität zu vermeiden. Einen Moment lang wandten wir uns beide zur Wand, hielten die Köpfe unter den Strahl, rieben uns die Gesichter, doch als wir uns einseiften, wandten wir uns wieder einander zu. Mittlerweile stand ich definitiv auf Halbmast; mein Schwanz hob sich in einem Winkel von 45 Grad vom Körper ab, und das Wasser strömte von der Spitze in alle Richtungen. Ich seifte mir Achselhöhlen, Brust und Bauch ein. Lees Haare klebten an seinem Schädel, sein Körper war mit einem Film aus weißen Bläschen bedeckt. Über seinem Schwanz befand sich ein schmaler Haarstreifen, fast bis auf ein Nichts getrimmt; davon abgesehen war er unbehaart. Sein Schwanz, den ich zum ersten Mal sah, war lang und unbeschnitten und, sollte ich mich nicht täuschen, regte sich gerade.
»Wohnst du schon lange hier, Dan?« Er wischte sich Seife aus den Augen.
»Mit Unterbrechungen mein ganzes Leben.«
»Wolltest du nie reisen?«
Ich lachte und wusch mir den Arsch. Ich gab mir dabei keine Mühe, meinen Schwanz zu bedecken. »Ach, ich war schon hier und dort.« Afghanistan, Irak, Bosnien – die ganzen angesagten touristischen Hotspots eben.
»Ich wollte schon immer reisen«, sagte er, »ein bisschen was von der Welt sehen und interessante Leute kennenlernen.«
»Ja, davon gibt’s eine Menge.«
»Deswegen bin ich auch in die USA gekommen.«
»Mmh.« Ich merkte, wie er mir verstohlen zwischen die Beine schaute. Er wollte ein bisschen was von der Welt sehen? Ich würde ihm die Welt schon zeigen. »Und entspricht unser Land deinen Erwartungen?«
Er lachte. »Na, Lowell ist nicht gerade Las Vegas.« Er rieb sich über den glitschig-nassen Bauch. »Ist aber schon okay. Mir gefällt’s hier.«
»Mir auch.« Ich legte die Hände ins Kreuz und schob die Hüften ein Stück weit vor. Mein Schwanz baumelte von einer Seite auf die andere. Lee betrachtete ihn wie ein Mungo eine Kobra. Vermutlich fehlte ihm seine Freundin in England ebenso sehr wie sein Hund. »Solange man Freunde hat.«
Er sah mir in die Augen. »Ist das denn okay?«
»Ich hab die Schlüssel. Und wir haben noch zwanzig Minuten Zeit, bis wir aufmachen.«
»Zwanzig Minuten.«
»Genau.«
Er kam über den Kachelboden unter meine Brause. »Ich bin aber nicht … du weißt schon … schwul.«
»Schon klar.« Ich schnappte mir seinen Schwanz. »Ich ja auch nicht.« Er keuchte, als ich ihn zu wichsen anfing, und knickte fast an den Knien ein. »Ich ficke einfach nur gern mit Kerlen.« Sein Schwanz stand nun wie eine Eins; das hatte gerade mal zwanzig Sekunden gedauert. Ach, die Freuden der Jugend. »Fickst du auch gern mit Kerlen, Lee?«
»Ich … ich weiß nicht …«
»Oder tut man so was nicht auf eurer Insel?«
Er öffnete die Augen und runzelte die Stirn. »Was?«
»Egal. Komm einfach her.« Seine Hände hingen schlaff an seinen Seiten herunter; ich nahm eine und legte sie auf meinen Schwanz. »Dann lernst du es halt.«
Er wirkte erst nicht sonderlich glücklich darüber, einen Schwanz in der Hand zu haben; er zog sogar einen Flunsch. Allerdings nahm er die Hand auch nicht wieder weg. Wir wichsten uns eine Zeit lang gegenseitig, wir waren eingeseift, und Wasser strömte über unsere Leiber. Zeit, ihn zu ficken, blieb keine – das Gefummel mit den Gummis setzte voraus, dass man für einen Quickie wenigstens eine halbe Stunde hatte –, aber ich wollte seinen Arsch als mein zukünftiges Revier markieren. Jody war weit weg, und es erschien mir sinnvoll, einen regelmäßigen Fuckbuddy zu haben, einen, der sich nicht gleich in mich verlieben und auch nicht ewig hierbleiben würde. Ich zog Lee näher an mich, sodass unsere Schwänze sich berührten. Ich packte seine rechte Hinterbacke. Sie war fest und prall. Lee schien das Gefühl von zwei harten, glitschigen Schwänzen, die sich im Zweikampf übten, so zu genießen, dass er sich nicht über meinen Übergriff auf vermutlich jungfräuliches Gebiet beschwerte. Es gibt Typen, die gleich aufschreien, wenn man ihren Arsch auch nur anschaut. Er nicht. Er nahm beide Schwänze in eine Hand, drückte sie zusammen, rollte sie herum.
»Meiner ist größer als deiner«, sagte er lächelnd.
»Kann schon sein.«
»Willst du mir einen blasen?«
»Klar.« Soll er nur meinen, dass er das Heft in der Hand hat. Es gibt so vieles, von dem er noch nichts weiß, aber das wird sich bald ändern. Ich ging in die Hocke, bildete mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis um seine Eier und fing an, ihm den Schwanz zu lutschen. Er schäumte mir sanft den Kopf ein, und sobald ich mit den Lippen am Ende angekommen war, fickte er mich in den Mund. Ich merkte an der Härte des Schafts und der Straffheit der Hoden, dass es nicht lange dauern würde – Zeit also, ihm die erste Lektion beizubringen. Mein Zeigefinger fand sein Arschloch und drang ein.
»Scheiße.«
Es war genug Seife überall, um das Eindringen zu erleichtern. Ich schob den Finger bis zum ersten Knöchel rein.
»Verdammt.«
Ich sah auf und fragte mich, ob dieses ›Verdammt‹ nun etwas Gutes oder Schlechtes heißen sollte. Sein Mund stand offen, und eine dicke Ader zeichnete sich auf seiner Stirn ab. Also hieß es wohl etwas Gutes.
Ich drang tiefer ein, während ich ihn weiter blies und er mir mit seinen großen weißen Händen eine Art Kopfmassage verpasste. Und schon hatte ich sie gefunden: die Prostata. Ich zog mit der Fingerspitze einen Kreis um sie, um ihn merken zu lassen, was ich gerade entdeckt hatte, dann drückte ich.
»Großer Gott, Dan … Himmel …«
Jetzt kam er, fickte mich hart in den Mund, drückte mich fest an sich. Ich zog seinen Sack straff, während sein Samen in meinen Rachen strömte.
Als er fertig war, zog ich langsam den Finger aus seinem Arsch und ließ seinen Schwanz los. Meine Schenkel verkrampften sich ein wenig, und ich stand auf. Lee wirkte wie vom Donner gerührt, wie er da gegen die Kachelwand gelehnt stand.
»Was war das denn?«
»Hat’s dir gefallen?«
»Ja, aber …«
»Nichts aber. Du legst dich jetzt auf den Boden, mein Hübscher, und lässt mich dich anschauen.«
Er tat, wie ihm geheißen – eine Eigenschaft, die ich sehr zu schätzen weiß –, und ich stellte mich mit den Füßen neben seinen Hüften auf. Wasser plätscherte ihm auf Brust und Gesicht, aber er wischte sich die Augen und sah mir zu.
Ich nahm meinen Schwanz in die Hand und wichste mich, wobei ich jeden Zoll seines wunderschönen nassen Leibes in mich aufnahm. Der breite Nacken, die definierten Schultern, die tiefen Gruben, die von der Hüfte zur Leiste verliefen, und diese rote Rose, die auf seiner Brust blühte. Er spielte an sich selbst herum, packte seine Schwanzwurzel zwischen zwei Fingern und peitschte den Schwanz hin und her; hätten wir mehr Zeit, könnte ich ihn noch mal zum Höhepunkt bringen. Er verschränkte den Arm hinter seinem Kopf und spannte dabei die Bauchmuskeln an.
»Ich hab so was noch nie gemacht«, sagte er, »aber geht schon in Ordnung.«
Mehr musste ich nicht hören. Mein Schwanz zuckte in meiner Hand und bespritzte Lee vom Hals bis zum Nabel mit Sperma; ein dicker Spritzer landete direkt im Herzen der Rose. Dort schimmerte er einen Moment lang, bis er vom Wasser weggespült wurde.
Schweigend trockneten wir uns ab und zogen uns unsere Arbeitskleidung aus Nylon an. Wir räumten die Umkleide auf, damit alles ordentlich aussah. Dann sah ich auf die Uhr: punkt sechs.
»Zeit, die Meute reinzulassen, Lee. Bist du so weit?«
Er nickte, sagte aber nichts. Scheiße, dachte ich, jetzt muss ich den ganzen Arbeitstag über einen verwirrt schmollenden Kollegen ertragen. Doch dann, als ich gerade die Vordertür aufschließen wollte, drückte er sich von hinten an mich. »Hast du das mit dem Wochenende eigentlich ernst gemeint, Dan? Also das mit dem Ausgehen und so?«
»Vielleicht.«
Er wirkte geknickt. »Ach so, nur vielleicht.«
»Wenn du mich küsst.«
Er lächelte. »Na, los dann.« Er packte mich im Nacken, öffnete den Mund und küsste mich. Dabei drückte er mich gegen die Tür und rieb seine Hüften an mir. Er hatte wieder einen stehen.
»Ab hinter den Schalter, Lee, und komm bloß nicht dahinter hervor, bis der hier wieder verschwunden ist.«
Er beugte sich über den Empfangsschalter und begrüßte die Frühankömmlinge mit einem besonders warmen Lächeln.
02
Ich war zu meiner Zeit in ein paar Hotels der Luxusklasse gewesen; Lagebesprechungen und Pressetermine in Kriegsgebieten finden oft in überraschend noblen Schuppen statt. Ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Ich bin zwar in Zivil unterwegs, aber ich sehe auch nicht aus wie ein Penner. Ich werde nicht rausgeschmissen.
»Ich würde gern Alan Benson sprechen.«
»Ja, Sir. Einen Moment, bitte.« Die Dame am Empfang war eine hübsche Blondine mit perfekt gepflegten scharlachroten Nägeln und guter Haut. Sie tippte auf einem Bildschirm herum. »Zimmer 249. Wen darf ich melden …«
»Dan!« Eine dröhnende Stimme schallte durch das Foyer, und ein Umriss erhob sich aus den Tiefen eines riesigen, weichen Sessels. »Schon gut, Süße, ich bin schon hier.«
Zwei starke Arme umfassten mich und drückten fest zu. Ich roch Seife und Mundwasser, spürte eine glatte Wange an meiner. Ich hatte auch für mein Erscheinungsbild gesorgt. Ehemalige Soldaten wollen nicht so aussehen, als seien sie auf den Hund gekommen – eine Frage des Stolzes.
»Lass dich mal anschauen.« Al trat zurück, hielt aber meine Schultern weiter umfasst. Er hatte immer noch dasselbe Lächeln, strahlend und selbstbewusst. Er trug ein gutgeschnittenes Sportjackett aus Tweed, ein oben offenes Hemd, aus dessen Kragen ein paar Büschel roter Brusthaare lugten, und teuer wirkende Halbschuhe. Seine blauen Augen funkelten trotz der umgebenden Fältchen so wie früher. »Mein Gott, Dan, gut siehst du aus – keinen Tag älter geworden.«
Ich nickte. »Immer noch Haarausfall.«
»Immer noch toll in Form.« Er schlug sich auf den eigenen Bauch, wo sich ein kleiner Hügel abzeichnete. »Ich bin fett geworden.«
»Wohl kaum.«
»Und sieh mal hier.« Er beugte sich vor, um mir eine kahle Stelle auf dem Kopf zu zeigen. »Ich hole langsam auf.«
»Die Zeit vergeht, Al.«
»Jepp. Wie lange ist es jetzt her?« Er sah hoch zur Decke. »15 – nein, mehr, 17 Jahre?«
Ich konnte mich wirklich nicht mehr genau erinnern. Wir hatten zusammen in irgendeinem riesigen Schlamassel gedient, aber ich wusste nicht mehr, welcher das war. »Wenn du das sagst.«
Er sah mir in die Augen und runzelte die Stirn. »Hast du’s etwa vergessen?«
»Ich glaube schon.«
»Viele wollen einfach nur vergessen.«
»Hey, ich bin keine gescheiterte Existenz.«
»Natürlich nicht.« Wieder das Lächeln, die weiß schimmernden Zähne, eine Hand in meinem Nacken. »Lass uns losziehen. Ich habe einen Tisch für uns reserviert. Ich hoffe, das macht dir nichts aus.«
»Bin ich denn passend angezogen?« Ich trug die Klamotten aus meinem Schrank, die man noch am ehesten als elegant bezeichnen konnte: einen Blazer und Anzughosen.
»Du siehst toll aus, Dan, einfach toll.«
Er steuerte mich mit fester Hand aus dem Foyer auf die Straße.
Das Restaurant war so ein Teil, in dem ich mich mein Lebtag nicht wohlfühlen werde: pastellfarbene Wände, Tischdecken aus Leinen, Blumen in winzigen Vasen, Kellner, die die Gäste umschwirren wie die Fliegen. Okay, ich esse nicht mit den Fingern und nage auch keine Knochen ab. Ich kneife die Kellner nicht in den Hintern. Aber ich kann sehr gut auf das Getue mit dem jus de dies und der crème de das verzichten, ebenso auf die ständigen Zwischenfragen: »Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, meine Herren?« Ja. Und jetzt zieh Leine und lass mich essen.
Doch schließlich lud Benson ein, und wenn er mir unbedingt vorführen wollte, wie viel Geld er hatte, schön. Die erste halbe Stunde über holte er kaum Luft. »Ich hätte nichts Besseres machen können, als die Marines zu verlassen. Du lieber Gott, Dan, stell dir nur mal vor, wie wir in unserem Alter noch Befehle vom beschissenen Pentagon annehmen! Ich hatte die Schnauze voll. Sie schnappen dich, wenn du jung bist, und unterziehen dich ihrer Gehirnwäsche. Aber ich wollte mehr vom Leben. Ich wollte all das, wofür wir immer kämpfen mussten, und irgendwann dachte ich mir, nach all den Kämpfen habe ich mir diese Dinge auch verdient. Ich weiß, ich weiß, ich habe Glück gehabt. Ich habe eine tolle Frau und zwei fantastische Kinder.« Er öffnete seine Brieftasche und zeigte mir die Fotos: Mr. und Mrs. Benson und ihre beiden perfekten amerikanischen Kinder, ein Junge und ein Mädchen, wie sie ein perfektes Thanksgiving feiern und einen perfekten Skiurlaub verbringen. »Mein Gott, sie werden so schnell groß. Al Junior ist schon zwölf. Zwölf! Und Jeleen ist zehn. Sieh sie dir mal an, das wird mal eine richtige Schönheit.«
Ja, dachte ich, sobald sie die Zahnspange und die Brille los wird und ungefähr zehn Kilo Babyspeck verliert.
»Ich hab noch mehr auf dem Handy.« Er griff in die Jackettasche und sah womöglich, wie ich leicht das Gesicht verzog. »Aber das können wir uns ja auch für später aufheben.«
Dies war der Moment, wo ich die Frage erwartete: »Und du, Dan? Was hast du aus deinem Leben gemacht?« Doch nein, er machte einfach weiter, konnte den Redefluss nicht mehr stoppen.
»Das hier muss ich dir noch zeigen.« Noch ein Foto aus der Brieftasche, dieses Mal von, ja, einem Haus. »Wir sind erst vor Kurzem in dieses Traumhaus in South Fayette eingezogen, ganz in der Nähe von Pittsburgh. Das Bild habe ich am Tag des Einzugs gemacht. Ich muss es immer bei mir tragen, weil ich sonst nicht glauben kann, dass wir das Haus auch gekriegt haben.«
»Sehr hübsch.«
»Du solltest uns mal besuchen kommen. Wir haben ’ne Menge Platz für Gäste. Du könntest quasi deinen eigenen Flügel haben!«
»Toll.« Ich teile mir meine Bleibe mit Ungeziefer. Für die ist auch ’ne Menge Platz.
»Ich dachte mir, wenn wir schon umziehen, dann kann ich auch gleich das Haus kaufen, das uns gefällt, oder? Das ist ein richtiges Familienhaus. Wir können dort für alle Zeiten bleiben. Zumindest bis ich in Rente gehe – und das ist ja noch ein bisschen hin, was? Auch wenn ich älter bin als du.«
Der Kellner nahm unsere Bestellung entgegen, was eine Viertelstunde komplizierter Diskussionen bedeutete: wie soll das Fleisch geschnitten, wie zubereitet sein, welcher Wein passt dazu. Ich fragte mich schon, ob ich nicht ein Zwölffingerdarmgeschwür vortäuschen und auf die Toilette flüchten sollte.
»Aber zum Teufel damit«, fuhr Al fort, sobald der Kellner endlich weg war, »ich arbeite schwer für mein Geld, also kann ich mir auch was gönnen. Die Leute meinen, weil ich an einer Uni arbeite, hätte ich jedes Jahr sechs Monate frei. So ein Quatsch! Ich habe zwei Wochen Urlaub, das ist alles, und ich verbringe jede Minute davon mit meinen Kindern. Jede Minute!«
Er schlug auf den Tisch, als wolle ihm jemand widersprechen.
»Aber wem will ich was vormachen? Ich liebe meinen Job. Sonst würde ich ihn nicht machen. Bei den Marines hab ich schon genug Dinge gemacht, die ich furchtbar fand. Ich muss aber auch dankbar sein, ich bin auf Kosten von Uncle Sam zum Software-Experten ausgebildet worden, und das habe ich voll ausgenutzt. Hier.« Er nahm eine Visitenkarte heraus. »Behalt sie, vielleicht brauchst du sie ja mal.«
Alan BensonLeiter der Abteilung für Software-EntwicklungUniversity of Pittsburgh Medical Center
»Super«, sagte ich und steckte die Karte ein.
»Die Bezahlung ist gut, zugegeben, aber wenn die Schulgebühren und vor allem die verfluchte Hypothek erst mal ab sind, bleibt nicht mehr viel übrig. Ich meine, wir haben Glück gehabt. Brendas Vater starb vor ein paar Jahren und hinterließ ihr ein bisschen was. Sie war ein Einzelkind. Das hat uns sehr geholfen.«
Das glaube ich gern, dachte ich, ich wünschte nur, ich hätte auch wohlhabende Verwandte, die in den letzten Zügen liegen.
»Ich bereue nichts. Ein paar Typen, ziemlich hohe Tiere, erklärten mich für verrückt, als ich bei den Marines ausstieg. Ich hätte die Karriereleiter steil erklimmen können, vier Sterne auf der Schulter, so Sachen. Aber das wollte ich nicht. Die können ja nicht über ihren Tellerrand hinaussehen. Ich ging, weil ich in der wirklichen Welt leben wollte, verstehst du? Ohne Rang und Beförderung und all diesen Mist. Ich hab Familie! Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Zehn Jahre ist das jetzt her, Dan! Ich sagte ihnen einfach, dass ich gehe, und dann bin ich gegangen.«
Mir wurde dieser Monolog allmählich langweilig, also sagte ich: »Ich wurde gegangen.«
Peng! Man konnte in der darauffolgenden Stille fast das Echo meiner Worte hören. Benson beschäftigte sich mit seiner Serviette, dann fuhr er fort.
»Es dauert lange, bis man sich an das Leben als Zivilist gewöhnt hat. Anfangs wusste ich kaum, wo mir der Kopf stand, aber meine Kids brachten mich schnell wieder auf den Boden zurück. Ich hatte schon die Babyjahre von Al Junior verpasst, und diesen Fehler wollte ich bei Jeleen nicht wiederholen. Ich war jeden Abend da, um sie ins Bett zu bringen. Jeden verdammten Abend.«
Und so weiter, und so fort. Ich spürte wieder, wie das Phantomgeschwür mir Schmerzen bereitete.
»Ich hatte nie Kinder.«
»O Mann …« Er rieb sich über den Kopf, um seine Haare neu zu ordnen. »Du weißt ja nicht, was dir …« Dann hielt er abrupt inne. Seine Blicke schossen durchs Restaurant auf der Suche nach einem unverfänglichen Gesprächsthema. »Wo ist denn der verdammte Kellner bloß?«
»Du weißt, warum ich rausgeworfen wurde, vermute ich?«
»Ich habe Hunger.«
»Al? Kumpel?«
Wenn er mich jetzt noch weiter ignorieren würde, würde ich aufstehen und gehen.
»Ja, ich weiß.«
»Ich hatte mich verliebt.«
Benson griff über den Tisch nach meinem Arm und drückte ihn. »Hör mal, Dan, ich hab damit kein Problem. Verstehst du? Ich bin da tolerant.« Er sah mir dabei nicht ins Auge. »Ah! Endlich, da kommt das Essen.«
Das Essen sah gut aus, also aß ich es. Dabei lauschte ich Bensons Ergüssen und sagte an den angemessenen Stellen ›Ja‹ und ›Sicher‹. Ich würde ihn die Rechnung bezahlen lassen und dann Leine ziehen.
Als wir einen Blick in die Dessertkarte warfen, nahm die Unterhaltung eine abrupte Wende.
»Hast du das mit Dick Coburn gehört?« Er sah mich geradewegs an, die Augen blauer denn je.
Der Name kam mir bekannt vor. Ein Marine, ja. Aber ich konnte ihn nicht zuordnen. »Was ist denn mit ihm?«
»Er ist tot.« Al sah wieder auf die Karte und gab vor, das Angebot zu studieren, aber ich sah, dass er rot wurde und nervös wirkte.
»Das tut mir leid.«
»Du erinnerst dich gar nicht an ihn, oder? Den hast du auch vergessen.«
»Sorry, Al. Mein Gedächtnis ist eben nicht so gut wie deines.«
»Erinnerst du dich denn gar nicht an diese besondere Geheimmission im Irak ’98?«
Natürlich doch: Das war das letzte Mal, dass ich Al Benson gesehen hatte. Er war damals Oberleutnant, ich Leutnant, und wir hatten den Auftrag, einen irakischen Überwachungsstützpunkt unschädlich zu machen – eine schmutzige Mission mit jeder Menge Schießereien und Toten. Wir standen unter dem Kommando eines besonders unangenehmen Offiziers, eines sadistischen Arschlochs namens …
»Harry Armitage«, sagte Benson. »Nach dem Namen suchst du doch.«
»Armitage, genau. Mein Gott.«
»Ich hab die letzten 17 Jahre versucht, den Typen zu vergessen. Was für ein Hurensohn.«
»Auf jeden Fall.«
»Und stell dir vor« – sein Mund verzog sich vor Ekel, als wolle er gleich ausspucken – »jetzt ist der General. Das ist der Grund, warum ich aus dem Verein rausmusste, wenn solche Scheißtypen dort nach oben kommen.«
»Egal, Al. Im Corps gab es immer eine Menge Psychopathen. Ich war selbst einer.«
»Mir ist das nicht egal, denn der Kerl bekommt immer mehr Macht.«
»Ist dem so?« Ich sah ein Glitzern in Bensons schönen Augen, das mir nicht sonderlich gefiel – es wirkte irgendwie besessen.
»Er bekommt demnächst einen Posten im Westflügel des Weißen Hauses.«
»Echt?«
»Liest du denn keine Zeitung, Dan?«
»Wenn es nicht sein muss, nein.« Auf einmal sah ich Lees nackten, weißen Leib vor mir, seinen verblüfften Gesichtsausdruck, als ich seinen Saft schluckte, das Gefühl seines jungen Körpers, der sich gegen meinen presste, als wir das Studio aufschlossen. »Ich habe Besseres zu tun.«
»Schön für dich, aber …« Benson atmete tief durch und legte die Hände auf den Tisch. »Okay, tut mir leid. Meine Frau sagt auch immer, dass ich alles viel zu ernst nehme. Möchtest du Nachtisch?«
»Nur Kaffee.«
»Ich auch.« Er winkte den Kellner herbei und bestellte.
»Also, was ist denn nun mit Dick Coburn passiert? War er noch im Dienst?«
Al schüttelte den Kopf, musterte seine Fingernägel und seufzte. »Dick hatte die Fliege gemacht.«
Das klang interessant. »Was soll das heißen, Al?«
Seine Augen schienen mich um Verständnis zu bitten. Er zögerte erst, dann fuhr er fort: »Du weißt schon. Einer von den Typen, die durch die Maschen des Netzes gefallen sind.«
»Durch welches Netz denn?«
»Dick ist ein Jahr vor mir bei den Marines ausgestiegen. Er hatte ein paar Probleme emotionaler Natur.«
Ich glaubte, eine Träne in Bensons Auge zu sehen, aber er zerdrückte sie. »Sprich weiter.«
»Er hatte so eine Art Zusammenbruch. Ging heim nach Kentucky und wohnte eine Zeit lang wieder bei seinen Eltern, aber das haute nicht hin. Er verstand sich nie besonders mit seiner Familie.«
Das kam mir bekannt vor. Ich fragte mich, wie viel Benson über meine Umstände wusste. Welche Kreise zogen solche Nachrichten?
»Irgendwann verlor ich ihn aus den Augen. Seine Mutter sagte, er sei nach Chicago gezogen – warum auch immer, er kannte dort kein Schwein. Er hätte sich bei mir melden sollen.«
»Vielleicht wollte er das nicht.«
»Natürlich wollte er …« Benson schrie fast. Der Kaffee wurde serviert, und er beruhigte sich. »Er war ein guter Kumpel. Er wusste, dass er mich um Hilfe hätte bitten können.«
»Das wollen wir aber nicht immer. Mir geht das genauso.«