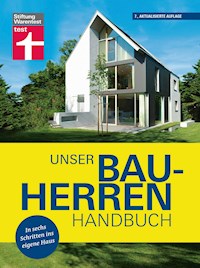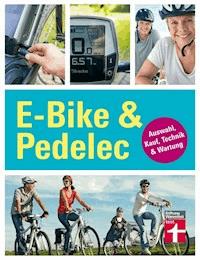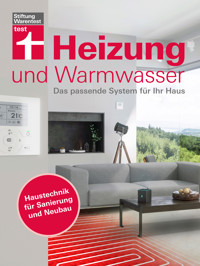
Heizung und Warmwasser - Das passende System für Ihr Haus, niedrigere Heizkosten und Klimaschutz dank energieeffizienter Planung E-Book
Karl-Gerhard Haas
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die optimale Heizung finden Sie spielen mit dem Gedanken, Ihr Heizsystem zu optimieren oder komplett zu erneuern? Dieser Ratgeber von Stiftung Warentest klärt Sie über alle gängigen Heizsysteme und Möglichkeiten der Warmwasseraufbereitung im Einfamilienhaus auf und hilft Ihnen, das für Sie passende System zu finden und dabei zu hohe Heizkosten einzusparen. Senken Sie Ihre Kosten! Dieses Buch nimmt Sie bei der Suche nach einem geeigneten Heizsystem an die Hand. Finden Sie heraus, wie Sie durch gezielte Bedarfsermittlung und effiziente Systemkomponenten Heizkosten sparen können. Auch über Fördermöglichkeiten und gesetzliche Vorgaben werden Sie in diesem Buch aufgeklärt. Außerdem können Sie Ihre Kosten mit unseren Musterrechnungen abgleichen und so weitere Sparmöglichkeiten finden. Die neue Heizung soll energieeffizient eingebaut werden? In diesem Leitfaden lernen Sie, was Sie bei Planung, Installation, Einstellung, Betrieb und Wartung beachten müssen, um so effizient wie möglich vorzugehen. Schützen Sie das Klima! Erfahren Sie alles über den Einsatz erneuerbarer Energien und die Voraussetzungen für energieeffiziente Gebäude. Auch wie Sie Ihr eigenes Haus optimieren können, wird Ihnen in diesem Ratgeber einfach erklärt. Was hat es eigentlich mit diesen Wärmepumpen auf sich? Lernen Sie die verschiedenen Arten von Wärmepumpen kennen und wie sie funktionieren. Auch über die Planung und den optimalen Einsatz von Wärmepumpen werden Sie in diesem Leitfaden aufgeklärt. In diesem Ratgeber werden Ihnen die wichtigsten Fragen rund um das Thema Heizen unkompliziert und leicht verständlich erklärt. In dem Buch erfahren Sie, wie Sie so umweltfreundlich und effizient wie möglich heizen können und dabei Heizkosten einsparen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl-Gerhard Haas, Jochen Letsch
Heizungund Warmwasser
Das passende System für Ihr Haus
Inhaltsverzeichnis
Effizient und umweltfreundlich heizen
Welche Heizung für mein Haus?
Die rechtlichen Rahmenbedingungen
Die Fördermöglichkeiten
Denken und Planen im System: Voraussetzung für Effizienz
Den Einsatz erneuerbarer Energien planen
Die Gebäudetypen
Die Dämmung: Voraussetzung für energieeffiziente Gebäude
Gebäudetechnik effizient dimensionieren und nutzen
Typische Häuser – und wie sie sich optimieren lassen
Wie kann man in Zukunft günstig heizen?
So funktionieren Heizungen
Wie heizt man klimafreundlich?
Das Wichtigste für die Planung: den Bedarf klären
Warmwasser zweckmäßig und effizient bereiten
Wärmepumpen
Wie funktionieren Wärmepumpen?
Wärmepumpenkennzahlen und ihre Bedeutung
Luftwärmepumpen
Erdwärmepumpen
Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Eisspeicher
Grundwasserwärmepumpen
Allein oder im Verbund? Hybrid-Wärmepumpen
Kühlen mit Wärmepumpen
Wärmepumpe planen
Wärmepumpe wirtschaftlich betreiben und warten
Alternativen und Ergänzungen zur Wärmepumpe
Warmwasser und Heizung mit Solarthermie
Gas- und Ölheizung
Wärmeerzeugung mit Biogas
Elektroheizung
Blockheizkraftwerke
Heizen mit Holz
Fernwärme – die effiziente Alternative?
Wichtige Auswahlfaktoren
Wärmeverteilung
Prinzipien der Wärmeübertragung
Heizung: Bestandsaufnahme
Warmluft oder -wasser als Medium?
Heizkörper
Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen
Luftheizung
Kühlen mit der Heizung – und umgekehrt
Kamine und Kaminöfen
Der richtige Rauchabzug
Heizungssteuerung und Smart Home
Regelung des Wärmeerzeugers
Regelung der Heizkörper
Smart-Home-Systeme
Das Haus für die Intelligenz vorbereiten
Wahl des richtigen Smart-Home-Systems
Die Heizung per Smart Home steuern?
Service
Bedarfsberechnungen für die Beispielgebäude
So teuer wird Ihr Warmwasser
Wann lohnt sich eine Hybridheizung?
Die Kosten verschiedener Wärmepumpentypen im Vergleich
Luft-Wasser-Wärmepumpen im Test
Smart-Home-Systeme im Überblick
Stichwortverzeichnis
Effizient und umweltfreundlich heizen
Welche Heizung für mein Haus?
Die rechtlichen Rahmenbedingungen
Die Fördermöglichkeiten
Denken und Planen im System: Voraussetzung für Effizienz
Den Einsatz erneuerbarer Energien planen
Die Gebäudetypen
Die Dämmung: Voraussetzung für energieeffiziente Gebäude
Gebäudetechnik effizient dimensionieren und nutzen
Typische Häuser – und wie sie sich optimieren lassen
Welche Heizung für mein Haus?
Bauherren wie Gebäudeeigentümerinnen müssen handeln. Niemand will im Kalten sitzen – aber die Wahl der richtigen Heizung wird immer komplexer. Zusätzlich macht die Politik Druck.
Nach politischem und medialem Getöse beschloss die Bundesregierung im September 2023 die Eckdaten des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Unmittelbar wirkt es sich auf Neubauten aus, sukzessive aber auch auf Bestandsbauten. Bauherren und Immobilieneigentümerinnen müssen also handeln.
Im Neubau ist dies relativ leicht: Hier deckt sich das wirtschaftliche Interesse der Hausbauer mit dem Willen des Gesetzgebers, möglichst energieeffiziente Gebäude zu errichten. Denn: Die billigste Heizenergie ist die, die man nicht braucht. Wesentlich komplizierter ist es, Bestandsgebäude heizungs- und dämmungstechnisch möglichst effizient zu sanieren.
Im Neu- und noch mehr im Bestandsbau führen viele Wege zum Ziel – die eine, für alle Situationen passende Lösung gibt es leider nicht. Viele Details hängen vom Standort, dessen Geologie und den dort herrschenden Temperaturen ab, dazu kommen die Gebäudeart, die persönlichen Wünsche und finanziellen Möglichkeiten sowie beim Bestand selbstverständlich die vorhandene Bausubstanz.
Unser Buch zeigt, wie man den neuen rechtlichen Vorschriften zur Heizung im Neubau und in bestehenden Gebäuden gerecht wird. Wir erklären, in welchen Fällen ein Heizungstausch erforderlich ist, wann er sinnvoll sein könnte und welches System für welche Bedürfnisse am besten geeignet ist. Dazu diskutieren und beschreiben wir im Detail die verschiedenen Technologien und ihre Kombinationsmöglichkeiten.
Die gute Nachricht: Die Energie liegt in vielen Fällen zwar nicht auf der Straße, aber oft in der Luft oder im Erdreich. Und sie ist kostenlos und unbegrenzt verfügbar – was für fossile Energien nicht gilt.
Zudem sind im Neubau nach der aktuellen Fassung des GEG reine Gas- oder Ölheizungen nicht mehr erlaubt. Hier wird man in vielen Fällen auf Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser setzen. Diese Geräte sind energetisch kleine Wunderwerke, denn aus einer Kilowattstunde (kWh) elektrischer Energie erzeugen sie drei oder mehr kWh Wärme. Alternativlos sind Wärmepumpen aber nicht – es gibt tatsächlich Konstellationen, in denen es wirtschaftlicher ist, direkt mit Strom zu heizen und warmes Wasser zu bereiten.
Besitzern und Besitzerinnen von Bestandsbauten lässt das GEG mehr Zeit – sie können die verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten über Jahre strecken. Wenn sie mit einem Energieberater einen Sanierungsplan erarbeiten, werden fast alle Maßnahmen gefördert.
Wichtig bei der Betrachtung technischer Möglichkeiten und ihrer Vor- und Nachteile ist, diese nicht isoliert zu sehen, sondern als System – jede mögliche Komponente der Haustechnik steht mit anderen in Wechselwirkung. Achtet man hingegen nicht auf das Zusammenspiel der einzelnen Gewerke, kann prinzipiell nützliche Gebäudetechnik kontraproduktiv werden. Diese Abhängigkeiten zu berücksichtigen stellt nicht nur für Handwerker und Energieberaterinnen eine Herausforderung dar – auch Bauherren selbst sollten sich so weit in die Materie einarbeiten, dass sie Dienstleistern in der Planungsphase die richtigen Fragen stellen können.
Denn im 21. Jahrhundert sind die Anforderungen an eine zeitgemäße Heizung sehr umfassend. Neben der eigentlichen Wärmeerzeugung sind folgende Punkte wichtig:
Heizung mit all ihren Unteraspekten, also Warmwasser, Lüftung, Klimatisierung
Nicht immer und überall – aber so wie an diesem Haus wird in Zukunft wohl oft in Deutschland eine Wärmepumpe heizen und warmes Wasser bereiten. Alternativlos ist die Technik aber nicht – Hausbauer und -besitzer müssen individuell entscheiden, welche Lösung die wirtschaftlichste ist.
Gebäudedämmung
zusätzliche Effizienz durch Smart-Home-Technik
Energiegewinnung durch Solarthermie und/oder Photovoltaik, Erdwärme und aus anderen Quellen.
Der letzte Aspekt wird in Zukunft immer wichtiger, denn die CO2-Emissionen des Gebäudesektors sollen sinken. Noch 2018 verursachte allein Deutschland einen CO2-Ausstoß von 120 Mio. Tonnen pro Jahr (t/a). Um die Klimaziele der Europäischen Union bis 2030 zu erreichen, muss er auf 72 Mio. Tonnen pro Jahr sinken.
Kein „Weiter so“
Mit vielen existierenden Gebäuden und deren Technik ist dies nicht zu realisieren. Solche Häuser müssen also renoviert und nachgerüstet werden, neue gleich so gebaut, dass sie möglichst wenig externe Energie benötigen und wenig zum CO2-Ausstoß beitragen. Dies ist nicht nur im Interesse der Allgemeinheit wünschenswert, sondern auch für jeden künftigen oder aktuellen Besitzer einer Immobilie.
Die lange preistreibende EEG-Umlage auf den Strompreis ist weggefallen; mit dem steigenden Angebot von Strom aus erneuerbaren Energien und den günstiger werdenden Möglichkeiten privater Stromerzeugung wird Elektrizität als Energieträger attraktiver. Aktuell ist es schon wirtschaftlicher und sinnvoller, Gebäude mit strombetriebenen Wärmepumpen statt fossiler Energie zu beheizen beziehungsweise auf fossile Energie nur noch zurückzugreifen, wenn die Leistung der Wärmepumpe allein nicht ausreicht. Ein weitgehender Verzicht auf fossile Brennstoffe ist nicht nur politisch gewünscht, sondern in puncto Erderwärmung im Interesse jedes Einzelnen.
Nachhaltigkeit hat viele Facetten
Nicht nur übers Heizen werden sich angehende Bauherrinnen und Bauherren Gedanken machen müssen. Angesichts immer längerer Hitzeperioden wird die Klimatisierung immer relevanter. Auch die CO2-Bilanz des gesamten Gebäudes wird stetig wichtiger. So spielt für die Nachhaltigkeit eines Hauses auch die Menge an CO2-Emissionen eine Rolle, die Herstellung, Einbau und später Entsorgung der Baumaterialien verursachen. Diese Aspekte werden unter dem Oberbegriff „graue Energie“ zusammengefasst.
Zudem steht bei allen Wünschen nach Effizienz und ressourcenschonender Technik immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vordergrund. Die beste Technik nützt nichts, wenn man sie sich nicht leisten kann oder sie sich schlicht nicht rechnet. Auch die Folgekosten sind zu berücksichtigen: Komplexe Regeltechnik etwa kann nach einigen Jahren ausfallen und benötigt ihrerseits Strom.
Es ist also immer sinnvoll, sich in der Planung die Frage zu stellen, was für ein effizientes Gebäude wirklich wichtig ist – und was nur nette Spielerei. Diese Entscheidung muss jeder nach einem gründlichen Blick auf die eigene Situation treffen: Halten sich Kinder oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen ständig im Haus auf, sollte die Gebäudetechnik darauf abgestimmt sein – wohnen dort nur gesunde Erwachsene, kann man auf manches Komfortdetail hingegen gut verzichten.
Bedarfsgerechte Haustechnik
Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit stehen immer im Widerstreit mit den Ansprüchen ans Wohnklima und die Benutzbarkeit des Gebäudes. Die effizienteste Heizung und Warmwasserbereitung machen wenig Spaß, wenn erst nach Minuten tatsächlich warmes Wasser fließt oder es Stunden dauert, bis im Haus wohlige Temperaturen herrschen.
Die Haustechnik soll zudem zuverlässig funktionieren, einmal eingerichtet, möglichst wenig Bedienung und Aufmerksamkeit erfordern – und die unvermeidliche Interaktion mit Heizung und Energieversorgung sollte verständlich und intuitiv sein.
Intelligente Kompromisse zu entwickeln und realisieren war schon immer die Quintessenz jeder Bauplanung. Dies kann aber nur gelingen, wenn man als Bauherrin oder Bauherr die Ausstattungsmöglichkeiten und -varianten kennt und überblickt. Unser Buch will exakt dieses Wissen vermitteln und potenziellen Hauseigentümern helfen, die für sie passende Entscheidung zu treffen.
Ein Schlüsselelement für diesen ganzheitlichen Ansatz ist das Intelligente Haus, neudeutsch oft Smart Home genannt. Moderne Kontroll- und Steuerungstechnik kann Ihnen helfen, die Übersicht über die komplexen und vielfältigen technischen Einrichtungen zu behalten. Die verfügbare Smart-Home-Technik illustriert zugleich beispielhaft die Komplexität moderner Systeme. Nur wer genauer nachfasst, überblickt, was die einzelnen Systeme tatsächlich leisten – und was nicht.
Beispiele zur passenden Lösung
In diesem Buch schildern wir, welche rechtlichen, finanziellen und praktischen Rahmenbedingungen Bauherren und Bauherrinnen bei der Planung und Nutzung eines Gebäudes im Blick haben sollten, welche Vor- und Nachteile sich aus Entscheidungen für oder gegen bestimmte Verfahren oder Technologien ergeben. Wir illustrieren dies ab Seite 34 an verschiedenen, im Alltag häufig anzutreffenden Konstellationen – Sanierungen eines freistehenden Hauses aus der Zeit von etwa 1930 bis etwa 1980, eines Reihenhauses aus der Mitte der 1990er, eines denkmalgeschützten Altbaus sowie dem Neubau eines Einfamilienhauses. Für diese vier Fallbeispiele schildern wir präzise, unter welchen Bau- und Ausstattungsvarianten Bauherren heutzutage wählen können – und was diese kosten.
In Neubaugebieten können Gemeinden vielfältige Vorschriften machen, die Bauherrinnen in spe in ihrer Planungshoheit und Entscheidungsfreiheit massiv einschränken, die Idee vom individuellen Traumhaus unter Umständen also schnell zunichtemachen. Umgekehrt bietet ein existierendes, unter Bestandsschutz fallendes Haus oft ungeahnte Sanierungs- und Ausbaumöglichkeiten – man muss sie nur kennen.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen
Wer ein Haus neu baut oder saniert, muss neben allgemeinen örtlichen Bauvorschriften mit Blick auf die Gebäudetechnik eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen beachten.
Im Oktober 2023 stellt sich für Neubauten die Rechtslage im Gebäudeenergiegesetz (GEG) wie folgt dar:
In Neubaugebieten ist es ab 2024 nur noch erlaubt, Heizungen zu installieren, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gilt dies erst ab 2026. In der Praxis bedeutet dies wohl meist eine Wärmepumpe (siehe ab Seite 72) oder eine dezentrale Stromheizung bei extrem gut wärmegedämmten Gebäuden (siehe „Elektroheizung“, Seite 143). Neben Strom zählen auch „grüner“ Wasserstoff aus PV-, Wind- oder Wasserkraftstrom (siehe ab Seite 143), Solarthermie (siehe ab Seite 124) sowie Holz (meist Pellets, – freilich nur aus nachhaltiger Produktion, siehe ab Seite 150) zu den erneuerbaren Energien.
In Bestandsgebäuden dürfen weiterhin Gasheizungen installiert werden, sofern diese sich auch mit Wasserstoff betreiben lassen. Außerhalb von Neubaugebieten ist dies auch in Neubauten erlaubt.
Die kommunale Wärmeplanung
Ein wesentliches Element des neuen GEG stellt die kommunale Wärmeplanung dar, die es bislang nur in Baden-Württemberg gibt. Hier sind Gemeinden ab Großen Kreisstädten zu einer Wärmeplanung verpflichtet; für die bundesweite Regelung ist eine Einwohnerzahl von 10 000 oder mehr als Grenze vorgesehen. Sinn der Planung ist nicht nur eine Bestandsaufnahme – also festzustellen, wie bislang geheizt wird –, sondern vor allem der Aufbau von Fernwärmenetzen.
Die Gemeinden haben bis 2028 Zeit, einen Wärmeplan zu erstellen. Solange es keinen Plan gibt, müssen Besitzerinnen von Bestandsbauten nichts unternehmen, und auch Erbauer neuer Häuser könnten die jüngsten Vorschriften theoretisch ignorieren – klug wäre das allerdings nicht.
Gibt es eine kommunale Wärmeplanung und sieht diese vor, ein Gasnetz mit klimaneutralem Biogas (siehe „Wärmeerzeugung mit Biogas“, Seite 138) oder Wasserstoff aufzubauen, dürfen auch in Neubauten noch reine Gasheizungen installiert werden. Ist ein solches Netz nicht vorgesehen, wäre eine Versorgung über Tanks möglich – ähnlich denen für Flüssiggas. In dieser Konstellation reicht es – wie auch bei anderen Heizungen –, dass mindestens 65 Prozent der Heizenergie mittels Biogas oder lokal erzeugtem Wasserstoff oder dessen Derivaten produziert werden.
Da die Gemeinden bis 2028 Zeit für die Wärmeplanung und den eventuellen Aufbau eines klimaneutralen Gasnetzes haben, darf man, solange der Wärmeplan eben nicht vorliegt, auch nach 2024 Gasheizungen durch Gasheizungen ersetzen. Diese müsste man theoretisch jedoch stilllegen, sobald die Kommune ihre Wärmeplanung abgeschlossen hat. Für solche Fälle soll es aber „angemessene“ Übergangsfristen geben – schließlich ist es auch nicht klimaneutral, einen wenige Jahre alten Heizungskessel zu verschrotten.
Mit Systemplanung zur Effizienz
Neu ist das GEG nicht: Schon seit Jahren, genauer gesagt seit November 2020, fordert der Gesetzgeber für Neubauten hohe Standards in Sachen Energieeffizienz – und spätestens bei einem Eigentümerwechsel mussten sich auch bisher die neuen Besitzer von Bestandsbauten schon um höhere Effizienz kümmern. Dabei steht das gesamte System der Gebäudetechnik im Fokus – erst die Kombination von guter Dämmung, wirksamer und möglichst klimaneutraler Heizung sowie eigener Energieerzeugung und bewusst gesteuertem Energieverbrauch erzielt die gewünschte und geforderte Nachhaltigkeit.
Mit der neuen Energieeffizienzauszeichnung („Label“) der Europäischen Union sollen Verbraucher auf einen Blick ablesen können, wie sparsam eine Heizung mit Energie umgeht und wie laut sie ist. Die „Klasse“ kann aber nur der groben Orientierung dienen; um zu entscheiden, ob eine Heizung fürs eigene Haus ideal ist, muss man die technischen Daten im Detail studieren.
Schwerpunkte des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind der Energieverbrauch und die Dämmung von Gebäuden. Als Bezugsgröße dient im GEG an vielen Stellen ein sogenanntes Referenzgebäude. Dabei handelt es sich um ein Rechenmodell, um einen Maßstab für Bau- und Sanierungsvorhaben zu haben. Hierfür sind Referenzmaterialien und -techniken definiert – sie entsprechen in etwa dem Stand des Bauwesens im Jahr 2014. Über das Referenzgebäude-Rechenmodell ermittelt man den Primärenergiebedarf (PE), also wie viel Energie aufgewendet werden muss, um den Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser (und gegebenenfalls Kühlung) bei für Deutschland standardisierten Randbedingungen über ein Jahr zu decken. Die primärenergetische Betrachtung berücksichtigt die Energieverluste, die auf dem Weg vom Ort der Brennstoffgewinnung (Erdölquelle, Kohleflöz, Erdgasbohrung) bis zur Wärmebereitstellung im Gebäude entstehen. Ausgedrückt wird dies in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m2a). Die zweite Größe bildet der mittlere Wärmedurchgangskoeffizient der Hülle – banal ausgedrückt wird also ermittelt, wie viel Wärme pro Quadratmeter Außenhautfläche ein Gebäude verliert. Die Einheit dafür ist Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m2·K)); der Koeffizient wird im GEG mit HT bezeichnet. Aus technischen Gründen werden viele Werte in Kelvin angegeben; praktisch entsprechen sie Grad Celsius.
Die Berechnung liegt schlussendlich in der Verantwortung der Bauherren; in der Praxis kümmern sich Architektin, Statiker oder Energieberaterin in deren Auftrag darum. Ein praktisches Beispiel: Das für Neubauten angestrebte Effizienzhaus 40 verbraucht lediglich 40 Prozent der Primärenergie des Referenzgebäudes und hat dabei einen mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten von 55 Prozent bezogen auf das Referenzgebäude. Das bei einer Modernisierung angestrebte Effizienzhaus 70 benötigt entsprechend 70 Prozent der Primärenergie des Referenzgebäudes – allerdings bei einem mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten von 85 Prozent.
Aus den GEG-Vorschriften ergeben sich Folgen für die Gebäudetechnik: Neue Heizungsanlagen müssen der ErP-Richtlinie (Energy-related Products; energiebezogene Produkte) entsprechen. Dies betrifft Heizkessel, Umwälzpumpen sowie Lüftungsanlagen. Ähnlich wie Hausgeräte müssen diese mit Energielabeln gekennzeichnet sein. Statt von A bis G wie bei Elektrogeräten reichen die Kennzeichnungen bei Heizungen von A+++ bis D. Das Verbrauchsklassenetikett muss vom Hersteller bereitgestellt und auf der Heizungsanlage angebracht werden, für die Kontrolle ist der Schornsteinfeger zuständig.
Bestehende Heizungsanlagen für flüssige und gasförmige Brennstoffe (in der Praxis also Heizöl oder Gas) ohne Niedertemperaturoder Brennwerttechnik dürfen nicht mehr betrieben werden, sofern sie älter als 30 Jahre sind. Kontrolliert wird dies von den Bezirksschornsteinfegermeistern. Eine Besonderheit gilt schon jetzt in Baden-Württemberg: Beim Ersatz zentraler Wärmeerzeuger muss ein Anteil von 15 Prozent der benötigten Heizenergie aus regenerativer Energie stammen. Alternative mögliche Ersatzmaßnahmen sind etwa Kraft-Wärme-Kopplung, der Anschluss an ein Fernwärmenetz oder der Einsatz von Strom aus Photovoltaik zur Heizung.
Die Heizkostenverordnung (HKV) legt seit dem Januar 2022 die Pflicht von Vermietern fest, Mietern und Mieterinnen monatlich eine Übersicht über die angefallenen Beträge für die Wärme zur Verfügung zu stellen – dies soll einerseits Mieter vor unerwartet hohen Nebenkostennachzahlungen schützen und andererseits zum verantwortlichen Umgang mit der Wärmenutzung animieren. Betroffen davon sind zunächst nur Wohnungen, in denen bereits passende Verbrauchszähler installiert sind; ansonsten müssen Vermieterinnen und Vermieter bis zum Jahr 2027 geeignete Zähler nachrüsten.
Schlechter darf es nicht werden
Laut GEG darf der Ersatz beziehungsweise Austausch vorhandener Anlagen und Gebäudeteile nicht zu einer energetischen Verschlechterung führen – darauf wird aber jede Hauseigentümerin schon im eigenen Interesse achten. Das GEG legt außerdem fest, dass, sofern nicht längst vorhanden, die Heizungsvorlauftemperatur (Details dazu ab Seite 47) über einen Außentemperatursensor (siehe Seite 194) gesteuert wird, an den Heizkörpern jedes Raumes Thermostatventile anzubringen sind (Seite 195) und die Heizungsanlage sachkundig gewartet und instandgehalten wird.
In der Praxis lässt sich dies meist am einfachsten durch einen Wartungsvertrag gewährleisten. In Häusern mit mehreren Parteien müssen die Zähler zur Abrechnung der Wärmemengen geeicht sein.
Weitere Details betreffen das Gebäude selbst. Sofern nicht bereits geschehen, muss die oberste Geschossdecke wärmegedämmt sein, ebenso Heizungsrohre im Haus, auf deren Wärmeabgabe die Nutzer keinen Einfluss haben, also die im Keller sowie zu anderen Räumen oder Wohnungen durchlaufenden Heiz- und Warmwasserleitungen.
Beim Verkauf neuer oder umfassend modernisierter Wohngebäude ist ein Energieausweis erforderlich (bereits vorhandene dürfen nicht älter als zehn Jahre sein), ebenso ein Beratungsgespräch mit einem Energieberater, sofern nach dem Kauf eines Ein- oder Zweifamilienhauses Änderungen an der Gebäudehülle geplant beziehungsweise gewünscht werden. Dies bietet sich schon mit Blick auf die Fördermöglichkeiten an (siehe ab Seite 14).
Lass die Sonne rein!
Bei einem Neubau sind der Primärenergiebedarf (PE) sowie der Mittlere Transmissionskoeffizient (HT) zu berücksichtigen. Der Primärenergiebedarf hängt maßgeblich von der Gebäudetechnik beziehungsweise direkt von den eingesetzten Energieträgern und der benötigen Brennstoff- und Strommenge zur Deckung der Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes ab, der Mittlere Transmissionskoeffizient ausschließlich von der Geometrie des Gebäudes und dem Wärmedämmvermögen der Gebäudehülle. Diese sind bereits in der Planungsphase zu berechnen und gegebenenfalls zu optimieren. Auch hier bestehen Fördermöglichkeiten.
Photovoltaikanlagen sind eine gute Möglichkeit, die Stromrechnung deutlich zu senken. Sie sind ideale Energielieferanten für Wärmepumpen und Elektroautos, versorgen aber auch andere Verbraucher im Haus.
Ebenso ist geregelt, was bei der Sanierung von Bestandsgebäuden zu beachten ist. So darf etwa der Primärenergiebedarf eines Bestandsgebäudes nach umfassender Modernisierung 40 Prozent über dem eines vergleichbaren Neubaus liegen; bei umfassender Modernisierung eines Baudenkmals ist ein Primärenergiebedarf von 60 Prozent über dem eines vergleichbaren Neubaus erlaubt.
Werden bei der Sanierung (fast) alle Fenster ausgetauscht, muss ein Lüftungskonzept erstellt werden. In der Praxis kann dies bedeuten, dass etwa Lüftungsöffnungen an den Außenwänden installiert werden müssen.
Will man Bestandsgebäude erweitern, kommt der Paragraf 51 des GEG zur Anwendung. Der besagt, dass bei Erweiterung und Ausbau von Wohngebäuden der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust der Außenbauteile der neuen Räume das 1,2-Fache des entsprechenden Wertes des Referenzgebäudes nicht überschreiten darf. Für Erweiterungen mit einer Grundfläche von mehr als 50 Quadratmetern müssen zusätzlich die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt werden.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buches hatten neun der 16 deutschen Bundesländer und Stadtstaaten eine Solardachpflicht beschlossen, Hausbauern also die Installation einer Photovoltaikanlage (PV) zur Stromerzeugung vorgeschrieben. Unabhängig davon können dies auch einzelne Gemeinden festlegen. Wie im deutschen Föderalismus üblich, unterscheiden sich die Details von Bundesland zu Bundesland – auch hier bleibt Bauherrinnen nur, sich im Vorfeld zu informieren und mit Energieberater und Architektin zu klären, ob und welche Vorgaben fürs eigene Projekt relevant sind.
Was auf die Schnelle tun?
Mit Blick auf das ab 2024 geltende GEG, wonach Heizsysteme mit rein fossilen Brennstoffen nicht mehr genehmigungsfähig sind, ist unüberlegter Aktionismus sicherlich nicht der richtige Weg. In den meisten Fällen können Eigentümer von Bestandsbauten in aller Ruhe nach der besten und günstigsten Technik für die Zukunft suchen.
Energieeffizientes Bauen und Sanieren sind der beste Schutz vor hohen Heizkosten. Die billigste Wärme ist die, die man nicht braucht. Wärmedämmung an Gebäuden wird die Regel sein, nicht wärmegedämmte Gebäude werden die Ausnahme bilden.
Wärmebedarf berechnen
Im Bestand ist die energetische Sanierung aber mit hohen Kosten verbunden, die nicht jeder Hauseigentümer stemmen kann oder will. Ist es angesichts der kommenden GEG-Regeln eine gute Idee, noch schnell eine neue, konventionelle Gas- oder Ölheizung einzubauen? Es kommt sehr auf die Umstände an. Handelte es sich beim bestehenden Heizkessel schon um ein älteres Exemplar, das erwartbar innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgetauscht werden müsste, kann man den Ersatz der Heizung erwägen. Man sollte die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme aber entweder selbst durchrechnen oder mit einem Energieberater kalkulieren. Wichtigste Voraussetzung dafür ist ein Kassensturz: Lesen Sie aus den Verbrauchszahlen der letzten Heizsaison – falls möglich besser der letzten drei Jahre – ab, wie viele Kilowattstunden (kWh) das Haus pro Jahr benötigt. Gas wird ohnehin in Kilowattstunden berechnet, ein Liter Heizöl entspricht rund 10 Kilowattstunden. Dann berechnen Sie, wie viel Fläche des Hauses beheizt wird. Dazu ermitteln Sie die Zahl der Quadratmeter aller beheizten Räume des Gebäudes. Auch beheizte Kellerräume und bewohnte Dachböden zählen dazu. Teilen Sie nun die Verbrauchswerte, also die ermittelten Kilowattstunden, durch die Zahl der Quadratmeter. Das Ergebnis ist der Wärmebedarf („spezifischer Verbrauch“) Ihres Hauses in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m2a). Faustregel: Ein halbwegs zeitgemäßes Haus sollte bei einem Wert zwischen 75 und 125 liegen, im unsanierten Altbau muss man mit 200 und mehr rechnen. Läge der Verbrauch in dieser Höhe, sollte man, wenn irgend möglich, in energetische Sanierung investieren.
Denn Erdgas wird durch steigende CO2-Bepreisung unabhängig von der Entwicklung der Energiepreise für die Verbraucher teurer. Der CO2-Preis ist bis 2026 über das BEHG (Brennstoffemissionshandelgesetz) geregelt und auf 60 Euro pro Tonne CO2 begrenzt. Danach soll der CO2-Preis voraussichtlich über das Europäische Emissionshandelssystem vorgegeben werden. Dabei werden aktuell CO2-Preise von 120 bis 180 Euro oder höher prognostiziert. Das führt zu einer Erhöhung des Erdgaspreises um circa 3 Cent pro Kilowattstunde und um circa 4 Cent pro Kilowattstunde bei Heizöl.
Unter Umständen ist es sinnvoller, eine günstige Luft-Wasser-Wärmepumpe (siehe Seite 85) zu installieren und den vorhandenen Heizkessel als Reserve für besonders kalte Tage zu halten. Ein solches Hybridkonzept (siehe ab Seite 103) ist auch in Zukunft erlaubt, solange die Wärmepumpe die erwähnten 65 Prozent regenerative Heizwärme liefert. Schließlich sind bei Luft-Wasser-Wärmepumpen wie auch bei Luft-Luft-Wärmepumpen (siehe Seite 91) sowohl Fortschritte in der Effizienz wie auch Preissenkungen zu erwarten – es kann also sehr wohl sinnvoll sein, die bestehende Heizung weiterzubetreiben und Geld für eine Wärmepumpe zu sparen. Sofern es der erwartbare Sonnenertrag rechtfertigt, sollte man ebenfalls über Solarthermie (siehe ab Seite 124) oder Photovoltaik (siehe ab Seite 118) als Energiequellen nachdenken.
Anhand von vier typischen Neu- und Bestandsbauten zeigt dieses Buch detailliert die technischen Optionen, deren Vor- und Nachteile, Kosten sowie die Fördermöglichkeiten. Was man allerdings an dieser Stelle schon sagen kann: Der Ersatz eines vorhandenen fossilen Brenners durch einen neuen dürfte sich in den allermeisten Fällen nur dann rechnen, wenn man das Haus absehbar nur noch für einige Jahre selbst nutzen will und die Generalsanierung auf die künftigen Eigner abwälzen kann.
Bei Kauf und Verkauf einer Immobilie sollte berücksichtigt werden, dass die europäische Gebäuderichtlinie (die maßgeblich für die deutsche Gesetzgebung ist) ab 2030 eine Mindesteffizienz für Wohngebäude entsprechend der Energieeffizienzklasse E (Energieausweis gemäß GEG) fordert. Ab 2033 muss sogar die Effizienzklasse D erreicht werden. Bei Kauf, Verkauf oder Vermietung eines Wohngebäudes werden die Kosten, die bei Bestandsgebäuden notwendig sind, um das geforderte energetische Niveau zu erreichen, schon jetzt eingepreist. Energieeffizienz wird damit von der Kür zur Pflicht!
Die Fördermöglichkeiten
Energieeffizientes Bauen und Sanieren kostet. Bund, Länder und Gemeinden unterstützen Bauherren mit Krediten und Zuschüssen.
Grundlage der meisten Fördermöglichkeiten ist die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude (BeG). In der BeG wurden diverse, zuvor mehr schlecht als recht koordinierte Subventionen zusammengefasst. Im Wesentlichen sind zwei Institutionen dafür verantwortlich: die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Darüber hinaus füllen an vielen Orten Länder sowie Gemeinden eigene Fördertöpfe. Welche speziellen Förderungen es für die verschiedenen Gewerke eines Hauses gibt – darüber informieren wir detailliert in den folgenden Abschnitten. An dieser Stelle soll es allgemeine Hinweise zu staatlichen Zuschüssen geben.
Zum 1. Januar 2024 treten mehrere Änderungen in Kraft. Die Wichtigste: Die Fördersätze steigen auf bis zu 75 Prozent, gleichzeitig sinken aber für viele Maßnahmen die förderfähigen Kosten von 60 000 auf 30 000 Euro. Jedoch können Maßnahmen für Gebäudehülle und Heizung gleichzeitig gefördert werden, sodass es in der Summe wieder auf Investitionen in Höhe von 60 000 Euro Zuschüsse gibt. Zweite wichtige Änderung: Bislang wurden durch die Bafa gezielt bestimmte Heizungstechnologien gefördert. Ab 2024 unterstützt die KfW pauschal Heizungserneuerungen mit bis zu 75 Prozent. Details in der Tabelle auf Seite 16.
Zuschuss oder Kredit
Bafa wie KfW vergeben – je nach den ihnen gemachten Vorgaben – direkte oder Tilgungszuschüsse oder zinsgünstige Darlehen. Vereinfacht kann man sagen, dass sich die KfW schwerpunktmäßig ums Haus als Ganzes kümmert – sie bezuschusst in der Hauptsache die Effizienzhäuser (siehe nebenstehende Aufstellung). Dafür hat sie Stufen definiert – aktuell lautet diese für den Neubau 40 NH. Kleinere Zahlen sind hier besser und geben den Prozentsatz des vom geförderten Gebäude noch benötigten Primärenergiebedarfs gegenüber dem Referenzgebäude an. Zusätzlich wird mit dem Zusatz NH der Nachweis für besondere Nachhaltigkeit gefordert, das betrifft die „graue Energie“, die zur Herstellung der Baustoffe und technischen Anlagen benötigt wird. Dies erfordert zumindest teilweise den Einsatz regenerativer Baustoffe (Holz). Bis Ende Januar 2022 wurden noch Effizienzhäuser der Kategorie 55 gefördert. Die zur Erfüllung der Kategorie 55 nötigen Spezifikationen gelten jedoch zwischenzeitlich als Standard im Neubau, weshalb es hierfür keine Unterstützung mehr gibt. Stattdessen wird die Förderung auf die Sanierung von Bestandsimmobilien verlagert, denn hier hat man das größte Einsparpotenzial verortet. Deshalb werden bei der Modernisierung zu Effizienzhäusern von der KfW die Standards EH 85, EH 70 und EH 55 gefördert. Bessere Konditionen gibt es, wenn zusätzlich die Anforderungen für den Status EE (Einsatz erneuerbarer Energie) oder NH (Nachhaltige Bauweise) erfüllt werden.
Zum Jahreswechsel 2023/2024 übernimmt die KfW zusätzlich die Förderung der Heizungsmodernisierung. Beim Bafa verbleibt die Förderung von Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle sowie der Wärmeverteilung. Eine verbindliche Aussage, welche Institution sich um welche Gebiete kümmert, ist leider nicht möglich, da sich deren Fördermöglichkeiten durch politische Vorgaben und die Kassenlage des Staats immer wieder ändern können.
Beispielhaft seien dennoch einige Maßnahmen genannt. Die KfW nummeriert ihre Förderprogramme. Zum Redaktionsschluss existierte für Effizienzhäuser der Topf 261 – dabei handelt es sich um einen Kredit mit Tilgungszuschuss. Der Bau von Photovoltaikanlagen wird aus dem Topf KfW 270 unterstützt.
Sanierung von bestehenden Immobilien zum Effizienzhaus
Wenn Sie ein Wohngebäude zum Effizienzhaus sanieren oder ein frisch saniertes Effizienzhaus kaufen, fördert die KfW das mit einem Kredit mit Tilgungszuschuss.
Effizienzhaus
Tilgungszuschuss in % je Wohneinheit*
Betrag je Wohneinheit*
Effizienzhaus 40
20 % von max. 120 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 24 000 Euro
Effizienzhaus 40Erneuerbare-Energien-Klasse**
25 % von max. 150 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 37 500 Euro
Effizienzhaus 55
15 % von max. 120 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 18 000 Euro
Effizienzhaus 55Erneuerbare-Energien-Klasse**
20 % von max. 150 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 30 000 Euro
Effizienzhaus 70
10 % von max. 120 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 12 000 Euro
Effizienzhaus 70Erneuerbare-Energien-Klasse**
15 % von max. 150 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 22 500 Euro
Effizienzhaus 85
5 % von max. 120 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 6 000 Euro
Effizienzhaus 85Erneuerbare-Energien-Klasse**
10 % von max. 150 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 15 000 Euro
Effizienzhaus Denkmal
5 % von max. 120 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 6 000 Euro
Effizienzhaus DenkmalErneuerbare-Energien-Klasse**
10 % von max. 150 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 15 000 Euro
Worst-Performing-Building-Bonus***
10 % von max. 150 000 Euro Kreditbetrag
bis zu 15 000 Euro
* Abgeschlossene Wohnungen nach Sanierung
** Die höhere Förderung für die Erneuerbare-Energien-Klasse können Sie in Anspruch nehmen, wenn Sie im Zuge der Sanierung zum Effizienzhaus eine neue Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer Energien einbauen und damit mindestens 65 Prozent des Energiebedarfs des Gebäudes gedeckt werden. Die höhere Förderung erhalten Sie auch, wenn mindestens 65 Prozent des Energiebedarfs des Hauses zum Teil oder ganz durch unvermeidbare Abwärme erbracht werden.
***Entspricht das zu modernisierende Bestandsgebäude der Effizienzklasse H oder liegt das Baujahr vor 1957 und es wurden noch keine energetischen Modernisierungen vorgenommen, kann der Worst-Performing-Building-Bonus zu der mit der Modernisierung erreichten Effizienzhausförderung addiert werden.
Quelle: kfw.de
Stand: 23. August 2023
Mit der Förderung will der Staat natürlich nicht Geld mit der Gießkanne unter Bauherren verteilen, sondern gezielt die Energiewende forcieren. Das hat Folgen für die als förderwürdig erachteten Vorhaben. So gibt es, wenn als zukünftiges Brennmaterial der nachwachsende Rohstoff Holz gewünscht ist, zwar Geld für einen automatischen Pellet-Heizkessel, nicht aber für einen manuell zu beschickenden Kamin, den man eher als wohlige Zusatzdenn als Primärheizung betrachtet.
Ob ein Kredit oder ein Zuschuss sinnvoller ist, ob das Bafa oder die KfW der bessere Partner ist – das kann am besten ein Energieberater einschätzen. Für viele Maßnahmen ist seine Unterstützung ohnehin zwingend, denn von den Antragstellern wird für die meisten der gewünschten Vorhaben eine genaue Wirtschaftlichkeits- und Effizienzberechnung verlangt. Aufgabe des Energieberaters oder der Energieberaterin ist es, den Ist-Zustand von Gebäude wie Gebäudetechnik zu evaluieren, Einsparungs- und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren und nach Dringlichkeit und Wirksamkeit einzustufen. Ihnen obliegt auch die Planung möglicher Verbesserungen sowie die Aufgabe, deren Wirksamkeit darzulegen und für die Förderung zu dokumentieren. Explizit ausgenommen vom Energieberaterzwang sind nur Förderungen für Heizungsanlagen über das Bafa. Das Bundesamt steuert seinerseits aber für Maßnahmen an Ein- und Zweifamilienhäusern 1300 Euro zu den Energieberaterkosten bei („Bafa-Vor-Ort-Beratungsprogramm“). Mehr dazu auf bafa.de (Suchworte: „Bundesförderung Energieberatung für Wohngebäude“).
Fördersätze der KfW für Heizungserneuerungen
Berechtigte
Anteil
Erläuterungen
Grundförderung, alle Hauseigentümer
30 %
Bezieht sich auf die Investitionskosten von neuen Heizungen. Alle im Bestand möglichen Heizungsanlagen, die dem neuen GEG entsprechen, sollen gefördert werden. Dazu zählen Wärmepumpen, Wärmepumpen als Hybridheizungen, Solarthermie, Biomasse-Heizungen, der Anschluss an ein Wärmenetz. Wasserstofffähige Gasbrennwertheizungen sollen nur in Gebieten gefördert werden, für die eine kommunale Wärmeplanung ein regeneratives Wasserstoffnetz vorsieht.
Grundförderung, alle Hauseigentümer
5 %
Innovationsbonus, wenn Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln installiert werden und/oder diese Erd-, Wasser- oder Abwasserwärme nutzen
Bewohner der eigenen Immobilie
25 %
Klima-Geschwindigkeitsbonus, wenn eine mindestens 20 Jahre alte Gasheizung oder eine Ölheizung, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicheröfen ersetzt werden. Nach 2026 sinkt der Zuschuss um 5 %, nach 2028 alle 2 Jahre um 3 %.
Bewohner der eigenen Immobilie
30 %
Wenn das zu versteuernde Einkommen des Nutzers unter 40 000 Euro/Jahr liegt
Alle Zuschüsse können kumuliert werden, der maximale Fördersatz ist aber auf 70% begrenzt. In den Jahren 2024 und 2025 wird die maximale Förderung bei der Heizungsmodernisierung mit dem „Speed-Bonus“ auf 75% angehoben.
Quelle: BMWK Stand: 27. September 2023
Da sich die Konditionen häufig ändern, sollten Sie sich für einen ersten Überblick zu Fördermöglichkeiten auf den Internetseiten der Behörden umschauen. Auf kfw.de und ba fa.de führen anwenderfreundliche Menüs zu den passenden Fördertöpfen.
Unter test.de/thema/eigenheimfoerderungfinden Sie die aktuellen Förderkonditionen und wesentlichen Informationen zur Förderung. Mit einem Rechner können Sie hier nach Eingabe der Rahmendaten einen schnellen Überblick über Höchstbeträge, Laufzeiten, Zinssätze und Tilgungszuschüsse der KfW-Programme bekommen.
Oft geben auch Kommunen Geld
KfW und Bafa decken nur bundesweit gewährte Hilfen ab. Viele deutsche Bundesländer und Kommunen legen ihrerseits aber immer wieder zusätzliche Programme auf, um Häuser klimaneutral auf- oder umzubauen. Neben einer simplen Abfrage der Suchmaschine Ihrer Wahl („Förderung energetische Sanierung/Effizienzhaus Gemeindename“ beziehungsweise „Förderung energetische Sanierung/Effizienzhaus Landesname“) findet sich in den Internetauftritten des jeweiligen Bundeslandes oder der jeweiligen Gemeinde Hilfreiches. Im Zweifelsfall hilft ein Anruf – auf Landesseite sind meist die Umwelt- oder Wirtschaftsministerien die richtigen Ansprechpartner, bei der Gemeinde das Wirtschafts- oder Umweltdezernat. Energieberater sind mit den lokalen Besonderheiten in der Regel bestens vertraut.
Die meisten staatlichen Förderprogramme sind befristet beziehungsweise die bereitgestellten Summen gedeckelt. Sobald man also sicher ist, alle wesentlichen Informationen und Unterlagen beisammen zu haben, und seinerseits zuversichtlich, nach einer Förderungsbewilligung mit dem Bau loslegen zu können, sollte man die Förderung beantragen. Wer bis zum letztmöglichen Einreichungstermin wartet, riskiert, dass der passende Topf leer ist. Sind Fördergelder aber einmal bewilligt, steht deren Zusage. Anders als bei anderen, meist kurzfristig vergebenen Hilfen prüfen die Behörden nicht erst rückwirkend, ob die Voraussetzungen für die Bezuschussung erfüllt wurden. Kurz: Was man hat, das hat man. Für die meisten Förderungen haben Bafa beziehungsweise KfW ohnehin die Technischen Mindestanforderungen (TMA) festgelegt, die Ihr geplantes Vorhaben erfüllen muss. Die Einhaltung oder, wenn mit vertretbarem Aufwand möglich, Übererfüllung dieser Spezifikationen liegt im ureigensten Interesse der Bauherrinnen, denn sie wollen sich gegenüber dem Ist-Zustand schließlich verbessern.
Bauen in Deutschland ist teuer, und die umweltpolitisch gewollte und gebotene energetische Sanierung vieler Gebäude wird vermutlich die Preise längere Zeit hoch halten. Bei der Sanierung von Bestandsbauten gibt es aber eine Möglichkeit, ehrgeizige Einsparziele auch mit begrenztem Budget zu erreichen: den individuellen Sanierungsfahrplan, den man zusammen mit einer Energieberaterin entwerfen kann (Bafa-Vor-Ort-Beratungsprogramm, siehe vorherige Seite). Es könnte beispielsweise sinnvoll sein, zunächst die Außenwände zu dämmen, dann die Fenster eines Hauses auszutauschen, dann eine Wärmepumpe für die Heizung zu erwerben und schließlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren. Rechnet man mit seiner Energieberaterin all diese Schritte durch und legt sie per Sanierungsfahrplan fest, erhöhen sich etwa die Bafa-Zuschüsse für die neuen Fenster von 15 auf 20 Prozent. Auch andere Maßnahmen an der Gebäudehülle werden mit Sanierungsfahrplan höher gefördert. Dadurch steigen für ein Einfamilienhaus die förderfähigen Kosten von 30 000 auf 60 000 Euro. Der individuelle Sanierungsfahrplan ist 15 Jahre gültig. Alle umgesetzten Maßnahmen an der Gebäudehülle, die im Sanierungsfahrplan fixiert wurden, erhalten den Bonus einer um 5 Prozent erhöhten Förderquote. Auf jeden Fall können die gewonnenen Daten zum Heizleistungs- und Lüftungsbedarf als wertvolle Grundlage für eine passgenaue Dimensionierung der neu zu installierenden technischen Anlagen dienen.
Bei Bafa wie KfW liegt der Fokus auf Maßnahmen, die ein Haus energieeffizienter machen. Dennoch sollte man bei jeder geplanten Sanierung prüfen, was diese Behörden sonst noch alles fördern. Viele aktuell unterstützte Vorhaben wird man nicht gleich mit Bafa oder KfW in Verbindung bringen. Ein Blick auf die verfügbaren Zuschüsse lohnt sich fast immer, eine Energieberaterin oder ein Energieberater können dabei helfen.
Denken und Planen im System: Voraussetzung für Effizienz
Nur wer bei Neubau oder Sanierung das gesamte Gebäudetechniksystem im Blick behält, erhält ein wirklich effizientes Paket.
Die geschilderten Vorschriften und Fördermöglichkeiten stecken für Neu- und Umbaumaßnahmen den Rahmen ab, innerhalb dessen man sich bewegen kann. Dennoch kann man sich gar nicht genug auf Eventualitäten vorbereiten. Vor allem sollte man – in Abstimmung mit Architekt und Energieberaterin – die Wechselwirkungen berücksichtigen, die einzelne Maßnahmen und Komponenten der Gebäudetechnik im Gesamtsystem auslösen.
Bei den Überlegungen für einen energieeffizienten Neubau oder die energetische Sanierung eines Bestandsbaus besteht die wichtigste darin, wie weit sich der Energiebedarf des Hauses senken lässt beziehungsweise wie viel regenerative Energie man auf Haus und Grundstück erzeugen kann – und was das kostet, sprich: ob sich die Investition rechnet.
Dabei sind neben den Anschaffungskosten auch die für Wartung und eventuelle Ersatzteile relevant – wie auch die in Abschnitt „Die Fördermöglichkeiten“ (siehe ab Seite 14) genannten Zuschüsse.
Verfügbare Energiequellen
Wenngleich noch nicht in allen Bundesländern Vorschrift: Die Investition in eine Photovoltaikanlage ist nur an solchen Standorten sinnlos, die den ganzen Tag im Schatten liegen. Ansonsten ist angesichts steigender Energiepreise und des Vormarsches von Elektromobilität eine weitestgehende Selbstversorgung mit Strom in jedem Fall wirtschaftlich.
Eine Photovoltaikanlage sollte mit einem Akku ausgestattet sein, der für zwei Nutzungstage überschüssige Energie speichern kann. Derzeit ist die Einspeisung überschüssigen Stroms ins öffentliche Netz für die Erzeuger unattraktiv. Da Wasserstoff bereits als Energieträger der nahen Zukunft gehandelt wird, zu dessen Produktion man ebenfalls Strom benötigt, kann sich die Situation für private PV-Anlagen in einigen Jahren deutlich verbessern. Übrigens: Eine heimische Wasserstoffproduktion mit überschüssiger Elektrizität ist zwar theoretisch machbar, da Wasserstoff ein extrem flüchtiges und explosives Gas ist, übersteigen die Kosten zur sicheren und dauerhaften privaten Lagerung den möglichen Ertrag.
Elektrizität ist aber nicht die einzige Energie, die ein Haus samt zugehörigem Grundstück liefern kann. Auch andere erneuerbare Energien können Sie an vielen Standorten nutzen. Mit der PV-Anlage lassen sich Wärmepumpen aller Art zu niedrigen Kosten betreiben; sofern PV möglich ist, ist es auch sinnvoll, mit einer Wärmepumpe zu heizen. Luft-Wasser-Wärmepumpen (siehe Seite 85) lassen sich praktisch überall zum Heizen verwenden, an vielen Standorten taugen aber – mit den entsprechenden Wärmepumpen – auch das Grundwasser oder die Erdwärme als Energiequelle. Beide Ressourcen sind jedoch nicht überall nutzbar, meist benötigt man zudem eine Genehmigung (siehe Seite 92 und 101). Es gilt also in der Planungsphase, alle potenziellen Quellen erneuerbarer Energie auf ihre Verfügbarkeit und den dafür nötigen Aufwand abzuklopfen. Daraus ergibt sich die bestmögliche Art der Heizung und Gebäudedämmung.
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Selbst wenn erneuerbare Energien bereitstehen, ist deren Nutzung nicht immer wirtschaftlich. Gerade in einem Bestandsbau, der sich nur eingeschränkt nachträglich dämmen lässt (siehe „Das freistehende Bestandshaus“, Seite 36), kann es sein, dass die erzeugbare eigene Energie nicht zur Beheizung des Hauses reicht. Aber auch bei einem Neubau sollte man auf jeden Fall zu Beginn der Planung prüfen, welche Primärenergieträger vor Ort zur Verfügung stehen. Sind Fern- oder Nahwärme verfügbar? Genossenschaftliche, lokale Betreiber können attraktive Angebote machen. Besteht in einem Neubaugebiet Anschlusszwang bei einem großen Versorger, sollte man sehr gründlich überlegen, ob man dort bauen will, denn eventuellen Preissteigerungen der Anbieter ist man komplett ausgeliefert. Im Einzelnen gehen wir im Abschnitt “Fernwärme – die effiziente Alternative?“(siehe Seite 158) auf die wichtigen Dinge rund um Fernwärme ein. Wenn überhaupt, sollte die Fern- oder Nahwärme sehr nachhaltig gewonnen und effizient bereitgestellt werden. Ein Hinweis darauf ist der für jedes Fernwärmegebiet ausgewiesene Primärenergiefaktor (fp). Je niedriger er ist, desto besser – er sollte möglichst unter 0,5 liegen. Bestehen andere Einschränkungen hinsichtlich der Heizung, etwa ein Kaminverbot? Besteht die Möglichkeit, Erdgas zu beziehen? Plant der Erdgasversorger schon konkret den schrittweisen Ersatz von Erdgas durch erneuerbare Gase? Darf man am Standort mit Holzpellets heizen? Diese sind zwar nachhaltig, erzeugen aber Feinstaub, der ebenfalls die Umwelt belastet, weshalb Pelletheizungen in manchen Lagen nicht erlaubt sind.
Mit Fernwärme lassen sich viele Gebäude gleichzeitig effizient versorgen. Mit der richtigen Energiequelle ist sie klimafreundlich, ihr Preis hängt vom Versorger ab.
Sind die verfügbaren erneuerbaren und Primärenergien und deren Preise ermittelt, können Sie entscheiden, wie viel Aufwand und damit Geld Sie in die Wärmedämmung des Gebäudes stecken möchten. Es gibt leider keine bundesweit einheitliche Anlaufstelle, bei der man mit wenigen Klicks erführe, was vor Ort bereitsteht. In Bestandsbauten erkennt man das üblicherweise schon daran, welche Leitungen in Keller oder Techniknische führen – es ist aber nicht zwingend, dass die Vorbesitzer alles, was am Platze lieferbar ist, tatsächlich selbst nutzten. Gute Adressen sind die örtlichen Energieversorger, bei Neubausiedlungen Bauträger, Gemeindeverwaltungen sowie die Grundstücksnachbarn. Die Entscheidung für einen bestimmten Energieträger und Heizungstyp hat (vor einer eventuellen späteren Sanierung) über Jahrzehnte Folgen für die Betriebskosten und den Marktwert eines Gebäudes. Mit Blick auf die Baukosten scheint es zunächst sinnvoll, beim Wärmeschutz des Gebäudes nur die Mindestanforderungen nach dem Baurecht (GEG) zu erfüllen. Es kann hinsichtlich der verfügbaren Förderungen aber dennoch erschwinglich sein, sich für einen sehr hohen Effizienzhausstandard zu entscheiden (siehe Seite 15) – sowohl bezüglich der Bau- als auch der Betriebskosten.
Weitere Rahmenbedingungen
Teil des Systems Haus – und das betrifft sowohl die Energieerzeugung und -nutzung wie auch den Dämmaufwand – sind die tatsächlichen wie rechtlichen Randbedingungen. So finden sich in Bebauungsplänen oft Vorgaben zur Dachform und dessen Firstausrichtung, was sich auf die Nutzung von Photovoltaik oder Solarthermie (Heizungs- und Warmwasserunterstützung) auswirkt. Existieren andere Vorschriften oder Sachzwänge am gewünschten Bauplatz, die Folgen für Bauform und Energiebedarf haben, etwa eine Hanglage, ein hoher Grundwasserspiegel, (un)mögliche Unterkellerung des Hauses?
Altbau: Worauf Sie achten müssen
Die genannten Rahmenbedingungen betreffen Neu- wie Altbau gleichermaßen. Bei der Sanierung eines vorhandenen Gebäudes ist aber nicht nur eine Bestandsaufnahme der energetischen Möglichkeiten geboten, sondern auch eine gründliche Evaluierung der Bausubstanz. Prüfen Sie zunächst, ob die Gebäudehülle in Ordnung ist und ob innerhalb der nächsten fünf Jahre absehbar Reparaturen fällig werden. Dasselbe gilt für die vorhandene Gebäudetechnik. Kontrollieren Sie die Trinkwasserleitungen: Aus welchem Material bestehen sie, und in welchem Zustand befinden sie sich? Ist Korrosion sichtbar? Sind die Leitungen für den geplanten Ausbauzustand nach einer Renovierung ausreichend bemessen? Existieren nicht benutzte Leitungsabschnitte, die im Zuge der Sanierung entfernt werden sollten?
Auch der Zustand der Regenwasserableitungen (Dachrinnen, Abflüsse) ist zu prüfen.
Vergewissern Sie sich, dass die Abwasserleitungen im Boden („Grundleitungen“) dicht sind. Führen sie unter der Bodenplatte des Hauses entlang? Checken Sie auch die Abwasserleitungen im Haus. Ist für diese Leitungen eine Schmutzwasserbelüftung (sorgt dafür, dass die Flüssigkeit in den Abwasserleitungen fließen kann) auf dem Dach vorhanden, und ist diese ausreichend dimensioniert?
Der Keller sollte rückstausicher sein, also durch eine manuelle oder automatische Klappe vor überlaufenden Mischwasserkanälen geschützt werden.
Befassen Sie sich als Nächstes mit der Heizung. Wie alt ist sie? Ist die Art der Wärmeerzeugung noch zulässig und wenn ja, wie lange noch? Sind die Abgaswerte in Ordnung? Ist am Heizkessel oder an den Heizungsrohren Korrosion sichtbar? Sind sie dicht?
Falls mit Öl geheizt wird, muss der Tank geprüft und dicht sein, die Schutzfolien im und unterm Tank müssen intakt sein. Ist eine Auslaufwanne vorhanden? Falls mit Erdgas geheizt wird, ist es wichtig, dass die Zuleitung frei zugänglich und der Raum mit dem Übergabepunkt ausreichend belüftet ist. Zeigen die Rohre sichtbare Korrosionsstellen?
Unabhängig von der Art der Wärmeerzeugung ist der Zustand der Wärmeverteilung. Sind die Heizungsleitungen des Gebäudes wärmegedämmt und dicht? Zeigt sich an ihnen Korrosion? Was für eine Umwälzpumpe ist im System verbaut? Prüfen Sie die Heizkörper auf Korrosion. Existieren an ihnen Thermostatventile mit regulierbaren Ventilunterteilen? Wann wurde zuletzt ein hydraulischer Abgleich durchgeführt (siehe Seiten 115, 117)?
Prüfen Sie den Zustand des Warmwasserbereiters. Achten Sie auf Verkalkung. Er sollte problemlos eine Temperatur von 60 Grad Celsius erreichen. Ist ein eventuell installierter Warmwasserkreislauf („Zirkulation“) installiert, sollte auch an der höchstgelegenen Zapfstelle des Hauses in weniger als fünf Sekunden warmes Wasser fließen. Ist die Temperaturregelung des Warmwasserbereiters in Ordnung? Schaltet sich die sogenannte Ladepumpe am Warmwasserbereiter automatisch ab, wenn die gewählte Temperatur erreicht ist? Dieses Gerät macht im Betrieb Geräusche und vibriert leicht; man bemerkt also, wenn es sich abschaltet oder läuft.
An der Elektrik sollten Laien nicht arbeiten – ihren Zustand muss ein Fachmann überprüfen. Lassen Sie sich vom Elektriker über die folgenden kritischen Punkte informieren:
Sind alle Stromanschlüsse im und am Haus korrekt geerdet? Ist ein Potenzialausgleich vorhanden? Ist die Absicherung der Elektroverteilung ausreichend dimensioniert, und ist sie funktionsfähig? Basiert die hausinterne Verteilung auf dem veralten Vier- oder dem aktuellen Fünfleitersystem? Braucht das Gebäude einen Blitzschutz und falls ja: Ist dieser bereits vorhanden und in einwandfreiem Zustand?
Den Einsatz erneuerbarer Energien planen
Erneuerbare Energien stehen fast überall zur Verfügung, und Ökonomie wie Ökologie gebieten es, möglichst viel davon zu nutzen.
Der typische Wärmebedarf eines Wohngebäudes liegt bei 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m2a) für ein Passivhaus und rund 200 kWh/m2a für einen Altbau; der typische Warmwasserbedarf zwischen 10 und 35 kWh/m2a – die Werte variieren je nach Zahl der Bewohner und Anforderungen. Strom verbraucht ein typisches Wohngebäude oder ein durchschnittlicher Haushalt (ohne Wärmepumpe oder Elektroauto) 15 bis 65 kWh/m2a.
Im Norden Deutschlands stehen an solarer Einstrahlung etwa 900 kWh/m2a und in Süddeutschland etwa 1100 kWh/m2a zur Verfügung. Die eingestrahlte Sonnenenergie wird in Erde, Luft und Wasser aufgenommen, führt zu Wind und kann direkt zur solarthermischen Wärme- oder photovoltaischen Stromerzeugung (PV) genutzt werden. Die Sonnenenergie treibt auch die Photosynthese der Pflanzen an, aus denen etwa Holz als Brennstoff entsteht.
Jedes Gebäude nutzt von der Sonne gelieferte Energie – auch ohne dafür gedachte technische Einrichtungen. Die Problematik besteht darin, erneuerbare Energie dann nutzbar zu machen, wenn sie gerade benötigt wird.
Ist das auch bio?
Zu Biomasse zählen Holz in Form von Scheiten, Hackschnitzeln oder Pellets, Miscanthus (Riesen-Chinaschilf), Pflanzenöl und Biogas sowie synthetische Brennstoffe. Biomasse kann die bisher eingesetzten fossilen Brennstoffe direkt ersetzen, vorhandene Heizanlagen müssen wenig bis gar nicht umgebaut werden. Mit Biomasse arbeitende Heiztechnik kann weiterhin problemlos neu eingebaut werden. Der Nachteil von Biomasse: Wer nicht gerade auf dem Bauernhof wohnt, muss die biogenen Brennstoffe außerhalb des eigenen Geländes anbauen und aufbereiten (lassen). Dafür wird viel Platz benötigt, je nach Art der Biomasse konkurriert sie mit dem Anbau von Lebensmitteln. Zudem könnte etwa Holz allein fossile Brennstoffe nicht ersetzen – das als Brennmaterial nutzbare, natürlich innerhalb Deutschland nachwachsende Holz würde höchstens sieben Prozent der benötigten Heizenergie abdecken. In jüngster Zeit wird zudem über den durch Holzheizungen verursachten Feinstaub diskutiert. Aber vielerorts tun sich Genossenschaften oder ganze Gemeinden zusammen, um etwa aus Gülle oder Pflanzenresten Biogas zu produzieren. Was immer letztlich als Biomasse verwendet wird – überwiegend wird sie dort eingesetzt, wo sie regional leicht verfügbar ist oder andere regenerative Heizungstechnik nicht ideal wäre.
Die Sonne bringt es an den Tag
Solarthermie meint die Nutzung des Sonnenlichts, um damit direkt Wärme zu erzeugen. Auf dem Hausdach angebrachte Solarkollektoren heizen Warmwasser und Heizung. Leider stehen rund 75 Prozent der jährlich eingestrahlten Sonnenenergie zwischen April und September zur Verfügung – wenn wenig bis gar nicht geheizt werden muss. Die gewonnene Energie für die Wintermonate zu speichern ist im Privathaus unwirtschaftlich. Deshalb werden solarthermische Heizsysteme meist so ausgelegt, dass sie bis maximal 50 Prozent zum gesamten Wärmebedarf beitragen und mit einem anderen regenerativen System, etwa einer Holzfeuerung, kombiniert werden.
Unter Photovoltaik (PV) versteht man die direkte Erzeugung von Strom durch Sonnenlicht. Photovoltaik ist sehr vielseitig einsetzbar, weil Strom für viele Zwecke nutzbar ist. Neben der Deckung des klassischen Strombedarfs für Haushaltsgeräte können auch Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung sowie die Elektromobilität versorgt werden. Photovoltaik kann also dazu beitragen, den zusätzlich benötigten Strom vollelektrisch betriebener Gebäude vor Ort bereitzustellen und damit die öffentliche Strominfrastruktur zu entlasten.
Eine Stromspeicherung im Gebäude ist zumindest für den Tag-Nacht-Übertrag beziehungsweise zur Überbrückung von ein bis zwei Schlechtwettertagen möglich, aber bisher aufgrund der Kosten für den Speicher in der Regel nur bei Betrachtungsdauern von mehr als zehn Jahren wirtschaftlich darstellbar.
Umweltwärme: Energie aus Nichts
Umweltwärme steht auf dem eigenen Grundstück zur Verfügung. Die Luft, das Grundwasser und der Erdboden speichern Wärme – mit geeigneten Wärmepumpen kann man der Umwelt diese Energie entziehen und damit das Haus heizen. Wärmepumpen benötigen Strom, weshalb sie idealerweise so weit wie möglich von einer Photovoltaikanlage versorgt werden. Luftwärmepumpen erzeugen Lärm, was bei dichter Bebauung zu Ärger mit den Nachbarn führen kann; wenn für Erdwärme eine Tiefenbohrung erforderlich ist, muss diese von der Gemeinde genehmigt werden. Eine Variante der Erdwärme ist der Eisspeicher. Detailliert gehen wir auf alle Formen der Umweltwärme im Kapitel „Wärmepumpen“ ab Seite 72 ein.
Die Nutzung der Windenergie ist im privaten Rahmen eher ein Nischenthema. Kleinwindanlagen für die Montage auf dem Hausdach werden nur von wenigen Herstellern angeboten. In windreichen Gebieten, also an der Küste oder auf einem Berg, sind sie sehr wohl effizient. Aber man hört und sieht sie, weshalb sie Nachbarn oft ein Dorn im Auge sind. Sie konkurrieren mit Photovoltaikanlagen und sind in den meisten Situationen eher die zweite Wahl. Mit ihnen sind in dicht bebauten Wohngebieten in der Regel nur Anlagengrößen von 200 bis 500 Watt (W) realisierbar. Mit maximal 1 000 bis 2 000 Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) bleibt ihr Jahresertrag auch bei sehr guten Windverhältnissen eher gering.
Externe Wärme – nicht immer klug
Als Nah- oder Fernwärme bezeichnet man die Wärmeerzeugung außerhalb des eigenen Hauses. Ein typischer Fall von Nahwärme wäre etwa ein gemeinsames Blockheizkraftwerk für eine Siedlung, typische Fernwärme etwa die Abwärme von Fabriken oder Kraftwerken. Der Vorteil von Nah- oder Fernwärme für Eigenheimbesitzer liegt darin, dass im Haus lediglich sehr einfache Heizungstechnik eingebaut werden muss und sie sich um die eigentliche, oft komplexe Wärmeerzeugung nicht kümmern müssen. Die Investition in den Wärmeanschluss ist vergleichsweise günstig, was die zu stemmenden Bau- oder Modernisierungskosten senkt. Die laufenden Kosten für Nah- oder Fernwärme sind wiederum eher hoch, weil in dem Wärmepreis auch der Wartungsaufwand, die Refinanzierung der Wärmezentrale und des -netzes und die Wärmeverluste des Verteilnetzes enthalten sind.
Ob Nah- oder Fernwärme eine Option ist, sollte geprüft werden. Wenn es sich um die – eventuell genossenschaftlich finanzierte – Gemeinschaftsanlage einer Siedlung oder eines Dorfes handelt, besteht üblicherweise ein Einfluss auf deren Preisgestaltung. Hält hingegen ein Großkonzern für ein Gebiet das Wärmemonopol, sollte man sich sehr genau überlegen, ob man sich dem ausliefern will.
Zukunftsmusik: Wasserstoff
Das Gas Wasserstoff kann prinzipiell per Elektrolyse (Spaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff durch Strom) vor Ort hergestellt werden, allein seine Lagerung ist problematisch. Ihn zu verheizen ist zwar möglich – energetisch sinnvoller ist es aber, ihn mithilfe einer Brennstoffzelle wieder in Strom zu wandeln und damit während der Dunkelflaute im Winter eine Wärmepumpe zu betreiben.
Wegen der Lagerungsprobleme und der hohen Entzündlichkeit des Gases ist Wasserstoff als Energiespeicher im eigenen Haus wenig geeignet. Wahrscheinlicher ist, dass Energieversorger Wasserstoff großtechnisch erzeugen und lagern. Ein Eigenheimbesitzer könnte dann im Sommer überschüssigen Photovoltaikstrom an den Energieversorger liefern, der damit Wasserstoff produziert und diesen für den Winter speichert.
Die Gebäudetypen
Wie sich beim Heizen möglichst hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erreichen lassen, hängt von der Art des Gebäudes und den daraus folgenden energetischen Voraussetzungen ab.
Ob Neubau oder Sanierung, freistehende Villa oder schmales Reihenhaus, fast immer führen zwar nicht alle, aber viele Wege zum Ziel. Für welchen man sich entscheidet, ist sowohl eine Frage der Kosten als auch der konkreten Situation vor Ort. Ausgangspunkte bei der Planung eines Neubaus oder einer Sanierung sollten das Heizkonzept und die dafür nötige beziehungsweise vorhandene Energiequelle sein. Um diese herum sollten dann – bei Bestandsbauten in Abhängigkeit von der vorhandenen Substanz – die übrigen Komponenten gruppiert werden.
Drei Ansätze für Gebäude und Heizkonzepte sind gängig: das Passivhaus, das Aktivhaus und das LowEx- (Niedrig-Exergie-, siehe nächste Seite) oder Niedrigenergiehaus.