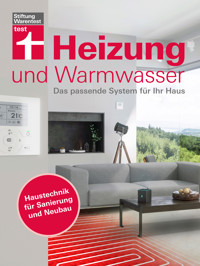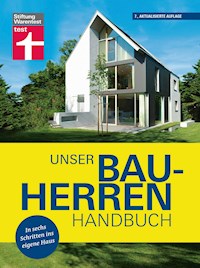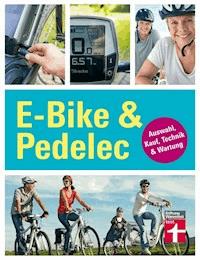
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
E-Bikes boomen! In der Stadt sind sie eine echte Alternative zum Auto geworden. Denn dank Motorunterstützung kommt man schnell und entspannt an sein Ziel. Außerdem ermöglichen die verschiedenen Antriebssysteme, Fahrradtypen und Akkus individuelle Einsatzmöglichkeiten in jedem Gelände. Mit dem neuen Ratgeber der Stiftung Warentest finden auch Sie Ihr E-Bike oder Pedelec, denn wir beantworten all Ihre Fragen: Welches Bike passt zu mir? Deckt mein Versicherungsschutz auch dieses Fahrrad ab? Kann ich Reichweitenangaben für Akkus trauen? Und wie kommt mein Bike mit in den Urlaub? Informationen zu den Themen Lebensdauer, Stromversorgung und Wartung helfen Ihnen bei der Entscheidung dieser kostspieligen Anschaffung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl-Gerhard Haas
E-Bike & Pedelec
Inhaltsverzeichnis
Was wollen Sie wissen?
Das neue Element: Der Elektroantrieb
Was spricht für E-Bikes, wo sind mögliche Haken?
E-Bike, (S-)Pedelec – das Wesentliche
„Pedelecs sollten generell als Fahrräder gelten“
Die Technik im Detail
Die Antriebskonzepte
Die Sensoren
Kette oder Riemen?
Gangschaltungen
Antriebe in der Werksausstattung und zum Nachrüsten
Elektroantrieb nachrüsten – wirklich eine Alternative?
Der richtige Umgang mit Akkus
Der Kontrollbildschirm
Bremsen fürs (S-)Pedelec
Ein E-Bike kaufen
Der richtige Rahmen
Welcher Fahrradtyp ist der richtige?
Wie viel muss ein gutes Pedelec kosten?
Mehr Sicherheit, mehr Spaß mit Zubehör?
„Der Elektroantrieb wird immer beliebter“
Mit dem E-Bike unterwegs
Auf dem Papier sind alle gleich
„Ein Kurs ist empfehlenswert“
Diebstahlschutz
Mit dem E-Bike verreisen
Das E-Bike pflegen und warten
Das richtige Werkzeug
Vor der ersten Ausfahrt
Wartung und Reparaturen
Allgemeine Pflegemaßnahmen
„Vom Elektroantrieb sollten Laienbastler die Finger lassen“
Pedelec-typische Probleme lösen
Fehler beim BionX-Antrieb
Fehler bei Bosch-Antrieben
Fehler bei Brose-Antrieben
Fehler beim Impulse-Antrieb
Fehler beim Panasonic-Antrieb
Fehler beim Shimano-Steps-Antrieb
Fehler beim TranzX-Antrieb
Fehler bei Yamaha-Antrieben
Hilfe
Adressen
Was wollen Sie wissen?
Durch einen Elektromotor unterstützte Fahrräder erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Immer öfter greifen Kunden zu Velos mit der Extraportion Schub. Laut Statistischem Bundesamt wuchs der Anteil der Stromer in deutschen Haushalten von 3,4 Prozent 2014 auf 5,1 Prozent im Jahr 2016. In absoluten Zahlen entspricht dies 1,9 Millionen Haushalten – Tendenz: rasant steigend.
Welcher E-Bike-Typ ist für mich der richtige?
Wörtlich genommen meint E-Bike: elektrisches Fahrrad. Tatsächlich sind unter diesem Sammelbegriff verschiedenste Konstruktionen erhältlich, die sich in Technik und Zulassungsbestimmungen gravierend unterscheiden. Schnelle Modelle mit dauerhaft wirkendem Antrieb etwa müssen versichert werden, teilweise sind auch Schutzhelme vorgeschrieben – Stichworte: Pedelec, E-Bike und S-Pedelec. Es lohnt sich also, vorab in Ruhe zu überlegen, welches Zweirad mit Elektroantrieb den eigenen Bedürfnissen am besten entspricht. Die grundsätzlichen Dinge zu Technik und Ausstattung der verschiedenen E-Bike-Typen finden Sie im Kapitel „Das neue Element: Der Elektroantrieb.“
Wo stelle ich ein E-Bike idealerweise ab und kann es laden?
Sind Fahrräder mitelektrischem Antrieb genauso unkompliziert in der Handhabung wie konventionelle Typen? Oder bedürfen sie besonderer Aufmerksamkeit und Unterstände? Wo und wie lädt man die Batterie des E-Bikes am besten auf? Nimmt man den Akku zum Laden in die eigenen vier Wände oder muss das ganze Fahrrad in Steckdosennähe platziert werden? Auch diese Fragen beantworten wir im Kapitel „Das neue Element: Der Elektroantrieb.“
Wie gut taugen Elektrofahrräder als Lastesel?
Ob Kind oder Kegel – die Motorunterstützung lässt E-Bikes attraktiv erscheinen für Menschen, die mehr als nur sich selbst befördern wollen. Aber viele fürs konventionelle Rad gültige Regeln gelten auch für ihre elektrischen Verwandten – und allzu schweren Lasten stehen oft technische Grenzen wie überforderte Bremsanlagen im Weg. Was E-Bikes auch mit Anhängern oder als spezialisierte Lastenräder, befördern können und wofür man besser auf andere Verkehrsmittel ausweicht, klären wir im Kapitel „Ein E-Bike kaufen“.
Worauf muss ich beim Kauf besonders achten?
Neben den Details des Elektroantriebs gilt es beim Kauf eines E-Bikes weitere Dinge zu beachten. Das betrifft sowohl die verschiedenen Rahmentypen als auch Informationsmöglichkeiten – sei es auf Messen oder direkt im Geschäft. Zudem bilden sich im Markt der Elektrofahrräder ähnliche Modelle wie im Pkw-Handel aus, etwa Leasing-Varianten. Auch die können interessant sein – haben aber ihre Tücken. Alles zur guten Wahl von Bauart und Händler fassen wir im Kapitel „Ein E-Bike kaufen“ zusammen.
Mit den Pedelecs in den Urlaub – was müssen wir planen und beachten?
Abweichende Verkehrsregeln, richtig schalten – mit dem elektrischen Rad fährt sich’s anders. Abseits des eigenen Unterstands will das teure Stück sicher vor Dieben sein – ein robustes Schloss ist Pflicht für E-Bikes. Auch beim Transport der Elektro-Drahtesel mit dem Auto gilt es etwas mehr zu beachten als bei konventionellen Velos. Alles dazu im Kapitel „Mit dem E-Bike unterwegs.“
Wer gut schmiert, fährt gut. Aber was tue ich bei streikender Elektronik?
Wie jedes technische Gerät danken auch E-Bikes gute Pflege mit besserer Performance und längerer Haltbarkeit. Aber was ist wichtig? Darf man den Fahrrädern mit dem Hochdruckreiniger zu Leibe rücken? Welche Teile können geübte Bastler selbst wechseln – und an welche sollte nur ein Fachmann ran? Kann man Elektrofahrräder tunen? Und was tun bei einer Panne? Antworten auf diese Fragen liefert das Kapitel „Das E-Bike pflegen und warten.“
Wie sichere und versichere ich mein E-Bike richtig?
E-Bikes sind teuer – manchen gebrauchten Pkw gibt es für weniger Geld. Umso wichtiger ist es, die Elektro-Velos mit robusten Schlössern und anderen Sicherungen vor Diebstahl zu schützen. Aber auch der beste mechanische Schutz kann Fahrräder nicht vor jeder Art Angriff bewahren – im Falle eines Falles hilft die richtige Versicherung, wenigstens die materiellen Folgen des Verlusts einzudämmen. Details zum Verriegeln und Versichern lesen Sie ab Seite 90.
Das neue Element: Der Elektroantrieb
Unter Anbietern von Fahrrädern mit Elektroantrieb herrschen Goldgräberstimmung und Pioniergeist. Alle naslang werden technische Neuheiten angekündigt, Parallelen mit der Entwicklung der ersten Automobile sind unverkennbar.
Die ersten „Motorwagen“ bestanden aus Kutschen mit drangebasteltem Verbrennermotor – erst nach und nach wurde die Technik speziell fürs Automobil entwickelt, setzten sich völlig neue Bauweisen auf den Straßen durch. Aktuell drängen Antiblockiersysteme und Automatikschaltungen in die neudeutsch „E-Bikes“ genannten Drahtesel. Wie beim Auto diskutieren E-Bike-Hersteller und -Käufer über die Vor- und Nachteile von Front-, Mittel- oder Heckmotor. Von der Forderung nach mehr Elektroautos auf deutschen Straßen dürften auch die E-Bike-Fahrer profitieren – in der Akku-Technologie sind große Fortschritte zu erwarten, die auch dem Zweirad mehr Reichweite verschaffen.
Aber wie jeder entstehende Markt ist auch der der E-Bikes unübersichtlich – das beginnt schon bei der Definition. Wann ist ein Zweirad mit Motor ein Fahrrad, wann ein Kleinkraftrad? Das sind keineswegs philosophische Fragen – die technischen und rechtlichen Unterscheidungen haben direkte Auswirkungen auf Fahrerlaubnis und den nötigen Versicherungsschutz.
Genauso wichtig sind selbstverständlich die eigenen Ansprüche: Vielen genügt es, an Bergstrecken oder bei Gegenwind etwas mehr Schub zu haben – andere möchten am liebsten gar nicht mehr in die Pedale treten.
Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf den Pedelecs (Pedal Electric Cycles), also klassischen Fahrrädern mit Elektrounterstützung. Diese erfreuen sich der größten Beliebtheit, weil sie am ehesten dem vertrauten Fahrrad entsprechen und man für sie weder Fahrprüfung noch eine eigene Haftpflichtversicherung braucht. Wir wollen Sie aber nicht nur bei der Kaufentscheidung unterstützen, sondern auch im alltäglichen Umgang mit dem Elektrofahrrad beraten – schließlich will die Technik gepflegt und vor Diebstahl geschützt sein.
Der technische Fortschritt vereinfacht nicht nur das Leben – er will auch bezahlt werden; zudem stellt er die Nutzer vor neue Überlegungen und Herausforderungen. Zunächst sollten Interessenten also klären, was sie von der neuen Technik haben.
Was spricht für E-Bikes, wo sind mögliche Haken?
Wie viele Produktgattungen haben Fahrräder mit elektrischer Unterstützung nicht nur Vorteile. Hier die wichtigsten Argumente für den Stromer – und die gegen eine Anschaffung.
So argumentieren die Anbieter, und viele Nutzer werden Ihnen von diesen Vorteilen erzählen:
Das E-Bike hilft, bergige Strecken bequem und schnell zurückzulegen und es unterstützt den Fahrer bei Gegenwind.
Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, schwitzt weniger, wenn er ein E-Bike nutzt, kommt also gepflegter ans Ziel.
E-Bikes verschaffen körperlich eingeschränkten Personen mehr Bewegungsfreiheit.
Mit den meisten Bautypen kann man auch einen Kinderanhänger mitnehmen, ohne sich zu verausgaben.
Auf vielen Routen ist es eine Alternative zum Pkw und spart so Geld sowie – je nach Situation – die Suche nach einem Parkplatz.
Weniger Trainierte können mit sportlicheren Fahrern mithalten, was bei gemeinsamen Touren geselliger ist.
Auch trainierte Radfahrer profitieren vom schnelleren Beschleunigen der E-Bikes.
Das spricht gegen Elektrofahrräder, und Besitzer eines Pedelecs werden das Ihnen gegenüber eher nicht so deutlich erwähnen oder auch runterspielen:
E-Bikes sind erheblich teurer als vergleichbare Fahrradmodelle ohne Motorantrieb.
Ist der Akku leer, fährt sich ein E-Bike wegen des höheren Gewichts schwerfälliger als ein konventionelles Modell.
Mit dem Elektroantrieb kommen zusätzliche Komponenten ans und ins Rad, die – teils vom Fachmann – gewartet werden müssen und ausfallen können. Erstmals taucht das Thema „Softwareupdate“ im Zusammenhang mit einem Fahrrad auf.
Wer sein Fahrrad regelmäßig mehrere Treppen hinauftragen muss, dürfte vom hohen Gewicht der Elektro-Velos nicht begeistert sein.
Wer sportlich genug ist, erreicht die mit den verbreitetsten Pedelecs mögliche Unterstützung bis 25 km/h auch ohne den Elektroantrieb, hat dadurch also wenig Vorteile, was die Höchstgeschwindigkeit betrifft.
Fährt man Rad, um sportlicher zu werden, fällt der Trainingseffekt geringer aus, wenn man auf der gleichen Strecke ein E-Bike nutzt.
Wie auf fast allen Zweirädern ist man auch auf dem E-Bike der Witterung ausgesetzt – es taugt nur selten als alleiniges Fortbewegungsmittel.
Für längere Strecken und solche, die nur auf Schnellstraßen komfortabel zu fahren sind, sind Fahrräder mit Elektroantrieb deshalb auch keine vollwertige Alternative zum Pkw.
Ist der Akku nach einigen Jahren erschöpft, muss ein neuer Ersatzakku angeschafft werden, was mit Preisen ab 150 Euro bis zu mehreren Hundert Euro spürbar Kosten verursacht.
E-Bike, (S-)Pedelec – das Wesentliche
Der schlichte Drahtesel von einst ist im 21. Jahrhundert zur sprintstarken Hightech-Maschine mutiert. So buhlen gleich mehrere Arten von Zweirädern mit Motor um die Käufergunst.
Schon bei der Bezeichnung beginnt die Verwirrung: Denn generell sind alle Fahrräder mit Elektroantrieb E-Bikes, und im Alltag sprechen Hersteller wie Kunden überwiegend davon. Das „E“ steht für „Elektro“ (wahlweise „Electric“), Bike ist die Kurzform des englischen „bicycle“, also wörtlich eines Zweirads. Aber darunter fallen von Muskelkraft getriebene Fahrräder ebenso wie Motorräder. In der Praxis differieren sowohl Technik wie rechtliche Voraussetzungen für die verschiedenen Bauarten. Bringen wir also Licht ins Dunkel der Elektro-Zweiräder.
Wesentliche Kriterien sind die Maximalgeschwindigkeit beziehungsweise die maximale Geschwindigkeit, bis zu der der Motor unterstützt, und ob die Zweiräder sich auch ohne Zutun des Fahrers bewegen. Alle folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Rechtslage in Deutschland – im deutschsprachigen Ausland, insbesondere der Schweiz, gelten andere Vorschriften.
Pedelec
Das Pedal Electric Cycle, kurz: Pedelec, ist dem klassischen Drahtesel am nächsten: Es darf einen Elektromotor mit einer Leistung von maximal 250 Watt (entspricht rund einem Drittel PS) mitbringen. Der unterstützt den Fahrer nur – man muss also weiterhin in die Pedale treten. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von rund 25 Stundenkilometern (km/h; in der Praxis werden toleranzbedingt 27 bis 28 km/h erreicht) klinkt sich der Elektroantrieb aus – fitte Radler dürfen ausschließlich mit Muskelkraft natürlich so schnell fahren wie sie können.
Versicherungs- und verkehrsrechtlich handelt es sich bei Pedelecs um Fahrräder. Es ist also kein Führerschein oder sonstige Fahrprüfung nötig und auch keine gesonderte Versicherung für dieses Fahrzeug. Eine private Haftpflichtversicherung ist aber sinnvoll, sobald man – in welcher Form auch immer – am Straßenverkehr teilnimmt. Die Autofahrern bekannte und von ihnen gefürchtete Obergrenze von 0,5 Promille Blutalkohol gilt auf Pedelecs ebenso wenig wie auf Fahrrädern.
Trotz des eigentlich nur unterstützenden Charakters des Pedelec-Elektroantriebs werden auch Modelle mit einer Anfahr- und Schiebehilfe angeboten. Diese Zweiräder setzen sich auf Wunsch des Fahrers selbsttätig in Bewegung – dies aber nur mit einer Geschwindigkeit von maximal 6 km/h. Die aktuelle Rechtslage betrachtet auch diese Zwitter aus Pedelec und E-Bike als Fahrräder. Das ist allerdings erst seit dem Juni 2013 der Fall.
Wer eine ältere Privathaftpflichtpolice hat, sollte klären, ob auch Unfälle mit Pedelecs (mit oder ohne Anfahrhilfe) abgedeckt sind. Einen Schutzhelm sollte man auf Pedelecs tragen, muss es aber nicht.
Für das Fahren von Pedelecs gibt es kein gesetzliches Mindestalter, es wird aber allgemein davon abgeraten, Kinder unter 14 Jahren damit fahren zu lassen. Jüngere Kinder können meist das Fahr- und Beschleunigungsverhalten von Pedelecs nicht richtig einschätzen.
S-Pedelecs (auch Schweizer Klasse oder S-Klasse)
Das S steht hier für „schnell“ (alternativ englisch: „Speed“) – mit einem S-Pedelec ist man flotter unterwegs als mit einem Pedelec. An diesem Fahrzeugtyp darf der Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h unterstützen und eine Leistung bis zu 4 000 Watt (vor 2017: 500 Watt) haben. Dabei darf der Motor die vom Fahrer aufgebrachte Kraft allerdings maximal vervierfachen. Rechtlich handelt es sich bei S-Pedelecs um Kleinkrafträder. Sofern man nach dem 1. April 1965 geboren ist, benötigt man für die Fahrt mit ihnen einen Führerschein der Klasse AM (enthalten bei Pkw-Führerschein Klasse B) und ein Versicherungskennzeichen; zudem muss man bei der Fahrt einen Helm tragen.
E-Bikes mit reinem Motorbetrieb
Wir erwähnten es bereits: In der Umgangssprache unterscheidet man nicht zwischen Pedelecs und E-Bikes – Hersteller und Gesetzgeber tun dies sehr wohl.
Der wesentliche Unterschied zu (S-)Pedelecs: E-Bikes fahren auch, wenn der Fahrer nicht in die Pedale tritt. Technisch sind sie einem Mofa oder Motorroller näher als einem Fahrrad.
Bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h gelten E-Bikes als Leichtmofa, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h als Mofa. Beide brauchen ein Versicherungskennzeichen, der Fahrer, sofern er nicht einen Führerschein für Pkw besitzt, eine Mofa-Prüfbescheinigung. Für vor dem 1. April 1965 Geborene reicht der Personalausweis. Zum Fahren dieses E-Bike-Typs muss man mindestens 15 Jahre alt sein; eine Helmpflicht besteht für die Modelle, die 25 km/h erreichen.
Die schnellsten E-Bikes dürfen wie S-Pedelecs bis zu 45 km/h schnell sein und werden als Kleinkraftrad eingestuft. Ihre Fahrer müssen mindestens 16 Jahre alt sein, man braucht mindestens einen Führerschein der Klasse AM (enthalten bei Pkw-Führerschein Klasse B) und ein Versicherungskennzeichen; zudem muss man bei der Fahrt einen Helm tragen.
Alle rechtlichen Aspekte und Bauartunterschiede haben wir in der Tabelle „Pedelecs (motorunterstützt), E-Mofas und E-Kleinkrafträder“ auf den Seiten 18–19 zusammengefasst.
Abseits dieser grundsätzlichen Kriterien teilt sich der E-Bike-Markt in viele verschiedene Kategorien wie Stadtfahrrad, Mountainbike, Rennrad und so weiter auf.
„Pedelecs sollten generell als Fahrräder gelten“
Siegfried Brockmann Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV) im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
Halten Sie die aktuelle Rechtslage in Bezug auf Pedelecs für praxisgerecht?
Nein – ich hätte mir eine andere Herangehensweise der Politik ans Thema gewünscht. Momentan haben wir die Situation, dass die zulassungsfreien Pedelecs für sportliche Fahrer zu langsam sind, für ältere Fahrer aber schon gefährlich schnell.
Was schlagen Sie stattdessen vor?
Die Trennung zwischen Pedelec und S-Pedelec sollte aufgehoben werden. Statt der leicht auszuhebelnden Beschränkung auf 25 km/h für Pedelecs sollte es eine manipulationsgeschützte Abhängigkeit von Tempo und Tretkraft geben. So hinge die tatsächliche Geschwindigkeit direkt von der körperlichen Leistungsfähigkeit des Fahrers ab. Eingeschränkte Personen liefen so weniger Gefahr, in Geschwindigkeitsbereiche zu geraten, die ihre Fähigkeiten übersteigen. Sportliche Personen würden Geschwindigkeiten erreichen, die sie auch auf dem Fahrrad schaffen.
Sollten dann Pedelecs als Kraftrad eingestuft werden?
Grundsätzlich wäre das geboten, denn alles, was schneller als 6 km/h ist und nicht ausschließlich mit Muskelkraft bewegt wird, gilt eigentlich als Kraftfahrzeug. Im konkreten Fall wäre ich allerdings dafür, alle Pedelecs mit der von mir vorgeschlagenen Tempokontrolle zu den Fahrrädern zu zählen. Momentan haben wir die Situation, dass S-Pedelecs nicht auf Radwegen oder Radschnellwegen fahren dürfen. Damit werden sie unattraktiv und auch gefährlich: Vielen Autofahrern ist zum Beispiel gar nicht bewusst, dass die schnellen E-Bikes auf der Straße, also auch neben einem Radfahrstreifen, fahren müssen, was zu Auseinandersetzungen führt.
Könnte die Einstufung aller Pedelecs als Kraftrad nicht mehr Sicherheit schaffen? Momentan erlaubt der Gesetzgeber an Pedelecs mäßig wirksame Rücktrittbremsen ebenso wie bissige Scheibenbremsen.
Das stimmt zwar – die verfügbare Bremskraft halte ich in der Praxis aber nicht für das Problem. Faktisch würden auch die schwächeren Bremsen die Anforderungen erfüllen, wie sie etwa an Mofas gestellt werden. Für Neulinge ist es allerdings ungewohnt bis schwierig, die Verzögerung richtig zu dosieren.
Halten Sie das von einem Hersteller angekündigte Bremsen-Antiblockiersystem (ABS) für einen Ansatz, die Sicherheit zu verbessern?
Grundsätzlich ja. Das System wirkt auf das Vorderrad und nimmt die Angst, zu überbremsen und zu stürzen. Gerade in Deutschland sind ältere Fahrer aber noch daran gewöhnt, zuerst die Rücktrittbremse einzusetzen. Wenn man also nicht übt, auch die vordere Bremse zu ziehen, bleibt das ABS wirkungslos.
Stichwort ältere Fahrer: Sind die auf Pedelecs besonders gefährdet?
Ja – wegen der momentanen Gesetzeslage fahren viele Menschen mit einem Pedelec mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h, die dazu auf einem konventionellen Fahrrad nicht in der Lage wären und mit diesem Tempo überfordert sind. In der Gruppe der über 65-Jährigen steigt die Zahl der Pedelec-Unfälle leider ganz erheblich. Gleichzeitig darf man Pedelecs ohne Helm fahren, was die Folgen eines Unfalls verschlimmern kann. Viele Menschen – nicht nur ältere – verzichten auf einen Helm, weil sie glauben, bei geringem Tempo könne nicht viel passieren. Das Gefährlichste an Pedelec-Kollisionen ist aber oft nicht der unmittelbare, sondern der Sekundäraufprall. Sprich: Man stürzt vom Rad auf den Asphalt – hierbei kann man sich auch bei sehr geringen Geschwindigkeiten schwerwiegende Kopfverletzungen zuziehen. Ich bin zwar ausdrücklich gegen eine Helmpflicht, hoffe aber, dass sich Pedelec-Fahrer freiwillig für Helme entscheiden, denn dass sie schützen, ist wissenschaftlich erwiesen.
Ist nach Ihren Erkenntnissen Pedelecfahren grundsätzlich gefährlicher?
Pedelecs werden über längere Strecken bewegt – allein deswegen steigt schon die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls. Zudem sind Pedelecs durchschnittlich 3 km/h schneller unterwegs. Das wirkt sich bei einer Kollision zwar nicht wesentlich auf die Schwere der Verletzungen aus. Aber mit dem Tempo verlängert sich der Reaktionsweg und damit das Risiko, einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden zu können. Hinzu kommen Gewichts- und Handlingaspekte. Man kann deshalb durchaus sagen, dass Pedelecfahren tendenziell gefährlicher ist.
Mit Blick auf die Risiken: Fordern Sie einen Führerschein für Pedelec-Fahrer?
Nein. Aber zumindest Senioren und andere ungeübte Fahrer sollten einen Kurs machen. Ich hielte zudem ein Fahrsicherheitstraining für sinnvoll. Denn mit allen Fahrzeugen meistert man gefährliche Situationen nur, wenn man in diesem Moment nicht nachdenken muss, sondern reflexartig das Richtige tut. Dies muss man wieder und wieder üben.
Wie sind denn Opfer bei vom Pedelec verursachten Unfällen geschützt?
Aufgrund der Gesetzeslage würde bei den langsamen Pedelecs, da diese ja ausdrücklich keine Kraftfahrzeuge sind, ausschließlich die private Haftpflichtversicherung eintreten. Das sind jetzt schon rund 97 Prozent des Marktes. Bei meinem Vorschlag kämen dann auch noch die restlichen 3 Prozent dazu, dann aber unter sichereren Bedingungen. Momentan haben aber durchaus noch nicht alle Menschen in Deutschland eine solche Versicherung. Da sollte dann schon der Fahrradhändler darauf hinweisen.
30
Sekunden
Fakten
Von 2012 bis 2016
stieg der E-Bike-Anteil am deutschen Fahrradmarkt von 10 auf 15 Prozent.
Im selben Zeitraum erhöhte sich der durchschnittliche
E-Bike-Preis von 1 637,24 Euro
auf 1 644,92 Euro.
2010 wurden in Deutschland
rund
127 000
E-Bikes produziert,
2016
waren es schon
351 500.
Quelle: Idealo.de/ZIV/Statista
Die Technik im Detail
Genug der juristischen Spitzfindigkeiten – im Folgenden wollen wir uns im Wesentlichen mit der Technik elektrisch betriebener beziehungsweise unterstützter Fahrräder befassen.
Schon unser kurzer Überblick verrät es: E-Bikes sind im Prinzip Motorroller, die statt eines Kraftstoff- einen Elektroantrieb haben. Eine Stromquelle, der Akkumulator, versorgt den Motor mit Energie; mit einem Regler bestimmt der Fahrer die gewünschte Geschwindigkeit. Nur, wenn der Akku leer ist, muss der Nutzer selbst in die Pedale treten – vorausgesetzt, das E-Bike hat welche.
Wesentlich komplexer ist die Technik bei (S-)Pedelecs: Wie erwähnt unterstützen sie den Fahrradfahrer nur. Das heißt: Zum Zweirad gesellt sich ein weiteres Element – der Elektromotor.
Für die zulassungsfreien Pedelecs ist er auf 250 Watt Nennleistung beschränkt – praktisch alle Anbieter verbauen entsprechende Motoren. Aus gutem Grund: Die Leistung eines durchschnittlichen Radfahrers entspricht bereits rund 100 Watt.
Arbeitsteilung
Die Antriebskomponenten verteilen sich übers Pedelec – der Motor sitzt nicht zwingend in der Mitte.
Der Motor allein macht das Pedelec nicht: Erst weitere Komponenten erwecken ihn zum Leben. Neben dem Akku gehören zum Paket ein Steuergerät, neudeutsch Controller genannt, sowie Sensoren – idealerweise für Drehmoment, Trittfrequenz und Geschwindigkeit. Ein üblicherweise am Lenker montierter Bildschirm ergänzt die E-Fahrradtechnik. Schlichte Ausführungen zeigen nur die wichtigsten Betriebsdaten an, etwa Geschwindigkeit und Akkuladestand. Ausgefeiltere Modelle integrieren weitere Funktionen, etwa die Navigation.
Die Motornennleistung ist auf 250 Watt begrenzt. Dennoch unterscheiden sich die verschiedenen Modelle stark im Fahrverhalten – das Drehmoment macht’s. In der Pedelec-Klasse sind Werte von 48 bis etwa 90 Newtonmeter (Nm) gängig. Je höher das Drehmoment, desto durchzugstärker und dynamischer wird der Vortrieb – desto leichter kann er ungeübte Fahrer aber auch überfordern. Die Fahrt mit drehmomentstarken Pedelecs wird zudem oft als weniger harmonisch empfunden. Viel hilft also nicht zwingend viel.
Die meisten Pedelecs offerieren verschiedene Unterstützungsstufen, wahlweise auch Fahrmodi genannt. Gängig sind drei bis fünf Stufen. Mit ihnen lässt sich wählen, wie sehr die Fahrt durch den Elektromotor getrieben wird. Dies ist nicht nur eine Frage der persönlichen Leistungsfähigkeit und Laune – sie wirkt sich auch direkt auf die mit dem Akku erreichbare Reichweite aus. Logisch: Tritt man mit weniger Krafteinsatz in die Pedale, ist der Akku schneller leer. Muss man mit dem Pedelec nur ein paar Kilometer bis zur Arbeit, möchte also nach Möglichkeit möglichst wenig verschwitzt bei Kollegen oder Kunden erscheinen, wird man eine Stufe mit hoher Unterstützung wählen – in den meisten Fällen wird sich am Arbeitsplatz eine Lademöglichkeit finden. Für ausgedehnte Touren hingegen dürfte eine möglichst dezente Unterstützung die klügste Wahl sein, um nicht zum Ende der Ausfahrt ohne Motorkraft zu fahren, sprich: Akku und Antrieb selbst per pedes befördern zu müssen.
Bei den Getrieben („Gangschaltungen“) zeichnen sich ähnliche Entwicklungen ab wie im Automobilbereich: Neben den vergleichsweise günstigen, aber auch pflegebedürftigen Kettenschaltungen bieten immer mehr Hersteller komplexe, teils vollautomatische Nabenschaltungen an. Die ersten Hersteller integrieren das Getriebe schon ins Motorgehäuse, wodurch die Technik weniger Platz braucht. Billiger werden die Pedelecs dadurch aber nicht.
Die Antriebskonzepte
Wesentliches Unterscheidungsmerkmal der verschiedenen Pedelecs ist die Position des Motors. Der Antrieb kann in der Mitte des Fahrrads, am Vorderrad oder hinten erfolgen.
Vorder- oder Hinterradmotoren sitzen direkt auf der Nabe des jeweiligen Laufrads – von Exotenkonstruktionen abgesehen. Der Mittelmotor nimmt hingegen im Rahmen dort Platz, wo bei konventionellen Fahrrädern das Tretlager angebracht ist.
Mittelmotor
Diese Antriebsart erfreut sich mittlerweile unter Pedelec-Herstellern der größten Beliebtheit. Das hat Gründe: Der Motor ist am tiefsten Punkt des Fahrradrahmens angebracht; der Fahrzeugschwerpunkt bleibt also niedrig, was der Sicherheit zugutekommt. Das Fahrverhalten entspricht am ehesten dem eines muskelbetriebenen Fahrrads, den Nutzern fällt die Umgewöhnung also leicht. Die elektrische Verbindung zum Akku ist meist kurz und, da der Akku oft ebenfalls im Rahmen verbaut wird, vor Beschädigung gut geschützt. Auch technisch hat der Mittelmotor beim typischen Pedelec Vorteile: Da er mit dem Pedalantrieb kombiniert ist, lässt sich die Motorunterstützung recht einfach und gezielt dosieren. Aktuelle Mittelmotor-Pedelecs lassen sich per Rücktritt bremsen, was den Gewohnheiten von Stadt- und Tourenrad-Fahrern entgegenkommt – allerdings bietet nicht jedes Modell diese Option. Setzt der Radhersteller auf Kettenantrieb (mehr zu anderen Kraftübertragungsmöglichkeiten ab Seite 26), beansprucht ein Mittelmotor diese, das Ritzel und auch die Schaltung stärker als beim gewohnten Fahrrad. Nur Nischenanbieter offerieren Nachrüstlösungen auf Basis eines Mittelmotors – da der Rahmen das Gewicht des Antriebs tragen muss, taugt diese Bauart in der Regel nicht zum Umbau eines konventionellen Zweirads.
Die goldene Mitte
Das Zusatzgewicht des Elektromotors stört das Fahrverhalten an dieser Stelle am wenigsten.
Wegen der Anforderungen an den Rahmen war der Mittelmotor früher auch als teuerste Antriebsvariante verschrien. Im aktuellen Angebot beeinflussen aber andere Details den konstruktiven Aufwand und damit den Preis eines Pedelecs in höherem Maße.
Aktuelle Mittelmotoren treiben das Tretlager mit an; früher war Kettenantrieb gängig. Der Antrieb am Tretlager ist technisch eleganter; in Verbindung mit einer Kettenschaltung (siehe Seite 26) reicht am Tretlager der Platz aber an einigen Modellen nur für einen Zahnkranz; bei Kettenantrieb finden sich häufig zwei oder gar drei Zahnkränze.
Vorderradmotor
Mit einem Frontmotor ist ein Pedelec besonders günstig zu realisieren. Er bietet Radherstellern und -käufern maximale Wahlfreiheit bei der Art der Schaltung; auch die Rücktrittbremse ist möglich. Der Antrieb verteilt sich bei Elektrounterstützung ausgewogen auf motorisiertes Vorder- wie muskelkraftbetriebenes Hinterrad. Da der technische Aufwand gering ist, eignet sich ein Vorderradmotor prinzipiell auch zum Nachrüsten eines konventionellen Fahrrads – mehr zu möglichen Nachrüstungen ab Seite 36.
Allradantrieb
Ein Frontmotor bringt Elektrokraft aufs Vorderrad; das hintere wird vom Fahrer angetrieben.