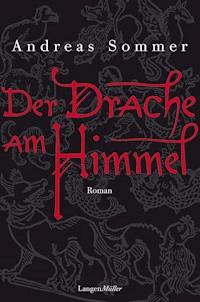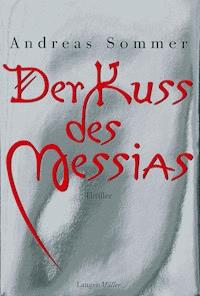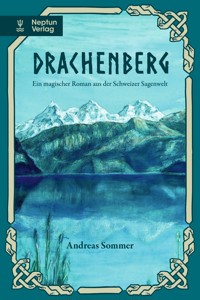13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neptun Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Ich bin mir sicher, dass nur du allein dieses besondere Werk vollbringen kannst. Und sei dir einer Sache bewusst: du bist bereits zu weit gegangen in dieser Geschichte, als dass du vor deiner Bestimmung jetzt noch davonlaufen könntest." Im 10. Jahrhundert gehört der westliche Teil der heutigen Schweiz zum Königreich Birgunt. Es ist eine wilde Gegend voller Wälder und Sümpfe, wo viele Menschen noch im Glauben an die alten Götter und Geister leben. Die gute Königin Bertha schützt dieses Land tapfer gegen räuberische Einfälle der mediterranen Mauren.Als der Hirtenjunge Ernestus, den die Leute im Dorf Erni nennen, eine ausgerissene Ziege in den Wald verfolgt, überschreitet er unabsichtlich die Grenze des verrufenen Landstriches Nuithônia. Seit Menschengedenken ist es verboten, dieses Gebiet am Fuss der Alpen zu betreten, denn es heisst, in seiner Wildnis verberge sich ein geheimnisvolles Tor in das verwunschene Reich Helisee, wo die Feenkönigin Helva Hof halten soll. Als Ernestus in Nuithônia einen aussergewöhnlichen Fund macht, gerät er in einen Strudel abenteuerlicher Ereignisse, die ihn nicht nur tief in die magische Wirklichkeit der Feen und Elben verwickeln, sondern auch die Frage aufwerfen, ob er wirklich derjenige ist, der er zu sein glaubt. Und auf welche Weise ist sein Schicksal wohl mit dem verwegenen Ritter Durestân Karassius verwoben, den es auf der Jagd nach einem weissen Hirsch ebenfalls nach Nuithônia verschlägt? Eine tiefgründige Heimatgeschichte um Macht und Magie, Liebe und Freundschaft, Wunder und Wandlung, welche die überlieferten Sagen und Mythen der alten Schweiz zu neuem Leben erweckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
«Ich bin mir sicher, dass nur du allein dieses besondere Werk vollbringen kannst. Und sei dir einer Sache bewusst: Du bist bereits zu weit gegangen in dieser Geschichte, als dass du vor deiner Bestimmung jetzt noch davonlaufen könntest.»
Im 10. Jahrhundert gehört der westliche Teil der heutigen Schweiz zum Königreich Birgunt. Es ist eine wilde Gegend voller Wälder und Sümpfe, wo viele Menschen noch im Glauben an die alten Götter und Geister leben. Die gute Königin Bertha schützt dieses Land tapfer gegen räuberische Einfälle der mediterranen Mauren.
Als der Hirtenjunge Ernestus in Nuithônia einen außergewöhnlichen Fund macht, gerät er in einen Strudel abenteuerlicher Ereignisse, die ihn nicht nur tief in die magische Wirklichkeit der Feen und Elben verwickeln, sondern auch seine Geliebte Anathêna, die Tochter des Dorfschmieds, in grosse Schwierigkeiten bringen. Und auf welche Weise ist sein Schicksal wohl mit dem verwegenen Ritter Durestân Karassius verwoben, den es auf der Jagd nach einem weißen Hirsch ebenfalls nach Nuithônia verschlägt?
Eine tiefgründige Heimatgeschichte um Macht und Magie, Liebe und Freundschaft, Wunder und Wandlung, welche die überlieferten Sagen und Mythen der alten Schweiz zu neuem Leben erweckt.
NUITHONIA REIHE, HELISEE-SAGA, Band 1
Weitere Bände sind in Planung
Über den Autor
Andreas Sommer (Jahrgang 1976) ist im Herzen des Üechtlandes in der Westschweiz aufgewachsen. Seit seiner Kindheit mit dem mythisch-magischen Gepräge dieser Voralpenlandschaft vertraut, entdeckte er schon früh seine Begeisterung für magische Orte und sagenhafte Geschichten. Seine langjährige Tätigkeit als Tour Guide in der Sahara brachte ihn in Kontakt mit der traditionellen Erzählkunst und dem animistischen Weltbild der Tuaregnomaden. Davon inspiriert, begann er die Sagenüberlieferungen seiner eigenen Heimatregion zu recherchieren, zusammenzutragen und zu überarbeiten. Dabei ist er bis heute bestrebt, die aufgespürten Fragmente in einen landschaftsmythologischen Kontext zu setzen und sie als Sagenwanderer immer wieder neu im heimischen Dialekt zu erzählen. Die traditionelle Erzählkunst neu zu beleben und in die unmittelbare Naturerfahrung einzubetten, ist seine Berufung und sein Beruf geworden. Es liegt ihm am Herzen, sein Publikum auf jene magische Erfahrungsebene zu entführen, wo Natur und Menschenseele auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben sind. Helisee ist sein erster Roman über die Sagenwelt jener Gegend, die ihn hervorgebracht hat
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2023 unter demselben Titel im Verlag BOD, Norderstedt.
2., durchgesehene und korrigierte Auflage.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmassnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritte enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung., da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2024 by Neptun Verlag, Rathausgasse 30, CH-3011 Bern/Schweiz
ISBN 978-3-85820-355-7
www.neptunverlag.ch
Für meine elbengleiche Lebensgefährtin Nathalie und unsere Töchter Eyana, Aliénor und Esmeralda – ich danke euch von Herzen, dass ihr mich immer wieder ziehen lasst, um diese Geschichten zu erträumen
Für alle jene treuen Menschenseelen, welche zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben
Helisee
Wanderer, wohlan, folge mir durch den Nebel der Gezeiten Lass’ uns selbander in ein lang’ verwich’nes Königreich reiten
Nach Birgunt, welches auf dem Erbe der altvorderen Helvêten errichtet Dessen Angedenken in Sang und Mär mannigfach erdichtet
Auf jenen Boden, wo die gute Königin Bertha weiland auf ihrem Schimmel ritt Mit Elbenmacht und Gotteshilf wider die raubenden Mauren stritt
Von trutzigem Gebirg’ und schimmernden Seen schützend beschirmt Ein ahnendes Menschengeschlecht alldort sich furchtlos hat erkühnt
Birgunts legendären Zauberglanz sehnsuchtsvoll zu preisen Und älteren Göttern ehrerbietig Huld zu erweisen
Darinnen liegt Nuithônia, voll raunender Wälder und wispernder Schluchten Allwo viele Sterbliche die verlorene Pforte nach dem Elbenland suchten
Den verheissungsvollen Hof der Feenkönigin Helva leiblich zu erschauen folgten sie der Aventüre fiebernd durch Birgunts verwunschene Auen
Denn fernab von Weg und Steg und vom dichten Hag verborgen lockt alldort ein ungeseh´nes Land ohne Hader, ohne Sorgen
Und wer einst den Wunderhort von Helisee mit eig’nen Augen hat erblickt Dessen Herz bleibt fürderhin und für immerdar hinter den Schleier entrückt
So wandelte auch ich nicht unberührt durch jene träumenden Hallen Nicht ohne Helvas Zaubergespinst alsogleich mit Leib’ und Seel’ zu verfallen
Wohl vernimm denn jetzt meine Mär durchwoben von so viel Ach und Weh Lass’ dich forttragen in die rätselhaften Gefilde des Landes Helisee
Niedergeschrieben A.D. 966, durch Bêrolant von Strelingân, einen fahrenden Ritter aus dem Wendelgau
Inhalt
Prolog
I Jenseits des Flüsterbaches
II Zauberstein
III Wenn der Sommerkönig reitet
IV Das goldene Tor
V Der silberne Ritter
VI Das Medaillon
VII Der alte Schäfer
VIII Eine Gebse voller Milch
IX Mûgo Sohn des Moruîn
X Mittsommerfeuer in den Bergen
XI Ein goldener Feenring
XII Die Spur des Weissen Hirsches
XIII Die Herrin vom Funkelnden Saal
XIV Die Wunder des Kristallenen Hofes
XV Das heisse Herz eines Sterblichen
XVI Lapis Draconis
XVII Der Haselwurm
XVIII Elbenschön und Murîg
XIX Feuer gegen Feuer
XX Helva von den Schwarzen Wassern
XXI Siebenmal sieben Tage
XXII Krötenzauber
XXIII Die Erneuerung des Bundes
XXIV Eyrïân und der Sehende Spiegel
XXV Der Geist im Krug
XXVI Der Schwurschädel
XXVII Der kahle Apfelhain
XXVIII Königin Berthas Rose
XXIX Der Rappe im Sturm
XXX Die Tränen der Maurenprinzessin
XXXI Der schwarze Ur
XXXII Luchsfährte im Schnee
XXXIII Die Alrûnenwurz
XXXIV Eine goldene Haarlocke
XXXV Das Gewebe der Einen und Einzigen Kraft
Epilog
Nachtrag des Verfassers
Dramatis Personae
Spectaculi Loca
Prolog
Da war wieder dieses Gesicht. Eine wunderschöne Frau mit einem elbischen Glanz in den Augen. Sie lächelte. Dennoch lag ein Anflug von Trauer in ihren Zügen. Ihre Lippen bewegten sich unmerklich.
„Komm nach Hause“, flüsterte sie. „Wir warten schon so lange auf dich“. In ihren dunklen, unergründlichen Augen glomm ein fernes Leuchten auf.
„Komm zu uns und erfülle dein Schicksal. Es ist zugleich das Schicksal von Nuithônia. Es ist an der Zeit, dass sich die Welten wieder vereinen. Sonst werden sie zugrunde gehen.“
Die Augen der Frau weiteten sich, und ein flehender Ausdruck huschte über das feengleiche Antlitz. „Komm, mein Sohn, bevor es zu spät ist.“
Das Leuchten in den Augen wurde stärker und überstrahlte die Konturen des Gesichtes. Da war nur noch flammendes Licht. Und die Stimme, welche unerbittlich in seinem Kopf hämmerte.
Keuchend schreckte er hoch. Er war schweissgebadet, wie im Fieber. Es war dunkel. Er lag auf seinem Strohsack in der Schlafkammer. Im Stall unter ihm bewegte sich eine Ziege geräuschvoll und brachte das alte Gebälk zum Ächzen.
Er seufzte und streckte sich erleichtert aus. Er hatte wieder geträumt. Denselben Traum.
Seit Wochen schon wiederholten sich diese nächtlichen Bilder immer wieder. Und er spürte, wie sich eine nagende Unruhe jedes Mal stärker in seinem Herzen ausbreitete.
ie Ziege hob ihren struppigen Kopf und liess ein unwilliges Meckern hören. Mit zwei, drei Sätzen entschwand sie in das Gestrüpp am Waldrand. Die gebieterische Stimme ihres Hirten überhörte sie geflissentlich.
„Volda, komm sofort zurück!“, rief Ernestus noch einmal. Er bemühte sich, seiner Aufforderung so viel Nachdruck wie möglich zu verleihen. „Du darfst da nicht rein! Donner und Drudenspucke! Vater hat es gesagt, Mutter hat es gesagt, Ulfgâr und Tilbôr haben es gesagt. Alle sagen es.“
Der junge, schlaksige Bursche mochte noch keine fünfzehn Winter zählen, doch wenn er wütend war, vibrierte ein Unterton in seiner Stimme, der ihn weitaus älter erscheinen liess.
Das kümmerte die ausgerissene Ziege jedoch herzlich wenig. Volda zog ein unwiderstehlicher Drang zum Bachufer, denn dort wuchsen die saftigsten Kräuter. Was scherte es sie, wenn das ihrem Hüter nicht passte?
Als Ernestus das gehörnte Biest verschwinden sah, warf er einen hastigen Blick zurück zum Rest der Herde. Die übrigen Ziegen weideten alle ungerührt unter den Eschen. Das widerborstige Gehabe der alten Volda schien sie nicht zu beirren. Der Hirtenjunge fasste seinen Stock fester und sprang hinter der Ausreisserin in das Unterholz. Fluchend bahnte er sich einen Weg durch klatschende Zweige und kratziges Gestrüpp.
Endlich stolperte er auf eine Lichtung. Nicht weit von ihm entfernt floss lautlos ein kleiner Bach unter den uralten Bäumen hindurch. An seinem Ufer wuchsen Elbenrauken, Nachtschatten und Drudensterne. Der Geruch dieser Pflanzen hing schwer und lockend in der Luft. Über dem träge dahinströmenden Wasser tanzte ein eigenartiges Flimmern. Volda stand zwischen den hohen Stauden und rupfte genüsslich das üppige Blattwerk von den Stängeln. Unschuldig blickte sie zu Ernestus hinüber, als sei es ganz normal und rechtens, dass sich eine Ziege der Obhut ihres Hirten entziehen darf. Der Junge hob seinen Stock und ging mit schnellen Schritten auf Volda zu.
„Warte nur, du unartiges Geschöpf“, keuchte er verdrossen, „dir werde ich jetzt deinen Meister zeigen.“ Als er nur noch wenige Schritte von ihr entfernt war, warf sich die Ziege ruckartig herum und sprang mit einem herausfordernden Meckerlaut über den Bach. Auf der anderen Seite äste sie unbehelligt weiter.
Ernestus prallte vor dem dunklen Wasser zurück, als starrte ihn ein Ungeheuer daraus an. In seinem Kopf hörte er unwillkürlich die ermahnende Stimme seines Vaters: Erni, du bist ein guter Hirte. Du kennst die besten Weideplätze. Aber du weisst, dass unser Land am Flüsterbach endet. Nicht nur unser Land, die Welt der Menschen hört dort auf. Erni, untersteh dich, jemals diese Grenze zu überschreiten!
Ernestus grunzte missmutig. Er hasste es, wenn sie ihn zuhause Erni nannten. Das war der Name eines kleinen Jungen. Wohl wahr, so hatten sie ihn von klein auf gerufen. Aber er war jetzt ein junger Mann. Und er hiess Ernestus. Das klang viel eindrucksvoller. Es war ein nobler birgundiônischer Name - wie er wohl einem Ritter gut anstehen mochte.
Wütend schlug er mit seinem Stock in das Gestäude.
Aber er war kein Ritter! Bloss ein gemeiner, unbedeutender Hirte. Der Sohn des Dorfmeiers1 von Calamis, dessen Leute am Rande der Waldöde einen Flecken Land bestellten und ihrem tyrannischen Landherrn brave Untertanen waren. Er hütete Geissen, seit er gehen konnte. Und er kannte jeden Winkel zwischen den Sumpfwiesen am See und dem Rand des grossen Waldes.
Dass man den Flüsterbach nicht überqueren dürfe, sagten sie alle. Die Bauern, die Jäger, die Köhler und die Reisigen. Alle ausser Grossmutter. Die Älteste von Reginalds Sippe lächelte bloss versonnen, wenn das Gespräch auf diesen verrufenen Landstrich fiel. Aber sogar der Landherr hatte bei schwerster Strafe angeordnet, den königlichen Bann unbedingt zu achten, welcher über das verbotene Land verhängt war. Und Herr Luitolf von der Burg Karass war ein Ritter von noblem Geblüt.
Hinter diesem Bach beginne ein anderes Reich, hiess es allenthalben. Den Menschen sei es nicht bestimmt, dort zu wandeln. Es sei ein verzaubertes Land, in dem kein Gaugraf und kein Edelherr zum Rechten sehe. Nicht einmal des Königs Wort gelte dort etwas.
Die Leute nannten dieses herrenlose Gebiet seit jeher Nuithônia, das Nachtland. Andere hiessen es auch den Elbengau. Die Dämmerlande. Die Helvêtenöde. Das verbotene Land oder das Bannland.
Ja, er trug viele Namen, dieser Landstrich jenseits des Flüsterbaches. Und er war Schauplatz unzähliger Geschichten. Die Feenkönigin Helva halte dort Hof über ihr Volk von Elbischen2, Zwergen und Schraten. Aber auch von Lindwürmern, menschenfressenden Ogern und unberechenbaren Wilwissen3 war die Rede. Die es nicht erwarten konnten, dass ein unvorsichtiger, dummer Junge wie er in ihre Fänge lief.
Ernestus äugte über den schmalen Bachlauf, dessen dunkles Wasser sich schweigend durch den moosigen Grund wand – und diese Ziege da, dachte er halblaut, gilt dieses Gebot für sie nicht? Was ist, wenn sie von den Unholden erwischt wird?
Der Hirtenjunge wiegte seinen blonden Krauskopf und lächelte grimmig. „Schlaues Tier“, schnarrte er, „meinst, du könntest dich einfach nach da drüben absetzen und mich loswerden, was?“
Ernestus liess seinen Stecken in die Höhe schnellen und lachte laut auf. „Ha, aber da täuschst du dich, du alte Schwerenöterin. Mir kannst du nichts vormachen. Ich fürchte mich nicht vor diesem Rinnsal. Die anderen sind weit weg und sehen nicht, wie ich dich jetzt da drüben holen komme.“
Der Junge nahm Anlauf und sprang behände über den Bach. Und ehe die alte Volda sich versah, hatte ihr Hirte sie am Halsriemen gepackt. „Und nun geht´s zurück auf die andere Seite, zum Rest deiner Sippe. Die sind nämlich alle schön brav und wissen, was sich gehört.“ Mit Schwung riss Ernestus an Voldas Halsband und wollte sie gewaltsam über das Wasser zurückzerren. Aber so schnell gab sich die Leitgeiss aus Reginalds Stall nicht geschlagen. Sie sträubte sich, warf ihren Kopf herum und entwand sich dem verblüfften Burschen mit einem kräftigen Ruck. Und um zu beweisen, dass es ihr ernst war, sprang sie mit einem anklagenden Meckern davon, tiefer in den Wald hinein.
Ernestus zögerte nicht und nahm sogleich die Verfolgung auf. Nun war er richtig zornig und würde das durchtriebene Biest nicht ohne züchtigende Stockschläge davonkommen lassen.
Volda liess den Flüsterbach eilends hinter sich und brach sich einen Weg durch das Dickicht. Unter mächtigen Eichen, Ulmen und Buchen wucherte ein verwachsenes Unterholz, in dem ungesehene Schatten schlummerten. Geschickt schlüpfte das flüchtige Tier durch jeden Durchlass, der sich bot, und zog flink davon, als gälte es, dem reissenden Wolf zu entrinnen. Ernestus verhedderte sich in den zudringlichen Ranken des Unterwuchses. Es kam ihm vor, als hätte sich dieses gehörnte Scheusal mit den Mächten des Waldes geradezu gegen ihn verschworen. Als würden die Zweige absichtlich nach ihm greifen und ihn zurückhalten. Er stolperte über eine Wurzel, die sich seinen hastenden Füssen in den Weg stellte. Hart schlug er hin, riss sich im Dornicht die blossen Unterarme auf und verlor seinen Stecken.
Mit einem wüsten Fluchen rappelte er sich wieder auf die Beine und stürzte weiter voran. Irgendwo weiter vorne hörte er Gezweig brechen und Laub rascheln. Da musste Volda sein. Er konnte sie nur mehr hören, aus den Augen hatte er sie längst verloren. Seine Gedanken überschlugen sich. Ernestus war in Rage. Dass Volda sich ihm derart widersetzte, hatte er bislang nicht erlebt. Aber er war sich sicher, dass er die Leitgeiss heute Abend in den Stall seines Vaters zurückbugsieren würde, auch wenn er ihr zuvor den Hals umdrehen musste.
Angestrengt lauschte der rennende Hirte auf Geräusche der entflohenen Quertreiberin.
Es war unvermittelt still geworden. Keuchend blieb Ernestus stehen.
Tiefer im Wald krächzte ein Häher. Hoch über dem dicht verwachsenen Kronendach der Eichen und Eschen ertönten rauschende Flügelschläge. Das kehlige Krroaak eines Raben erklang und entfernte sich. Ansonsten war kein Laut zu hören.
„Volda!“, rief der Hirtenjunge und versuchte einen Anfall aufkommender Unruhe zu unterdrücken. Aus den grünen Säulenhallen des endlosen Waldes klang lediglich sein Echo zurück.
Erst jetzt gewahrte Ernestus, wie urwüchsig dieser Wald war. Die Baumstämme waren so dick, dass man daraus grosse, geräumige Weidlinge hätte hauen können. Oder mächtige Firstbalken und Pfetten für neue Häuser und Scheuern. Aber hier wurde kein Holz geschlagen. Das erkannte er sofort. Denn keines Menschen Fuss betrat gemeinhin diese Waldungen, um etwas daraus fortzunehmen. Und wenn, dann war hier gewiss kein wachsamer Bannwart zur Stelle, der einen solchen Frevel ahndete. Er befand sich jenseits des Flüsterbaches. In jenem Landstrich, den seine Leute angstvoll mieden.
Nuithônia, raunten sie seinen Namen und schlugen überlieferte Zeichen zur Abwehr von Unheil und Drudenwerk.
„Verdammt Volda“, schluchzte Ernestus und spürte, wie sich sein Unbehagen zu einem stockenden Klumpen in der Brust verdichtete. Er konnte doch nicht ohne die Leitgeiss der ihm anvertrauten Herde zurückkehren. Seine Eltern zählten auf ihn. Und er wollte kein kleiner Junge mehr sein. Wenn schon kein hehrer Ritter, so doch wenigstens ein tüchtiger Hirte.
Grimmig ballte er seine Fäuste und stapfte entschlossen in jene Richtung, aus welcher er zuletzt Geräusche der fliehenden Ziege vernommen hatte. Es war noch nicht spät. Wenngleich er die Sonne durch das Wipfelgewölbe des Waldes bloss erahnen konnte, so schätzte er doch, dass ihm noch eine Weile zugute bliebe bis zum Einbruch der Dämmerung.
Er mühte sich, seine Sinne zu schärfen und Spuren eines mittelgrossen Tieres im Unterholz auszumachen. Abgebrochene Zweige, zerstampfte Stauden, aufgewühltes Laub. Er war sich nicht sicher, ob er sich noch auf dem richtigen Weg befand. Einige Male zögerte er und blickte ratsuchend umher. Das war ihm noch nie passiert. Dass ihn dieses verfluchte Hornvieh derart in Schwierigkeiten brachte.
Mit zunehmender Aufregung verlor er jene Gelassenheit, welche für eine nüchterne Beurteilung der Situation erforderlich gewesen wäre. Er ertappte sich dabei, wie er geradezu willkürlich durch das Unterholz strauchelte und jeweils jene Richtung einschlug, die ihm am wenigsten Hindernisse entgegensetzte.
Vermutlich habe ich die Spur längst verloren, mutmasste er, aber was soll ich tun? Ich muss Volda wieder finden.
Unvermittelt wich das Dickicht zurück. Ernestus trat auf eine kleine Lichtung hinaus.
Und da stand Volda und blickte ihn an, als hätte sie ihn nachgerade erwartet. Sie befand sich am Ufer eines kleinen Waldweihers, dessen Wasseroberfläche wie ein dunkler Spiegel unter den verschlungenen Ästen der umstehenden Bäume schlummerte.
Tierchen mit schillernden Flügeln huschten über das Wasser. Wenn sie einen der Sonnenstrahlen streiften, die wie ein schimmernder Kranz durch das Wipfeldach fingerten, leuchteten sie flüchtig auf.
Waren es Elbennadeln4? Oder vielleicht Wesen aus einer Zauberwelt?
Nuithônia.
Ernestus sog hörbar die Luft ein. Der Anblick dieses stillen, verborgenen Ortes mitten im alten Wald versetzte ihn in atemholendes Erstaunen. Es kam ihm vor, als stünde hier die Zeit still. Reginalds Hof, wo er zuhause war, schien weit entrückt zu sein. Seine Eltern, seine Geschwister und Grosseltern. Seine Tante Beldwîna mit dem schiefen Bein. Die Riedwiesen. Der Weidenhain an der Vivra. Das war eine andere Welt, denn sie lag nun von ihm aus gesehen jenseits des Flüsterbaches.
Mit bedächtigen Bewegungen näherte sich Ernestus der abwartenden Volda. Er konnte sie berühren, ohne dass sie zurückzuckte. Ruhig löste er den Strick, der seine Tunika um die Taille gürtete und band ihn um den Halsriemen der Leitgeiss. Das andere Ende knotete er an einer jungen Eberesche fest, die dicht am Ufer wuchs.
„Nun ist gut“, flüsterte der Hirtenjunge und tätschelte den Hals der struppigen Ziege. Jeglicher Zorn in ihm war verraucht. Der Friede dieses Ortes hatte allen Unmut in ihm aufgelöst.
Mit geradezu feierlicher Langsamkeit bückte sich Ernestus zum Wasser des Waldweihers hinab. So dunkel war es, dass er sein Spiegelbild klar und deutlich darin zu erkennen vermochte. Zuhause konnte er sich nur im Brunnentrog betrachten, aber das klare Wasser dort spiegelte sein Konterfei nicht in denselben Einzelheiten wider wie der Waldweiher hier.
Andächtig erforschte er seine Züge. Er begann ein junger Mann zu werden. Dennoch hatte er ein sehr feines, fast filigranes Gesicht. Nicht mädchenhaft, aber irgendwie edel. Himmelblaue Augen unter geschwungenen, hellen Brauen. Hohe Backenknochen und ein schmales Kinn, auf dem sich der erste Bartflaum abzeichnete. Ein schmallippiger Mund, der jetzt in einem Anhauch von Konzentration zusammengepresst war. Über den Schläfen kräuselte sich ein ungezähmter, goldblonder Lockenschopf, worüber sich seine Schwestern und die Nachbarsmädchen mitunter lustig machten.
Dabei gefällt es ihnen vielleicht, sinnierte Ernestus. Denn in unserer Familie trägt niemand solche Locken. Grossmutter sagt, dass auch unter den Altvorderen unseres Geschlechtes niemand eine derartige Haarpracht hatte. Nicht einmal in der umliegenden Nachbarschaft gibt es jemanden mit ähnlichem Kraushaar. Seltsam, fast als wäre ich ein Wechselbalg5…
Ernestus betastete mit seinen Fingern die gelben Locken, die ihm verschwitzt in die Stirn herabhingen.
Ob sie mir deshalb „Schön Erni“ nachrufen?
Eigentlich war es ja äusserst schmeichelhaft, wenn die jungen Maiden ihn so nannten - und nicht etwa „Strauchelfuss“ oder „Eulengesicht“.
Ob Anathêna ihm auch diesen Namen gab, wenn er es nicht hörte? Sie war die Tochter des Schmieds, nur wenig jünger als er. Sie hatte feine Hände, obwohl ihr Vater ein bärenprankiger Haudegen war, der früher in königlichen Diensten gestanden hatte. Seidene Haare umflossen ihr Gesicht in der Farbe goldener Garben zur Zeit des Kornschnitts. Und sie hatte das Gemüt eines Rehkitzes, das im Brachmond6 im Morgentau einer ungemähten Wiese herumtollt.
Wenn er ein Ritter wäre, dann könnte er ihr den Hof machen. Er würde sie vor sich in den Sattel heben und mit ihr auf seinem prächtig aufgezäumten Ross weite Ausritte in die Dämmerung lauer Sommerabende hinein unternehmen. Sie würden gemeinsam dem Gesang der Nachtigall lauschen und das Aufglimmen der ersten Sterne bewundern.
Und er würde sie über den Flüsterbach entführen. Hierher, an diesen verträumten Weiher.
Ob überhaupt jemand ausser ihm diesen Ort kannte? Wenn es den Leuten im Dorf verboten war, wenn es überhaupt allen Menschen verboten war, den Bach zu überschreiten, dann musste er ja wohl der Einzige sein, der diesen kleinen See im Herzen des Waldes je erschaut hatte.
Unwillkürlich durchlief Ernestus am hellichten Tag ein Schaudern. War er im Begriff, ein Geheimnis zu lüften, das ihm nicht bestimmt war?
Verstohlen sah sich der Junge um, als hätte er unwillentlich eine heilige Handlung gestört. Aber alles um ihn herum war still.
Volda hatte sich in ihr Los gefügt und knabberte interessiert am Laub herum.
Ernestus’ Blick fiel zurück auf den dunklen Wasserspiegel. Hinter seinem Gesicht nahm er darin das Kronendach des Waldes wahr, welches sich in einem urwüchsigen, lichtdurchfluteten Bogen wie ein grün schimmerndes Gewölbe hoch über dem Weiher aufspannte. Er betrachtete die mächtigen Äste der umstehenden Bäume, die sich im Spiegelbild gleichsam in die Tiefe des Wassers hinab reckten.
In einer Astgabel dicht über ihm entdeckte er ein grosses Knäuel aus verflochtenen Zweigen. Es sah aus wie ein grosses Vogelnest.
Vielleicht der Horst eines Raben, ging es dem Jungen durch den Kopf. Oder eines Raubvogels.
Er merkte sich den Baum und richtete sich auf. Es war eine alte, knorrige Eiche, die unmittelbar hinter ihm den Eingang in das Waldesdunkel bewachte. Die Astgabel, die er im Wasser gesehen hatte, befand sich etwa drei Mannlängen über seinem Kopf. Mit etwas Geschick musste sie zu erreichen sein. Von der Aussicht getrieben, in dem Nest ein Gelege oder sonst etwas Besonderes zu finden, nahm er sich vor, einen neugierigen Blick hineinzuwerfen.
Ernestus ging in die Hocke und sprang zum untersten Ast hoch. Er klammerte sich daran fest und zog sich geschmeidig in die Höhe. Mit einigen flinken Griffen arbeitete er sich höher in den Baum empor, bis er die gesuchte Astgabel vor sich hatte.
Da war kein Nest.
Die Mulde zwischen den Ästen war leer.
Ernestus blinzelte und rieb sich die Augen. Seltsam, er hatte doch im Spiegelbild klar und deutlich gesehen, dass sich an dieser Stelle etwas befinden musste.
Er stieg noch etwas höher und begutachtete die Astgabel auf der nächsten Ebene des Baumes. Auch dort fand sich nichts. Verwirrt kletterte der Junge wieder hinunter und beugte sich an derselben Stelle wie zuvor noch einmal über das Wasser.
Da sah er ganz deutlich das Nest hinter seinem Gesicht. Es musste an der Stelle liegen, die er eben gerade erkundet hatte. Was war er doch bloss für ein Tölpel, dass er den Zusammenhang zwischen einem gespiegelten Bild und der Wirklichkeit nicht eindeutig herstellen konnte.
Angespornt von dem Eifer, diesem merkwürdigen Nest sein Geheimnis zu entreissen, hangelte er sich noch einmal in die Eiche empor. Und starrte abermals auf die leere Stelle in der Astgabelung. „Donner und Drudenspucke!“, entfuhr es dem enttäuschten Jungen. Mit der Faust schlug er auf den leeren Hohlraum zwischen den Ästen, der ihn dermassen narrte.
Verdutzt hielt er inne.
Da war etwas.
Seine Hand erfühlte gebogene Äste, trockenes Moos und Federn. Aber er sah nichts.
Gaukelten ihm seine Sinne etwas vor?
Mit der Hand tastete er die Stelle zwischen den Ästen ab und erhielt unzweifelhaft den Eindruck eines grossen Vogelhorstes. Aber seine Augen zeigten ihm nur Leere.
Verblüfft liess er seine Hand weiter über das verflochtene Astwerk gleiten.
Nachdem er den ersten Schrecken überwunden hatte, befiel ihn ein verspielter Fürwitz, und er wollte dieses Rätsel nun erst recht ergründen. Die Erfahrung, dass seine Sinne ihm widersprüchliche Wahrnehmungen vermittelten, faszinierte ihn.
Ob dieses unsichtbare Nest etwas mit dem Geheimnis von Nuithônia zu tun hatte? Überraschend fand Ernestus’ tastende Hand etwas zu fassen. Etwas Kleines, Rundes, das sich angenehm in seine Hand schmiegte. Es war glatt und warm. Er umschlang es mit seinen Fingern und hob es hoch. Als könne er einen Bann brechen, wenn er es näher an seine Augen heranführte.
Da sah er es.
Es war ein kleiner, weisser Stein. Nicht grösser als ein Rabenei.
Ein bescheidener Kiesel, weiss wie Schnee, aber er lag so warm in seiner Hand, als hätte er eine Weile an der Sonne gelegen.
Und nun sah er auch das Nest.
Es lag einfach da, kunstvoll eingebettet in die Mulde zwischen den beiden auseinanderstrebenden Ästen der alten Eiche. Ernestus stutzte.
Und er legte den Stein wieder in die Nestkuhle.
Sofort entschwand das Nest aus seinen Augen. Nur den Kiesel konnte er noch vage erkennen.
Kaum nahm er diesen erneut auf, erschien das Nest sogleich wieder.
Er trieb das Spiel noch einige Male und beobachtete mit steigender Verwunderung, wie seine Sinneswahrnehmung sich jeweils veränderte.
Kaum lag der Stein im Nest, trübte sich sein Auge. Und sobald er ihn wieder behändigte, lüftete sich der Schleier und er sah alles klar und deutlich vor sich.
Der Hirtenjunge beschnupperte den merkwürdigen Kiesel. Er biss vorsichtig mit den Zähnen darauf.
Es gab keine Zweifel, das war ein simpler, weisser Stein.
Aber er trug ein Geheimnis in sich.
Behutsam knotete Ernestus seinen Fund in einen Zipfel seiner Tunika.
Als er wieder auf den Boden zurückkletterte, fühlte er sich etwas benommen. Als wäre er frisch aus einem traumreichen Schlaf erwacht.
Um ganz sicher zu gehen, betrachtete er die Szenerie jetzt noch einmal in der spiegelnden Wasseroberfläche.
Das Nest war immer noch da.
Und als er sich umwandte und in den Baum hochschaute, sah er das Nest nun auch so. Der Junge pfiff leise durch die Zähne. Etwas in diesem Wald begann ihn zu umgarnen und zu verzaubern. Es war wohl angeraten, nun allmählich an den Heimweg zu denken.
Ernestus löste Voldas Halsstrick vom Baum und zog sie hinter sich her. Erstaunlicherweise liess sie sich nun willig führen. Entweder hatte sie inzwischen genug gefressen oder ihre Lust an diesem seltsamen Wald begann ebenfalls zu schwinden.
Ohne grosse Umwege erreichten sie wieder den Flüsterbach und überquerten ihn mit einigen Sprüngen.
Allen Befürchtungen zum Trotz befand sich Voldas Herde immer noch äsend am Waldrand und nahm die Rückkehr ihrer Leitgeiss ohne Aufhebens zur Kenntnis. Die Sonne hatte sich inzwischen den Waldhöhen der Jôrberge im Westen angenähert. Es war nun höchste Zeit, die Ziegen heimwärts zu treiben.
Nachdem er die gehörnte Schar mit lauten Rufen zusammengemustert hatte, wandte Ernestus seine Schritte dem elterlichen Hof zu.
Unterwegs löste er den merkwürdigen weissen Kiesel aus seinem Obergewand und wog ihn prüfend in der Hand. Immer wieder warf er einen flüchtigen Blick darauf, als müsste er sich vergewissern, dass sein rätselhafter Fund aus dem Wald von Nuithônia immer noch da war.
Da erblickte er zwischen den Hecken hindurch die Häuser seines Heimatdorfes Calamis.
Im Gegenlicht der versinkenden Sonne erkannte er das vertraute Bild der schiefen Schilfdächer vor den hohen Weidenbäumen am Flüsschen Vivra. Weiter westlich zeichnete sich im Dunst die Fläche des grossen Sees Moredûn ab. Dies war sein Zuhause.
Aber wer in diesem Dorf mochte auch nur erahnen, wie weit weg sich der schlaksige Bauernbursche namens Ernestus heute Nachmittag davon entfernt gehabt hatte?
Bei diesem Gedanken befiel den Jungen eine unerklärliche Leichtigkeit, und er begann frohgemut zu singen, als er seine Ziegen zum Brunnen in der Dorfmitte trieb.
nd, habt ihr etwas gefunden?“, rief Reginald den beiden Mädchen zu, die mit schnellen Schritten vom Waldrand her die Riedwiese überquerten. Sie hielten ihre Fürtücher7 mit beiden Händen gerafft, als hätten sie etwas darin verborgen. „Ja, Vater“, erwiderte Rûnhild, die ältere der beiden, „wir haben neunerlei Kräuter gesammelt, so wie Grossmutter es uns aufgetragen hat. Waldmeister und Gundram, Drudenstern und Rauschblatt, und all die anderen, du weisst schon.“
Reginald runzelte verwirrt die Stirn.
„Heute ist doch die Beldennacht8“, erinnerte ihn Mandraë, das jüngere Mädchen. „Der fünfte Vollmond im Jahresrad. Wir mischen den Trunk der Lebenskraft. Wie es die Frauen immer tun zu dieser Zeit.“
Der alte Bauer seufzte und winkte seinen Töchtern begütigend nach. Das hatte er beinahe vergessen.
Reginald Eldring war ein pragmatischer Mensch. Ein Riedlandbauer durch und durch. Was für ihn zählte, waren seine Tiere, das Wohlergehen seiner Familie und seines Hofes und gut gefüllte Tröge in der Vorratskammer. Wenn ihm der Himmel über das Jahr gewogen war und günstiges Wetter bescherte, dann schoss das Kraut auf den Weiden. Dann gediehen der Flachs, das Korn und die Rüben so, wie er es wünschte. Er war froh, dass sich die Frauen seiner Sippe um die Mächte und Geheimnisse der unsichtbaren Welt kümmerten. Seine Schwiegermutter war ein Weib vom alten Blut. Sie war mit diesen überkommenen Bräuchen so untrennbar verwachsen wie die Waldreben mit der uralten Eiche auf dem Dorfanger.
Dabei sah es der örtliche Landherr gar nicht gerne, wenn sich das Volk mit den überlieferten Festen der Altvorderen beschäftigte. Heidnischen Unfug nannte er es.
„Wir leben in einer neuen Zeit“, hatte der Edle letzthin im Beisein seines glattzüngigen Kaplans9 salbungsvoll verkündet. „Das Licht des Gottessohnes leuchtet auf unser Land und vertreibt die unheilvollen Schatten der Alten Götter.“
Reginald wusste nicht, was er davon halten sollte. Das eifernde Gerede des Burgpriesters behagte ihm nicht. Dessen selbstherrliches Gehabe erschien ihm irgendwie verdächtig. Aber der Freibauer hatte im Dorf Calamis als Meier die oberste Gewalt inne, umso mehr wollte er den Frieden mit seinem Landherrn wahren. Dies fiel ihm beileibe nicht immer leicht, denn Herr Luitolf Karassius war, gelinde ausgedrückt, ein unverschämter und rüpelhafter Mann. Von ganz anderem Schlag als sein leider allzu früh verwichener Vater Berchthold und sein verschollener, älterer Bruder Durestân es gewesen waren. Vor allem liess er sich durch seinen Kaplan etwas zu sehr beeindrucken und streckte sich zunehmend nach dessen verbohrten Ansichten.
Aber es war sowieso eine seltsame Zeit. Seit dem unerwarteten Aufbruch von König Rodolphus vor mehr als einem Jahr, um in fernen Landen an der Seite des suebischen Herzogs Herimân einen langwierigen und verlustreichen Krieg gegen die räuberischen Beutereiter der Hunnen10 zu führen, seither schien den Edelleuten hierzulande bisweilen der rechte Sinn abzugehen. So wie es eben geschehen mochte, wenn der Herde ihr Hirte abhandenkam. Dabei bemühte sich Königin Bertha in Abwesenheit ihres Gemahls nach besten Kräften um die Hut des Landes Birgunt.
Freilich machten sonderbare Gerüchte die Runde. Beim letzten Schwarzmond hätte eine maurische Streitmacht die Stadt Genâva eingenommen, und es drohe nun Krieg bis hinauf in die nördlichen Gaue11 des Königreiches, die sich zwischen dem Alpenwall und den Jôrbergen erstreckten. Der Wanderpriester, der diese Neuigkeit im vergangenen Eôstarmond12 in den Dörfern am See verbreitet hatte, wollte die Schuld dafür der Königin und ihrer mangelnden Gottesfurcht zuschieben. Weil sie immer noch aus dem versiegenden Brunnen des alten Glaubens trinke, strafe sie der Himmlische Vater nun zu Recht mit brandschatzenden Horden und Unbill aus den Heidenländern des Südens.
Reginald schüttelte den Kopf und sah seinen Töchtern nach, die soeben über die Schwelle ihres Heims traten. Diesen Hof hatte der Bauer von seinen Eltern übernommen, und diese hatten ihn zuvor als Erbe zahlreicher Ahnengenerationen geführt. Soweit sich das Gedächtnis der Sippe zurückerinnerte, war dieses Land immer den Eldring anvertraut gewesen. Sie hatten es als freie Bauern im Namen ihres jeweiligen Edelherrn bestellt. Und das hatten sie bereits getan, als die legendären ersten Birgundiônen an die gesegneten Gestade der Grossen Seen gekommen waren, um hier ihre Herrschaft zu errichten.
Das lag freilich weit zurück. Dennoch war dieser Hof nach wie vor die Grundfeste von Reginalds Sippe.
Abgesehen davon, woran die Leute glaubten, war ihm ehrlich gesagt einerlei. Das mochte ein jeder für sich selbst entscheiden.
Allein vor der Bannmarch13 Nuithônias hatte er grössten Respekt. Seit der Zeit des grossen Erzherrschers Karolus galt das Betreten des Elbengaus nämlich als schandbares Vergehen wider die königliche Autorität und die göttliche Ordnung, wie sie die Kleruspriester14 vertraten. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Aber für ihn war ein gutes Einvernehmen mit der Obrigkeit von grösster Bedeutung. Deshalb trat ihm aus Prinzip niemand aus seiner Sippe über die Grenze des verwünschten Landes. Das hatte er seinen Kindern eingebläut.
Allerdings musste er zu seinem Missfallen feststellen, dass Erni die Ziegen immer wieder in die Nähe des Flüsterbaches trieb. Irgendetwas schien ihn geradezu dorthin zu ziehen. Ob dies etwas mit der Geschichte des Jungen zu tun hatte?
Sei’s drum, wenn dieser Schlingel nur nicht über die March trat! Ansonsten war er ja ein brauchbarer Hirte. Bislang hatte er sich mit den Tieren leidlich geschickt angestellt. Wenn er erst noch ein paar Jahrläufe hinter sich gebracht hätte, würde er dereinst schon das rechte Zeug zum Bauern aufbringen.
Aber wo steckte der Bengel überhaupt? Die Sonne würde sich bald in ihrem Bett aus blauem Dunst jenseits der Grossen Seen zur Ruhe legen. Eigentlich müsste der Hirte jetzt zurück sein. Bald begann ja das Fest.
Reginald prüfte noch einmal den festen Sitz des Pfostens, mit dem er den Schweifelzaun15 geflickt hatte. Er nickte zufrieden. Das musste reichen, damit ihm die Sauen nicht wieder in das Ried hinaus entwischten.
Es ist Zeit für den Stall, dachte er und warf einen letzten Blick über das Land. Bis an das weidenbestandene Seeufer jenseits der Vivra erstreckten sich offene Wiesenflächen. Seine Ahnleute hatten sie der Waldöde und den Sümpfen in mühevoller Arbeit abgerungen. Genau das war es, was zählte: Die Tatkraft des Menschen. Da waren kein Zauber und keine geheimnisvollen Mächte im Spiel. Nur Fleiss und redlicher Wille.
„Vater, Vater, so komm doch schnell!“ Die aufgebrachte Stimme von Rûnhild schreckte den Bauern aus seinen Gedanken auf. Das Mädchen sprang über den Hof und wedelte aufgeregt mit den Armen.
Ob die Schweine doch noch einen Durchschlupf gefunden hatten? Er beschleunigte seinen Schritt und eilte zu seiner Tochter.
„Komm schnell, Erni ist mit den Ziegen am Brunnen. Aber etwas stimmt nicht. Die Leute meinen, er sei verzaubert.“
Reginald schnaubte argwöhnisch und folgte seiner Tochter über den Platz vor seinem Haus. Zwei Steinwürfe entfernt stand der Hof des Nachbarn Marbert. Daneben die Schmiede mit ihren festen Steinmauern. Und gleich dahinter ragte die hohe Linde auf. Unter diesem mächtigen Baum lag der Brunnen des Dorfes. Dorthin trieben die Hirten bei ihrer Heimkehr am Abend jeweils die Tiere, um sie vor dem Einstallen nochmals zu tränken.
Eine Handvoll Leute hatte sich bereits am Rand des Brunnenplatzes versammelt und tuschelte verhalten. Reginald sah seine Ziegen am Brunnentrog stehen. Die alte Volda schubste ihre Kameradinnen mit rüden Hornstössen zur Seite, um als Erste trinken zu können. Der Bauer konnte Ernis Stimme deutlich hören. Er trällerte ein fröhliches Lied, wie er es mitunter tat, wenn er abends heimkam. Er war ein aufgestellter Bursche, den selten etwas verdross.
Aber wo war er denn?
Reginald konnte den jungen Hirten nirgends entdecken.
„Da Vater, schau doch“, keuchte Rûnhild entsetzt.
Der triefende Schöpfkübel tanzte am langen Seil aus dem Brunnenschacht hoch, verharrte kurz in der Luft und schwebte dann wie von Geisterhand bewegt hinüber zur Tränke. Dort kippte er und entleerte seinen Inhalt in den Trog. Die Ziegen meckerten und rangelten um das Becken herum. Der leere Kübel ruckelte durch die Luft wieder zurück zum Brunnenschacht und stürzte platschend hinab. Da sauste Ernis Stock zwischen die zankenden Ziegen, und Reginald hörte die energische Stimme des Hirten, welche die Tiere zur Ordnung anhielt.
Aber wo steckte dieser Bengel? Warum war er deutlich zu hören, aber blieb unsichtbar? Und weshalb flogen diese Gegenstände von selbst durch die Luft?
Nun sprang Reginalds Frau Hertlind dazu und drängte sich an die stämmige Gestalt ihres Mannes. „Siehst du ihn?“, fragte sie ungläubig. „Er hat die Ziegen heimgebracht, aber er ist nicht zu sehen.“
Reginald straffte sich und schritt entschlossen auf den Brunnenplatz hinaus. „Schluss jetzt!“, donnerte er mit lauter Stimme, so dass die Ziegen am Trog zusammenfuhren. „Erni, hör´auf mit diesem Spielchen! Zeig‘ dich, Junge!“
Der Bauer stand nun am Brunnenschacht und beobachtete, wie das Zugseil langsam mit dem gefüllten Schöpfkübel hochglitt, das andere Seilende legte sich in Schlingen auf den Boden. Aber es war niemand da, der Hand anlegte.
„Was ist denn bloss, Vater“, hörte er Ernis beschwichtigende Stimme unmittelbar neben sich. Sie bebte vor Anstrengung, und dann erreichte der Kübel den Brunnenrand. „Ich habe mich etwas verspätet, es tut mir leid. Aber ich tränke nur noch rasch die Tiere, dann treibe ich sie ein“, hörte er Erni japsen. „Was soll denn diese Aufregung, Vater. Warum stehen die Leute alle da und machen solche Gesichter?“
Reginald trat an den Brunnenrand und sprach mit Nachdruck zu seinem unsichtbaren Jungen. „Höre mir jetzt gut zu, Erni. Kannst du mir erklären, warum du hier die Ziegen tränkst und mit mir sprichst, während du nirgends zu sehen bist?“
„Aber ich stehe doch hier vor dir, Vater“, lachte der Hirtenjunge ungläubig. „Schau, jetzt leere ich den Kübel in den Trog.“ Und schon flog der Holzeimer wieder durch die Luft und bahnte sich den Weg zwischen den drängelnden Ziegen hindurch.
Reginald erhob drohend seine tiefe Stimme. „Wo bist du heute Nachmittag gewesen, Junge? Bist du etwa auf eine Beldenwurz getreten oder unbemerkt in einen Feenring gestolpert?“
Ernestus’ Mutter war dazu gesprungen und sprach beschwörend auf den unsichtbaren Jüngling ein. „Es ist ein besonderer Tag heute, Erni. Bist du vielleicht zu nahe an den Bannhag herangegangen? Warst du wieder am Flüsterbach?“
Der Schöpfkübel hatte sich entleert und blieb unvermittelt in der Luft über dem Trog hängen.
„Ich war an einem schönen Waldweiher und habe dort ein Rabennest ausgenommen“, erklärte Ernis Stimme verlegen.
Reginald und Hertlind schauten einander betreten an. „Hast du dort etwas gefunden“, fragte Ernestus’ Vater nach einer Weile forschend. „Hast du etwas aus diesem Nest entwendet?“
„Nur dieses Steinchen“, kam die Antwort des Jungen vom Tränkbecken. Unvermittelt tauchte ein kleiner Kiesel vor Ernestus’ Eltern auf und schwebte ruhig in der Luft. Er war rund wie ein Ei und schimmerte weiss wie reiner Marbelstein16.
Reginald ergriff den Stein und zog ihn an sich.
Da schrie Hertlind auf und wich einen Schritt zur Seite. Ein verblüfftes Raunen lief durch die Versammelten am Rand des Brunnenplatzes. Reginald sah Erni nun plötzlich ganz deutlich neben seinen Ziegen stehen. In seiner Rechten hielt er den leeren Schöpfeimer. Der Hirtenjunge bot den gewohnten Anblick, nur dass er den Kopf gesenkt hielt und ein verstörtes Gesicht machte. Seine Mutter stützte sich derweil neben ihm auf den Brunnenrand und rang sichtlich um ihre Fassung.
„Reginald, wo bist du denn nun? Hast du den Stein?“, keuchte sie ungläubig.
„Ich halte ihn in meinen Händen, mein Lieb“, bestätigte Reginald ruhig. „Er ist ganz warm. Woher hast du das Ding, Erni? Wo hast du dieses Rabennest gefunden?“ Er wandte sich zu seiner Frau um, die immer noch misstrauisch die Stirn runzelte und ihn wie ein Gespenst ansah. „Ich bin hier und halte den Stein. Es scheint ein Zauber auf ihm zu liegen.“
Reginald legte den Kiesel vorsichtig auf den Brunnenrand und da zuckte Hertlind abermals zurück. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie Erni ein Grinsen unterdrückte. Die umstehenden Leute flüsterten aufgeregt miteinander.
Nun trat Gersewîn, der stämmige Schmied von Calamis, mit ausgreifenden Schritten hervor und näherte sich dem Brunnen. Das heisst, er kam auf die Stelle zu, wo sich der Brunnen eigentlich hätte befinden müssen. Denn mitten auf dem Dorfplatz klaffte nur mehr ein gähnendes Loch, in dessen dunkler Tiefe das Wasser schimmerte. Der gemauerte Brunnenrand, das Holzgerüst mit der kunstvoll geschnitzten Umlenkrolle, das Seil und der Schöpfkübel waren allesamt verschwunden. Bloss der kleine, weisse Stein war immer noch da und schwebte an jener Stelle, wo ihn Reginald hingelegt hatte, als leicht flimmernder Fleck in der Luft.
„Jetzt bist du wieder zu sehen, Rego“, brummte der Schmied, dessen klobige Gestalt sich zu Reginald und seiner Frau gesellte. „Aber der Brunnen ist weg. Was ist das für ein vermaledeiter Stein?“
Reginalds Frau schien den ersten Schrecken überwunden zu haben und sprach eindringlich auf die beiden Männer ein. „Eine Feengabe“, hauchte sie, „Erni hat diesen Zauberstein am Vorabend der Beldennacht gefunden. Jetzt, wo die Tore offenstehen. Das ist gewiss ein Zeichen der Hohen Elbe Helva.“
Reginald lächelte grimmig. Dass seine Frau das Ganze als Wunderwerk der sagenumwobenen Feenkönigin Helva deutete, verwunderte ihn nicht. Nach althergebrachter Auffassung standen zu gewissen Zeiten im Jahr die Pforten in das Anderland der Feen und Elbischen offen. Davon wussten die Alten manche wunderliche Geschichte zu erzählen. Genauso wie über das Dämmerland Nuithônia, wo angeblich ungesehene Eingänge in ein verzaubertes Reich hinter dem grünen Hag schlummerten. Dass man die verwunschene March nicht überschreiten durfte, war seit Menschengedenken dringliches Gebot. Sogar der Herr Luitolf bestand darauf, den alten Bann zu achten, obgleich er sonst dergleichen Überlieferungen mit Schimpf und Schande bedachte.
Reginald sah seinen Jungen nachdenklich an. „Erni, warst du heute wieder am Flüsterbach? Hast du etwa das Gebot missachtet?“
Dem Hirtenjungen war es merklich unwohl zumute. Er wand sich unter Reginalds strengem Blick und stammelte etwas Unverständliches vor sich hin.
„Sprich, Junge, warst du drüben?“ Reginald packte seinen Sohn mit beiden Händen an den schmächtigen Schultern und schüttelte ihn kräftig. „Warst du auf der anderen Seite des Flüsterbaches, sag´es mir!“
Ich sollte diesem unfolgsamen Lümmel eine ordentliche Tracht Prügel verpassen, fuhr es Reginald durch den Kopf. Soweit hat es ja kommen müssen, nachdem er sich in letzter Zeit wiederholt an der Alten March herumgetrieben hat.
Erni sackte unter dem festen Griff seines Vaters förmlich zusammen. „Es ist wegen Volda“, quengelte er, „sie ist mir entwischt und über den Bach gesprungen.“ Nun erzählte der Junge seinen Eltern und den umstehenden Dorfbewohnern sein merkwürdiges Erlebnis am Waldweiher hinter dem Bach.
Einige Mädchen hatten sich im Hintergrund versammelt und tuschelten verhalten miteinander. Reginald sah, dass auch die Tochter des Schmieds dazugekommen war. Aus wachen Augen sah sie zu ihnen herüber und strafte das Kichern und Gackern der anderen Mädchen mit Missachtung. Der Bauer wusste, dass sein Sohn grosse Stücke auf Anathêna hielt.
Der Schmied räusperte sich, nachdem Ernestus seinen Bericht beendet hatte, und sah Reginald tief in die Augen. „Und was ist jetzt mit unserem Brunnen?“, polterte er, „Hat dein Sohn unseren Dorfbrunnen verhext?“
Hertlind legte dem sichtlich ungehaltenen Essenmeister versöhnlich die Hand auf den Arm. „Sei ohne Sorge, Gersewîn, wir nehmen den Stein wieder weg, und du siehst den Brunnen gleich wieder. Er ist noch da. Der Zauber des Feensteins macht ihn bloss unsichtbar.“
„Das glaubt der Teufel!“, erwiderte Gersewîn, der Schmied, unwirsch. „Wer weiss, was nun aus unserem Brunnen geworden ist. Womöglich ist sein Wasser ungeniessbar.“
Reginald wusste, dass der bärenstarke Mann durch unerklärliche Erscheinungen rasch aus der Fassung zu bringen war. Deshalb war er für die Ideen der Kleruspriester auch besonders empfänglich. Dem Obmann der Bauern von Calamis war klar, dass dieses Vorkommnis reichlich Unfrieden stiften konnte, wenn er jetzt nicht besonnen handelte. Dass dem Stein ein Zauber innewohnte, war unleugbar. Soweit er die Sache einschätzen konnte, entzog dieser kleine, weisse Kiesel allem, was mit ihm in Berührung kam, die äussere Erscheinung. Das war soweit ziemlich harmlos. Reginald fragte sich freilich, ob noch andere Kräfte in dem unscheinbaren Stein schlummerten.
Das war ihm zu unberechenbar. Wenn der Landherr oder die Kleriker von diesem Geschehen Wind bekamen, mochte das einen unangenehmen Aufruhr geben. Am besten war es, den verdächtigen Kiesel so rasch als möglich aus dem Weg zu schaffen.
„Ich werde mich darum kümmern“, beschied Reginald und griff nach dem Stein, der auf dem unsichtbaren Brunnenrand scheinbar immer noch in der Luft hing. Kaum hatten sich seine Finger um den Kiesel geschlossen, nahm der Brunnen wie aus dem Nichts wieder Gestalt an.
Gersewîn prallte zurück und schnaufte ungläubig. Reginald konnte sich ein Kopfschütteln nicht verkneifen. Dass dieser raubeinige Mann so leicht zu erschrecken war. Nun ja, er hatte lange Zeit in den Diensten der königlichen Familie gestanden. Womöglich hatte er dort Dinge gesehen, die weit über seinen schlichten Verstand hinaus reichten. Jedenfalls sprach er nie darüber.
Und im Dorf wusste auch niemand, wer wirklich Anathênas Mutter war. Als der Schmied vor einigen Jahren nach Calamis zurückgekehrt war, hatte er seine Tochter alleine mitgebracht.
Reginald hielt den Stein fest umklammert und wandte sich wieder an die Leute, die ihn nun mit offenen Mäulern anstarrten, als seien ihm unvermittelt Bockshörner aus den Schläfen gesprossen.
Der Bauer schmunzelte, als ihm bewusst wurde, dass er ja nunmehr wieder aus ihrem Blickfeld entschwunden war. Deshalb sprach er die verdutzten Dorfbewohner ruhig an: „Ich bin immer noch da. Wir wissen nun, dass der Stein jeden und alles unsichtbar macht, was mit ihm in Berührung kommt. Ich will keinen Ärger mit diesem Ding. Deshalb werde ich jetzt hinüber zum See gehen, Erkharts Weidling17 einwassern und so weit wie möglich hinausrudern. Dort wo der See am tiefsten ist, versenke ich den Stein. Und dann haben wir wieder Ruhe.“
Reginald sah, wie Gersewîn, der Schmied entgeistert aufbegehrte. „Und was ist, wenn dann der ganze See aus unseren Augen verschwindet?“
„Das wird er bestimmt nicht“, liess sich Reginald ungerührt vernehmen. „Der See ist zu gross und zu mächtig. Vielleicht verschluckt ein Fisch den Schmäh, und der lebt dann seine restlichen Tage unbehelligt und unsichtbar im grossen Moredûn.“
Zufrieden sah Reginald, wie die meisten Leute auf den Scherz eingingen. Bloss seine Frau Hertlind schaute nachdenklich in seine Richtung.
„Und wenn Erni uns ein Feengeschenk nach Hause gebracht hat?“, wisperte sie ihm zu. „Wir sollten es nicht vorschnell verwerfen.“
Reginald beugte sich zu seiner Frau hinab und raunte ihr ins Ohr. „Ich will nicht, dass jemand Unfug treibt mit diesem Ding. Wenn ich den Stein in den See werfe, können ihn die Feen wieder an sich nehmen. Das weite, unergründliche Wasser ist genauso ihr Reich wie der tiefe Wald.“ Er sah zu Erni hinüber, der immer noch bei den Ziegen stand und der alten Volda den Hals tätschelte. Der Junge schien durcheinander zu sein, weil er im Dorf ein solches Aufsehen verursacht hatte. Er blickte betreten vor sich hin. Irgendwie war ihm aber auch Erleichterung anzusehen. Reginald würde die Angelegenheit nun wieder ins Lot bringen. Er wusste, dass es das Beste war, diesen Stein rasch loszuwerden.
Er verabschiedete sich von seinen Leuten und schritt zügig davon.
Mit rauschenden Schwingen erhob sich ein silbergefiederter Reiher über die dürren Schilfhalme, die dicht an dicht das Seeufer bestanden. Reginald konnte das grosse Wasser bereits riechen. Auf einem schmalen Sumpfpfad war er von Erkharts Hütte her geradewegs in das Röhricht vorgedrungen.
Den weissen Zauberstein hatte er vor seiner Aufwartung bei dem Fischer wohlweislich in einem hohlen Baumstrunk verborgen. Nach den Geschehnissen am Brunnen wollte er kein zusätzliches Aufsehen mehr erregen mit dieser ungeheuerlichen Sache. Reginald war weithin wohlgelitten, er hielt in Calamis ein respektables Amt inne, deshalb hatte es ihn nicht viel Mühe gekostet, den alten, weissbärtigen Zausel dazu zu bewegen, ihm seinen Weidling für eine kurze Weile zu überlassen. Natürlich hatte Erkhart Fragen gestellt, was es denn am Vorabend der Beldennacht so Dringliches auf dem Moredûn zu erledigen gebe. Reginald hatte klar und bestimmt erläutert, es gelte etwas loszuwerden. Er hatte dem Fischer als Gegenleistung ein Mässlein Korn versprochen.
Zuerst hatte sich der Krauterer gesträubt und ihm ans Herz gelegt, nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt auf das Wasser hinaus zu fahren. Die Wasserfrauen seien wild und aufsässig in dieser Nacht. Und in den umliegenden Sümpfen rege sich allerlei Gelichter. Da hatte Reginald sein Angebot auf einen halben Vierling erhöht und den Fischer dahingehend beschwichtigt, er werde sich ohnehin nicht lange mit dieser Angelegenheit aufhalten.
Nun hatte er das Seeufer erreicht. Unter einer uralten, knorrigen Weide, umgeben von einem undurchdringlichen Schilfwald, lag Erkharts Nachen vertäut. Reginald warf einen Blick über die weite, offene Wasserfläche.
Auf der anderen Seite erhob sich der Berg Wistlis aus den Sümpfen. Er war weitherum die höchste Erhebung in diesem flachen Marschland zwischen den Grossen Seen. Die Altvorderen hatten auf seiner trockenen Anhöhe einst eine Stadt erbaut. Doch inzwischen war sie zerfallen, ob von ihren Bewohnern verlassen oder in einem längst vergessenen Krieg zerstört, er vermochte es nicht zu sagen.
An den südostwärts gerichteten Hängen konnte er deutlich die Weinreben erkennen, die sich in langen Reihen gegen die Höhe hinaufzogen. Seit den Tagen der Romanen wurde an diesem Gestad des Moredûn ein vortrefflicher Wein gekeltert. Die Bewohner von Lugnaurum auf der anderen Seeseite waren begnadete Winzer. Die Noblen des Landes würden heute Nacht in ihren Burgen rund um den See wieder viel von diesem Rebensaft saufen. Die meisten von ihnen verachteten die berauschenden Trünke, welche das Volk aus den neun überlieferten Kräutern braute, um den Geist der Vollmondnacht am Sommerbeginn zu zelebrieren. Aber was wussten diese eitlen Popanze schon von den alten Bräuchen. Sie hingen ihren belesenen Buchpriestern an den Lippen und erahnten nicht, was ihre Untertanen draussen im Land wirklich umtrieb.
Vorsichtig schob Reginald den Weidling, der aus einem einzigen grossen Eichenstamm gehauen war, in das dunkle Wasser hinaus.
Mückenschwärme tanzten in der lauen Abendluft. Im Schilf erhoben die Frösche ihr ohrenbetäubendes, vielstimmiges Raunzen. Ein friedlicher Abend, der auf einen guten Sommer hoffen liess. Wenn nur die Sache mit diesem unseligen Stein nicht wäre. Reginald mochte es gar nicht, wenn er und seine Angehörigen zum Gespräch in Calamis gemacht wurden. Wenn er das Zauberding rasch aus der Welt schaffen konnte, mochte sich die Aufregung bald wieder legen. Er zählte sowieso darauf, dass die Feierlichkeiten der bevorstehenden Nacht, die Ausgelassenheit und die Berauschung am Feuer, das Vorkommnis rasch aus der Erinnerung der Dorfbewohner tilgen würden. Vielleicht war das sein Glück. Die Beldennacht erfasste die Gemüter der Menschen jeweils wie eine verzückende Woge und schwemmte jeglichen verkrusteten Kummer und die letzten Verstockungen des vergangenen Winters aus ihren Adern hinfort.
Mit ruhigen Zügen senkte Reginald das Ruder in das Wasser und stiess sich vom Ufer ab. Das Boot schwankte leicht, aber die Wasseroberfläche lag völlig unbewegt da, nicht die geringste Brise kräuselte den See. Mit kraftvollen Ruderschlägen hielt der Dorfmeier von Calamis hinaus auf das offene Wasser, den Berg voraus im Auge behaltend. Wenn die Fischer aus dieser Gegend die tiefgründigen Bereiche des Sees aufsuchen wollten, entfernten sie sich soweit vom Ufer, bis sie die Türme der alten Festung Moredûn im Süden auftauchen sahen. Dieser Ort hatte dem See einst seinen Namen verliehen, und dem Gerede der Alten zufolge war er älter als das vergangene Reich der Romanen und ihre Provinz Helvetia. Vielleicht älter noch als die Mauern der grossen Stadt Aventia südlich des Sees.
Auf der Hochfläche des Wistlis regte sich etwas. Eine grosse Anzahl Leute schichtete dort den Holzstoss auf für das Beldenfeuer. Traditionellerweise nahmen sie dazu neunerlei Hölzer.
Jetzt trieb Reginald mitten im See. Das reichte. Hier wollte er den Stein versenken und dieser bösen Sache ein Ende bereiten. Erni würde er sich noch zur Brust nehmen müssen. Dass er das Gebot übertreten hatte, war absolut untolerierbar. Heute Nacht würde ihm die Feier eine Aussprache wohl nicht erlauben. Aber morgen würde er dem unfolgsamen Burschen eine gehörige Abreibung verpassen. Wenn nötig würde er den Bengel am hellichten Tag Sternlein schauen lassen, damit er sich nie wieder eine derartige Unverfrorenheit erlaubte.
Reginald klaubte den Stein aus seiner Wamstasche hervor. Hoffentlich hatte ihn niemand beobachtet. Ein Nachen, der sich von selbst auf den See hinaus ruderte, würde unwillkürlich Aufsehen erregen. Nun, an diesem Abend mochte man derlei Vorkommnisse wenigstens auf die Wunderkraft der Beldennacht schieben können.
Im letzten Abendlicht wollte er den elbenweissen Stein noch einmal betrachten, bevor er sich seiner entledigte.
Der Dorfmeier von Calamis erschrak.
Der Stein, den er in Händen hielt, war auf einmal schwarz wie Rabengefieder. Er hatte dieselbe vollendete Form wie zuvor, und er lag genauso warm und prickelnd in seiner Hand, aber seine Farbe hatte sich gewandelt, als wäre er in Pech getaucht worden.
„Ihr Götter!“, keuchte er, „was ist das für ein verwunschenes Ding?“ Er spürte, wie ein Anflug von Furcht sein üblicherweise tapferes Herz zusammenkrampfte. Ohne Zweifel, dieser Stein entstammte nicht der Welt, die er kannte. Ob er wohl einen Fehler beging, wenn er ihn einfach im Wasser verschwinden liess?
Seine Frau hatte ihn beschworen, nicht voreilig zu handeln. Eine Feengabe hatte sie den Stein genannt. Wer wusste schon, ob das Volk der Faë überhaupt existierte? Ihm war noch keines von den elbischen Wesen je über den Weg gelaufen. Und er hatte auch nicht gehört, dass sich diesseits von Nuithônia letzthin eine solche Begegnung ereignet hätte. Vielleicht ging die Zeit der Feen einfach zu Ende, so wie auch das alte Brauchtum unter den flammenden Predigten der neuen Kleruspriester zunehmend zerbröckelte. Wenn die Frauen in Calamis nicht wären und ihr gefestigter Sinn für Kraft und Bedeutung der Überlieferung, würde heute Nacht vielleicht kein Rauschfeuer entzündet und kein Beldentrunk herumgereicht. Vielleicht.
So wie er das emsige Treiben oben auf dem Wistlis beobachtete, war er sich dessen freilich nicht sicher. Möglicherweise waren die Kräfte der alten Welt immer noch stärker und lebendiger, als er erahnte, und sie würden nicht so rasch verstummen. Zumindest in der Seele des Landvolkes hatten die altvorderen Götter und Geister noch immer ihren festen Platz. Möglicherweise schauten ihm die Faë jetzt gerade zu bei seinem… Frevel.
„Ihr Götter, nehmt diese Gabe als Opfer für die Beldennacht!“, schrie er unvermittelt und schwang den Wurfarm weit nach hinten, um den verfluchten Kiesel mit aller Kraft in den See hinaus zu schleudern. In hohem Bogen flog das Ding auf den Wistlis zu.
Mit einem vernehmlichen Platschen landete das Geschoss im Wasser.
Reginald stockte der Atem.
Unter der Wasseroberfläche breitete sich ein helles Licht aus und schoss in alle Richtungen davon. Ein dumpfes Gurgeln schwoll in der Tiefe an.
Reginald warf sich der Länge nach in den Kahn, ehe sich ein schäumender Wasserturm aus dem See hochwölbte und auf alle Seiten niederflutete. Die Woge erfasste den Weidling und stiess ihn wie eine zornige Faust von sich. Das Boot schlingerte hin und her und drohte einen Moment lang zu kentern. Der Mann wäre bestimmt in das Wasser gestürzt, wenn er nicht Zuflucht auf dem Kahnboden gesucht hätte.
Mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen sah Reginald, wie aus heiterem Himmel ein gleissender Lichtblitz auf den See herniederstach und unweit seines Standortes zischend in das Wasser hineinfuhr. Noch einmal spritzten Wasserfontänen auf und bedeckten den vor Angst schlotternden Mann mit einem nassen Schwall. Ein gedämpftes Grollen drang aus den Wassertiefen herauf, als würde dort unten eine unbändige Riesenkreatur toben. Die Wellen breiteten sich in alle Richtungen aus und verebbten allmählich. Das brodelnde Geräusch vom Seegrund verstummte, und nach einigen Augenblicken kehrte wieder Ruhe ein auf dem See.
Fassungslos starrte Reginald über den Bord des Weidlings auf die Stelle, wo der kleine Stein versunken war.
Welche Mächte hatte er entfesselt?
Rasch setzte er sich auf, ergriff das Ruder und wandte den Kahn wieder in die Gegenrichtung. Durchnässt bis auf die Knochen und getrieben von einer plötzlichen Unrast, ruderte er das Boot so schnell wie möglich an das Ufer zurück.
Dabei bedrückten ihn nagende Zweifel, ob er wirklich das Rechte getan hatte.
ngestrengt blickte Ernestus nach Süden. Er konnte den Reiter noch nicht erspähen. Von Moredûn herauf müsste er längst über den Hügel kommen. Es war Zeit.
Das letzte Abendlicht verdämmerte bereits hinter dem langgezogenen Waldrücken des Jôr. Der Gesang unter den Linden schwoll an, als wolle er durch seine Kraft den ersehnten Reiter herbeilocken. Die Frauen und Mädchen von Calamis waren allesamt liebreizend anzuschauen. Sie trugen Gewänder aus gebleichtem Leinen, mit roten Stickbordüren und leuchtenden Bändern verziert, die nur anlässlich der Hohen Feste aus den Kleidertruhen hervorgeholt wurden. Dazu hatten die Dorfbewohnerinnen ihren schönsten Schmuck umgelegt. Die älteren Frauen trugen prachtvolle Erbstücke ihrer Ahnherrinnen, Halsketten und Stirnreifen, die aus aneinandergereihten, silbernen Kugeln und Plättchen bestanden. Ihre Töchter hatten sich mit schlichteren Anhängern geschmückt, aus Horn, Bein und harten Hölzern geschnitzt, mit bunten Federn, Bändern und Glastränen geziert. Ihr Haar trugen sie kunstvoll geflochten und mit Blütenkränzen umwunden. Den ganzen Tag hatten sie dafür aufgewendet, sich schön zu machen für diese eine Nacht.
Vorhin beim Brunnen, als er die Sache mit dem Stein über sich hatte ergehen lassen müssen, hatte Ernestus geglaubt, der ganze Zauber dieser Feier sei nun zunichte gemacht durch den unglückseligen Zwischenfall. Zum Glück hatte er sich getäuscht. Kaum war sein Vater mit dem Zauberstein verschwunden gewesen, hatte sich die Aufregung bald wieder gelegt und die Leute waren in ihre Häuser zurückgekehrt, um die letzten Vorbereitungen zu treffen.
Seine Grossmutter hatte die Arbeiten zuhause schon seit Tagen mit klaren Anweisungen angeleitet. Ihre Augen hatten wieder dieses geheimnisvolle Leuchten angenommen, wie immer, wenn sie die Hohen Feste im Jahresrad beging. Bereits als junges Mädchen hatte sie den alten Bräuchen gehuldigt. Und nun gab sie das Feuer ihrer innigen Begeisterung weiter. An Ernis Mutter Hertlind und an seine Schwestern Rûnhild und Mandraë. Auch Tante Beldwîna konnte dem allgemeinen Eifer nicht entrinnen. Sie war wohl schon in die Jahre gekommen, und ihr krankes Bein bereitete ihr Beschwerden. Deswegen würde sie nur schwerlich tanzen können in dieser Nacht. Aber jetzt sang sie mit glockenheller, klarer Stimme.
Die Lieder, welche die Frauen immer sangen am Beldenabend, um den Sommerkönig herbeizurufen.
Wo er wohl ausblieb? Wusste er etwa nicht, dass sie auf dem Lindenhügel ausserhalb des Dorfes feierten?
Um den Landherrn nicht zu verärgern, war bereits vor etlichen Jahren beschlossen worden, die alten Feste fernab der Hütten und Höfe zu begehen. Die Leute von Calamis wussten, dass ihr Edelherr gegen die alten Riten eingenommen war und seine Untertanen lieber an den Messen seines neuen Predigers versammelt sah. Einige wenige Leute aus dem Dorf folgten seinem Aufruf. Gersewîn, der Schmied gehörte beispielsweise dazu. Der war folgedessen heute auf dem Hügel nicht anzutreffen. Der Gedanke daran schnitt Ernestus ins Herz.
Nicht dass er den grantigen Rauschebart vermisst hätte. Mitnichten, aber sein Ausbleiben bedeutete leider auch, dass seine Tochter Anathêna nicht hier sein konnte. Ihr grimmiger Vater hatte es ihr strengstens verboten, den Feiern des Alten Kultes beizuwohnen. Dabei hätte er heute gerne mit ihr am Rauschhorn genippt und die ganze Nacht hindurch getanzt. Er malte sich das Mädchen aus in einem weissen Festkleid. Mit seinen goldenen Zöpfen und den klaren, wachen Augen. Er bedauerte zutiefst, dass er die Erfahrung dieser feierlichen Nacht nicht mit ihr teilen konnte.
Er hatte sie vorhin am Dorfbrunnen gesehen. Sie war dagewesen und hatte die Auseinandersetzung um den weissen Stein sorgenvoll mitverfolgt. Wenn er ihr nur erklären könnte, dass alles wieder gut würde und sein Vater die Sache inzwischen gewiss zurechtgebogen hätte.
Das hoffte er zumindest. Denn seit dieser sich zu Erkharts Fischerhütte aufgemacht hatte, war er nicht wieder aufgetaucht.
„Da, er kommt“, rief Ernestus’ Grossmutter mit strahlenden Augen und deutete hinter die Hecken Richtung Süden. Der ersehnte Sommerkönig war endlich aufgetaucht! Das Land war zwar bereits in die Schatten der einbrechenden Dämmerung gehüllt, aber der helle Schimmer des weissen Pferdes war durch seine Bewegung deutlich auszumachen. Zudem schwenkte der Reiter zur Begrüssung den Arm.
„Erhebt eure Stimmen, ihr Maiden“, feuerte Grossmutter die jungen Mädchen an. „Stellt euch zwischen die Feuer und reicht dem Sommerkönig zum Empfang das Trinkhorn.“
Zwei Feuer brannten auf dem Hügel unweit der Linden. Sie standen gerade so weit voneinander entfernt, dass man zwischen ihnen hindurch huschen konnte. Es stärkte die Lebenskraft, wenn man zwischen den Feuerlohen hindurch tanzte - und es verhiess überdies gute Gesundheit übers Jahr. Deshalb wollten einige der Bauern in dieser Nacht auch ihr Vieh zwischen den Feuern hindurchtreiben, um es für das kommende Jahr gegen Krankheit und Unbill zu feien. Mit seinem Bruder Ulfgâr hatte Ernestus Vaters Ziegen und Schweine hochgetrieben. Der Ältere stand unverwandt in der Nähe und behielt ein wachsames Auge auf der Herde.
Nun begannen die Trommeln zu schlagen, der durchdringende Klang von Luren18 liess Ernestus erschauern. Der Chor der Sängerinnen steigerte sich zu einem stürmischen Funkenwirbel.
Wie ein Held aus einer alten Sage ritt der Sommerkönig unter den Linden ein. Es war heuer ein Bursche aus Kurmalis. Stattlich sah er aus in seinem lindgrünen Wams mit den breiten, weissbordierten Schulterbesätzen und mit der antiken, güldenen Torque19 um den Hals. Ein Kranz aus geflochtenen Weissdornzweigen schmückte seine Stirn wie eine lebendige Krone. In einer Hand hielt er ein gefülltes Trinkhorn. Der Brauch wollte es, dass er in jedem Dorf ein Horn abgab und dafür ein neues an sich nahm. So verbreitete sich der Rauschtrunk rund um den See, und auch wenn jede Dorfgemeinschaft für sich feierte, so machten die Hörner in des Reiters Hand doch die Runde und festigten die Verbundenheit unter den Bewohnern der Seedörfer.
Rûnhild eilte dem grünen Reiter entgegen. Ihr wurde heute Nacht die ausgesuchte Ehre zuteil, den Sommerkönig mit dem Trunk ihres Heimatdorfes zu beschenken. Und wenn er ihr gefiel, konnte sie sich zu ihm in den Sattel gesellen. Vorausgesetzt der Platz war noch frei.