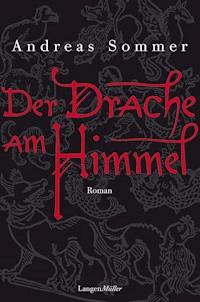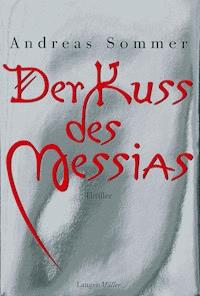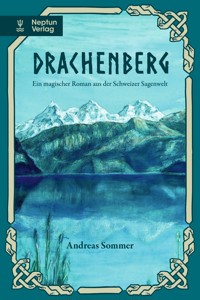17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neptun Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
«Dieses gefrässige Ungeheuer spottet der Schöpfung in höchstem Masse. Es fällt über die Abkömmlinge von Adam und Eva her, wie es ihm beliebt, und verschlingt sie mit Haut und Haar, sobald es ihrer habhaft wird. Es nennt sich selbst die Rauels und es hält sich für die Königin aller Waldteufel, Druden und Wilwisse. Das ist auch der Grund, warum dieser markante Hügel mit seinen zwei Kuppen gemeinhin als Drudenberg bezeichnet wird. Denn hier hat die Rauels ihre Heimstatt.» Die Handlung knüpft direkt an die Ereignisse von Band I an. Ernestus und Anathêna erhalten im Feenreich Helisee von einer undurchschaubaren Wasserelbe den geheimen Auftrag, nach Birgunt zurückzukehren und dort den wieder aufgetauchten Helistein in Gewahrsam zu nehmen. Auf dieser gefahrvollen Reise werden sie an den unheimlichen Drudenberg verschlagen, wo sie unabsichtlich an einen jahrhundertealten Feenfluch rühren und in die tragische Geschichte eines unglücklichen Ritters hineingezogen werden… Gleichzeitig verkündet Magister Erastrius, Eingeweihter in die alten Mysterien und Prophetien, dass ein kleines Mädchen aus Helikum dazu ausersehen ist, gemeinsam mit einem adligen Sänger vom Wendelsee den Fluch des Drudenberges zu brechen. Das ungleiche Gespann muss sich zunächst zusammenraufen und sieht sich in der Wildnis Nuithônias vielfachen Herausforderungen gegenübergestellt, denn die Menschenfresserin ist beileibe nicht die grösste Gefahr, welche vom Drudenberg ausgeht. Und einmal mehr stellt sich heraus, dass Ernestus, der Sohn der Feenkönigin, und der rätselhafte Helistein eine tragende Rolle im Treiben der Schicksalsmächte spielen. Zahlreiche Motive aus der Schweizer Sagenwelt und aus der keltisch-germanischen Überlieferung verspinnen sich zu einer märchenhaften Erzählung um einen uralten Bund zwischen Menschen und Feen. Ein farbenprächtiger Reigen innerer Mythenbilder und sagenhafter Gestalten. Helvetic Fantasy mit tiefen Wurzeln in realer Historie, Mythologie und Landschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1224
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Zahlreiche Motive aus der Schweizer Sagenwelt und aus der keltisch-germanischen Überlieferung verspinnen sich zu einer märchenhaften Erzählung um einen uralten Bund zwischen Menschen und Feen. Ein farbenprächtiger Reigen innerer Mythenbilder und sagenhafter Gestalten.
Helvetic Fantasy mit tiefen Wurzeln in realer Historie, Mythologie und Landschaft.
Die Handlung knüpft direkt an die Ereignisse von Band I an. Ernestus und Anathêna erhalten im Feenreich Helisee von einer undurchschaubaren Wasserelbe den geheimen Auftrag, nach Birgunt zurückzukehren und dort den wieder aufgetauchten Helistein in Gewahrsam zu nehmen. Auf dieser gefahrvollen Reise werden sie an den unheimlichen Drudenberg verschlagen, wo sie unabsichtlich an einen jahrhundertealten Feenfluch rühren und in die tragische Geschichte eines unglücklichen Ritters hineingezogen werden...
Gleichzeitig verkündet Magister Erastrius, Eingeweihter in die alten Mysterien und Prophetien, dass ein kleines Mädchen aus Helikum dazu ausersehen ist, gemeinsam mit einem adligen Sänger vom Wendelsee den Fluch des Drudenberges zu brechen. Das ungleiche Gespann muss sich zunächst zusammenraufen und sieht sich in der Wildnis Nuithônias vielfachen Herausforderungen gegenübergestellt, denn die Menschenfresserin ist beileibe nicht die grösste Gefahr, welche vom Drudenberg ausgeht.
Und einmal mehr stellt sich heraus, dass Ernestus, der Sohn der Feenkönigin, und der rätselhafte Helistein eine tragende Rolle im Treiben der Schicksalsmächte spielen.
Über den Autor
Andreas Sommer lernte als langjähriger Tour Guide in der Sahara an den Lagerfeuern der Tuareg die Erzählkultur und die magische Wirkung von überlieferten Geschichten kennen, ehe er begann, die heimische Sagentradition zu erforschen. Heute ist er als Erzählkünstler, Wanderführer und Autor bestrebt, an die ursprüngliche Verbundenheit von Natur und Menschenseele zu erinnern. 1976 in Bern geboren, ist er mit den urwüchsigen Landschaften des Üechtlandes von Kindsbeinen auf vertraut. Er lebt mit seiner Familie in einem alten Bauernhaus am Fuss der Berner Voralpen.
www.animahelvetia.ch
Über den Illustrator
Martin Aeschlimann, 1972 geboren, im Üechtland aufgewachsen. Heute, verheiratet und Vater von vier fast erwachsenen Kindern, betrachtet er das magische Land und die stolzen Häupter der Gantrischkette vom östlichen Aareufer aus.
Zeichner, Holzwerker, Hobbywinzer...und was sich das Leben sonst noch so einfallen lässt.
IMPRESSUM
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmassnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2025 by NeptunVerlag
Rathausgasse 30
CH-3011 Bern / Schweiz
www.neptunverlag.ch
ISBN 978¨3 85820 392 2
Dank
Allen Lesern des ersten Bandes, die mich ermutigt haben, die Saga fortzuspinnen
Daniel Vaucher für sorgfältiges Gegenlesen des Manuskripts und fundierte Kritik, die mir ermöglicht hat, die Endfassung dieses Bandes nochmals zu straffen und zu verdeutlichen
Mirjam Helfenberger für das stimmungsvolle Coverbild des Drudenberges (die Künstlerin lebt selbst am Fuss dieses sagenumwobenen Hügelzuges). Martin Aeschlimann für die Karten im historischen Stil und die toröffnende Innenillustration (auch er hat seine Wurzeln in Nuithônia). Dominique Bischofberger für die kreative Gestaltung von Satz und Layout (sie ist in der Magie des Waldes ebenso zuhause wie in den Layoutprogrammen). Kunst, Ästhetik und handwerkliches Geschick machen aus einer Buchstabensammlung erst ein ansprechendes Gesamtwerk
Roman Wild und dem Neptun Verlag für die Bereitschaft, den Ideen des Sagenwanderers wiederum den Weg zu einem neuen Buch zu ebnen und Nuithônia mithin fortleben zu lassen
Meiner Frau Nathalie und unseren Töchtern Eyana, Aliénor und Esmeralda, die mich immer wieder tagelang, nächtelang, wochenlang klaglos entbehren, wenn ich erneut auf Traumpfaden losziehe, um in Nuithônia neue Geschichtenfäden zu knüpfen. Es ist ein Geschenk, dass ich diese verwunschene Heimat mit Euch teilen darf!
Ich widme diesen magischen Roman
dem Grossen Lebensgewebe,
welches unser Land erfüllt
bis in die entlegensten Winkel,
und eine jede hier heimische Kreatur,
jeden Stein, jeden Wassertropfen, jeden Sonnenstrahl,
jeden Windhauch, jeden Gedanken und jeden Traum
in ein einzigartiges Wunderwerk einbettet
Drudenberg
«(...) Druden (idem Truden, Truten) sind gemesz heydnischer Conceptio eigenthuemliche Jungfrouwen und Priesterinnen, nach teuthonischem Sagenthum specialiter mit mannigfeltiger Zouberey behaftet. Praecisius in der Superstitio des ordinaeren Volkes sind D. daemonische und gar schröckliche Weybsgesthalten, die auf den Menschen hülfreych oder verderplich eynwirken. Die D. nehmen, similis den Alben, variable Formae an, per exempla von eyner Feder, Rauchwolken, Hummel, Schlange oder Kroethe. In olims Zeythen war der Glauben, dass unter dero sieben Toechtern eine D. seyn muesse, allso wie unter dero sieben Soehnen eyner eyn Wehrwolf seye (...)»
– Aus dem Liber de Angelis Daemonibusque in Christiano orbe des Armandus von Merseburg, 11. Jahrhundert, neuzeitliche Übersetzung aus dem Latein
«(...) Im Gau von Nuithônia aber, im Reichsteil Burgundia gelegen, soll in der Regierungszeit des guten Königs Dagobert auf dem Mons Drudarum, vulgo auch Trudenberg, Munt Simbelîn oder Guriganthis Castellum geheissen, eine Hexenkönigin ihr Unwesen getrieben haben. Postremo sei diese Teufelin mitsamt ihrem dämonischen Gefolge in einem veritablen Albenkrieg vergangen. Jegliche Spur von dem luziferischen Brodem wurde samt und sonders vom Antlitz der Gotteserde getilgt. Sanctus Dominus magnificatur! Der Gau Nuithônia blieb durch diesen Kataklymus indes dergestalt verwüstet zurück, dass seither ausser Erlen, Schlangenwurz und giftigem Gewächs nichts mehr auf seinem Boden gedeiht. Darob meidet ein jeder Sohn Adams, dessen Herz in Christo schlägt und dessen Seele nach dem Heil trachtet, bis auf den heutigen Tag diese verderbte Wildnis am Saum des Reiches (...)»
– Aus der Gesta Francorum des Fredegârius Scholasticus, Aufzeichnung der fränkischen Geschichte zur Zeit der Merowinger-Dynastie, 8. Jahrhundert, moderne Übersetzung aus dem Latein
Inhalt
Prolog
I
Drachenaugen und Purpurflügel
II
Milimindrum
III
Die Mär vom Ritter Uriân
IV
Uyôla Nebelsang und die Schwanentöchter
V
Die Feenburg
VI
Wolfsnacht
VII
Die Letzte Jagd
VIII
Die Rauels
IX
Der Neffe des Königs
X
Ulldraugfârn
XI
Gekreuzigt mit Silbernägeln
XII
Schatten der Vergangenheit
XIII
Amaldaïa
XIV
Das Mädchen und der Sänger
XV
Des Fischers Frau
XVI
Prophetie und Ballade
XVII
Im Auftrag des Chalifa
XVIII
Der Schwarze Keiler
XIX
Malefica
XX
Noctium Phantasmata
XXI
Die Erlkönigin
XXII
Schlafdorn
XXIII
Erben des Fluchs
XXIV
Lebensapfel
XXV
Tränen für einen Feenhelden
XXVI
Der Kuss der Prinzessin von Elesîr
XXVII
Auf den Pfaden des Zorns
XXVIII
Der Fluch der Katzenfrau
XXIX
Lupârius
XXX
Wenn Vater und Sohn sich entzweien
XXXI
Funtamûr
XXXII
Wuyvra
XXXIII
Die Spinnerin der Schicksalsfäden
Epilog
Nachtrag des Verfassers
Dramatis Personae
Spectaculi Loca
Karten des Königreiches Birgunt und der Landschaft Nuithônia befinden sich ganz vorne und hinten in diesem Buch.
Prolog
Die Beldennacht1 war erfüllt von einem sinnlichen Zauber, der unter dem Vollmond wie samtener Nebel durch den Wald wogte. Im Unterholz regten sich heimliche Wesen, deren huschende Schatten kein menschliches Auge wahrzunehmen vermochte. Doch den geschärften Sinnen der pirschenden Wildkatze blieb nichts verborgen. Sie sah die lebendigen Auren der umherstreifenden Geschöpfe überall als flimmernde Schemen um sich herum wimmeln. Im silbergesprenkelten Mosaik des nächtlichen Waldes boten sie ein faszinierendes Schauspiel.
Die Katze verschwendete ihre Aufmerksamkeit freilich nicht an belanglose Erscheinungen. Sie folgte zielsicher dem Ruf, welcher sie in der Abenddämmerung ereilt hatte. Es war ein Ruf, der keinen Widerspruch duldete. Allzu gut war ihr die gestrenge Macht vertraut, welche dahinter waltete. Deshalb bahnte sie sich mit geschmeidigen Sätzen einen Weg durch den verschlungenen Unterwuchs im ungezähmten Urwald von Nuithônia. Welch bestechender Vorteil, dass die samtpfotige kleine Jägerin das unbemerkte Unterwegssein in der Wildnis meisterhaft beherrschte.
Als sie zuvor aus dem verschwiegenen Abgrund der Schlucht hochgestiegen war, hatte sie einen kreisenden Schatten über ihrem Kopf bemerkt. Kein Nachtvogel war es gewesen. Eher ein ungewöhnlich gross gewachsener Rabe. Was dieser düstere Geselle entgegen seiner Gewohnheiten mitten in der Nacht dort zu schaffen gehabt hatte, war ihr schleierhaft geblieben. Dabei wusste sie wohl, dass es in diesem Land viele wundersame Wesen gab, die ihr äusseres Erscheinungsbild nach Belieben wandeln konnten. Sie selbst war eines von ihnen. Denn in Nuithônia schmiegten sich die Feenlande mit ihren vielfältigen zaubermächtigen Einflüssen näher an die irdischen Gefilde als in jeder anderen Gegend weit und breit.
Später hatte sie auf ihrem Weg durch den Wald die Geruchsspur eines riesigen brandschwarzen Auerochsen gekreuzt. Geradezu erstickend waren ihr die widerlichen Ausdünstungen dieses Biestes in ihre empfindliche Nase gestochen. Das war kein gewöhnlicher Waldstier gewesen, dessen war sie sich sicher. Irgendetwas ungemein Bedrohliches war seinem Gestank angehaftet. Und vor allem Wut. Unbezähmbare Wut...
Nun näherte sie sich endlich dem Ursprungsort jenes Rufes, welcher sie zu dieser nächtlichen Reise veranlasst hatte. Zwischen dem Flechtwerk von Ästen und Ranken zeichnete sich eine klobige schwarze Masse im Gestrüpp ab. Es war ein ungewöhnlich grosser Felsbrocken, der an der oberen Kante einer steil abfallenden Böschung im Wald kauerte. Wie ein unförmiges Tier, das sich hatte zum Sprung ducken wollen und dabei unvermutet zu Stein erstarrt war. Weit unten, am fernen Fuss des Abhanges, dehnte sich ein breites Tal aus, durch welches sich mehrere Wasserläufe wie schimmernde Silberadern in den geschmolzenen Schatten wanden. Sie flossen der Arûra entgegen, jenem unbändigen Fluss aus dem Gebirge, welcher sich weiter östlich durch versumpfte Erlenbrüche wälzte.
Die Katze kannte diesen Ort. Hierhin hatte der verfluchte Zauberkünstler ihre Mutter gebannt, nachdem diese sich von ihm hatte überrumpeln lassen, damals in jener schicksalhaften mondlosen Nacht vor einem halben Jahrlauf.
Umso weniger erstaunte es sie, dass dieser Felsblock, welcher Morigundel Unkenmutter gefangen hielt, selbst beinahe die Gestalt einer riesigen steingewordenen Kröte aufwies.
Vorsichtig sicherte sie in alle Richtungen, um festzustellen, ob ausser ihr noch andere Wesen dem Ruf nachgefolgt waren.
Sie konnte nichts und niemanden ausmachen. In dieser Nacht schien es alleine sie anzugehen.
Mit einem lautlosen Sprung versetzte sie sich auf die moosüberwachsene Oberfläche des Steinungetüms. Sie vermochte die machtvolle Gegenwart der gedemütigten Elbe darin förmlich zu fühlen – hier schmorte unzweifelhaft das durchtriebenste Geschöpf, welches je aus dem verborgenen Reich der Feenkönigin verstossen worden war.
«Erfreulich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, mein schönes Töchterchen», wisperte eine brüchige Stimme aus dem Innern des krötengestaltigen Felsbrockens. «Ich habe mich also nicht in dir getäuscht. Hältst deiner Mutter noch immer die Treue, was? Wie rührend.»
«Natürlich tue ich das, Mütterchen». Die Katze formte die Worte gleichsam in ihrem Geist, denn für sprachliche Lautäusserungen war ihre tierhafte Zunge nicht geschaffen. «Ich bedaure wirklich sehr, was dieser heimtückische Eulenbart dir angetan hat.»
«Ach was, dieses lästige Vorkommnis ist lediglich ein unbedeutender Abschnitt auf dem langen Weg hin zur Vollendung all meines Strebens. Weisst schon, dass nichts von Dauer ist. Schon gar nicht die unbeholfenen Stümpereien der Menschen... Aber genug geplaudert jetzt!»
Der Unmut der unsichtbaren Feenfrau, welche auf magische Weise im Innern des massiven Felskerns gebunden war, versetzte das überwucherte Gestein geradezu in Schwingung. Die Katze sträubte argwöhnisch ihre Nackenhaare. Auch wenn ihre Mutter ihre körperliche Erscheinung eingebüsst hatte, so manifestierte sie ihren durchdringenden Willen doch immer noch mit eindrücklicher Kraft.
«Sage mir, wie ich dich aus dieser unwürdigen Lage erlösen kann, Mütterchen», barmte die Katze und scharrte dabei aufgebracht mit ihren gespreizten Krallen im Moos, als erhoffte sie, dadurch das Wesen freilegen zu können, welches darunter eingeschlossen war.
Die Antwort erfolgte wie ein Hieb, der das samtpelzige Tier unwillkürlich aufspringen liess, obwohl kein Laut zu hören war. «Törichtes Blag! Spar dir deine Mühe! Es lässt sich derzeit nicht ändern, dass ich in diesem Stein festsitze. Vielleicht ist es sogar besser, wenn unsere Widersacher einstweilen nicht mit mir rechnen. Der Helistein, Kind! Wir brauchen den Helistein. Das ist alles, was jetzt zählt.»
«Ist er denn mittlerweile wieder gefunden worden?», fragte die Katze hellhörig.
«Sie suchen ihn allenthalben», erwiderte die Stimme im Stein gehässig. «Und sie werden ihn finden. Wo auch immer er verloren gegangen ist. Oder er wird sich von selbst offenbaren. Bist regsam, mein Kätzchen, bewegst dich schnell und flink. Beobachtest die Dinge mit äusserster Wachsamkeit. Ich komme derzeit nicht vom Fleck, du siehst es. Geflucht sei es dem vermaledeiten Pulvermischer! Deshalb musst du nun mein schweifendes Auge da draussen sein, Töchterchen. Und sobald das Kleinod auftaucht, dann schnappst es dir. Schlägst unverhofft zu, wie es deine Art ist. Und bringst das gute Stück flugs hierher zu mir.»
«Ich werde mein Bestes versuchen, Mütterchen, sei versichert. Aber seit der elbenblütige Junge den Feenstein aus Nuithônia verschleppt und ihn in sein Dorf gebracht hat, ist er spurlos verschwunden. Es ist wie verhext.»
Ein raues Lachen erschütterte die feinstoffliche Hülle des mächtigen Findlings. «Ja, ja, dein goldlockiger Schönling. Hat Grosses vollbracht, was? Hätte ich ihn nur erkannt, als er mich in Elesîr aufgesucht hat, dann hätte dies alles einen ganz anderen Lauf genommen. Ich bin mir sicher, das Schicksal dieses Bürschchens ist eng mit dem Helistein verwoben. Nicht von ungefähr hat es ihn so unvermutet aus der Wildnis geborgen. Das Blut der Feenkönigin fliesst in ihm. Und das Erbe eines alten Menschengeschlechts. Aber sein Verstand ist simpel. Ein treuherziger, einfältiger Narr. Behalte ihn im Auge. Er könnte dich auf die Spur dessen führen, was wir zutiefst begehren. Einmal schon hast du ihn beinahe für dich gewonnen...»
«Die weisse Eule, sein Liebchen, hat ihn mir streitig gemacht!», schleuderte die Katze jäh dazwischen und spürte, wie ein ungestillter Zorn sie glühend heiss durchwallte.
«Ha, Luyôbas Tochter!», entgegnete die Stimme aus dem Felsen mit einem Anhauch von Häme. «Feenblut noch und noch! Gewiss, bei dieser musst dich mehr vorsehen. Sie hat einen klaren Verstand und lässt sich nicht so leicht irreführen. Auf jeden Fall sollst deine Triebe diesmal zügeln, Kind. Kannst deinen Mutwillen mit dem Jüngelchen treiben, sobald es unsere Zwecke erfüllt hat. Zunächst brauchen wir den Helistein. Dies muss dein vordringlichstes Ziel sein, verstehst mich wohl, ja?»
Die Katze wand sich unbehaglich und greinte wie ein verzweifeltes Kind. «Ach, Mutter, würden dir meine älteren Schwestern in dieser Sache nicht besser zu dienen wissen mit ihrer Zaubermacht? Was vermag ich schon auszurichten...?»
«Du weisst, was mit ihnen geschehen ist! Törichte Weiber! Ein freudloses Schicksal hat sie am Drudenberg ereilt. Sie können uns jetzt nicht helfen. Du bist die letzte von uns, die noch frei ist. Das Geschick unserer Familie liegt jetzt in deinen Händen. Dein Vater leidet unsägliche Qualen, vergiss das nicht. Er ist es, der zuerst erlöst werden muss. Der Rest wird sich geben. Diese Elbenmetze in ihrem entrückten Kristallturm hat zu vieles schon vermasselt. Es wird endlich Zeit, dass wir den gerechten Ausgleich erzwingen. Und dass das alte Blut von Elesîr seinen ihm vorbestimmten Platz wieder einnimmt! Kreuzbruch und Höllenbrand!»
Die Katze sprang jäh vom Felsrücken hinunter und landete im weichen Laub zu dessen Füssen. Wie ein Peitschenschlag waren die letzten Worte aus dem Innern des bebenden Gesteins in sie gefahren. Voller Wut und triefendem Hass.
«Merke dir, Kind, der Mondrudûr wird unser aller Schicksal erfüllen!», fuhr Morigundels Stimme knirschend fort. «Ur und Rapp2 gilt es zu vereinen. Aber der Schlüssel dazu ist der Helistein. Darum begib dich jetzt auf die Suche nach deinem Faïon3. Er weiss mehr über den Verbleib des Kleinods als mir sein misstrauischer Ziehvater damals in Calamis preisgeben wollte. Und wenn du ihn gefunden hast, mache dir seine Einfalt zunutze, damit er dir verschafft, was wir so dringend benötigen.»
«Und wenn du dich täuschst, Mutter?» Die Katze hatte sich dem unheimlichen Steinkoloss wieder vorsichtig angenähert und äugte verunsichert zu dessen schwarzer Gestalt hinauf. «Wenn Ernestus sich inzwischen nicht mehr um den Helistein schert und anderen Abenteuern nachstreicht?»
«Dann bringst mir sein Blut!», knurrte der belebte Fels gereizt. «Die Macht der Feenkönigin brodelt darin. Wenn wir den Helistein nicht erlangen können, dann bedienen wir uns anderer Mittel. Bleibe auf jeden Fall in Verbindung mit Uriân. Mein Schwiegersohn war stets ein treuer Verbündeter, auch wenn er deinen Schwestern zum Verhängnis geworden ist.»
«Aber Uriân ist selbst dem Fluch zum Opfer gefallen», gab die Katze zu bedenken. «Was soll der ruhelose schwarze Keiler uns nützen? Zudem bin ich nicht sicher, ob er wirklich auf unserer Seite steht. Nach allem, was damals passiert ist zwischen meinen Schwestern.»
«Er ist auf unserer Seite!» beharrte die raue Stimme aus dem düsteren Felsklotz unwirsch. «Er streift viel umher und sieht mancherlei Dinge. Und er ist stark. Unterschätze ihn nicht, Elveïa! Schickst ihn zu mir, wenn du ihm begegnest. Aber nun geh und tue, was ich dich geheissen habe! Und treibst keinen Unfug, ja?»
Die Katze liess ein kuschendes Maunzen hören und duckte sich rasch von dem schwarzen Felsblock weg. Sie war froh, sich wieder aus der Reichweite der einnehmenden Macht entfernen zu können, die gegenwärtig darin wohnte. Die Gefangenschaft an diesem einsamen Ort schien ihrer Mutter arg zuzusetzen. Kaum jemals zuvor hatte sie sich in einem derartigen Zustand der Verbitterung befunden.
So behände und zielsicher wie sie gekommen war, fand die Waldkatze wieder den Weg zurück. Vieles ging ihr dabei durch den Sinn. Sie würde diesen reizvollen feenbürtigen Jüngling also noch nicht loslassen müssen. Ihr Schicksal schien weiterhin an ihn geknüpft zu sein. Und das gefiel ihr.
Ehe der neue Morgen graute, glitt sie in ihren behaglichen Unterschlupf, der sich tief unten in der Schlucht der Neravîna verbarg. Wohlig schnurrend streckte sie sich auf dem roten Samtlaken des grosszügigen runden Lagers aus und räkelte sich einige Augenblicke lang.
Dann schmolz ihre Katzengestalt mit einer einzigen fliessenden Bewegung in den elbenblütigen Leib von Elveïa Mondschatten, jener dunkelhäutigen Faï, welche die Menschen Nuithônias schaudernd Helva von den Schwarzen Wassern nannten.
Sie schlug die Augen auf und lächelte.
Noch in derselben Nacht flog der grosse Rabe von Nuithônia zurück zu seinem Horst auf einer kühn hochragende Felszinne, welche seit jeher Guriganths Horn genannt wurde. Wie der abgebrochene Stumpf eines uralten Turmes erhob sich diese unheimliche schwarzgraue Felsformation über das von Schluchten und Gräben durchfurchte Waldland. Der Rabe vermochte nicht zu ermessen, wie lange er bereits mit seinen Brüdern dort oben hauste. Zu Beginn hatte er die Jahre noch gezählt, doch irgendeinmal hatte er den rechten Sinn für das Verstreichen der Zeit verloren. Sein Aufenthalt auf der Felskrone mochte inzwischen die Spanne mehrerer Menschenleben umfassen. Tief in seinem Innern wusste er, dass er einst Faromund geheissen hatte und der Sohn eines stolzen Ritters aus dem Wendelgau gewesen war. Aber je länger je mehr war es ihm einerlei geworden, unter welchen Umständen sich sein früheres Dasein abgespielt hatte.
Bald würde hinter den schneeweissen Bergen im Südosten ein neuer Tag heraufdämmern. Der Rabe würde sich dann in seinem geschützten Felsennest zur Ruhe begeben. Es war ungleich aufregender, im Schutz der Dunkelheit durch das wilde Land zu streifen und das heimliche Leben in der Wildnis zu beobachten. Besonders in magischen Nächten wie dieser gab es mancherlei zu entdecken. Weit im Osten hatte er ein verschwörerisches Gespräch belauscht. Die katzengestaltige Faï vom Schwarzen Wasser und ihre arglistige Mutter - die in Fels und Moos gebannte Kröte Morigundel - hatten gemeinsam üble Pläne geschmiedet. Zudem war er auf seinem Weg einmal mehr dem furchterregenden Schwarzen Ur begegnet, der - von vielen blutigen Wunden gezeichnet - wie von Sinnen durch den Unterwuchs raste und blindwütig auf alles losging, was ihm unter die Augen kam.
Auf dem Heimflug schwenkte er wie üblich über jene zerfallene Burgruine hinweg, die unweit seines Nistfelsens vergessen im schattigen Waldesgrund schlummerte. Eine unbestimmte Macht zog ihn immer wieder dorthin; vielleicht war es eine ferne Erinnerung, die ihm zuflüsterte, dass er dort einst gelebt hatte. In glücklicheren Tagen, ehe der Fluch ihn und seine ganze Familie zu einem unsteten Dasein in wilder Tiergestalt verdammt hatte.
Manchmal stöberten in diesen überwachsenen Gemäuern, die ihm so anheimelnd vertraut waren, zwei seltsame Wildschweine umher: Ein riesenhafter brandschwarzer Keiler und eine zierlichere, silberweisse Bache. Auch wenn er äusserlich keinerlei Ähnlichkeiten mit diesen urtümlichen Geschöpfen aufwies, vermeinte er ihnen doch sehr nahe zu stehen und verspürte bisweilen regelrecht den Drang, mit ihnen zu ziehen. In dieser Nacht kreuzte er wiederum ihren Weg und freute sich über die flüchtige Begegnung mit ihnen.
Nicht weit von ihnen entfernt, am Fuss jenes Felsenturmes, auf dem sein Horst lag, konnte der Schwarzgefiederte kurz darauf eine andere Nachtkreatur ausmachen, deren Anblick ihn freilich erschauern liess. Es war die rauhaarige Hünin, die in den Wäldern rund um den Zwiefältigen Berg schon so lange umging, wie er sich zurückzubesinnen vermochte. Diese ungeschlachte Unholdin, welche sich am liebsten an blutwarmem Menschenfleisch gütlich tat, erweckte nichts als Abscheu in ihm, und gleichwohl fühlte er ebenfalls eine Art Verwandtschaft mit ihr.
Welches unaussprechliche Geheimnis mochte es sein, welches alle diese unterschiedlichen Bewohner des Drudenberges schicksalhaft miteinander verband?
Das abstossende Riesenweib sass beinahe andächtig in einem Teppich dunkelviolett blühender Blumen. Neuerdings wucherte dieses aufdringlich duftende Gewächs allenthalben rund um die beiden Hügelkuppen. Auch andernorts in Nuithônia war es ihm bereits aufgefallen. Er konnte sich keinen Reim darauf machen, warum die tumbe Ogerin4 einen solchen Narren an diesen fremdartigen Pflanzen gefressen hatte.
Als sich der Rabe zuoberst in seinem felsigen Schlupfwinkel niedergelassen hatte, bemerkte er, dass die Menschenfresserin unter der Fluh witternd ihren unförmigen Schädel anhob. Ein frohlockendes Gurgeln entfuhr ihrer zottigen Brust. Offenbar hatte etwas Interessantes ihre Aufmerksamkeit erregt.
Es war gewiss seine Fressgier, welche das unersättliche Ungeheuer hatte aufhorchen lassen. Denn von Südwesten her näherte sich eine zweibeinige Gestalt über einen bewaldeten Hügelrücken. Ein einsamer Wanderer, ein Mensch, strebte geradewegs auf die kleine Kapelle zu, welche am Fuss von Guriganths Horn neben einem Wildbrunnen auf einer Waldlichtung stand. Nun musste sich die Menschenfresserin aber mächtig ins Zeug legen, wenn sie diesen Happen noch erbeuten wollte, denn sobald die Sonne mit ihren ersten Strahlen über den Bergkranz im Süden blinzeln würde, wäre es für dieses lichtscheue Unwesen höchste Zeit, Zuflucht in seinem Höhlenversteck zu suchen.
Wachsam beobachtete der Rabe, wie sich die Riesin ungelenk auf ihre dicken Beine erhob und mit langen Schritten die dicht bewaldete Hügelflanke hinab stapfte, unbeirrbar auf ihre Beute zu. Die verblichenen Totenbeine, welche wie ein widerwärtiger Gürtelschmuck um ihren feisten Wanst baumelten, klapperten unheilvoll.
Der Wanderer schien die drohende Gefahr bereits zu erahnen, ehe er sie wahrnahm. Am Rand der Lichtung verharrte er und blickte prüfend gegen den stumpfen Felszahn hinauf. Beinahe bedächtig zog er sein schlichtes Breitschwert aus der Scheide. Unter seinem langen Ledermantel verbargen sich verschiedene weitere Waffen.
Die Ogerin stiess ein triumphierendes Brüllen aus, welches die friedvolle Stille des noch ungeborenen Morgens brutal zerriss. Mit ihrer ungestümen Kraft rupfte sie eine junge Buche mitsamt deren Wurzelballen aus dem Erdreich und schlug damit das dichte Gesträuch zur Seite, welches ihren Lauf behinderte. Wenn der Hunger sie antrieb, war sie durch nichts aufzuhalten.
Der Reisige hatte die furchterregende Angreiferin entdeckt und schien einen Moment abzuwägen, ob er sich dem Ungeheuer todesverachtend entgegenwerfen oder doch lieber sein Heil in der Flucht suchen sollte.
Grollend trampelte die Menschenfresserin durch das Unterholz auf ihn zu und schwenkte ihre grobschlächtige Keule. Ihre tief in den borkigen Schädel eingesunkenen Äuglein glitzerten siegessicher.
Ehe die beiden ungleichen Wesen aufeinanderprallten, schwang sich plötzlich ein neuer Laut in die frische Luft des jungen Tages empor. Klar und rein.
Es war die kleine Glocke, welche der fromme Einsiedler in der Kapelle jeden Morgen und Abend schlug. Ihrem Klang wohnte etwas Tröstliches, ja geradezu Feierliches inne. Dieses Läuten hatte die Macht, jegliches Ungemach aus dem Umkreis des hölzernen Gotteshauses zu vertreiben.
Die Ogerin heulte in ohnmächtiger Wut auf. Sie ertrug das Geläut der Glocke nicht. Mehr noch, dieses Signal kündigte ihr unmissverständlich den heraufziehenden Tag an, welcher ihr so verhasst war.
Nun war die Neugier des Raben erst recht geweckt. Er schwang sich nochmals in die Luft empor, um den vom Glück gesegneten Fremden aus der Nähe betrachten zu können. Bestimmt war dieser gekommen, um den einsamen Waldbruder aufzusuchen. Die wildpelzige Riesin trollte sich derweil rasch. Mit entrüstetem Schnauben floh sie vor der herannahenden Lichtflut der aufgehenden Sonne in das düstere Zwielicht des Waldes zurück.
Als der Wanderer im langen Umhang vor das Wildkirchlein trat, erschien der weissbärtige Klausner in der niederen Bogentür. Mit Verwunderung betrachtete er den unverhofften Besucher, der ihm wohl ebenso unbekannt war wie dem rabenäugigen Beobachter. Der Fremde hatte ein kantiges Gesicht mit harten stechenden Augen, die beinahe gelblich schimmerten und etwas Wölfisches ausstrahlten. Aus ihnen war Furchtlosigkeit zu lesen. Und zugleich ein verhohlener Zug von Grausamkeit. Haar und Bart, beides in der Farbe von reifen Kastanien, trug der kräftige Mann lang und wirr. Seltsamerweise waren die dunklen buschigen Brauen, die wie haarige Raupen über seinen funkelnden Augen klebten, oberhalb der Nasenwurzel richtiggehend zusammengewachsen. Der Rabe hatte im Laufe ungezählter Jahre viele unterschiedliche Menschengesichter in Nuithônia studiert, aber ein solches war ihm noch nie untergekommen.
«Pax et bonum5, Vater», hob der Fremde mit herber Stimme zu sprechen an. «Mir scheint, Ihr habt mir mit dem Angelusläuten6 soeben das Leben gerettet. Habt Dank. Die Glocke erklang keinen Augenblick zu früh. Aber was war das bloss für eine teuflische Kreatur?»
«Deo gratias7», erwiderte der betagte Eremit bedächtig und blinzelte dem unerwarteten Gast wohlwollend entgegen. «Gottes Friede sei auch mit dir, mein Sohn. Mein Name ist Theudâtus von Aurônum. Ich lebe hier allein und demütig nach der Regel des heiligen Benedictus von Nursia. Der allbarmherzige Vater scheint über dir zu wachen. Wärest du der Rauels eine Stunde früher begegnet, hätte es für dich vermutlich ein böses Ende genommen. Die Ogerin vom Drudenberg fängt sich vorzugsweise Menschen, um sich an ihrem Fleisch zu nähren. Hat man dich denn nicht vor ihr gewarnt?»
«Da draussen erzählt man sich manche ungeheuerliche Mär über die Schrecken des Nachtlandes», bestätigte der Wolfsäugige. «Aber sagt an, ehrwürdiger Vater Theudâtus, dann ist es also wahr, was uns ein frommer Bruder aus Agaunum berichtet hat? Am Drudenberg, mitten im finsteren Heidenwald, hegt ein furchtloser Einsiedel das heilige Angedenken an unseren Erlöser und Heilsbringer.» Der Mann senkte seinen Blick und bekreuzigte sich flüchtig. Er schien ein gläubiger Christ zu sein. Dies war in der Tat eine rare Erscheinung inmitten eines Landstriches, der von Heiden nur so wimmelte.
«Mein halbes Leben habe ich hier oben inmitten von mannigfaltigen Gefahren zugebracht, das ist wohl wahr», seufzte der Gottesmann und liess seine lebhaften Augen zu der düsteren Felsspitze emporwandern, die seine Heimstatt überragte. «Und es ist ein fortwährendes Hasardspiel. Aber hat nicht auch unser grosses Vorbild, der Heilige Mauritius von Theben, sein Leben vertrauensvoll in die Hände unseres liebenden Herrn gelegt, als er sich mit seiner Legion von Getauften in Agaunum dem unmenschlichen Befehl der romanischen Imperatoren8 widersetzte? Unser aller Leben ruht in Gottes Hand. Du musst wissen, mein Sohn, die Glocke, deren Klang dich heute Morgen vor tödlicher Unbill bewahrt hat, wurde vor Zeiten im Monasterium9 von Agaunum gegossen und geweiht. Sie verscheucht alles Böse und schafft mitten in dieser Wüstenei einen sicheren Zufluchtsort für schutzsuchende Reisende wie dich.»
Der unbekannte Besucher musterte den alten Einsiedler eindringlich. «Nach allem, was man mir im Lande versichert hat, ist es freilich nicht eine Reliquie unseres Reichsbehüters Mauritius, die Ihr an dieser unzugänglichen Stätte verwahrt, Vater», bemerkte er mit geheuchelter Freundlichkeit.
Der Waldbruder verzog seinen bartumflochtenen Mund zu einem wissenden Lächeln. «Bei meiner Seel‘, mir deucht, du hast den beschwerlichen Weg zum Drudenberg in einer ganz bestimmten Absicht auf dich genommen. Wohlan denn, mein Sohn, ich will es dir nicht verschweigen. Dieser Ort birgt in der Tat ein schreckliches Geheimnis. Aber willst du mir nicht zuerst kundtun, wer du bist und woher du stammst? Ich habe dich hier nie zuvor angetroffen. Du scheinst keiner von den Waldläufern aus Plenafaï zu sein.»
«Vergebt mir meine Unhöflichkeit, ehrwürdiger Vater. Ihr habt natürlich Recht. Man nennt mich Gunthâr. Ich stehe als Lupârius10 in gräflichen Diensten bei Turoldus Schönhaar, dem Landherrn im Wiblisgau. Er schickt mich, um bei Euch Erkundigungen über einen uralten Drudenfluch einzuholen, der diesen Berg angeblich seit Menschengedenken heimsucht. Nach allem, was mir zu Ohren gekommen ist, bewahrt Ihr in Eurer Obhut eine Kuriosität auf, welche in diesem Zusammenhang von erheblicher Bedeutung ist.»
Der Rabe horchte auf. Die Worte des Fremden berührten einen tiefen Schmerz in seinem Inneren. Sein jahrhundertealtes tragisches Geschick war in der Tat eng mit dem machtvollen elbischen Pfand verwoben, welches unter dem Altarstein der Kapelle verborgen lag. Es war Vater Theudâtus‘ eigentliches Geheimnis.
Der Klausner bedachte seinen Gast mit einem listigen Blick. «Vielerlei Mysterien aus alter Zeit haften dem Drudenberg an, fürwahr», murmelte er. «Aber lass uns nun zunächst eintreten, mein Sohn, und dem gütigen Vater im Himmel, unserem Schirmherrn Sankt Mauritius und der Muttergottes dafür danken, dass die Rauels dich und deine ausgeprägte Neugierde heute in der Früh nicht in ihren feisten Wanst hineingeschlungen hat.»
Der grosse Rabe von Nuithônia krächzte enttäuscht, als die beiden Männer in der kleinen holzgezimmerten Kapelle verschwanden und sich somit seiner Wahrnehmung entzogen. Zu gerne hätte er ihrer Unterhaltung noch ein bisschen länger beigewohnt. Verdrossen flog er auf und kehrte zu seinem felsigen Hochsitz zurück, um sich dort von den Strapazen seines nächtlichen Streifzuges auszuruhen.
Er hatte in dieser denkwürdigen Vollmondnacht wahrhaft viele Dinge erfahren. Und er erahnte, dass sie alle in denselben schicksalhaften Strom von Ereignissen eingebunden waren, der vor genau einem Jahrlauf mit dem Fund des Helisteins im Niedergau von Nuithônia losgetreten worden war. Er selbst hatte das Feenkleinod damals in einem Nest am Torweiher versteckt gehabt, nachdem er es einer vorwitzigen Elster abgeknöpft hatte, die es ihrerseits jenem widerwärtigen Krötenweib hatte entwinden können, welches nun auf Gedeih und Verderb in einem festen Felsbrocken festgebannt war.
Was mochte wohl aus dem feenblütigen Bauernburschen geworden sein, der den Helistein unverhofft wiederentdeckt hatte? Dieser sorglose Jüngling war ungewollt zu einer entscheidenden Kraft im unaufhaltsamen Räderwerk des Schicksals geworden. Ob ihm eigentlich bewusst war, dass er je länger je mehr in beträchtlicher Gefahr schwebte?
I
Drachenaugenund Purpurflügel
rnestus blickte in das ebenmässig geschnittene, alabasterreine Gesicht einer elbenhaften Frau. Es war von unvergleichlicher und vollkommener Schönheit. Er erkannte es wohl. Es gehörte der Feenkönigin Helva Zauberweberin von Helisee, welche über dieses Land gebot.
Seiner Mutter.
So viel Liebe strahlte aus diesen Zügen. Aber unwillkürlich verspürte der junge Mann einen Widerstand in sich aufsteigen. Der Anblick seiner Mutter, so wohlwollend und warmherzig er sich auch immer darbieten mochte, missfiel ihm. Was war bloss mit ihm geschehen, dass diese Feenfrau derart unbehagliche Gefühle in ihm auslöste?
Da fiel ein trüber Schatten in die strahlenden Elbenaugen, die auf ihn gerichtet waren. Unvermittelt erstarrten sie und ihr Ausdruck gefror. Das seidenglänzende Haar der Fee kräuselte sich zu russchwarzen Strähnen. Ihr anmutiges Antlitz verzerrte sich zu einer Fratze, überzogen von lederartiger Schuppenhaut. Der Mund schnappte auf und entblösste nadelspitze Zähne. Eine geschwollene, schleimtriefende Zunge, lang wie sein eigener Unterarm, schnellte ihm entgegen. Die Augen flammten auf wie Feuerlohen und drohten ihn zu versengen.
Hebe dich hinweg aus meinem Reich, Unwürdiger! hämmerte die zischende Stimme des Drachenweibes in seinem Kopf. Krieche zurück in die Schatten jener Welt, aus der du gekommen bist!
Von blankem Entsetzen geschüttelt schrie Ernestus auf.
Er schrie. Und schrie.
Da spürte er eine warme Hand auf seinem schweissbedeckten Gesicht.
«Schsch... es ist doch nur ein Traum, Erni», wisperte eine sanfte, vertraute Stimme an seinem Ohr. Er spürte die feste Umarmung Anathênas, welche sich an ihn schmiegte.
Ernestus erinnerte sich. Er lag auf weichem, würzig duftendem Moos unter den Wurzeln einer uralten Eiche. Im Lande Helisee. Sie waren durch das leuchtende Tor im Waldweiher geschritten. Jenseits des Flüsterbaches. In der Beldennacht. Anathêna und er.
Mit einem tiefen Seufzer entspannte er sich wieder in die Arme seiner Geliebten und übergab sich ihrer tröstlichen Nähe.
Ja, er hatte bloss geträumt.
Aber in einem schwer zugänglichen Winkel seines Bewusstseins war ein schwarzer Splitter jenes namenlosen Entsetzens, das ihn in der Drachenhöhle tief unter dem Gläsernen Brunnen von Schloss Helisee ereilt hatte, unheilbar steckengeblieben.
Er hatte es gesehen, das furchterregende Ungeheuer, welches in der Feenkönigin lebte: Ernestus hatte im Verlauf einer abenteuerlichen Suche erfahren, dass er der Sohn der Feenkönigin Helva Zauberweberin und ihres Silbernen Ritters Durestân Drachenherz war. Sie hatten ihn als Säugling zu einer Ziehfamilie am Rand der Dreiseenlande gegeben, damit er dort in seinen menschlichen Erbteil hineinwachsen konnte. Aber bereits von Klein auf hatte ihn ein unbestimmbarer Drang stets nach der verfemten March der Landschaft Nuithônia gezogen, wo die Macht des entrückten Elbischen Volkes noch immer sehr stark war. Leider verlor er durch Unachtsamkeit ein zaubermächtiges Medaillon, welches ihm in die Wiege gelegt worden war, um ihm dermaleinst den Rückweg in die Feenlande zu erschliessen, an eine abtrünnige Zauberin aus Helisee. Weil ihn deswegen ein schlechtes Gewissen plagte – und weil seine Mutter sich weigerte, Ernestus bei der Befreiung seiner Geliebten Anathêna aus dem Kloster von Paterniacum zu unterstützen – stieg er verbotenerweise in den Gläsernen Brunnen im Kristallenen Hof von Schloss Helisee hinab und übertrat dadurch ein dringliches Gebot, welches ihm seine Mutter auferlegt hatte. Dieses törichte Eindringen in die verborgene Drachenhöhle unter dem Feenpalast konfrontierte ihn mit dem schrecklichsten Geheimnis von Helva Zauberweberin: Dass sie sich an jedem siebten Tag tief unter der Erde in einen leibhaftigen Lindwurm verwandelte, der grauenvoller war als alle Druden der Unterwelt zusammen11.
Ein weiches, warmes Licht streifte sein Gesicht, als die ersten Sonnenstrahlen eines neuen Tages über das Kronendach des Waldes blinzelten. Der tausendfältige Morgengesang der Vögel schallte in seinem Ohr. Der belebende Geruch des Mooslagers stieg in seine Nase. Verwundert schlug er die Augen auf.
Er befand sich am Rand jener ausgedehnten Lichtung, welche er in der vorangehenden Nacht mit Anathêna durch den Torweiher betreten hatte. Eine blumenblühende Wiese erstreckte sich bis zu einem schilfumkränzten Seelein, welches wie ein selig schimmerndes Auge den Morgenhimmel spiegelte. Eine Gruppe schneeweisser Kraniche vollführte am Ufer des Gewässers einen lieblichen Reigen. Sogleich begann die lebendige Kraft dieses Ortes seine Sinne zu verzaubern. Jeder Zweig, jeder Halm, jede Blüte in diesem verwunschenen Land schien ein reines und warmes Licht auszustrahlen. Er erschauerte unter der Intensität dieser Eindrücke. Die zwiespältigen Empfindungen der vergangenen Nacht waren wie fortgewischt. Der Anblick erweckte in ihm ein Gefühl von Vollkommenheit.
Nur Anathêna lag nicht mehr neben ihm. Suchend liess er seine Blicke durch die Umgebung schweifen. Diese Situation kam ihm bekannt vor. Aber auch im Teich konnte er seine Gefährtin nirgends erkennen.
Sie war eine freiheitsliebende und unternehmungslustige Jungfrau. Gewiss streifte sie bereits wieder umher und erkundete die Wunder dieses geheimnisvollen Landes. Es war wunderschön gewesen, sich in der verstrichenen Nacht eng umschlungen mit ihr in dieses weiche, wohlgeborgene Waldnest zu kuscheln.
Immer noch etwas benommen erhob sich der junge Mann und schlenderte zum Wasser hinüber. Er war so unbekleidet, wie er die Nacht zugebracht hatte. Die Luft war jetzt schon schmeichelnd warm, und er wollte sich im Weiher etwas erfrischen. Die Kraniche liessen sich nicht von seiner Annäherung beirren. Am gegenüberliegenden Ufer des Weihers hob eine weisse Hirschkuh kurz ihren Kopf und warf ihm einen vertrauten Blick zu. Die Tiere hier fürchteten sich nicht vor ihm. Ein unverbrüchlicher Friede schien das ganze Land zu durchströmen.
Ob diese Geschöpfe spürten, wer er war?
Ernestus‘ Aufmerksamkeit wanderte zu dem warmen Pulsieren auf seiner Brust. Das Medaillon mit dem Drachenkopfemblem und dem achtspeichigen Rad. Die Scheibe aus dem Karfunkelstein, welchen sein Vater in der Lindwurmhöhle von Caras Bôr errungen hatte. Der Gedanke an Durestân berührte das Herz des Jünglings. Hier an diesem Ort war er dem Silbernen Ritter der Feenkönigin zum ersten Mal begegnet. Es mochte nun genau ein Jahr zurückliegen. Damals hatte der Kämpe mit dem Drachenwappen Anathêna und ihn auf diese verträumte Waldlichtung in die Feenlande entrückt, um sie vor einer Gefahr zu schützen, welche ihnen am Torweiher in Nuithônia gedroht hatte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendetwas Gefährliches ihnen hierher hätte folgen können. In der unberührten Waldwildnis hinter der Bannmarch von Nuithônia war das freilich anders. Mit Schaudern dachte er an seine Begegnung mit dem schwarzen Auerochsen im vergangenen Winter, welche beinahe einen tödlichen Ausgang für ihn genommen hätte.
Aber hier durfte er sich getrost in Sicherheit wiegen. Dieses Land stand unter dem Schutz der Feen. Seine Mutter würde niemals zulassen, dass...
Ernestus fröstelte unwillkürlich in der warmen Morgensonne, die ihr goldenes Licht nun grosszügig über die gesamte Lichtung ausgoss. Wie kam er dazu, sich der Obhut seiner Mutter so bedingungslos anzuvertrauen, wo hinter ihrer liebreizenden Erscheinung doch eine ebenso furchterregende Bestie schlummerte? Verstohlen blickte er sich um, als befürchte er, allein seine Gedanken könnten die Aufmerksamkeit der Feenkönigin unwillkürlich an diesen Ort lenken. War es nicht so, dass ihr Bewusstsein allgegenwärtig war in den Feenlanden? Anathêna hatte ihm von diesem geheimnisvollen unsichtbaren Gewebe erzählt, welches alle Erscheinungen der Wirklichkeit miteinander verband.
Er schluckte leer und spürte einen Hauch von Wehmut in sich aufsteigen. Wenn nur sein Vater hier wäre. Wenn er in diesem Augenblick wieder vom Waldrand her angeritten käme. Gewiss, Durestân hatte ihn hart abgewiesen in der Mittwinternacht am Felsentor und ihm die Rückkehr nach Helisee verwehrt. Aber zugleich hatte er ihn deutlich spüren lassen, dass er stets um seine Sicherheit besorgt war. Seine Männer hatten ihn vor dem mörderischen Ur gerettet. Und wahrscheinlich darüber hinaus vor zahlreichen anderen Gefahren bewahrt, die er in seiner Unbedachtheit gar nicht erst wahrgenommen hatte.
War es vermessen von ihm, sich so vertrauensvoll im Reich seiner umtriebigen Mutter aufzuhalten? Hätte er besser nicht hierher zurückkommen sollen?
Verunsichert blickte er sich um. Alles war friedlich. Es gab keine Anzeichen dafür, dass irgendeine Macht seine Anwesenheit beargwöhnte. Warm und vertraut pochte das Feenmedaillon auf der Höhe seines Herzens.
An jener Stelle, wo er Anathêna vor einem Jahr in den kleinen See gefolgt war, liess sich Ernestus zwischen den Uferbinsen in die Hocke nieder und vergegenwärtigte sich das vergangene Geschehen. Er hatte sich damals grosse Sorgen um seine Geliebte gemacht, weil er befürchtet hatte, sie würde im Torweiher ertrinken. Dabei hatte sie lediglich ihrer Mutter in dieses Glück verheissende Land folgen wollen. Und ehrlich gesagt war sie es gewesen, welche ihn später auf seiner Reise immer wieder beschützt hatte. Wenn Elbenschön nicht gewesen wäre, die weisse Eule, deren Gestalt seine Gefährtin im Schlaf annehmen konnte, dann wäre manches anders verlaufen. Und sie hatte ihm letztlich gar sein verlorenes Medaillon zurückgebracht, welches sie der Krötenhexe Morigundel entrissen hatte. Anathêna war eine unerschrockene Maid.
Wo sie sich wohl herumtreiben mochte an diesem Morgen? Er konnte immer noch keine Anzeichen von ihr entdecken.
Ernestus erhob sich wieder und watete vorsichtig in das kühle Wasser hinaus. Das prickelnde Nass auf seiner Haut weckte die zaghaften Lebensgeister in ihm. Das Bad im Wasser der Feenlande bekam ihm gut und wusch nicht nur den Staub von seinem Leib, sondern auch die bedrückenden Gedanken aus seinem Sinn.
Prustend liess er seine Blicke dem Waldrand entlang wandern. «Anathêna, wo bist du?», rief er lauthals. «Wäre es nicht Zeit für ein Morgenbad?»
Eine Weile stand er still im hüfttiefen Wasser und horchte auf eine Antwort. Die Melodien der Vögel waren von überwältigender Fülle. Er konnte sich nicht entsinnen, zuhause am Rand des grossen Waldes bei Calamis jemals solche Klangspiele vernommen zu haben.
Versonnen widmete er sich seinem Angesicht, welches sich auf der ruhigen Wasseroberfläche spiegelte. Wie hatte er sich doch verändert in diesem letzten Jahr. Er war ein junger Mann geworden. Die vielen durchlittenen Fährnisse hatten ihn frühzeitig gezeichnet. Die Finger seiner rechten Hand legten sich in gewohnter Geste um das Medaillon auf seiner Brust. Es fühlte sich immer noch warm an, obwohl es mit ihm in das Wasser getaucht war.
Plötzlich verschwammen die Züge seines gespiegelten Gesichtes im Wasser. Ernestus blinzelte verdutzt. Der Himmel war nach wie vor wolkenlos und strahlend klar, und die Weidenbäume am Ufer zeichneten scharf umrissene Gegenbilder auf die Oberfläche des Seeleins.
Der junge Mann hielt den Atem an. Jetzt sah er es deutlich. Das Gesicht, welches ihm aus dem Wasser entgegenblickte, hatte eine neue Form angenommen. Es zeigte nun das Antlitz einer Frau, elbengleich und wunderschön, aber überhaucht von einem Ausdruck der Sorge.
Es war seine Mutter.
Wie im Traum der vergangenen Nacht.
Der junge Mann wollte zurückweichen, doch er sah, wie das Wasserbild die Lippen bewegte. Und nun hörte er deutlich eine dunkle Frauenstimme.
«Eyrïân, mein Sohn!» sprach sie langsam und nachdrücklich. «Ich erwarte dich im Funkelnden Saal. Komm rasch zu mir. Dein Platz ist hier bei mir.» Ihre Stimme klang herzhaft und freundlich, aber der eindringliche Unterton darin liess keinen Zweifel offen, dass sie ihn an ihre Seite befahl. Unverzüglich.
Eyrïân nannte sie ihn. Das war sein Name in den Feenlanden. An seinem blossen Klang schien ein Bild zu haften, welches seine Mutter bereits in allen Einzelheiten gemalt hatte, ohne dass er selbst etwas dazu zu sagen hatte.
Ernestus begann zu zittern. Das Traumbild der vergangenen Nacht schob sich unwillkürlich über die Erscheinung im Wasser. Er sah wieder die flammenden Augen dieser Drachengöttin. Das grässliche Maul mit der herausschiessenden gespaltenen Zunge.
Ein erstickter Schrei entfuhr ihm, und er schlug entsetzt mit der Faust in das Wasser, um dieses grauenvolle Gesicht zu vertreiben.
Der Kopf seiner Mutter war immer noch da und bewegte sich leicht mit den allmählich zur Ruhe kommenden Wellen im Wasser. Die atemberaubend schöne Gebieterin des Elbischen Volkes blickte ihn unverwandt an. Doch allmählich begannen ihre Züge zu verblassen.
«Zögere jetzt nicht», wisperte die vertraute Stimme aus der Tiefe des Teiches. «Es ist von grosser Bedeutung, dass du rasch zu mir kommst. Wir werden einen Weg finden, um Frieden zu schliessen mit dem, was zwischen uns geschehen ist...»
Die letzten Worte verhauchten über dem Wasserspiegel. Ernestus sah eine Handvoll dürrer Herbstblätter, die an jener Stelle im Wasser trieben, wo sein eigenes Spiegelbild nun wieder in Erscheinung trat. Sie strudelten leicht in einer feinen Wirbelbewegung, die sie nach unten zog.
Auf einmal war ihm dieser verwunschene Weiher nicht mehr geheuer. Mit kräftigen Sätzen sprang er aus dem Wasser an das Ufer zurück und blickte sich verwirrt umher.
Da rauschte etwas über seinem Kopf. Ernestus erkannte einen mittelgrossen, hell befiederten Vogel, der auf den Waldrand zuhielt und sich unter jener Eiche niederliess, wo er mit Anathêna genächtigt hatte.
Kurz darauf hörte er die aufgeregte Stimme seiner Gefährtin. «Erni, ich bin wieder da.»
Anathêna lief ihm über die Blumenwiese entgegen und fiel ihm in die Arme.
«Es ist unglaublich», keuchte sie und blickte Ernestus aus ihren leuchtend blauen Augen entgegen. Ihr weizenblondes Haar, das seit ihrer Flucht aus dem Kloster bereits wieder bis auf Schulterlänge nachgewachsen war, hing aufgelöst und in wirren Strähnen um ihr glückstrahlendes Gesicht. Sie war genauso nackt wie er. Er spürte das rasche Pochen ihres galoppierenden Herzens auf seiner Brust. Er drückte sie fest an sich und streichelte ihr über den Rücken. Ihre Nähe beruhigte seine aufgebrachten Gedanken. Nach dem aufwühlenden Gesicht im Wasser war er jetzt umso dankbarer, dass sie bei ihm war.
«Ich kann fliegen», sprudelte es aus der jungen Frau heraus, als sie sich aus seiner festen Umarmung herauswand. «Ich kann mich hier in meine Eulengestalt verwandeln, ohne dass ich dazu meinen Körper verlassen muss. Erni es ist wundervoll. Es ist, als könnte ich die eine Gestalt einfach in die andere hineinfliessen lassen...»
Ernestus starrte sie betroffen an. Er bemühte sich, seinen Lippen ein Lächeln abzuringen. Dann war dieser Vogel, der vorhin über seinen Kopf gestrichen war, also Elbenschön gewesen, und Anathêna hatte in ihrer Eulengestalt einen ersten Morgenflug unternommen.
Die junge Frau bemerkte die augenscheinliche Verwirrung ihres Gefährten und setzte eine forschende Miene auf.
«Erni, was ist los?», fragte sie leise. «Du wirkst so verstört. Hast du dir Sorgen gemacht, weil ich fort war heute Morgen?» Sie liess sich wieder in seine Arme gleiten und schmiegte sich an seinen nassen Körper.
«Nein», entgegnete Ernestus nach einigen Augenblicken atemholender Stille. Er hielt die Augen geschlossen und ergab sich ganz in die beruhigende Wärme seiner Geliebten. «Es ist wegen meiner Mutter. Sie ist mir soeben erschienen und hat mich zu sich an den Kristallenen Hof gerufen.»
Anathêna hatte Waldbeeren gesammelt, die sie nun gemeinsam an ihrem Lagerplatz unter der alten Eiche verspeisten. Die allgegenwärtige Fülle, mit der sie hier beschenkt wurden, beeindruckte Ernestus. In den Feenlanden schien einem das Leben keine Entbehrungen abzuverlangen. Zumindest die leiblichen Bedürfnisse liessen sich hier mühelos versorgen. Er fühlte sich immer noch etwas berauscht. Nach seiner Enthüllung über den Aufruf seiner Mutter hatte Anathêna ihn auf das weiche Moosbett geladen und ihn seine drangvollen Gedanken rasch vergessen lassen. Es war wundervoll gewesen mit ihr. Nicht nur ihre Leiber, sondern auch ihre Herzen waren regelrecht ineinander verschmolzen. Was er auf dem Liebeslager bei Helva von den Schwarzen Wassern erlebt hatte, war nicht zu vergleichen mit den Wonnen, welche die innige Verbundenheit mit seiner Geliebten ihm erschloss. In ihrem Zusammensein bedurfte es keines Zaubers und keiner Verführungskünste. Ihre tiefe Zuneigung zueinander war echt und wahr.
Anathêna streckte ihm neckisch ihr Gesicht entgegen. Sie hielt eine grosse Walderdbeere mit ihren Lippen umfasst und bot sie ihm dar. Lächelnd nahm er die Einladung an und küsste sie. Viel länger als er brauchte, um die süsse Frucht aus ihrem Mund zu erhaschen. Wenn er daran dachte, welche Ängste er in den verwichenen Monden um sie ausgestanden, wie lange er verzweifelt nach ihr gesucht hatte, dann hatte er jetzt gewiss allen Grund, um diesen lang ersehnten Moment dankbar auszukosten.
Anathêna legte ihren Kopf an seine Brust und räkelte sich wohlig an seiner Seite. «Als ich vorhin über den Wald geflogen bin», murmelte sie dicht an seinem Herzen, «habe ich versucht, mich zu orientieren. Soweit meine Blicke schweiften, habe ich nichts als Wald gesehen. Ein leuchtendes Kronendach, von einem Horizont zum anderen. Ich frage mich, wie wir den Kristallpalast deiner Mutter finden wollen. Du warst ja schon hier unterwegs, vielleicht weisst du, wie wir den richtigen Weg ausfindig machen können.»
«Damals hat Beleriân mich begleitet», erwiderte Ernestus. «Der Herold und Ratgeber meiner Mutter. Und wir ritten auf Elbenrossen. Diesen Tieren wohnt ein eigener Zauber inne. Ich glaube, es ist hier anders als zuhause. Der Raum, die Distanzen, die Fortbewegung... alles gehorcht fremdartigen Gesetzen, an die wir uns nicht gewöhnt sind. Ich weiss nicht, wie es ist, zu Fuss durch diese verzauberten Lande zu reisen...»
Anathêna hob ihre Augen zu ihm empor und musterte ihn ernst. «Wenn deine Mutter dich gerufen hat, wird sie dich gewiss an ihren Hof geleiten», stellte sie fest.
Plötzlich merkte er, wie sich das subtile Unbehagen in seinem Herzen zu einem unangenehmen Kloss zu verdichten begann. Er räusperte sich gequält. «Anathêna.» Ihm wurde es immer enger in der Brust. Abrupter, als es er beabsichtigt hatte, schob er ihren Kopf von sich weg und stand auf. Mit einer hastigen Bewegung griff er nach seinem Beinkleid und stieg hinein. «Ich kann jetzt nicht dorthin gehen», stammelte er verdrossen. «Du kannst dir nicht vorstellen, was ich dort alles erlebt habe. Meine Mutter ist ein grausames Ungeheuer. Ich verabscheue sie dafür. Nein, ich hasse sie. Es ist alles... noch immer viel zu nahe...»
Anathêna richtete sich ebenfalls auf und wollte ihn an sich ziehen. Er wehrte ihre Hände jedoch ab und streifte sich seine Tunika über.
«Ich möchte doch einfach das Zusammensein mit dir auskosten», stiess er mit verzweifelter Stimme hervor. «Wir haben einander so lange entbehren müssen, Anathêna. Endlich haben wir einander gefunden. Warum können wir jetzt nicht einfach die Gunst des Lebens geniessen und erst einmal ein paar Tage für uns haben? Hier in den Feenlanden, wohin wir uns beide so lange gesehnt hatten. Ich weiss genau, was mich am Kristallenen Hof erwartet. Meine Mutter hat ganz klare Vorstellungen davon, was meine Aufgaben sind. Sie will mich in ihre umwälzenden Pläne einspannen. Sie sieht in mir bloss ein nützliches Werkzeug zur Erneuerung ihres grossartigen Bundes. Aber ich bin jung, ich will frei sein, mit dir das Leben entdecken, eigene Wege gehen...» Verzweifelt verwarf der junge Mann die Hände. Je weiter er diese Gedanken verfolgte, desto auswegloser erschien ihm auf einmal seine Lage.
Sanft fasste ihn Anathêna bei den Händen. «Schön Erni», hauchte sie. «Dir ist Grosses bestimmt, ich fühle es. Aber ich bitte dich, vertraue deiner Mutter. Sie ist die Königin aller Faë. Das Wohlergehen sämtlicher Lebewesen, die ihrer Obhut anvertraut sind, liegt ihr am Herzen. Gewiss sind ihre Absichten rein und redlich. Wenn es in deiner Macht liegt, ihr bei ihren Bestrebungen beizustehen, dann darfst du dich dieser Verantwortung nicht entziehen.» Sie schenkte ihm ein ermutigendes Lächeln und drückte fest seine Hände. «Und ich werde mit dir ziehen, Liebster. Denn das Heil von Menschen und Feen bedeutet auch mir viel. Aber ich verstehe dein Bedürfnis nach Rast und Erholung. Lasse uns den heutigen Tag hier verbringen und in aller Ruhe darüber nachdenken, wie wir weiter vorgehen wollen.»
Ernestus stiess vernehmlich den Atem aus. «Ich weiss nicht», bemerkte er zweifelnd. «Mir gefällt das einfach nicht. Vielleicht hätten wir besser in Nuithônia bleiben sollen.»
Anathêna ging nicht weiter darauf ein. Sie zog ihren Gefährten auf die offene Wiese hinaus und tänzelte anmutig durch das samtweiche Gras. «Weisst du was?», nahm sie nach einigen Augenblicken das Gespräch wieder auf. «Ich frage mich gerade, ob in dem Prinzen von Helisee nicht auch ein Geisttier schlummert, dessen Gestalt er bei Bedarf annehmen könnte. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass er seine Aufmerksamkeit diesem Geheimnis seiner Seele zuwendet.»
Anathêna hätte sich gerne ihr silberweisses Federkleid übergestreift, um in die lichtdurchflutete Weite des verlockenden Waldes hinauszufliegen. Die Eule mit ihrer ganzen Leiblichkeit zu verkörpern war nochmals eine ganz andere Erfahrung, als lediglich mit ihrem Seelenlicht in die tierische Form hineinzugleiten. Aber sie spürte tief in sich drinnen, dass sie Erni jetzt nicht alleine lassen durfte. Machtvolle Kräfte rangen in diesem Augenblick in seinem Herzen und in seinem Verstand. Sie hatte gehofft, ihn mit ihrer Begeisterung für die Tierwandlung vielleicht etwas von seiner Trübsal ablenken zu können. Und tatsächlich hatte er sich auf ihre Anregung eingelassen und versucht, sich in seinen Geist zu versenken. Aber sie hatte ihm angesehen, dass er grösste Mühe damit bekundete, sich innerlich sammeln und auf ein klares Ziel ausrichten zu können. Schliesslich war er seufzend aufgestanden, hatte ihr einen bekümmerten Blick zugeworfen, kurz ihre Hand gestreift und war hernach alleine zum silbernen Weiher hinübergestapft, welcher das magische Herz dieses wundersamen Ortes zu bilden schien. Vielleicht erhoffte er sich, dort ein neues Gesicht vorzufinden, welches seinem verunsicherten Gemüt Klarheit verschaffen konnte.
Anathêna liess den Gefährten ziehen, denn gewiss war ihm zu wünschen, dass er in einem ungestörten Moment der Stille wieder näher zu sich finden konnte. Erni hatte ihr von seinem verbotenen Gang in den Gläsernen Brunnen am Hof seiner Mutter erzählt, und davon, wie er in den lichtlosen Gewölben tief unter dem Kristallpalast einen dunklen Aspekt der Feenkönigin kennengelernt hatte, der seinen Geist zutiefst zerrüttet hatte. Anathêna konnte sich nach allem, was sie über Helva Zauberweberin erfahren hatte, einfach nicht vorstellen, dass der Königin der Feenlande, welche sich wie eine grosse Mutter um das Wohl aller ihrer Schutzbefohlenen kümmerte, etwas Unlauteres oder sogar etwas Boshaftes anhaftete. Wahrscheinlich war sie lediglich erzürnt und enttäuscht gewesen, dass ihr Sohn, in den sie so viel Hoffnung gesetzt hatte, ihr heiliges Gebot missachtet hatte. Anathêna wäre so gerne mit ihrem Gefährten nach Schloss Helisee gezogen. Nicht nur, weil sie darauf brannte, den Mittelpunkt dieses zauberischen Landes mit eigenen Augen zu sehen, sondern auch, weil sie von Herzen gerne endlich persönlich der Feenkönigin begegnet wäre. Ihre Mutter Luyôba Balmlicht, welche selbst dem Holden Volk entstammte, war stets des Rühmens voll gewesen, wenn sie von ihrer Gebieterin gesprochen hatte.
Während Erni sinnierend am Weiher hockte, sog Anathêna mit halb geschlossenen Augen den Zauber der Waldlichtung ein und malte sich aus, welche wundervollen Dinge ihnen dieser Ort noch offenbaren mochte.
Plötzlich merkte sie auf. Etwas veränderte sich.
Täuschte sie sich, oder war am Waldrand gegenüber Nebel aufgezogen, der in leichten Schwaden zwischen den Bäumen hervorwallte und in der lauen Luft unter dem offenen Himmel geisterhaft zerfaserte?
Eine blütenweisse Hirschkuh hatte sich dem Teich angenähert und blickte unverwandt zu Erni hinüber. Dieser schien jedoch so tief in seinen Gedanken versunken zu sein, dass er ihrer nicht gewahr wurde.
Tatsächlich wogten nun von allen Seiten einzelne Nebelbänke aus dem grünfunkelnden Waldschatten heraus und verwehten über der Blumenwiese zu wirbelnden Figuren.
Anathêna erinnerte sich an jenen unheimlichen Moment vor einem Jahr, als der Silberne Ritter, Ernis Vater, sie beide auf seinem prachtvollen Schimmel durch die Nebelschwaden zurück nach Calamis geleitet hatte.
Plötzlich beschlich ein unbehagliches Gefühl die junge Frau, deren Gemüt noch vor einigen Augenblicken mit der goldenen Sonne um die Wette gestrahlt hatte. Sie stand auf und bewegte sich mit raschen Schritten auf den Weiher zu.
Da erregte sie die Aufmerksamkeit der Hindin12, und das anmutige Tier wandte sich überraschend ihr zu. So lieblich und unschuldig die Erscheinung dieses Geschöpfs auch immer war, so liess sein Anblick doch ein leises Gefühl von Vorsicht in Anathêna anklingen. Sie hielt inne und blickte der Hirschkuh abwartend entgegen.
Da geschah etwas Seltsames.
Die Umrisse des graziösen Tieres zerflossen in einem leuchtenden Nebel und formten sich kurz darauf neu zu der Gestalt einer Frau.
Sie war hochgewachsen und schlank wie eine Birke. Ein schlichtes, weisses Gewand floss über ihren Leib zu Boden. Ihr langes kastanienbraunes Haar trug sie offen, an der Stirn lediglich von einem Kranz aus Laubwerk umfasst. Ihre Augen waren so dunkel und geheimnisvoll wie diejenigen der Hindin, deren Gestalt sie offenbar nach Belieben anzunehmen vermochte. Auf unbestimmte Weise erinnerte die Ausstrahlung dieser elbenhaften Frau Anathêna an ihre eigene Mutter, die Bergfee von Grahârz.
«Prinz Eyrïân ist trüben Sinnes», liess sich die Hirschfrau vernehmen. Ihre Stimme hatte einen dunklen, vollen Klang – und obwohl sie leise sprach, verstand Anathêna jedes Wort klar und deutlich. Bedeutungsvoll sah sie zu Erni hinüber, der in diesem Moment blinzelnd die Augen erhob, als sei er frisch aus einer tiefen Träumerei erwacht.
«Dabei ist dies ein Tag der Freude», fuhr die Elbische fort. «Meine Gebieterin Helva Zauberweberin ist geneigt, sich bald mit ihrem Sohn auszusöhnen, damit die Eine und Einzige Kraft wieder ungehindert und frei durch das Grosse Gewebe fliessen kann.»
«Was ist geschehen?», begehrte Anathêna zu wissen. «Und wer bist du?»
«Ich bin Sulivôna Waldlied», erwiderte die geheimnisvolle Frau freundlich. «Mir sind die verborgenen Wege durch den Lichtwipfelforst von Flimfarîn wohlvertraut. Die Herrin vom Funkelnden Saal schickt mich, damit ich euch vor ihren Lebendigen Stuhl geleite. Sie wird euch selbst eröffnen, in welcher Angelegenheit sie nach euch verlangt.»
Erni war still neben Anathêna getreten und legte ihr den Arm um die Taille. «Bitte teile mir mit, was meine Mutter von mir will», verlangte er höflich, aber bestimmt, zu wissen.
«Mir steht kein Einblick in die Beweggründe meiner Gebieterin zu», bekannte die Elbenfrau verlegen und senkte ihren Blick. «Sie hat mir lediglich den Auftrag erteilt, euch wohlbehalten durch den Wald zu führen, denn wer seine verschlungenen Wege nicht kennt, kann in seiner Tiefe leicht in die Irre gehen.»
«Erni, das ist die Gelegenheit, die wir uns erhofft haben», stellte Anathêna unumwunden fest und warf ihrem Gefährten einen beschwörenden Blick zu. «Komm schon, lass uns hören, was deine Mutter zu sagen hat. Wenn du dich mit ihr gütlich einigst, wirst du auch in dir selbst endlich wieder Frieden finden.»
«Solange ich nicht haargenau erfahre, worauf dieses neuerliche Spiel hinausläuft, werde ich mich keinen Schritt in ihre Richtung bewegen», verkündete Erni mit trotziger Miene. Anathêna gefiel dieser Ausdruck in seinem Gesicht nicht, sie wusste nur zu gut, dass der Widerstand, den er dadurch anzeigte, nicht leicht zu durchbrechen war.
«Erni, ich bitte dich, wir sind unkundig in diesem Land. Es wäre töricht, ein Willkommensangebot der Feenkönigin auszuschlagen. Wer weiss, ob wir ohne ihren Segen hier nicht in Schwierigkeiten geraten könnten.»
«Donner und Drudenspucke! Dann kehre ich diesem Land lieber wieder den Rücken zu, als dass ich mich vorschnell dem Zugriff meiner Mutter aussetze». Erni sprach mit gepresster Stimme und zog finster seine Augenbrauen zusammen. «Wahrscheinlich ist es sowieso geraten, bald wieder den Heimweg anzutreten, damit ich endlich in Ruhe gelassen werde.»
«Liebster, warum wehrst du dich nur so gegen diese Einladung, den Zwist mit deiner Mutter aufzulösen und mit ihr ins Reine zu kommen.»
«Dann lass du dich doch zu ihr führen, wenn dir der Sinn dermassen danach steht», giftete Erni und funkelte erbost mit den Augen. Ohne die Waldfrau auch nur eines Abschiedswortes zu würdigen, wandte er sich ab und stampfte missmutig dem Waldrand zu.
«Es tut mir leid», seufzte Anathêna. «Er ist so stur. Und so unbelehrbar. Vielleicht lässt du uns noch etwas Zeit. Es hat jetzt keinen Sinn, weiter in ihn dringen zu wollen. Sei so gut und komme morgen nochmals. Ich werde versuchen, ihn zum Einlenken zu bewegen.»
«Wie du willst», erwiderte Sulivôna ruhig. «Ich werde in der Nähe bleiben und über euch wachen. Aber seht euch vor, wenn der Nebel euch einhüllt. In seinem verwirrenden Gespinst können unbedachte Wanderer nur allzu leicht auf Abwege gelockt werden.»
Anathêna schluckte leer und nickte. Und ehe sie es sich versah, stand bereits wieder die weisse Hirschkuh vor ihr. Mit einigen Sätzen sprang sie auf die Lichtung hinaus und fuhr fort zu äsen - als hätte sie nie etwas anderes getan.
Ernestus war durch die fortgesetzten Versuche seiner Mutter, ihn ihrem Willen gefügig machen zu wollen, zutiefst verdriesslich gestimmt. In ihm verdichtete sich zunehmend die Gewissheit, dass es ein Fehler gewesen war, so rasch nach Helisee zurückzukehren. Er merkte, dass er mit den Ansprüchen, welche die Feenkönigin an ihn richtete, überfordert war. Wenn er sich nicht einmal einen Tag lang in den Feenlanden aufhalten konnte, ohne dass sie ihn sogleich wieder an ihr Gängelband zu nehmen trachtete, dann war seines Bleibens hier wirklich nicht mehr länger.
Bekümmert sah er zu Anathêna hinüber. Seine Geliebte war erfüllt von dem Wunsch, sich so rasch als möglich an den Kristallenen Hof zu begeben und dessen Wunder zu bestaunen. Er konnte es ihr nicht verübeln. In ihr strömte dasselbe Feenblut, welches auch ihm inne war. Natürlich wollte sie sich diesen ganzen Zauber mit Haut und Haar einverleiben. Genau dasselbe Bedürfnis verspürte er im Grund der Dinge ja auch in sich. Nur dass sich jede Faser in ihm dagegen sträubte, sich den Vorstellungen seiner gebieterischen Mutter unterordnen zu müssen.
Fieberhaft begann er zu überlegen: Er war in der Beldennacht mit Anathêna durch das Weltentor geschritten. Die Magie dieses heiligen Zeitpunktes im Jahresrad hatte den Schleier zwischen den Wirklichkeiten gelüftet. Wie konnte er wohl in die andere Richtung wieder hinüberwechseln? Darüber hatte er sich ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Eigentlich müsste sein Medaillon ihm dabei behilflich sein. So hatten sie es am Kristallenen Hof zumindest behauptet. Ob sich seine Macht auch auf Anathêna übertrug, wenn er mit ihr zusammen heimkehren wollte?
Aber er glaubte nicht daran, dass sie sich dazu bewegen liesse, den Wundern der Feenlande jetzt bereits wieder zu entsagen. Die Aussicht, sie hier zurücklassen zu müssen, versetzte ihm einen Stich ins Herz.
Erst jetzt bemerkte Ernestus den Nebel, der in luftigen Schwaden dem Waldsaum entlang waberte. Er war unnatürlich rasch aufgezogen. Wieder eines jener unerklärlichen Phänomene im Reich seiner Mutter.
Das eintönige Grau, welches das sattgrüne Lichtspiel des endlos verschlungenen Blattwerkes zu verschlucken begann, spiegelte freilich in zutreffender Weise die trostlose Stimmung in seinem Innern wider. Er fühlte einmal mehr mit brennender Intensität die Zerrissenheit in seiner Seele. Dass er nicht entscheiden konnte, welcher Welt er angehören wollte, belastete ihn über alle Massen.
Doch da blitzte ein unerwarteter Farbtupfer inmitten der sich ausdehnenden Leere auf. Es war ein grosser Falter mit purpurschillernden Flügeln, der über die Blumenwiese gaukelte, fast als wolle er den zudringlichen Nebelarmen entwischen, die nach ihm haschten. Etwas an diesem Tierchen zog Ernestus unwiderstehlich an. Vielleicht glaubte er in ihm jenen ersehnten Hoffnungsfunken zu erkennen, der ihm einen Ausweg aus seinem Dilemma weisen konnte.
Von einem Gefühl neuer Zuversicht ergriffen, lief er in die Nähe des dunkelroten Schmetterlings, der nun am Ufer des Weihers auf und ab tanzte, derweil die trägen Nebelschleier von allen Seiten näherkrochen.
«Erni, wir sollten vorsichtig sein», hörte er Anathêna plötzlich rufen. Sie stand immer noch an jener Stelle, wo sich zuvor die Hirschfrau offenbart hatte. Auf keinen Fall durfte er sie im Nebel aus den Augen verlieren.
«Komm hierher», forderte er sie auf. «Da ist etwas, das du unbedingt sehen musst.»
Als sie sich an seine Seite gesellte, fasste er ihre Hand und wies auf den Weiher hinaus, wo der seltsame Falter noch immer über der Wasseroberfläche taumelte. Inzwischen hatte sich der Nebel weiter ausgebreitet und den gesamten Wald ringsumher ausgelöscht. Nur der silberschimmernde Teich und ein rundum laufender Streifen grüner Wiese waren noch frei geblieben. Der Anblick gemahnte Ernestus auf faszinierende Weise an ein riesenhaftes, edelsteinumrändertes Auge, über dem sich ein immer kleiner werdendes Himmelsfenster wölbte.