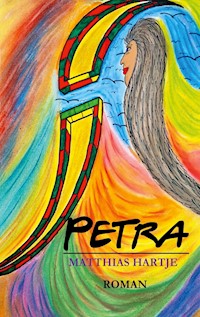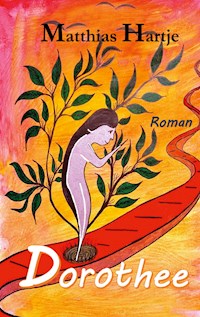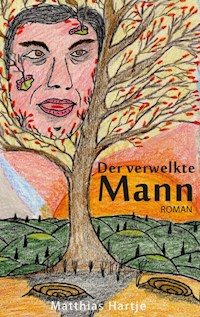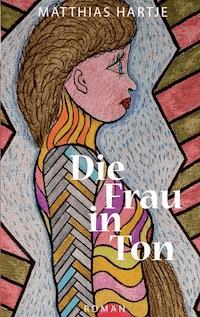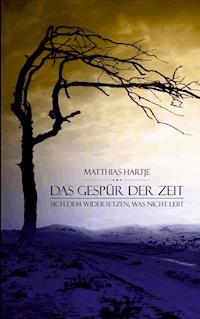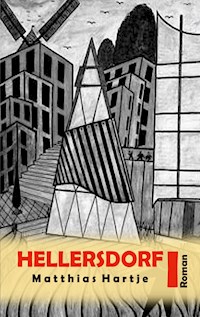
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo ist Hellersdorf? Ist der schlechte Ruf von Hellersdorf berechtigt oder kann man davon ausgehen, dass jeder hier wohnen und seiner Arbeit nachgehen kann? Gibt es Unterschiede zwischen Zehlendorf und Hellersdorf oder ist das Denken über die Welt so unterschiedlich, dass nur hier in Hellersdorf der braune Sumpf Fuß fassen konnte? Das Buch sagt "Nein!" und beschreibt den Stadtteil "Hellersdorf" als selbstständig, freundlich und naturbelassen. Hellersdorf ist ein Ort, den man kennenlernen muss, wo die Menschen sagen: "Wir leben gerne hier." Es ist ein Ort, an dem gestritten wird, wo die Kunst mit der Natur im Einklang ist, wo eine Seilbahn fährt und die Menschen zur Gartenschau und zum Dialog einlädt. Dass ein Dialog zwischen den Menschen stattfindet, darüber erzählt dieser spannende und interessante Roman. Er erzählt von Denkern, wie sie mit Kompromissen und ihren Leidenschaften umgehen und gleichzeitig versuchen, dass Hellersdorf ein normaler Wohnort bleibt, so wie jeder andere Bezirk in Berlin und im Umland auch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Inspiration lebt davon,
wie ich sie wahrnehme
und verstehe, um daraus
was entstehen zu lassen.
Und falls beides möglich wird,
ist die Inspiration ein Gefühl,
das die Angst in mir ernst nimmt.
Für Jens Pingel
Vorwort
Warum werden meine Gedanken nicht in einen vernünftigen Schriftsatz umgewandelt, aus dem die „Alten Denker“ herauslesen können, wie es mit der Welt bestellt ist und wie ich sie gerade empfinde? Das ist die spontane Frage eines „Alten Denkers“, wobei ich nicht weiß, wie so ein Text geschrieben wird.
Wie soll ich die Welt in mir beschreiben? Ich meine, die Welt in mir ist jeden Tag eine andere. Sie wandelt sich ständig und beschert mir in jedem Moment einen neuen Impuls. Doch wie lange hält er an? Geschieht vielleicht etwas in mir, wenn der Impuls seine Bedeutung verliert und ich nicht weiterhin lernen kann? Ich möchte viel über die Welt lernen, sie verstehen und im Ganzen betrachten. Im Ganzen kann ich aber die Welt nicht sehen, sondern nur ein Bruchteil davon.
Also blende ich sie aus, und das aus gutem Grund. Die illusionäre Welt übergeht meine Gedanken. Ja, und das ohne mein Einverständnis. Ich kann sie mir nur vorstellen, doch im gleichen Augenblick ist die Welt, die ich sehe, wieder anders. Die Wolken lösen sich auf. Ein Sturm zieht von Westen auf und ein lautes Auto will von A nach B fahren. Ich höre Stimmen in ihrer eigenen Sprache und sehe einen Fluss, an dessen Ufer sich die Wellen brechen. Zugleich aber blühen die Sonnenblumen auf dem Feld, das noch am Abend mit Schnee bedeckt war. Vögel fliegen umher und suchen Nahrung und schenken mir auf dem Balkon ein Lied. Alles ist im Gleichgewicht. Alles geht und kommt. Ankunft und Abfahrt wechseln ihre Standorte. Und der Ort, wo ich wohne, verändert sein Gesicht, weil dort Bäume und Hecken wachsen.
Ein Baum wird gefällt und ein neuer gepflanzt. Ein Denker liegt im Sterben und ein Kind sucht gerade das Licht. Ich lege mich hin und werde wieder aufstehen, um im Wandel meines Ichs zu lernen, wer ich bin. Ich stehe in einer Welt der unverdrossenen, habgierigen, tollwütigen, unermesslichen und hasserfüllten Denker. Sie, die ihren Reichtum denen übergeben wollen, deren Welt auch von Reichtum geprägt ist. Sie schüren Angst und führen zu ihrem Schutz dunkle Wolken mit sich. Als Mauer, die jeden Tag eine neue Reihe bekommt, auf dass sie höher und höher wird. Sie geben nicht zu, dass es Orte gibt, wo Genugtuung herrscht, wo Demut und Dankbarkeit angenommen werden. Was für ein Ort könnte das sein, wo Vertrauen und Gefasstheit gedeihen, wo Liebe und Nähe zugelassen werden? Muss der Ort erst geschaffen werden, wo der Preis in roten Lettern zu lesen ist? Nein! Der Ort ist überall zu finden. Dort suchen die „Alten Denker“ ihre innere Sehnsucht auf. Sie geben sich selbst die Erlaubnis, ihre Welt zu beschreiben. Es ist ein Ort, der dem Paradies gleicht, wo der Frühling kein Ende hat und die süße Frucht der Liebe immer wieder neu gedeiht. Und diese Welt sehe ich in mir. Ich sehe ganz deutlich, dass der Groll mehr und mehr im „Tal der Verlassenen“ verschwindet und ich ein Bild male, das einem geschriebenen Buch gleicht.
Eine Stahlbrücke, quer über einen See gebaut, ist ein seltener aber schöner Anblick, wenn ich aus dem Fenster meines Arbeitszimmers sehe. Im Hintergrund befindet sich der Kienberg, der mit Bäumen und wilden Sträuchern bewachsen ist. Genau deshalb wollte ich ein paar Zeilen über diesen meinen Wohnort schreiben.
Noch bevor ich über den Anfang nachdenken konnte, fiel mir beim morgendlichen Joggen das nahe gelegene Wuhletal ein. Früher schaute ich über eine Wiese, die unberührt auf mich wirkte. Die Wildblumen blühten das ganze Jahr. Über eine Anhöhe blies der Wind. Er pfiff durch das Geäst der Bäume. Damals war an eine Stahlbrücke, die jetzt das Wuhletal überspannt, noch nicht zu denken. Aber dann kam vor den Toren von Hellersdorf der Tag der Veränderung.
Manchmal konnte ich von meinem Arbeitsfenster aus beobachten, wie sich die dicken Stahlseile des Krans strafften und die schweren Brückenteile auf den Betonpfeilern abgesenkt wurden. Die Arbeiter riefen sich untereinander laut zu und gaben Zeichen, ob alles in Ordnung sei. Ich nahm nicht wahr, wie mir die Zeit durch die Finger glitt. Der Schnee war nur kurz da. Winter wollte es in diesem Jahr nicht so richtig werden. Weihnachten war bereits vergessen, und zum Jahreswechsel, wo Raketen bunte Sterne funkeln lassen, ängstigte sich das scheue Wild. Am Neujahrstag sah ich es am Wegrand unter dichtem Gestrüpp versteckt liegen. Doch nun wurde es warm und die Sonne stand gut in der Höhe. Ich wusste, dass der Frühling sein Lied formulieren würde. Schon kamen die Wildgänse aus dem Süden und flogen ihre Runden über dem See. Sie waren irritiert von der Stahlbrücke, die das Tal überspannte. Meine Nachbarn im Haus gaben dieser Brücke den Namen „Wuhletalbrücke“. Das klang harmonisch und schürte keine Vorurteile.
Überall hörte ich ein Sägen und laute Schläge auf Metall. Planierraupen schoben Sand und Geröll. Verwahrloste Landschaften verwandelten sich zu Wiesen und Gehwegen. Weinstöcke bekamen neue Erde, die ich zuvor im Traum schon gesehen hatte. Aufgebrochene Erde und tiefe Gräben gaben dem Blick mehr Raum. Jahre zuvor gab es dort nur brachliegende Flächen mit kranken Bäumen am Rand einer toten Straße. Sie wurden gefällt und der Boden geebnet. An diesem Ort sollte eine neue Welt geschaffen werden, die „Internationale Gartenausstellung“. Das war ein Zauberwort, welches die alte Erde im Neubaugebiet von Hellersdorf verdrängte.
Archäologen hoben uralte Schätze aus der Erde. Mit Spannung sah ich über den Bauzaun zu ihnen herüber. Später, als die Grabungen zu Ende waren, sollten an dieser Stelle zwei große Blumenhallen aus weißen Plastikplanen errichtet werden. So konnte im Sommer die Hitze ein wenig eingedämmt werden.
Als ich die Stahlbrücke zum ersten Mal überquerte, wurde mir deutlich, was sich hier alles verändert hatte. Ich ahnte nicht, dass mich neu angelegte Blumenrabatten so beeindrucken würden, dass ich mir den Frühling sofort herbeiwünschte. Die imposante Tulpenpracht in allen Ehren, aber so eine bunte Vielfalt von Blumen hätte ich mir nie vorstellen können. Einen Berghang bepflanzte man sogar mit seltenen Obstbäumen. Auch Streuobstwiesen entstanden.
Mein Herz erfreute sich jedenfalls daran. Dabei stand ich immer noch auf der Stahlbrücke, die das Wuhletal überspannte. Erst später wurde diese Brücke mit dem Namen „Wuhlesteg“ getauft. Wer allerdings dachte, es sei mit den Prachtbauten aus Beton und Stahl nun genug, wurde eines Besseren belehrt. Meine Besichtigung dieser Baustelle konnte daher nicht enden. Die Architekten ließen den „Wolkenhain“ entstehen – eine kreisförmige Plattform mit Stufen, zu der man mit einem Fahrstuhl gelangte. Wer es aber schaffte, die Plattform zu besteigen, der wurde mit einem wunderschönen Ausblick belohnt. Weites Land erstrahlte unter der Sonne, wenn sie mal schien. Mich rief der Wind beim Namen. Wolken tanzten über mir, Krähen stolzierten über die Terrasse in der Hoffnung, von den Gästen ein paar Krümel ihres Kuchens zu erhaschen.
Ja, es war lange her, dass ich zum letzten Mal hier oben war. Damals war das ein Schandfleck des Stadtteils. Überall lag Müll, abgebranntes Grillholz, Alufolie, Fett und Öl. Heute ist es eine pure Freude, auf der Terrasse des Cafés zu sitzen.
Ich beschreibe das bewusst so, denn ich traf hier zum ersten Mai einen alten Mann, der schon öfter seine Zeit in diesem Café verbracht hatte. Ihm schien es hier zu gefallen. Bei einer Tasse Kaffee und einem Cognac genoss er den wunderschönen Ausblick. Als dann Pfingsten vorbei war, unternahm ich erneut einen meiner vielen Spaziergänge und traf den alten Mann wieder. Ich musste ihn einfach ansprechen und fragen, ob an seinem Tisch noch ein Platz frei ist. Er bejahte.
Sein Aussehen war sehr gepflegt. Sein blondes langes Haar und das weiße Hemd mit der bunten Fliege machten ihn zu einem feinen Herrn. Dazu trug er eine schwarze Metallbrille und einen braunen modernen Sommerhut, was sehr edel wirkte. Sein Name war Konrad Schellenbaum, geboren in Oberschlesien, Jahrgang 1926, über vierzig Jahre verheiratet, lebt jetzt in Biesdorf und hat zuvor seine Berufsjahre in Sonneberg verbracht. Fünf Jahre später, nach der Wende, fand er ein gemütliches Anwesen mit Garten, wo seine Frau die Beete pflegte und er den Rasen mähte. Er kam immer mit dem Bus und fuhr natürlich mit der Seilbahn nach oben. Konrad schwärmte von dem Ausblick, der ihm kostbar schien. Wir verstanden uns gut. Er erklärte mir, wie es hier früher ausgesehen hat: „Hellersdorf war ein kleines Dorf. Den Berg, auf dem wir hier sitzen, gab es früher nicht. Nur die ausgedehnten Felder sind von den Bauern aus Mahlsdorf und Marzahn bewirtschaftet worden. Die Mühle, die jetzt in Marzahn steht, gab es früher schon, aber in schlechtem Zustand. Das gemahlene Mehl ging zu den umliegenden Backstuben, um Brot zu backen. Die Hellersdorfer waren ein kleines Völkchen. Das Dorf selbst war nicht groß. Das Gut war überschaubar. Ein paar Scheunen und diverse Wohnhäuser sind heute noch zu sehen.“
Ja, ich stimmte ihm zu, dass sich in Marzahn und Hellersdorf seit damals viel getan hat. Die Gärten der Welt sind ein kleines Juwel geworden, das sich gut in die Natur einfügt. Ein Tropenhaus und eine große Arena, wo Konzerte stattfinden, sind hinzugekommen. Als meine Mutter vor zwei Jahren noch lebte, gingen wir im Spätsommer immer zum Konzert ins Grüne. Die Konzerte mit dem Namen „Viva la Musica“ waren stets ausverkauft. Die Plastikstühle waren für meine Mutter allerdings gewöhnungsbedürftig. Sie waren hart und ungemütlich; nach einer gewissen Zeit plagte sie beim Sitzen der Schmerz. Egal, irgendwie überstanden wir das.
Konrad konnte viel von damals berichten. So war er im Zweiten Weltkrieg in der Normandie bei den Feldjägern gewesen. Nach dem Krieg wurde er von den Amerikanern verhaftet und eingesperrt. Nach fünf Jahren Gefangenschaft konnte er nach Hause gehen. Sein Geburtsort war nicht mehr da. Seine Familie war vertrieben worden. Die Einreise nach Königsberg wurde ihm verweigert. Seine Ehefrau lebte nicht mehr. Er musste sich eine neue Bleibe suchen.
Als Konrad und ich mit der Seilbahn nach unten fuhren, sahen wir uns den „Italienischen Park“ an. Auch den hatte er in sein Herz geschlossen. Mich erstaunte es, dass er nach so vielen Jahren und Schicksalsschlägen immer noch seine Freude so zeigen konnte. Meine Mutter war da anders gewesen. Sie ging gern spazieren. Als mein Vater noch lebte, ging er mit Mutter an den Wochenenden oft im Park spazieren. Das tat ihnen gut. Da meine Eltern vor ein paar Jahren ihr Grundstück in Ahrensfelde verkaufen mussten, waren die Gärten der Welt wie für sie geschaffen, um einen Neuanfang zu beginnen: Neubau, Marzahn, Ende 2000 zogen sie zum letzten Mal um. Zweite Etage mit Fahrstuhl. Ein Wintergarten mit Küche. Besser ging es nicht. Fünf Minuten Fußweg zu den Gärten der Welt.
Konrad hörte mir zu, wie ich von meinen Eltern sprach. Er fand es schön, wie der Zusammenhalt einer Familie sein kann, wenn alles stimmig ist. Aber leider war es nicht immer so. „In meiner Familie war nicht alles harmonisch. Später, als Vater körperlich und geistig abbaute, wurde er zugänglicher. Zu diesem Zeitpunkt zeigte er, welch ein Wunder, seine weiche Seite. Das habe ich früher als Kind oft vermisst“, erzählte ich Konrad. Er war erstaunt, wie ich mit diesem Gefühl umging. „Denke daran“, meinte er, „dass auch mein Vater eine bittere Zeit erlebt hat. Es soll keine Entschuldigung sein, aber man muss die Medaille immer von zwei Seiten betrachten.“
Nach nur drei Tagen traf ich Konrad auf dem Wuhlesteg wieder. Wir erkannten uns sofort. Er rief meinen Namen zwar falsch, aber ich wusste, dass er mich meinte.
„Konrad, ich heiße Markus“, sagte ich zu ihm, „nicht Martin.“
Wir liefen langsam am Wuhlesteg entlang und schauten uns drei Pferde in einer Koppel an. Es waren scheue Tiere, die einen großen Abstand zum Wuhlesteg hielten. Konrad sah das Heu im Gatter liegen. Er beklagte sich über die sommerliche Hitze. Das Gras würde dadurch nicht richtig wachsen. Er könne nicht richtig einschlafen. Daher mache er morgens seinen Spaziergang, während seine Frau das Mittagessen zubereiten würde.
Auf dem Wuhlesteg hatte man einige Stühle aus Holz gebaut, wo man sich ausruhen konnte. Konrad setzte sich und schaute in den Himmel. Ich staunte beim Anblick der vielen Wildgänse, die mit ihren Küken auf dem Wasser schwammen. Mein Blick von der Brücke teilte den Boden und das Wasser in Quadrate auf. Ich spürte Melancholie in mir aufsteigen. Der Wind strich mir übers Haar, während ich an meine Kinder dachte und mir vorstellte, mit ihnen über die Brücke zu laufen. Aber meine Kinder waren ja inzwischen groß, ihre Haarfarbe war etwas dunkler als meine (na ja, was an Haaren bei mir noch übrig war) und man sah ihre hohe Stirn, die ebenso auf eine baldige Glatze hinauslaufen würde.
Florian, der Älteste, besaß bereits einen zarten Bart. Mein mittlerer Sohn Milo hatte die Geheimratsecken meines Vaters vererbt bekommen. Und mein jüngster Sohn Tino war dynamisch. Er hatte ein volles Gesicht und interessierte sich fürs Theater. Ihm genügte ein kurzer Igelhaarschnitt. Obwohl jeweils fünf Jahre auseinander, besaßen sie so ähnliche Lebensgeschichten wie mein Vater und ich. Dementsprechend wollten sie auch ihr Leben anders gestalten. Das Alter geht eben voran und lässt die Dinge des Lebens reifen. Ich nenne das: „Gewonnene Lebenserfahrung“.
Sie bezeichnen diese hektische Welt als Farce. Die Zeit sei sehr kurzlebig. Und das würden sie eines Tages auch so empfinden, sagte ich zu meinen Kindern. Und die heutige Zeit ist nicht die von früher. Sie überlässt uns nichts, sie geht an uns vorüber und hinterlässt die Spuren vieler Sekunden, Minuten, Stunden, Wochen, Monate und Jahre.
Es sind die Stunden, die einen Tag machen, Minuten, die umgekehrt eine Stunde zu einem Tag anwachsen lassen. Wer weiß schon, wie die Zukunft aussieht? Das innere Gefühl lässt die Dinge so geschehen und wir achten nicht auf die Schnelligkeit. Die Monate werden die bevorstehenden Jahreszeiten im gleichen Muster vorbeigehen lassen: Der Winter kommt. Der Frühling lässt die Blütendüfte frei. Der Sommer führt zu Wachstum und der Herbst lässt seine Farben tanzen. Mein Nachbar, der im Haus über mir wohnt, klagt ständig über die schnelllebige Zeit. Er erinnert sich ebenso wie Konrad an die Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Fred Kalkenbrenner, auch weit über neunzig Jahre alt, war viele Jahre in Norwegen in der Gefangenschaft.
„Das ist ein kaltes, aber schönes Land“, meinte Fred zu mir, als er mir ein Bild zeigte, auf dem er mit neunzehn Jahren ein Gewehr in den Händen hält. Als die Wehrmacht sie umzingelte und sie festnahm, war das schöne Leben vorbei. Für ihn schien es erst gestern geschehen zu sein. Sein Atem ging schwer bei den Erinnerungen. Seine Gefangenschaft war bitter für ihn, meinte er und schaute sich dabei seine Hände an.
Die Tage wurden wieder schön und das Licht der Sonne berührte seine Hände. Ich sah in seinen Augen Traurigkeit aufflackern. Der Rollator mit den vier kleinen Rädern ratterte über die Gitter der Brücke. Der alte Fred sagte zu mir: „Früher war alles anders. Da gab es nur kaputte Brücken. Bomber richteten viel Schaden an. Als der Krieg dann vorbei war, mussten wir alle mit anpacken, damit die Brücken wieder funktionierten. Ich werde das nie vergessen.“ Seine Frau rief mit zarter Stimme dazwischen: „Fred, Fred hör’ auf! Hör’ endlich auf!“ Sie lief ein paar Schritte weiter und drehte sich zu mir um. „Mein Fred kann dir viele Geschichten erzählen“, schmunzelte sie. Ich spürte, wie stolz sie auf ihren Fred war, der im Dezember fünfundneunzig Jahre alt werden würde. Nun, auch ich wollte keine Geschichten mehr aus dem Krieg hören. Zu oft hat mir mein verstorbener Vater vom Krieg erzählt, vom Wiederaufbau und von der Gefangenschaft. Mir war klar, dass ich mich glücklich schätzen konnte, einige Jahre später auf die Welt gekommen zu sein. Aber wem nützt das schon im Nachhinein? Heute stehe ich auf einer der vielen Brücken in dieser Stadt und denke darüber nach, wie viele Arschlöcher auf der Erde wieder einen Krieg anzetteln wollen. Meine Kinder, die alle einen Beruf haben, stellen sich diese Frage nicht. Sie überlegen nur, wie es sich anfühlt alt zu werden.
Mein Vater hätte auch im Krieg frühzeitig sterben können. Selbst meine Mutter hatte große Angst vor dem Sterben. Ich fragte Mutter, als ich ihr einmal Brötchen zum Frühstück holte, was so schlimm wäre, über den Tod zu sprechen. „Wir alle müssen sterben“, gab ich patzig zur Antwort. Mutter sagte nichts dazu; ich denke, sie wollte auch nichts dazu sagen. Sie ist vor drei Jahren von dieser Welt gegangen. Einfach so. Sie schlief ein und ist nicht mehr aufgewacht. So erging es meinem Vater auch. Nach dem Abendbrot legte er sich wieder hin, schaute aus dem Stationsfenster und schloss für immer die Augen. Der Tod ist für uns alle ein Geschenk, das geöffnet wird, wenn die Zeit naht.
„Und wann kommt für uns dieser Tag?“, fragte mich einst mein jüngster Sohn, als seine Oma starb. Eigentlich ist dieser Gedanke seltsam, denn ich habe nie über den Tod nachdenken wollen. Das Alter spielt keine Rolle, zu jeder Zeit kann etwas mit mir geschehen. Nach der biologischen Uhr zu urteilen, habe ich noch lange zu leben. Der Wuhlesteg, auf dem ich vor einer Woche stand, wird die Wiesen auch in dreißig Jahren noch überspannen, vorausgesetzt man reißt ihn nicht ab.
Ich habe oft über die Zukunft nachdenken müssen. Man verlässt das Wohnhaus, wenn man alt ist, und verstirbt. Dann wird der Leichnam abgeholt und die letzte Fahrt wird feierlich zelebriert – die Fahrt zum Friedhof. Dann wird die Wohnung renoviert, damit ein neuer Denker einziehen kann, bis auch er sie wieder verlassen muss. Irgendwann steht auch er auf dieser Brücke und denkt über sein Leben nach, über den Tod und was daraus folgt. Das sind Generationsbilder, die immer wieder erscheinen.
Diesem roten Faden folge ich in ruhigen Stunden und denke darüber nach, wie schön die Welt sein könnte, wenn die Regenwälder nicht weiter gerodet, die Weltmeere nicht im Plastikwahn ertrinken und der letzte Buckelwal am Strand enden würde. Wann wird der Smog die Großstädte besiegen? Sie reden alle und tun nichts. Alles bleibt beim Alten. Vor Jahren, als mein Vater noch bei der Wehrmacht in der Flaggschule 41 diente, da haben sie Hunderte Bomber gebaut, um unzählige Städte und Dörfer von der Landkarte zu radieren. Alles lag am Ende in Schutt und Asche. Feuer loderte überall. Manche Flieger kamen nicht mehr zurück. Sie wurden abgeschossen. Dabei hatten sie viel Kerosin in den Himmel abgelassen. Tonnenweise wurden Gase freigesetzt, dabei versuchte man der Bevölkerung klarzumachen, dass keiner zu schaden käme. Alles Lügen! Und heute? Ich höre und lese immer wieder vom Klimawechsel und Dieselskandal. Millionen Kubikmeter Abgase werden Jahr für Jahr in den Großstädten freigesetzt und alle denken kaltblütig „nach mir die Sintflut“. Diese Art von Denken mag ich nicht. Früher dachte ich genau so, wenn die Volksarmee der DDR in den Flüssen ihre Panzer säuberte. Ölwannen wurden abmontiert und im Wasser gereinigt. Trotzdem es damals schon Alternativen gab, ließ man sie ihre Arbeiten verrichten. Kein Denker in Uniform scherte sich um saubere Gewässer wie die Spree oder die Elbe.
Detlef, ein Schulfreund, mit dem ich bei der DEFA in die Lehre ging, wollte gegen die bösartige Verschmutzung der Spree bei Hangelsberg etwas unternehmen. So kam er auf die geniale Idee, sich Spülmittel zu besorgen. Er wusste, dass es ein Lager im Keller der Oberschule gab. Dort befanden sich diverse Vorräte für die Küche. Nach kurzem Suchen in den Regalflächen nahm er sich zwei Kanister Spülmittel heraus und versteckte sie in der Nacht am Ufer der Spree, ohne dass andere Schüler oder Lehrer dies bemerkten. Im festen Glauben, dass das Spreewasser wieder sauber werden würde, kippte Detlef die zwei Kanister in der darauffolgenden Nacht in die Spree. Wenige Stunden später zog ein starkes Gewitter auf. Es regnete ohne Unterlass. Der Regen peitschte auf die Wasseroberfläche und der Schaum türmte sich auf. Wir Schüler dachten am nächsten Tag, es sei Winter. Auf der Wasseroberfläche sah man weiße Schaumberge. Glitzernd schäumte jede Welle ans Ufer und hinterließ eine Spur der Verwüstung von Öl und Dreck.
Diese uralten Geschichten, mit ihren vielschichtigen Gedanken, hinterlassen bei mir eine Art Rückstau, den ich nur langsam abarbeiten kann. Die Flucht anzutreten und die Äcker aus der damaligen Zeit noch mal umzupflügen, das macht keinen Sinn. Egal ob der saure Boden unter meinen Füßen das hergibt oder nicht, die Geschichten sind fertig geformt und letztendlich unbrauchbar.
Es wird geschehen, egal welche Nuancen meine Gedanken formen. Sie erhalten nicht die Möglichkeit, sich zu verändern. Ich muss wollen, dass die Schönheit der Begierde den hohen Rang einnimmt. Der Anteil am Ganzen rügt in mir das Ungleichgewicht zwischen Gut und Böse, weil eigentlich immer das Böse die Hand führt. Ich sollte das ändern, dringend. Denn die Zeit ist vergänglich und ruft nicht nach Vergeltung oder nach Vergebung. Die Zeit ist hier auf meiner Hand und ich darf sie existieren lassen. Sie hat mich zum Einklang verführt, als ich die Opferrolle hinter mir ließ. Dem Krieg, der das Schlaraffenland in ein Feld des Grauens verwandelte, werde ich keinen Glauben schenken. Niemals werde ich mir das anschauen und darauf reinfallen. Diese zurückliegende Zeit gab dem König kein Geschenk, sondern nur die Bitterstoffe von Galle und Feuerstein. Diese Musik wird bald wieder erklingen. Ich fühle es. Daher ist es notwendig, diese Begierde auszuradieren und ein neues Lied zu komponieren. Und ich weiß, dass das neue Lied die Wolken am Himmel forttreibt. Erst dann werde ich den Azur am weiten Horizont sehen. Erst dann sehe ich, dass die alten Schriften auf der Geburtsurkunde bleiben. Ich bin da, und das ist Beweis genug, um der Begierde zu trotzen.
Ich bin immer gern über den Wuhlesteg gelaufen. Am liebsten, wenn der Himmel sich leicht bewölkt gezeigt hat. Ich schaute mich um und begann es zu genießen, natürlich in der Hoffnung, dass ein kleiner Sonnenstrahl mein Gesicht erwärmte. Dann würde sich alles verlangsamen – das Denken, das Träumen und auch die Einsamkeit.
Das Geschehene spiegelte sich im Wasser. Ich gab mir Mühe, meine Wut und die Angst aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Aber das gelang mir nicht. Also hielt ich inne und wartete ab. Ich sah die neuen Hochhäuser im Norden und fühlte Dankbarkeit in mir aufsteigen, ganz spontan. Es war gut zu wissen, dass die Zeit, die mein Verständnis für den Sinn des Lebens bekundet, nachreift. Die Zeit schenkt mir Raum, und ich glaube zu ahnen, dass ein Teil von mir letztendlich alles richtig macht. Ist das die Wahrheit, von der viele Denker sprechen, oder darf die Wahrheit sich gegen meinen Willen bei mir einbrennen?
Bereits als Kind war mir klar, dass mein Vater mein Leben komplett vereinnahmt, zwar nicht so wie heute im Rückblick, aber im rhythmischen Tagesablauf von damals gesehen schon. Die ständigen Wutanfälle waren täglich fest einprogrammiert. Zu jeder Zeit konnte er das Cholerische abrufen. Als Kind war mir das wie gesagt nicht so bewusst, aber meine Not machte mich in vielerlei Hinsicht erfinderisch. Ich wollte ja überleben und der Gewalt entkommen.
Die schrecklichen Erfahrungen, die im Kindesalter mit voller Härte über mich hereinbrachen, haben tiefe Spuren hinterlassen. Vater war ein Choleriker. Eines Tages rastete er in der Küche aus, nur weil ich meine Hausaufgaben nicht in die Schule mitgenommen hatte. Er hat mir fast das Genick gebrochen, so stark packte er mich am Hals. Den Schmerz und die Gefühle eines Kindes hat er völlig missachtet.
Wer war dieser Denker von einem Vater, der mich mit seiner unglaublichen Brutalität egoistischerweise vereinnahmte? Wer glaubte er zu sein, um ein solches Benehmen an den Tag zu legen? Welches Recht hatte er, so mit einem Kind umzugehen? Ich betone, so brutal mit einem Kind umzugehen, ohne ihm eine Fluchtmöglichkeit zu lassen. Das Zimmer wurde ja vorher immer verriegelt. Mutter war zu diesem Zeitpunkt in der Küche und kochte das Mittagessen für den nächsten Tag. Ich aber lebte in ständiger Angst, und diese Angst gehörte zu mir und erzeugte einen Abwehrmechanismus, weil ich ja überleben wollte. Der Preis, den ich zahlen musste, war hoch. Ich musste mich verändern und suchte für die Zukunft eine Lösung, die mein Leben erträglicher machen sollte. Mir wurde klar, dass ich mein Muster verändern könnte, indem ich meinen Schmerz verdränge. Jedoch befürchtete ich, es nicht zu schaffen. Im Nachhinein ist das alles leicht gesagt, aber mir stand eine Mammutaufgabe bevor. Zu aller erst musste ich erfahren, wer ich wirklich war. In mir lebte eine Stimme, die mir sagte: „So kannst du echt nicht weitermachen.“ Anpassen war die Devise. Später missfiel mir dieser Gedanke.
Heute bin ich ein erwachsener Denker, der nach seinen Fähigkeiten lebt und wenn vorhanden, die Bedürfnisse in sich sucht. Ist das eine Erkenntnis? Oh, nein! Denn dieses Bedürfnis nach Sicherheit lebte schon früher in mir. Es sendete Signale, die ich aber nicht verstehen wollte. Irgendwie auch nicht konnte, denn ich wusste nicht, wie ich sie benennen sollte. So war es auch mit der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Diese Sehnsucht war in mir immer präsent, keine Frage. Nur wurde mir früher gesagt, dass die Liebe erlernbar sei und man Liebe nur erhält, wenn man etwas leistet. „Mehr Leistung, mehr Liebe“, so lautete die Devise der „Alten Denker“. Was für ein Unfug! Viele Jahre habe ich daran geglaubt. Das Ergebnis war, dass ich ein nervliches Wrack wurde und nicht wusste, wann ich nein oder ja sagen sollte. Diese Entscheidung im Jetzt zu treffen, war mir nicht möglich. Mein Leben war eine vage Skizze auf einem Blatt Papier, die ich zu jeder Zeit wegradieren, verwerfen oder gar vernichten konnte. Die Seele in mir blieb unruhig. Ich fühlte eine permanente Nervosität, die mich nicht schlafen ließ.
Früher habe ich mich dann im Malen versucht. Das tat mir gut. Ich habe die Motive meiner inneren Angst versucht zu finden, aufzuspüren, zu entdecken. Ich nahm mir sogar vor, in die Volkshochschule zu gehen, um das Malen zu erlernen. Die Volkshochschule in Hellersdorf gab mir diese Möglichkeit. Die Dozentin, Mitte vierzig, hieß Vera. Sie zweifelte daran, dass alle Schüler der Klasse, wir waren neun, malen könnten. Ihr kurzes Haar war dunkelblond, wurden wohl nicht oft gewaschen. Sie hatte fettiges Haar und neigte zum Schwitzen, wenn sie im Stress stand. Ihre braune Bluse aus Seide war gewellt und unter den Achseln sah ich oft feuchte Flecken. Sie redete viel und leitete uns nur sporadisch durch die Themen.
Die Klasse bestand aus sechs jungen Frauen und drei Männern in meinem Alter. Das Erstaunliche war, dass die Schüler gut mit dem Pinsel umgehen konnten. Man hätte meinen können, dass Hermann Hesse zuvor im Unterrichtsraum gewesen war und all die schönen Bilder gemalt hätte. Schon am dritten Tag wurde der Dozentin bewusst, mit welchen Denkern sie es zu tun hatte. All die Probezeichnungen sahen fantastisch aus. Einmal wurde eine Ananas und ein anderes Mal ein gefüllter Apfelkorb so frisch dargestellt, als wäre alles echt. Nach jeder Unterrichtseinheit mussten wir unsere fertigen Bilder zur Schau stellen und darüber urteilen. Vera wurde wüten und war ungeduldig. Sie wusste, dass einige Schüler talentiert waren, dieses Talent aber nicht nutzten. Ich dagegen gab mir die größte Mühe, eine Ananas zu malen. Dabei war es mir von vornherein unwichtig, wer von den Teilnehmern im Kurs der talentierte kreative Denker war. Ich wollte Freude am Malen haben und Gleichgesinnte finden, um die Aquarellmalerei zu erlernen.
Am fünften Unterrichtstag meldete sich die Dozentin krank. Der Unterricht in der Volkshochschule fiel für längere Zeit aus. Eines Tages gab es eine Gutschrift auf meinem Konto. Der Kurs war beendet. So blieb mir nur übrig, Literatur zur Aquarellmalerei und seinen Techniken zu finden, die mich weiterbrachte. Ich fand gute Fachbücher, die meinen Bedürfnissen entsprachen. Alles, was mit Kunst in meinem Wohnumfeld zu tun hatte, nahm ich mit großem Interesse wahr. Ich studierte kleine Rubriken in der Tagespresse über Ausstellungen und Lesungen. In einer großen Bibliothek in Marzahn fand ich sogar ein Kulturheft für den jeweiligen Monat, das darüber Auskunft gab, wo sich Künstler trafen. Meinen Hunger nach Information konnte ich damit stillen. Meine Begeisterung hielt sich aber noch in Grenzen, obwohl das Datum einer ganz besonderen Ausstellung für mich von Interesse war. Die Ausstellung hieß „Glasbruch“. Leider musste ich zwei Wochen warten, bis die erste für mich erlebbare Vernissage stattfand. Meine Neugierde wuchs täglich mehr.
Es war ein normaler mittelgroßer Laden unweit von einem großen Einkaufscenter gelegen; irgendwie ahnte ich schon vorher, dass es nach alten Kartoffeln und Kohlrabi riechen würde. Ich betrat diesen Laden in den Abendstunden. Abstrakte Bilder hingen an den Wänden. Bunt oder mit dünnen schwarzen Strichen versehen, sah ich diverse Skizzen und Aquarelle. Die Wände waren abgeschabt und ungepflegt. Sie passten einfach nicht zu den Bildern, die ich sah. Meine Suche galt dem Künstler, der diese Bilder gemalt hatte. Ich fand ihn nicht. Sein Name war Hilbert M. Diesen Hilbert M. suchte ich im Laden natürlich vergebens. Draußen standen viele „Alte Denker“ und rauchten und diskutierten. Mein erster Gedanke war, dass ich auf einer Modenschau und nicht auf einer Ausstellung sei, denn die Kleidung der weiblichen Denker war bunt und schrill. Eine trug ein knallrotes Kleid mit mehreren großen Ketten um den Bauch. Sie lachte so laut, dass ich in Versuchung kam zu fragen, ob sie einen Arzt bräuchte. Zudem galt plötzlich meine Bewunderung den unterschiedlichen Frisuren der Damen: hochgesteckte Filzpantoffelhaare mit dickem Knoten, Spielkugeln und lange aus Silber gefertigte Ketten im Haar und Aufstehfrisuren, die mit bunten Tüchern festgehalten wurden. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus und suchte weiter nach dem Künstler. Die Eröffnung sollte 19:00 Uhr sein, doch diese Zeit war längst vorbei. Dann ertönte plötzlich eine sehr schrille Stimme in der Masse, die fast schrie und kindlich auf mich wirkte: „Meine Damen und Herren! Ich begrüße sie ganz herzlich und freue mich, sie alle hier so zahlreich zu sehen.“ Mehr konnte oder wollte der Kurator nicht sagen. Überall wurde getuschelt, gelästert und geurteilt. Und das alles hinter vorgehaltener Hand. Da schreckte man nicht zurück, die Wahrheit über die Bilder zu sagen. Mir wurde fast übel, mit welcher frivolen Schmeichelei man über den Künstler Hilbert M. herzog.
Die Anzahl der Gäste war überschaubar. Ich dachte, dass nur Leute aus der Kunstszene anwesend wären, und das stimmte. Man war unter sich. Versteht sich! Ich stand rechts an einer Wand, niemand nahm von mir Notiz. Die Einsamkeit in mir übte das Theaterstück: „Wie kann ich mich allein unterhalten“.
Ich konnte das Gespräch zwischen einer Denkerin und dem Kurator, die ein paar Meter weiter rechts von mir standen, nicht richtig verstehen. Sie erkundigte sich, wo der Künstler geboren wurde und woher er kam. Der Kurator schwieg und gab keine genaue Auskunft über das Privatleben von Hilbert M. Schließlich hörte ich, wie sie über andere Themen sprachen: über eine Ausstellung in Paris und über die „Neue Galerie“, die in Berlin die nächste Ausstellung zu planen schien.
In der Vita, die neben dem Eingang an der Wand im Bildrahmen hing, las ich, dass Hilbert M. in Marzahn und Hellersdorf bekannt sei. Selbst in Biesdorf habe er früher unzählige Ausstellungen durchgeführt. Er war ein Star aus der ehemaligen DDR und galt als die Ikone der Malerei der „Abstrakten Kunst“. Ich ließ alles so stehen und war im Begriff Kontakt zu einer jungen Denkerin aufzunehmen, die vor einem Bild stand und ihr Sektglas zum Mund führte. Ich wollte sie fragen, woher sie Hilbert M. kannte. Doch ich hatte meine Frage noch nicht mal zu Ende gesprochen, als sie mich von oben bis unten anstarrte und mir dann den Rücken zukehrte. Ein Gitarrist (Anfang dreißig, dunkler Anzug mit roter Krawatte) spielte einen Tango. Seine bunte Strickweste nährte in mir den Verdacht, dass seine Heimat Spanien war. Während die Musik spielte, sah ich plötzlich Hilbert M. sich mit einer gut aussehenden Dame am Eingang angeregt unterhalten. Ich war erstaunt über sein kühles Benehmen, denn ich achtete darauf, ob er den Gitarristen wahrnahm, der auf den Saiten seiner Gitarre elegant ein schönes Lied zupfte. Zwar konnte ich Hilbert M. leider nicht weiter beobachten, aber er schaffte es tatsächlich, dem Gitarristen keinen einzigen Blick zu würdigen. Er trug einen weißen aus Bast geflochtenen auffälligen Sommerhut. Sein braun gebranntes Gesicht bildete zu seinem weißen Flanellhemd einen so starken Kontrast, dass man glaubte, er wäre im Urlaub gewesen. So unterhielt er sich begeistert mit der charmanten Denkerin und ignorierte den freudigen Beifall der vielen Gäste, die den Gitarristen bejubelten.
Es machte mich wütend, zu beobachten, wie arrogant Hilbert M. sich gegenüber dem Publikum benahm. Aber da ich das schon oft beobachtet hatte, wunderte ich mich nicht mehr, dass solche Denker ungestraft mit dem Kopf durch die Wand gehen durften. Sie sahen ihr Ziel und ließen sich durch nichts beirren, es zu erreichen. Es scherte sie auch nicht, wie andere über sie dachten.
Mutter sprach oft davon, dass man still sein soll, wenn es darum geht, die Verletzungen von anderen Denkern zu schlucken. „Nur kein Gefühl zeigen, sonst zeigt man, wie schwach man ist. Wer sensibel ist und ständig rumheult, wird ewig ein Verlierer bleiben“, so Mutters These. Bin ich ein Verlierer? Meine Alten hielten mir jahrelang vor, dass ich es nie zu was bringen würde. Später, wenn ich selbst Kinder hätte, müsste ich sie ebenso egoistisch erziehen, damit sie gehorchen und brav sind. Das stimmte mich traurig. Heute bin ich selbst Vater und kann mich nicht erinnern, dass ich meine Kinder unter Anwendung von Gewalt erzogen hätte. Auch sie werden Erinnerungen aus ihrer Kindheit mitnehmen und einen vernünftigen Ansatz finden, mit Kind und Kegel liebevoll umzugehen.
Ich weiß, dass ich als Vater, wie jedes Elternteil auf der Welt auch, nicht ganz fehlerfrei in der Kindeserziehung war. Es kann nicht immer alles Super laufen, auch wenn man sich Mühe gibt. Die Gesellschaft hat es einem doch vorgemacht. Stress und politische Verhältnisse waren damals starken Veränderungen unterworfen. Einen Ruhepunkt zu finden, das war in der Wendezeit schwierig. Jeder „Alte Denker“ in der Stadt wollte in Ruhe arbeiten gehen, um sich was leisten zu können. Da konnte man froh sein, eine eigene Wohnung zu bekommen, eigene Möbel zu haben. Ohne zu fragen, wann man nach Hause kommen muss.
Dann kam der Tag der Familiengründung. Ein Kinderbett wurde aufgebaut. Spaziergänge im Park und auf dem Spielplatz mit dem eigenen Kind spielen, das waren schon tolle Sachen. Ja, alte Traditionen und Prägungen wollen gepflegt werden.
Erinnerungen geben die alten Rituale nicht einfach auf. Zuckersüß lassen sie sich am Abendbrottisch zerkleinern, um zu behaupten, dass kein Verstehen möglich ist.
„Ich kann es nicht verstehen!“
Wie laut musste ich lachen? Die Gedanken saugen das auf und lassen alles in mir lebendig werden. Die latenten Bilder der Erinnerungen werden abgespult und der Wahnsinn des Erlebten richtet sich auf und ruft ganz laut meinen Namen.
„Du Dieb! Du Halunke von einem Bengel!“
Ich wollte nicht aufgeben, wollte der Zeit trotzen und im selbst gemachten Bild zum Ausdruck bringen, dass nicht nur Disziplin wichtig ist, sondern auch Zucht und Ordnung. Alles rückt von allein zusammen, bricht weg, was vorhergesagt wurde, wird an Tagen geduldet, wo es einem nicht gut geht. Und dennoch spüre ich die Anwesenheit von Erinnerung und Zweifel. Reste von Vorhaltungen entstanden dabei, die mit dem Schaum der vielen Erzählungen einfach weggewischt wurden. Mythen begrüßten den Abend und machten zum guten Stil, dass die Erinnerung selbst schon wertvoll war. Man sprach gern über die Zeit vor dem Tagesanbruch und über das, was nie geschah. Sie rannten weg und ließen das Tor zur Welt offen. Nicht aus Vergesslichkeit. Oh, nein! Sie waren ja nicht dumm. Sie wussten, dass die Geschichtsbücher neu geschrieben werden. Jeder Tag war eine Revolution, ein Aufbegehren, ein Voranschreiten, das einem Entkommen glich. Ja, sie ahnten, dass das Kind aufstehen würde. Das eigentliche Wissen über die Erinnerungen, vor allem wie sie nachträglich belichtet wurden, wird so belassen. Die Zeitspanne von Anfang bis Ende genügte nicht mehr, um zu beweisen, dass Erinnerungen in der Wirklichkeit keinen Halt finden. Behauptungen und Thesen, selbst alte Tonaufnahmen, dienten dem Zweck, die Gedanken immer wieder zu täuschen. Daher der Selbstbetrug: Es war einmal ein Sultan, der den kleinen Kindern die Hände abschlagen ließ, als sie aus Hunger vom Müller Brot stahlen. Ist die Legende wahr, um die Erinnerungen rechtfertigen zu müssen? Ich verneine das.
Ich lebe seit 1984, also schon viele Jahre, in einem Neubau am Rande einer turbulenten Stadt und ergründe meine These für das Überleben in Stahl und Beton. Es ist ein Revier wie jedes andere auch.
Man wohnt, arbeitet, ruht und entspannt sich so gut wie möglich. Ich habe das Geschehen um mich herum immer genau beobachtet. Informationen von Nachbarn und Arbeitskollegen haben meinen Einfluss im Umfeld, den ich dann auch gern wieder weitergab, gestärkt. Dazu gehörte es, die Erfahrungen anderer Denker zu übernehmen. Diese Hilfe nahm ich gern an. Ich lernte den Verzicht, lernte abzugeben.
Nach über dreißig Jahren fiel mir auf, dass das kulturelle Leben in meinem Wohnumfeld nicht sehr rosig aussah. Große Kulturhäuser wurden unter Honecker gebaut und trugen dazu bei, das Zusammenleben der Menschen zu fördern. Keine Kommune im Ostteil besaß den ernsthaften Willen und das Geld, diese Kulturhütten nach der Wende zu unterhalten. Gern war ich mit meinem Fahrrad unterwegs und radelte durch die gerade eröffnete „Marzahner Promenade“. Dort wurde eine Einkaufsmeile gebaut, und sogar eine große Kunstgalerie. Für „Alte Denker“, die mit der Kunst lebten und arbeiteten und ihre Produkte zeigen wollten, war das ein idealer Standort.
Ich erinnere mich an ein unauffälliges Gebäude in der Marzahner Promenade, das, eingebettet zwischen zwei Hochhäusern, von Wolf-Rüdiger Eisentraut entworfen worden war. Das Gebäude bestand aus Glas und Beton. Diese Materialien harmonierten hervorragend miteinander, denn sie schufen helle Ausstellungsräume, die die Kunst ins rechte Licht setzten. Die Marzahner Denker nannten es „Galerie M“. Die Kunstinteressierten waren froh, ein solch schönes Gebäude für Ausstellungen auf zwei Etagen zu haben. In der „Galerie M“ wurden Bilder verschiedenster Genres gezeigt, angefangen von Zeichnungen und Fotografien, bis hin zu Aquarell- oder Ölmalerei. Zwei Etagen voller Kunst. Würde die „Galerie M“ noch stehen, hätte ich gekämpft, um selbst mal dort ausstellen zu dürfen. Heute sehe ich dort nur ein verwildertes Stück Wiese, eine schmerzhafte Lücke zwischen den zwei Hochhäusern, die heute noch stehen und darauf warten, dass solch ein Gebäude wieder entsteht. Es stimmt mich traurig.
Nicht weit von der Promenade stand das einzigartige Kino „Sojus“, das mit mehreren kleinen und großen Sälen ausgestattet war. Jede Woche gab es Filme, die meine Fantasie anregten. Auch hier fand man keinen neuen Betreiber, der genügend Geld für einen Neuanfang gehabt hätte. So stand eines Tages die Abrissbirne bereit, um auf dieser Fläche einen Supermarkt mit Parkplätzen für 250 Fahrzeuge zu bauen.
Da Berlin nach dem Krieg durch eine Mauer geteilt wurde, war auch das deutsche Volk geteilt. Achtundzwanzig Jahre lang gab es einen Westteil und einen Ostteil. Die politischen Hintergründe waren in Ost und West unterschiedlich und somit auch die politische Erziehung der Bürger. Die Öffnung der Mauer und die Zusammenführung der Menschen berührten mich anfänglich. Doch das verging mit der Zeit, denn im Westteil von Berlin zogen finanzstarke „Alte Denker“ ein, und zwar aus den alten Bundesländern, wohingegen im Osten tiefste Armut herrschte. Arbeitslosigkeit wurde im Osten neu definiert, und Vollbeschäftigung war ein Traum, den die Menschen nur aus alten sozialistischen Zeiten kannten. Überall im Osten wurden Betriebe abgewickelt und verkauft. Das hatte ernste wirtschaftliche Folgen.
Ich stand in meiner Jugendzeit oft allein an der Mauer und sah die gelben Doppelstockbusse an der Bernauer Straße umherfahren. Die DDR lebte unter der roten Arbeiterfahne und ich konnte den goldenen Westen erblicken. Bunte Bilder in den Nachtstunden. Wenn der Ostteil sich verdunkelte und schlief, bin ich in die Oderberger Straße gelaufen, um in den fünften Stock eines Altbaus zu gelangen. Eine Fensterluke unter dem Dach des Hauses konnte ich öffnen, um in Ruhe zu sitzen und über Berlin zu schauen. Das Fernglas von Vater half mir dabei, den Westen ganz nahe an mich heranzuzoomen. Ich konnte die Häuser fast berühren. Ich sah die vielen „Alten Denker“ auf der Straße umherlaufen und an der Eckkneipe ihr Bier trinken. Ich konnte mich nicht sattsehen. Alles war so aufregend, aber auch fern. Doch die Zeit lief weiter und meine Begeisterung für diese funkelnde Welt fing Feuer.
Die Kindheit prägt jeden Denker. Darum habe ich erst heute verstanden, warum ich so geworden bin. Ich hatte häufig Zahnschmerzen und trug lange fettige Haare. Die kurze und stark abgenutzte schwarze Cordhose und den selbst gestrickten hellblauen Pullover von Mutter, das war echte DDR-Mode, mit der man klarkommen musste. Die dicke braune Plastikbrille, die ich trug, war meinem Empfinden nach für mein Aussehen nicht sehr vorteilhaft.
Ich wurde von meinen Klassenkameraden stets angepöbelt und auf dem Nachhauseweg aufgelauert. Sie rissen mir meine alte Schulmappe vom Rücken und zerschnitten mir oft die Gurte. Nie habe ich eine nagelneue Schulmappe erhalten. Mutter musste sie stets flicken. Für mich war das eine schreckliche Zeit. Gott sei Dank sind das nur Erinnerungen.
Ein Atelier zu haben, das empfand ich zwar in Gedanken gut, aber es erschien mir im Laufe der Zeit zu teuer. Daher war es mir recht, aus meinem Zimmer ein kleines Atelier zu machen. Der Kompromiss war preiswert. Ich konnte meine Bilder malen, und wenn es darum ging, eine große Leinwand zu bemalen, musste ich halt auf den Balkon gehen.
Das Jahr 2013 begann. Im Laufe meiner künstlerischen Tätigkeit lernte ich viele „Alte Denker und Denkerinnen“ kennen, die in ihren Ateliers arbeiteten. Und eine von ihnen war Ulrike, die sogar drei Ateliers ihr Eigen nannte. Ulrike Weiß ließ es sich nicht nehmen, in der hiesigen Kunstszene jeder Zeit im Rampenlicht zu stehen und sich äußerst wichtig zu positionieren. Sie nahm jede Gelegenheit wahr, sich in einer guten Pose darzustellen. Jeden Ausstellungsraum, der ihr angeboten wurde, nahm sie zum Anlass, sich wie eine Schauspielerin aufzuführen und ihr Programm abzuspulen, um die Bilder ihren Gästen zu erläutern. Im Dorfkrug von Marzahn, unweit der schönen Mühle und der Kirche, hörte ich ihre schrille Stimme und sah ihr markantes Lachen. Ich möchte nicht darüber urteilen, aber mir war es etwas suspekt, wie sie ihre Werke vorstellte. Sie konnte keine Minute ruhig stehen, lief ständig hin und her und erzählte von ihren Bildern. Ein paar Gäste waren vor Ort und sahen sich die Bilder an. Andere Denker hielten sich am Büfett auf, und nach kurzer Zeit war Ulrike beim nächsten Bild und erzählte fast ähnlich lautende Erlebnisse aus der Vergangenheit.
Ich hielt es nicht lang aus, musste flüchten, zog mich ebenfalls ans Büfett zurück und trank ein Glas Wasser. Gerechterweise muss ich hier schreiben, haben mir ihre Bilder gefallen. Ihr Stil war comichaft mit warmen Farben. Das gefiel mir wirklich. Das plastische Malen hatte Gewicht. Ich sah, wie geschickt sie die Figuren malte. Die Motive sprachen mich sofort an. Sie machten mich auf weitere Bilder neugierig. Ich konnte verstehen, dass so mancher „Alte Denker“ ein Bild erwarb.