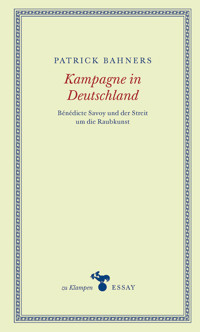13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Kein anderer deutscher Politiker ist so notorisch unterschätzt worden wie Helmut Kohl. Seine rhetorischen Fähigkeiten waren begrenzt, als Intellektueller ist er nicht auffällig geworden, und sein Provinzlertum berührte viele Deutsche eher peinlich, als der „Oggersheimer“ 1982 in aufgeräumter Stimmung die Weltbühne betrat. Doch während Kohl anfangs noch Spott und Häme auf sich zog, belehrte er seine Gegner rasch eines Besseren und gewann vier Bundestagswahlen hintereinander. Kein anderer Kanzler der Bundesrepublik hat länger regiert als er, und als „Kanzler der Einheit“ und großer Europäer ist ihm auch in den Geschichtsbüchern sein Platz sicher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Patrick Bahners
Helmut Kohl
Der Charakter der Macht
C.H.Beck
Zum Buch
Kein anderer Kanzler der Bundesrepublik hat länger regiert als Helmut Kohl. Als «Kanzler der Einheit» und als großer Europäer ist ihm ein Platz in der Geschichte sicher. Doch auch die Spendenaffäre mit ihrem befremdlichen Rechtsverständnis gehört zu Kohls Biographie, ebenso wie sein uneingeschränkter Machtwille, der bei Weggefährten und in der Familie tiefe Wunden hinterlassen hat. Patrick Bahners entwirft ein Portrait des Politikers Kohl und eröffnet scharfsinnige Einsichten in den abgründigen Charakter der Macht.
«Das Buch von Patrick Bahners beweist immer wieder Humor von proustischer Feinheit, aber seine Beobachtungen haben einen ernsten Kern. Kohls Handeln und politisches Wahrnehmen war, so hat man spät, aber doch bemerkt, erheblich subtiler als sein Sprechen. … Ein perfekt poststrukturalistisches Buch über den deutschen Kanzler.»
Gustav Seibt
Über den Autor
Patrick Bahners ist verantwortlicher Redakteur für Geisteswissenschaften in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», deren Feuilleton er von 2001 bis 2011 geleitet hat. Bei C.H.Beck sind von ihm erschienen: Die Panikmacher. Die deutsche Angst vor dem Islam. Eine Streitschrift. 2. Aufl. 2017; Entenhausen. Die ganze Wahrheit. 3. Aufl. 2014.
Inhalt
1.: Größe
2.: Aufstieg
Staatsmannskunde
Karriere in der Honoratiorenpartei
Ein expansiver Politikbegriff
Die Schaffung einer «modernen Volkspartei»
Innerparteiliche Gewaltenteilung
3.: Opposition
Das «fleischgewordene Godesberg» der CDU
Helmut Schmidt
Grenzen neu ziehen
Dynamische Demokratie
Subjekt und Mentalität
Ambivalenzen des Unpolitischen
4.: Regierung
Identität von Person und Position
Zeit, Arbeitskraft, Intensität
Methodik und Antimethodik
5.: Einheit
Kanzler und Kabinett
Kanzler und Minister
Stabilität statt Erschütterung
Dresden 1989
Der Volkssouverän nimmt Gestalt an
Der Mantel der Geschichte
6.: Europa
Vom richtigen Zeitpunkt
Der verzögerte Abschied
Durch die Wüste
Der Meistesser
Das Friedhofsgefühl
Personalisierung der Politik
7.: Sturz
Anderkonto
Das Schweigen
Das Ehrenwort
Parteidienst vor Staatsdienst
Ziviler Ungehorsam
Wolfgang Schäuble
Ein napoleonisches Schicksal?
Memoiren
§ 153a StPO
Hannelore Kohl
8.: Überleben
Der Dom zu Speyer
Erinnerung und Dankbarkeit des Herzens
Maike Kohl-Richter
Bruch mit der Familie
Ein geborener Mittelpunkt
Krise ohne Alternative
Kanzler der Zwietracht
Ein europäischer Staatsakt
Die Weisheit der Mutter
Nachwort
Für meinen Vater,einen parteilosen Staatsdiener
Ein eigentümlicher, persönlich gewichtiger, wenn auch undeutlicher Mann.
Thomas Mann, Der Zauberberg
1.
Größe
In den Jahren der ersten deutschen Einigung, zwischen 1868 und 1873, hielt Jacob Burckhardt dreimal eine Vorlesung über das Studium der Geschichte, die sein Neffe 1905 unter dem Titel «Weltgeschichtliche Betrachtungen» drucken ließ. Den Schluss des Manuskripts bildet eine Untersuchung des Begriffs der historischen Größe. Burckhardts Definition ist eine negative. «Größe ist, was wir nicht sind.» Der große Mann ist ein Fremder unter den Normalsterblichen. Sein Lebensentwurf ist von anderen Dimensionen als die Hoffnungen und Pläne der Bürger. Es fällt ins Auge, dass sein Charakter sich den Konventionen des zivilisierten Lebens nicht fügt. Ein Evidenzerlebnis stiftet die Autorität des großen Mannes: An ihm kommt niemand vorbei. Sein Anspruch auf Dominanz muss sich nicht weiter ausweisen. Er will absolut gelten, losgelöst von jeder Begründungspflicht. Bei objektiver Betrachtung entpuppt sich die Größe freilich als relativer Wert. Schlechthin überlegen erscheint der Riese nur den Zwergen. «Dem Käfer im Grase kann schon eine Haselnussstaude (falls er davon Notiz nimmt) sehr groß erscheinen, weil er eben nur ein Käfer ist.» Größe ist, was wir nicht sind, und bleibt eben deshalb an unsere Maßstäbe gebunden. Anhänger und Opfer findet der Große nur unter den Kleinen. Die Haselnussstaude muss sich schon zum Käfer hinunterbeugen, wenn er von ihr Notiz nehmen soll, muss ihm Nahrung, Aufstiegschancen oder das Glück im Schatten gewähren. Der Traum vom Helden ist eine Unterwerfungsphantasie, in der sich das Geltungsbedürfnis des Träumers verbirgt: Wir sind «unwiderstehlich dahin getrieben, diejenigen in der Vergangenheit und Gegenwart für groß zu halten, durch deren Tun unser spezielles Dasein beherrscht ist und ohne deren Dazwischenkunft wir uns überhaupt nicht als existierend vorstellen können». Es macht dem eigenen Dasein Ehre, dass fremdes Tun es beherrscht; der Held hat gearbeitet, damit wir es uns gut gehen lassen. So gilt auch für die welthistorische Machtverteilung die Dialektik von Herr und Knecht: Der Anführer lebt von der Anerkennung seiner Gefolgschaft.
Es ergibt sich noch eine zweite, wiederum negative Definition: Größe ist das, ohne das wir nicht wären. Die Frage nach der Größe verlangt ein gleichsam transzendentales Gedankenexperiment, sie zielt auf die Bedingungen der Möglichkeit der gegenwärtigen Weltlage. Wer ist beim besten Willen aus der Geschichte nicht wegzudenken? Bundestagspräsident Norbert Lammert zitierte Burckhardt am 22. Juni 2017, als das deutsche Parlament Abschied nahm von Helmut Kohl, der sechs Tage vorher im Alter von 87 Jahren gestorben war: «Kein Mensch ist unersetzlich – aber die wenigen, die es eben doch sind, sind groß.» Durfte man auf den ersten Blick glauben, das große Individuum stehe über dem historischen Prozess, sei frei, wo jeder andere durch Zeit und Raum gebunden ist, so erweist es sich nun als «wesentlich verflochten in den großen Hauptstrom der Ursachen und Wirkungen». Auch diesen Gedanken Burckhardts zitierte Lammert in seiner Gedenkrede auf Kohl, der dem Bundestag von 1976 bis 2002 angehört hatte. Der Held ist kein Gesandter einer besseren Welt, der ein höheres Gesetz verkündet; der Schwanenritter taugte nicht zum Herzog. Das Einmalige, sieht man es nur nüchtern an, lässt sich immer wegdenken; der Zauber der genialen Begabung oder der bezwingenden Erscheinung liegt darin, dass der Himmel dieses Geschenk ebenso gut hätte für sich behalten können. Wirklich unersetzlich ist, was nicht aus dem Rahmen fällt, die beharrliche Arbeit an der Stabilisierung der Verhältnisse. Gerne würde man im großen Handelnden einen Ausnahmemenschen verehren. Aber er steht ein für die Normalität. Auf Schritt und Tritt begegnet man seinen Einrichtungen; dauerhaft und gleichförmig, nehmen sie sich zwangsläufig langweilig aus. Die Alternativlosigkeit der bestehenden Ordnung kränkt den Verstand, der seinen Ehrgeiz daransetzt, nichts als gegeben hinnehmen zu müssen und alles wegdenken zu können.
Burckhardts Definition der historischen Größe ist formal. Er legt in dieses Prädikat kein Werturteil. Dass jemand unersetzlich ist, heißt nicht, dass es nicht wünschenswert wäre, ihn zu ersetzen. Größe ist bei Burckhardt tatsächlich eine quantitative und keine qualitative Einheit. Gemessen wird sozusagen die Zahl der Berührungen eines Individuums mit dem Weltgeschehen, die Dichte seiner Beziehungen zum historischen Prozess. Groß ist, wer sich mit dem Gang der Dinge so eng verbündet hat, dass seine Absichten von den geschichtlichen Tendenzen nicht mehr zu unterscheiden sind. Die Regeln des Spiels begünstigen den Teilnehmer, der es lange betreibt. Die «momentane Größe» ist ein Sonderfall; wer dauerhaft seinen Platz auf der historischen Bühne behauptet, hat den Verdacht der Größe für sich. Die Allgegenwart des Unersetzlichen bedingt, dass er keine einnehmende Erscheinung sein wird. Er hat es nicht mehr nötig, um Sympathie zu werben. Trotzdem erlebt man ihn als aufdringlich, denn es ist gar nicht möglich, ihm aus dem Weg zu gehen.
Burckhardt ist sein eigener Begriff nicht geheuer. Wenn wir einen Handelnden daran messen, wie viele Wirkungen er ausgelöst hat, riskieren wir, «Macht für Größe zu nehmen». Im Reich des Politischen ist diese Gleichsetzung fast unvermeidlich, da die «politische Größe egoistisch sein muss und alle Vorteile ausbeuten will». Unproblematisch erscheint die Verehrung der großen Künstler und Philosophen. Sie kann man aber genau deshalb «gelten lassen», weil man «nichts von ihnen zu wissen» braucht: Dem Werk sieht man die Gewalt nicht an, der es seine Entstehung verdankt. Die Qualitäten eines Staatsmanns oder Feldherrn zeigen sich dagegen nicht in dem Erbe, das er seinen Nachfolgern hinterlässt, sondern in seinem Handeln. Die «großen Männer der historischen Weltbewegung» sind interessante Individuen, gerade weil sie im Zwielicht operieren. Die politische Tätigkeit verleitet zur Haltlosigkeit. Während der Künstler die Zeit anhält und der Philosoph die Zeit überwindet, geht der Politiker mit der Zeit. Es gibt die Sache nicht, an der er sich orientieren könnte. Man mag glauben, dass Schönheit und Wahrheit sich immer gleichbleiben. Die Macht ist kein solches Ideal jenseits von Wettbewerb und Streit; sie wird im politischen Prozess gewonnen und verloren. Der Politiker ist auf sich selbst angewiesen; andere Ressourcen hat er zunächst und zuletzt nicht. Die Ethik verpflichtet zur Selbstlosigkeit; zur Selbstbezüglichkeit nötigt die Politik. «Die historische Größe betrachtet als erste Aufgabe, sich zu behaupten und zu steigern; und Macht bessert den Menschen überhaupt nicht.»
Weshalb aber legt Burckhardt der nackten Macht überhaupt den Umhang der Größe um? Was hat Napoleon, dieser «mangelhaft ausgestattete Mensch», in der Gesellschaft des göttlichen Raffael zu suchen? Wie in den großen Werken der Kunst einer darstellt, was alle fühlen, oder in den Sternstunden der Philosophie einer beweist, was alle denken, so geschieht es auch in der Politik, dass einer tut, was alle wollen. Es mag sogar sein, dass er tut, was niemand selbst getan hätte, aber jeder getan sehen möchte. «Die Bestimmung der Größe scheint zu sein, dass sie einen Willen vollzieht, der über das Individuelle hinausgeht und der je nach dem Ausgangspunkt als Wille Gottes, als Wille einer Gesamtheit, als Wille eines Zeitalters bezeichnet wird. Hierzu bedarf es eines Menschen, in welchem Kraft und Fähigkeit von unendlich vielen konzentriert ist.» Als Beispiele nennt Burckhardt die Eroberung Persiens durch Alexander und die Einigung Deutschlands durch Bismarck.
Die Willensstärke des großen Staatsmanns ist «abnorm»; sie zerbricht jede Vorstellung vom Maß und Gleichgewicht des gesitteten Verhaltens. Diese ins Übermenschliche gesteigerte Kraft bewährt sich auf Dauer nur in der Arbeit an Zielen, die jenseits des Horizonts eines bürgerlichen Einzellebens liegen. Wer reich werden will oder dem Namen seiner Familie Respekt verschaffen möchte, gehe besser nicht in die Politik. Die unsichtbare Hand der welthistorischen Ökonomie hat es so gefügt, dass derjenige seinen Willen durchsetzen wird, der mit der Entwicklung paktiert. «Es zeigt sich, scheint es, eine geheimnisvolle Koinzidenz des Egoismus des Individuums mit dem, was man den gemeinen Nutzen oder die Größe, den Ruhm der Gesamtheit nennt.» Dem Politiker wird seine Selbstsucht nachgesehen; ihn schützt «die merkwürdige Dispensation von dem gewöhnlichen Sittengesetz», eine Immunität gegen moralische Zensuren. Der Begriff der historischen Größe bezeichnet für Burckhardt weniger ein metaphysisches als ein moralisches Rätsel. Ob das Individuum oder die Gattung als letzte Ursache der historischen Bewegung anzusehen ist, möchte er nicht entscheiden. Ihn fasziniert, dass die Ausnahmemenschen durch solche Handlungen Bewunderung auf sich ziehen, die bei gewöhnlichen Sterblichen verachtet werden.
Burckhardts Überlegungen zur Natur der politischen Tätigkeit schreiben eine realistische Soziologie fort, die auf Machiavelli zurückgeht. Der Staat kommt nicht allein durch freie Vereinbarung zustande; es ist immer Zwang im Spiel. Wer Herrschaft auf gute Absichten und edle Prinzipien gründen möchte, übersieht, dass es Mittel geben muss, die in den Dienst dieser Zwecke gestellt werden können. «Es ist tatsächlich noch gar nie Macht gegründet worden ohne Verbrechen. Und doch entwickeln sich die wichtigsten materiellen und geistigen Besitztümer nur an einem durch Macht gesicherten Dasein.» Die Unsicherheit der Gründerjahre, die drakonische Maßnahmen rechtfertigte, hält für den Politiker an. Wer einem bürgerlichen Gewerbe nachgeht, hält den Fortbestand des Gemeinwesens für selbstverständlich. Dem Politiker ist der eigene Erfolg so ungewiss, wie es in der Anfangszeit die Existenz des Staates war. Die permanente Bewegung, die Normen und Institutionen stillzustellen suchen, dauert im Binnenbereich des politischen Systems fort. Der Politiker muss auf alles gefasst sein und ist daher zu allem fähig. Das Anforderungsprofil für seinen Beruf ist diffus. Wo ein Künstler oder Handwerker ein bestimmtes Material zu einem bestimmten Zweck bearbeitet, da ist dem Repräsentanten der Allgemeinheit jedes Mittel recht. Die Übung der Verwertung als solche bestimmt sein Handeln, eine Zweckorientierung, der die einzelnen Zwecke gleichgültig sein können. Dieser amoralische Pragmatismus lässt sich auch als moralische Haltung beschreiben, als Utilitarismus, der sich den Reichtum seiner Optionen nicht durch Vorgaben oder Rücksichten einschränken lässt.
Die Fertigkeit des Politikers, in der Instinkt und Kalkül, Vorbereitung und Improvisation zusammentreffen, nennt Burckhardt den «Machtsinn». Er ist ein Gespür für das Konkrete, für die handfeste Gelegenheit, die ein greifbares Resultat verspricht. Zugleich ist es eine Leistung der Abstraktion, alle Verhältnisse wie Konstellationen im Schachspiel zu betrachten, allein auf die von ihnen eröffneten Machtchancen hin. Burckhardt spricht dem Umgang mit der Macht eine erzieherische Wirkung zu: Er ist eine Schule der Disziplin, da der Politiker auch seine eigenen Wünsche daraufhin prüfen muss, ob ihre Erfüllung seine Macht mehren oder mindern würde. So wird zum Mittel der Machtsteigerung, was Machtlosen als Zweck des Machterwerbs erscheinen mag. Es ist nicht der Ehrgeiz, sondern «der Machtsinn, der als unwiderstehlicher Drang das große Individuum an den Tag treibt». Die Ehrungen der Mitwelt sind für die Mächtigen nicht Belohnung, sondern bestenfalls Bestätigung. Auch lieben sie «eher die Schmeichelei als den Ruhm; letzterer huldigt nur ihrem Genie, wovon sie ja ohnehin überzeugt sind; erstere aber konstatiert ihre Macht». Wer sich vom Machtsinn treiben lässt, muss an seine Unersetzlichkeit glauben; sonst verliert er den festen Punkt, auf den alle seine Berechnungen bezogen sind. Der Ruhm kann ihm schon deshalb im Ernst nichts bedeuten, weil er von der Urteilsfähigkeit der Menschen keine hohe Meinung hat. Er achtet allein «auf ihre Unterordnung und Brauchbarkeit», hält alle für austauschbar.
Die Politik ist ein Spiel, in dem jeder Teilnehmer sich anstrengt, gegen alle Wahrscheinlichkeit die eigene Unersetzlichkeit zu beweisen. Den freiwilligen Rückzug darf es nicht geben, denn er kommt dem Eingeständnis der eigenen Ersetzbarkeit gleich. Caesar nannte daher Sullas Niederlegung der Diktatur einen Fehler. Kein deutscher Bundeskanzler ist aus freien Stücken aus dem Amt geschieden. Kein Mensch ist unersetzlich: Die Demokratie erhebt auch deshalb den Anspruch auf den Titel der besten Staatsform, weil sie diese ungeschriebene Lebensregel als Verfassungsprinzip ausbuchstabiert. In der Demokratie gilt jeder Amtsträger jederzeit als austauschbar. In festen Abständen erhält der Souverän Gelegenheit, einen Ersatzmann an die Stelle des bisherigen Amtsinhabers zu setzen. Aristokratische Regierungen regeln den Zugang zur Macht. Magistrate nehmen nach dem Ende ihrer Amtsperiode als Senatoren oder Ratsherren weiter an der Herrschaft teil. Demokratische Verfassungen sorgen dafür, dass das Volk eine Regierung wieder loswerden kann. Bei Monarchen ist eine lange Regierungszeit Anlass für Dankgottesdienste; in der Demokratie wird die Erfolgsserie einer Regierung irgendwann zum Argument für einen Wechsel. Lässt die Volksherrschaft dem großen Mann keinen Spielraum? Burckhardt sah mit der Massengesellschaft düstere Zeiten für das Individuum heraufziehen. Demokraten sind neidisch, Bürokraten sind kleinlich; gemeinsam bewirken sie «die polizeiliche Unmöglichkeit alles großartig Spontanen». Dieselbe Verfassung, die den Mächtigen nicht dulden kann, der auf Formen nichts gibt, bedarf aber auch seiner Dienste. Jener Gesamtwille, dem ein Prophet oder ein Usurpator Wirkung in einem historischen Augenblick verschaffte, soll dauerhaft zu seinem Recht kommen; das Volk braucht Sprecher, und es braucht einen Sprecher, wenn es sich als eines fühlen soll.
Die Theorie der großen Männer in der deutschen Geschichtsschreibung gilt heute zumeist als antidemokratisches Erbteil, als literarisches Abbild des Obrigkeitsstaates. Übersehen wird, dass die welthistorischen Individuen mit der Exekution eines Willens beauftragt werden, der in der politischen Theorie Alteuropas keinen Ort hatte. Wo der Konservatismus Herrschaft als rechtlich und statisch dachte, da verkörperten Nationalhelden wie Reformatoren und Bürgerkönige eine moderne, dynamische Legitimität: Der allgemeine Nutzen war ein Produkt der historischen Bewegung, die über alte Rechte hinwegschritt. Fiktionen wie der Nationalgeist oder die Stimme der Geschichte hielten den Platz des souveränen Volkes frei. In der Demokratie gehen der Eigensinn des Volkes und der Machtsinn seiner Repräsentanten eine dauerhafte Verbindung ein. Nicht in Revolutionen, sondern in Wahlen und Abstimmungen artikuliert sich der Volkswille; er wird berechenbar und scheint kaum noch gewaltsam. Burckhardt sah das «Verhältnis der großen Männer zu ihrer Zeit» als «heilige Hochzeit», als mystische Übereinstimmung, die keiner deutlichen Worte bedarf. Diese Vermählung wird heute alle Tage gefeiert, wenn ein Politiker den Ton seiner Worte und die Farbe seiner Haare den in Umfragen ermittelten Stimmungen des Publikums anpasst.
Seit das Volk selbst zur Institution im Verfassungsstaat geworden ist, scheint sein Wille kanalisiert. Aber er hat die Kraft behalten, über die Ufer zu treten. Es widerstrebt ihm, Grenzen anzuerkennen; daher bleibt das Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat heikel. Wenn das Bundesverfassungsgericht Minderheitsrechte in Schutz nimmt, findet sich selten ein Politiker, der öffentlich erklärt, dass es Freiheiten gibt, die keine Mehrheit außer Kraft setzen kann. Es ist nicht bloß Opportunismus, der die Volksvertreter die Partei des Volksempfindens ergreifen lässt. Ihnen selbst sind die rechtlichen Beschränkungen ihrer Handlungsfreiheit lästig. Der Berufspolitiker darf hoffen, dass sein Egoismus mit dem allgemeinen Nutzen zusammenfällt. Dem Gemeinwohl wahrt er gerade dann die Treue, wenn er es mit den rechtlichen Grenzen seiner Macht nicht zu genau nimmt. Die Demokratie hat kein Verhältnis zur Form. Quelle aller Autorität ist die Spontaneität des Volkes; jeder Rückgriff auf die Traditionen wirkt willkürlich. Der demokratische Staat macht sich kein Bild von sich; im Staatsvolk gibt es keine Unterschiede. Das Amorphe demokratischer Politik gehört zu ihrem Wesen. Verfahren können im Interesse der Allgemeinheit unterlaufen werden. Die formelle Kommunikation in Gremien und Organen ist nur der anstrengende Sonderfall einer informellen Verständigung, die allemal dem Ganzen dient, wenn ein Kompromiss herauskommt.
Die großen Männer waren Parvenus auf dem welthistorischen Parkett, auch die Erbfürsten unter ihnen, wie Peter und Friedrich der Große. In der Demokratie besteht das gesamte politische Personal aus homines novi. Schafft ein Prinz es einmal, dazuzugehören, tut er gut daran, seinen Rang zu verschweigen. Kein adliger Verhaltenskodex, keine bürokratische Staatsgesinnung bietet diesen Aufsteigern Orientierung. Sie müssen selbst die Strukturen schaffen, in denen sie sich einrichten können. Gegen das Votum der Mehrheit gibt es keine Berufung; kein Argument gibt es gegen den Politiker, dem es gelingt, sich Mehrheiten zu verpflichten. Seit den Usurpatoren der Renaissance gilt die persönliche Herrschaft als instabil. Ein Staat, der sich einem Glauben oder einem Gedanken verschreibt, kann sein Interesse auf den Begriff bringen; wer seine Loyalität einem Herrn schenkt, liefert sich dessen Launen aus und muss zudem fürchten, dass er von heute auf morgen durch einen anderen ersetzt wird. In der Demokratie ist dagegen stets mit einem Wertewandel zu rechnen, der Prinzipien außer Kraft setzt. Hier sind persönliche Verbindungen dauerhafter als sachliche Gemeinsamkeiten. Es schafft Vertrauen, dass auf Wahlplakaten für die neuen Ideen das alte Gesicht wirbt. Wo eine Sache verloren ist, wenn ihre Unterstützer in die Minderheit geraten, da kann ein Politiker, der an Zuspruch verliert, sich eine neue Mehrheit suchen.
In modernen Demokratien wird nicht mehr durch das Los ermittelt, wer aus dem Volk zur Verwaltung der Angelegenheiten des Volkes berufen wird. Der Präsident der Vereinigten Staaten kann nur einmal wiedergewählt werden. Eine Ausdehnung dieses Prinzips auf die Volksvertretung begegnet dem Einwand, dass das Volk seine eigene Souveränität beschränken würde, wenn es sich das Recht nähme, einen bewährten Repräsentanten nicht zu ersetzen. An die Forderung nach «term limits» knüpft sich die Hoffnung einer Hebung des ethischen Niveaus im politischen Geschäft: Politiker, die ins bürgerliche Leben zurückkehren müssten, wären nach dieser Vorstellung nicht darauf angewiesen, um jeden Preis ihren persönlichen Vorteil zu verfolgen. Wahrscheinlich stabilisiert es hingegen die Demokratie, dass ihre moralischen Kosten den Berufspolitikern zugerechnet werden. Stellte sich unter einem Regiment der Ärzte, Anwälte und Professoren heraus, dass auch sie nicht immer sagen, was sie meinen, und nicht immer tun, was sie sagen, litte das Vertrauen in sämtliche Institutionen. Indem die Bürger die Politiker vom gewöhnlichen Sittengesetz dispensieren, dürfen sie sich einbilden, sie selbst hielten sich daran. Das Grundgesetz begrenzt nur die Amtszeit des Bundespräsidenten, bei dem Machtmissbrauch am wenigsten zu befürchten ist. Alle anderen Politiker fordert es auf, an ihrer Unersetzlichkeit zu arbeiten.
Im Jahre 62 vor Christus bekleidete Caesar die Prätur, das zweithöchste Amt in der Ehrenlaufbahn der römischen Republik. Nach dem Ende seines Amtsjahres wurde er als Statthalter nach Spanien entsandt. Als er die Alpen überquerte, kam er durch ein armseliges Barbarenstädtchen. Scherzhaft fragten seine Begleiter, ob es wohl auch hier die Konkurrenz um die Ämter und den Neid unter den Mächtigen gebe. Da sagte Caesar, wie Plutarch erzählt, in vollem Ernst: «Ich wenigstens wollte lieber hier der Erste sein als in Rom der Zweite.» Helmut Kohl hat seine Karriere unter denselben Anspruch gestellt, der dem Ehrgeiz ein hohes Ziel und ein strenges Maß setzt. Er hätte sich eher auf den kleinsten Fahnenmast der Welt gesetzt, um dem Volk zu beweisen, dass er das Zeug zu Höherem habe, als einem anderen beim Aufstieg geholfen. Der Zweite mag sich nützlich machen, unabkömmlich ist er nie, denn der Erste kann ihn abberufen. Den Ersten kann allein die Geschichte ersetzen.
2.
Aufstieg
Zwei Wochen nach der knapp verlorenen Bundestagswahl 1976 verkündete Kohl vor Journalisten: «Ich bin bereit, jede Wette zu halten, dass ich vor Ablauf von zwei Jahren Kanzler sein werde.» Als Horst Teltschik, Mitarbeiter der CDU-Bundesgeschäftsstelle und vorher Assistent des Politologen Richard Löwenthal an der Freien Universität Berlin, 1972 ein Vorstellungsgespräch in der Mainzer Staatskanzlei hatte, sagte ihm der Ministerpräsident, der im Jahr zuvor in der Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden unterlegen war: «Sie werden für mich arbeiten, weil ich eines Tages Kanzler sein werde.» Er redete, als hätte er keinen Referenten rekrutieren wollen, sondern einen Apostel. Der Fernsehjournalist Peter Hopen berichtet, im Frühjahr 1968 habe Kohl, Landesvorsitzender seiner Partei, aber noch nicht einmal Ministerpräsident, nach einer durchzechten Bonner Nacht mit schwerer Zunge die Prophezeiung hervorgebracht: «Ich sage Ihnen, ich werde Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.» Der Prophet, der im eigenen Land die Macht anstrebte, hatte schon früher Glauben gefunden, wenn wir einer Anekdote glauben, die Otto Graf Lambsdorff 1985 erzählte. Beim Bundesgeschäftsführer der FDP gaben sich 1962 zwei Besucher die Klinke im Bonner Bundeshaus in die Hand. Der zweite fragte seinen Gastgeber, wer denn der erste gewesen sei. «Das ist Helmut Kohl. Der wird einmal Bundeskanzler.» Zwanzig Jahre später sorgte Hans-Dietrich Genscher dafür, dass sein Wort wahr wurde.
Heinz Korbach, der erste Landessekretär der rheinland-pfälzischen Jungen Union, lernte den fast zehn Jahre jüngeren Helmut Kohl 1947 kennen. «Wer damals mit ihm sprach und ihn nach seinen späteren politischen Absichten fragte, erfuhr unverblümt und ohne Wenn und Aber: Ich werde einmal der erste Mann in diesem Lande.» Der Wortlaut klingt authentisch; man darf annehmen, dass der Kriegsheimkehrer sich die selbstbewussten Worte des Schülers genau gemerkt hat. Alle Umschreibungen der Ambition hätten das Unschickliche einer um Jahrzehnte vorgreifenden Bewerbung um das Amt des Ministerpräsidenten nicht getilgt. Hätte der wortmächtige Plakatkleber angegeben, er wolle für sein Land tun, was in seiner Kraft stehe, hätte er die Frage provoziert, ob er sich nicht übernehme. Aber derjenige zu werden, der niemanden mehr vor sich hat: Im Bekenntnis zu diesem Ziel lag eine Frechheit, die auf den Sieg setzen mochte, weil sie sprachlos machte. Im Unverblümten des Machtwunsches spricht sich zugleich eine Art von Bescheidenheit aus, die sich nicht in Floskeln erschöpft. Nur auf die Position kommt es an, nicht auf die mit ihr verbundenen Titel, Pfründen und Annehmlichkeiten. Der erste Mann im Lande ist ein Abkömmling Friedrichs II., des ersten Dieners seines Staates – nur dass er in der Demokratie, die den Herrscher abgeschafft hat, nicht die Rolle des Dieners spielen muss.
Wenn der Ehrgeiz sich nicht tarnen muss, wirkt er versachlichend. Die Politiker finden zur Gemeinsamkeit, weil sie um dieselben Posten kämpfen. Wer seinen Anspruch auf den ersten Platz nicht mit einem philosophischen Programm begründet, kann seine Mitbewerber nicht als ideologisch unzuverlässig abtun. Nur Chancengleichheit am Start macht den Sieger unangreifbar. In einem Fernsehgespräch mit Günter Gaus erklärte Kohl 1970, er traue sich das Amt des Bundeskanzlers durchaus zu, doch der Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel sei «von seiner Position her ganz einfach dran». Man unterstellte Kohl damals, er beschreibe den Status quo, um ihn zu untergraben; das Treuebekenntnis, das nur die faktische Situation des Älteren erwähnte, nicht dessen Leistungen, Fähigkeiten und Aussichten, las man als Variation auf die Versicherung, die Barzel am 4. Oktober 1966 namens der Fraktion abgegeben hatte, Ludwig Erhard sei und bleibe Bundeskanzler. Diese Deutung verkannte, dass Barzels Positionsvorteil Kohl echten Respekt abnötigen musste. Wer vorne ist, ist vorne: Diese Tautologie regiert den politischen Wettstreit, sobald er auf ein Wettrennen reduziert wird. Der Erfolg spricht für sich. Der Spitzenmann ist von jedem Legitimationszwang entlastet. Er hat nur die eine Pflicht, sich an der Spitze zu behaupten.
Als Nachfolger von Barzels Nachfolger im Fraktionsvorsitz hat Kohl von 1976 an einem immensen moralischen Druck getrotzt; mehrfach schien der Sturz nahe. Dass seine Gegner ein Idealbild des in Wort und Geste beeindruckenden Oppositionsführers entwarfen, dem Kohl nicht genügte, bestärkte ihn nur darin, sich im Besitz der Macht durch Erwartungen nicht beirren zu lassen. Die Demütigungen wurden ihm zur Kraftquelle, weil sie seine Unabhängigkeit bestätigten: Dass er die Spitzenstellung verteidigte, wurde immer erstaunlicher. Man ließ ihn im Amt, weil man ihn geschwächt glaubte; aber auf den moralischen Kredit, den er verloren hatte, gab er nichts. Ihm kam es nur darauf an, für alle Fälle der Erste zu sein. Als die Union im Oktober 1982 einen Kanzler benennen musste, war Kohl von seiner Position her ganz einfach dran.
Nach Einschätzung von Hanns Schreiner, den der Fraktionsvorsitzende der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag 1964 zu seinem Sprecher machte, wäre Kohl nie als Minister von Mainz nach Bonn gegangen. «Das hätte seiner Maxime, lieber der Erste im zweiten Glied als der Zweite im ersten Glied zu sein, nicht entsprochen.» In Kohls Provinzialismus steckte machtökonomisches Kalkül. Den Bezirk, den er überschauen und beherrschen konnte, zog er einem Reich vor, in dem er einem anderen Augen und Hände hätte leihen müssen. Er schlug Kurt Georg Kiesingers Angebot aus, als Innenminister in die Regierung der Großen Koalition einzutreten.
«Noch lieber als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wäre Kohl vielleicht Oberbürgermeister von Ludwigshafen», vermutete 1971 sein Vertrauter in der Bonner CDU-Zentrale, der Journalist Ludolf Hermann. Indem Kohl seinen Aktionsradius beschränkte, konnte er den ganzen Kreis der Politikfelder ausschreiten. Der Provinzfürst durfte Generalist sein. 1968, als Kohl noch mit dem «Spiegel» sprach, pries der designierte Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz das Glück, sich nicht festlegen zu müssen. «Ich erlebe hier das ganze Tableau der Politik, nicht nur ein Stück. Deshalb hat es mich nie gereizt, Minister zu werden …» Der Interviewer nahm den Ball auf und warf ihn in Richtung Bonn: «… sondern gleich jemand, der die Richtlinien der Politik bestimmt». Die leise Ironie in der schmeichelhaften Anspielung auf Artikel 65 des Grundgesetzes ist dem selbstbewussten Kohl damals womöglich entgangen. War es nicht anmaßend, wenn jemand gleich die Richtlinien eines Geschäfts bestimmen wollte, das er selbst nie betrieben hatte? Glich er nicht dem Schwiegersohn, der die Leitung der Firma übernahm, ohne sich vorher in die Buchhaltung einweisen zu lassen?
Wie Pompeius sich vor dem Volk rühmte, jede Ehrenstelle früher als erwartet erlangt zu haben, so strich Kohl gerne heraus, er sei in allen Ämtern der Jüngste gewesen. Nicht zuletzt deshalb malt man sich seine Ablösung des Patriarchen Peter Altmeier leicht als überstürzte Palastrevolution aus. Klaus Dreher weist darauf hin, dass sich der Koadjutor, der sich selbst das Recht der Nachfolge zusprach, acht Jahre Zeit ließ. 1961 wurde Kohl gegen den Willen des Ministerpräsidenten Altmeier in Mainz zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt, 1969 zog er in die Staatskanzlei ein. Kohls Verlobungszeit hatte fast so lange gedauert, von 1953 bis 1960. Erst hatte er seine berufliche Existenz zu sichern, ehe er die eigene Familie gründen konnte: Nicht nur für Kinder von Finanzbeamten galt, dass die Mittel für das bürgerliche Leben angespart werden mussten. Als Politiker erweckte Kohl den Eindruck des unziemlichen Drängens, indem er sich als Ministerpräsident im Wartestand benahm, seit 1963 als Fraktions-, seit 1966 als Landesvorsitzender. Er dachte nicht daran, sich einbinden zu lassen und ein Ministeramt zu übernehmen, obwohl seine Förderer ihn gerne in die Schule der Verwaltung geschickt hätten. Heiner Geißler, den Kohl Altmeier als Sozialminister aufzwang, hatte diese Lektion nicht vergessen, als er im Frühjahr 1989 eine Rückkehr in die Bundesregierung ablehnte. Kohl versprach sich mehr davon, unbequeme Reformen zu befürworten als zu verantworten. Er nahm sich den Freiraum, den er drei Jahrzehnte später seinem eigenen erwählten Nachfolger Wolfgang Schäuble nicht gönnte: Als Regierungschef in Reserve verhieß er zugleich Wechsel und Kontinuität, und das Publikum sollte sowohl seine Ungeduld als auch seine Geduld bewundern. Schon neben Altmeier hatte Kohl die Richtlinien der Politik in die Zukunft ausgezogen. Dass sich hier jemand auf das Allgemeine spezialisierte, wurde nicht als Mangel an Solidität wahrgenommen, sondern als Beweglichkeit, die in bewegter Zeit erwünscht war. Einer der Kollegen aus der CDU-Landtagsfraktion charakterisierte den Redner Kohl anerkennend mit den Worten, in Momenten der Verwirrtheit habe er «mit dem großen Bügeleisen alles glatt gestrichen». Die Unbestimmtheit von Kohls Visionen, die in den düsteren Anfangsjahren seiner Kanzlerschaft als Zeichen der Ratlosigkeit erschien, harmonierte in den sechziger Jahren mit einem Optimismus, der sich die Zukunft nicht zu genau vorstellen wollte.
Sozial konnte man Kohl ebenso wenig lokalisieren wie geistig: Er hatte seine Ursprünge hinter sich gelassen. Der alte und der junge Mann blickten auf eine ähnliche Herkunft zurück, waren aber durch ein Lebensalter und zwei Kriege getrennt. Kohls Vater war Steuersekretär, Altmeier war der Sohn eines kleinen Funktionärs der Zentrumspartei. Der weite Weg, den der kriegsversehrte Altmeier zurückgelegt hatte, macht verständlich, dass er wie der Gründer eines Familienunternehmens seinen Platz nicht räumen wollte, solange er bei Kräften war. Der Aufstieg war in Kohls Generation keine Ausnahme mehr und begründete nicht länger moralische Rechte. Wer der Austauschbarkeit trotzen wollte, dem Schicksal des Angestellten, musste sich wie die Gesellschaft alle Möglichkeiten offenhalten. Weder auf der Universität noch im Berufsleben hatte Kohl Qualifikationen erworben, die ihn als Fachmann auswiesen.
Staatsmannskunde
Die Jahre, in denen er der Landtagsfraktion vorstand, hat er als «harte Schule» bezeichnet. Er habe «unendlich viel» gelernt, «weil über den Tisch eines Fraktionsvorsitzenden im Landtag nahezu alle Probleme der Politik gehen, und wenn er daraus etwas macht, dann erfährt er einfach zwangsweise eine ungewöhnlich instruktive Ausbildung». Der Unterricht, selbst die freiwillig belegte Staatsmannskunde in der Schule des Lebens, wird hier mit der Vorstellung des Zwangs verbunden: Bildung erscheint nicht als Chance, sondern als Schicksal des Aufsteigers, der sich einen Überblick verschaffen will. Eine ähnlich aufschlussreiche Bemerkung ließ Kohl in der Fernsehdiskussion der Parteivorsitzenden vor der Bundestagswahl 1976 fallen: Studieren solle «jedes Kind, das begabt ist, gleich wie sein Elternhaus, seine soziale Herkunft aussieht, und das bereit ist, das Opfer des Lernens zu bringen». Das Versprechen sozialer Mobilität durch Bildung wird an eine Gegenleistung gebunden, die pathetischer nicht benannt werden könnte. Früher forderte der Staat von den jungen Männern im Ernstfall das Opfer des Lebens; passt dasselbe Wort wirklich auf die Unbequemlichkeiten eines Universitätsstudiums?
Den Schulbesuch nannte Kohl 1972 im Rückblick «eine Pflichtübung, die einfach zum Weiterkommen notwendig war». Auf Spitzennoten hatte er es nie angelegt; dafür erfuhr er früh, dass seine Begabung die Menschenführung war. Sehr früh: Am ersten Schultag kam er nicht allein nach Hause. Klassenkameraden, die er gerade erst kennengelernt hatte, bildeten sein Gefolge. Später bewährte sich der Klassensprecher nicht nur als Organisator. Vertrat er die Schüler vor der Direktion, fiel ihm oft ein unerwartetes Argument ein, das die Lehrer sprachlos machte. So soll auch Themistokles als Schüler in den Unterrichtspausen Reden ausgearbeitet haben, in denen er Kameraden verteidigte; sein Lehrer sagte ihm voraus, aus ihm werde etwas Großes – im Guten oder im Bösen. Während Themistokles sich eifrig in den Fächern betätigte, die auf das praktische Leben vorbereiteten, machte er nur zögernd mit, wenn es darum ging, sich die Anmut des gebildeten Menschen anzueignen. Die Folge war, berichtet Plutarch, «dass er später von Leuten verspottet wurde, die auf der Höhe zu sein glaubten in allem, was feine Bildung und gesellschaftlichen Schliff betraf».
Viele von Kohls Klassenkameraden studierten Naturwissenschaften und technische Fächer. Dieses nüchterne Interesse am Fassbaren und Begreiflichen, das charakteristisch für den Abiturjahrgang 1950 gewesen sein mag, war Kohl nicht fremd, vielleicht aber eine Disziplinierung des Denkens, die den Menschen als einsamen Beobachter einer Natur gegenüberstellt, in der er nie heimisch werden darf. Der Beamtensohn nahm zunächst an der Universität Frankfurt ein Studium der Rechte auf. Dieser klassischen Vorschule des Staatsdienstes, in der man mit der Herrschaftstechnik den Regelgehorsam erlernt, kehrte er nach drei Semestern den Rücken. Das Staatsrecht führte er als Nebenfach weiter, als Hauptfach wählte er nach dem Wechsel an die pfälzische Heimatuniversität Heidelberg Geschichte. Sein Vater war enttäuscht, dass er ihm nicht auf den Weg der Sicherheit und der Pflicht folgte. Obwohl Hans Kohl den Kreisverband der CDU Ludwigshafen mitgegründet hatte, litt er darunter, dass sein Sohn die ganze Hoffnung auf die Partei setzte, in die er 1946 eingetreten war. Das Beamtenethos band den Dienst am Gemeinwohl an die Fähigkeit, die eigene Person zurückzunehmen; wo es um der Sache willen geboten war, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu wecken, musste die Solidität der Lebensführung dem Verdacht der Wichtigtuerei vorbeugen. Den Finanzbeamten schmerzte es, dass der Sohn durch sein lärmendes Auftreten einen Kredit verlangte, der noch durch kein persönliches Verdienst gedeckt war.
Der Student sah sich bei einigen derjenigen Fächer der philosophischen Fakultät um, die zur Kommentierung des Weltlaufs anregen und ihre Absolventen in den Stand setzen, für gute Zwecke gute Worte zu finden. 1959 wurde Kohl vom Landesverband der chemischen Industrie als Referent angestellt, zuständig für die Pflege von Kontakten zu den Bundesbehörden, zur Landesregierung und zur Stadtverwaltung von Ludwigshafen. Zehn Jahre lang blieb er in den Diensten des Verbandes. Berufspolitiker im förmlichen Sinne wurde er erst, als er das Amt des Ministerpräsidenten übernahm. Hätte Kohl den ersten Platz im zweiten Glied des Regierungssystems der Bundesrepublik nicht erreicht, wäre aus ihm womöglich der Kommunikationschef bei einem Verbandsmitglied geworden, dessen wolkige Rhetorik bei Gelegenheit giftige Dämpfe hätte einhüllen müssen. Als Kohl später selbst junge Leute suchte, die seine Taten der Welt erläutern sollten, griff er mit Vorliebe auf Politologen zurück, die meist im Bonner Seminar von Karl Dietrich Bracher gesessen hatten. Die Politikwissenschaft war eine Nachkriegsgründung wie die CDU, zusammengehalten nicht von einem großen Gedanken, sondern von einer guten Absicht. Dem strengen Begriff zog das junge Fach die wirksame Meinung vor. Der Staat war ihm nicht nur Gegenstand der Betrachtung, sondern Objekt der Fürsorge. Karriere wurde zur ersten Bürgerpflicht.
Die von Kohl beanspruchte Allzuständigkeit trotz oder gerade wegen fehlender Fachkompetenz kam jenem Recht zur Kritik an allem und jedem sehr nahe, das seine Intimfeinde für sich reklamierten, die Intellektuellen. Die Berufspolitiker bilden wie die Intelligenz eine freischwebende Schicht, deren Mitglieder sich ihres sozialen Status nie sicher sein können. Macht respektive Aufmerksamkeit wird ihnen nur auf Zeit zuteil; Beziehungen untereinander gehen sie ad hoc ein, ohne Rückhalt an einem Standesethos. Dem Mainzer Korrespondenten der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» erschien der Landesvorsitzende der CDU 1967 als selbstsicherer Intellektueller, dem man ansehe, dass er einmal Universitätsassistent gewesen sei.
Als Kohl sich noch unter Geistesarbeitern bewegte, hatte er sich andersherum als Mann der Praxis in Szene gesetzt, als Botschafter aus der wirklichen Welt. Seiner politischen Erfahrung verdankte er auch die Anstellung als Forschungsassistent – nach heutigen Begriffen studentische Hilfskraft – in der Heidelberger Politologie. Er untersuchte die Auswahl der Bundestagskandidaten 1957, an der er selbst beteiligt war. Als er in Dolf Sternbergers Seminar seine Ergebnisse vorstellte, bat er die Kommilitonen um Diskretion. Freimütig schilderte er die «erbitterten» Auseinandersetzungen um die Landesliste seiner Partei. Mit der Intensität des innerparteilichen Wettbewerbs stand die CDU nach der Einschätzung des teilnehmenden Nachwuchsforschers «wohl für eine deutsche Partei einzig» da: Schon auf dem Höhepunkt der Macht des Bundeskanzlers Konrad Adenauer wagte sie mehr Demokratie als ihre Konkurrenz. Und das bedeutete mehr Ungewissheit: Kohl berichtete, dass «niemand vorher wissen» könne, «wie die Abstimmungen ausgehen speziell mit Bezug auf die strittigen Plätze». Bei der Bundestagswahl am 15. September 1957 trat der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer zum zweiten Mal vergeblich als Spitzenkandidat gegen Adenauer an. Der junge Parteienforscher Kohl hatte einen Rat für Deutschlands älteste Partei: Er warnte sie in einem seiner Seminarvorträge davor, «Ollenhauer zum Sündenbock zu stempeln» und «einem Schmid-Mythos zu verfallen». Kohl hatte in Frankfurt völkerrechtliche Vorlesungen bei Carlo Schmid gehört, der den Wahlkreis Mannheim I als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag vertrat. Wie später Richard von Weizsäcker verkörperte Schmid, der Machiavelli und Baudelaire übersetzt hatte, das Versprechen einer Staatskunst kraft der Macht des wohlgesetzten Wortes. Auch Weizsäcker wurde von seiner Fraktion zum Bundestagsvizepräsidenten bestimmt, auch Schmid wurde von seiner Partei einmal vergeblich als Bundespräsident vorgeschlagen, zwei Jahre nach dem von Kohl improvisierten Gutachten über Schmids Eignung als Parteiführer. Kohl äußerte Zweifel daran, dass Schmid «der Härte der Auseinandersetzung gewachsen» wäre und den «Willen» mitbrächte, «sie zu bestehen». Die Entmythologisierung des Gelehrtenpolitikers Schmid, verbunden mit der Ehrenrettung des wackeren Parteifunktionärs Ollenhauer, war auch ein Lehrstückchen für Kohls Mitstudenten und seinen Professor, eine kleine Lektion über die Grenzen der Macht des Geistes.
Mit der Dissertation ließ Kohl sich Zeit, obwohl er vor der Promotion keinen anderen akademischen Abschluss erwarb. Er besuchte noch Lehrveranstaltungen, als er schon dem Landesvorstand seiner Partei angehörte. In dessen Sitzungen konnte er freilich auch mehr über den Gegenstand der Doktorarbeit lernen als in der Universitätsbibliothek. Der Titel der 1958 eingereichten Arbeit: «Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945». Erwin Faul, Assistent Sternbergers, promoviert mit einer Arbeit über «Die Situation des modernen Machiavellismus», später Professor in Bochum und Trier, berichtet, Kohl habe im Seminar den Platz gegenüber dem Professor eingenommen. Weniger durch Worte als durch Blicke kommentierte er es, wenn die Wissenschaft von der Politik zu wissenschaftlich oder zu politisch wurde. Schon damals trat er öffentlich als Pfeifenraucher auf, mit dem Accessoire des Manns, der Zeit hat. Kommilitonen erzählen, dass er an seinem Stammplatz eine ganze Pfeifensammlung vor sich ausgebreitet habe. Er hielt sich für zwei Rollen bereit: Er war fähig, die Diskussion in die Hand zu nehmen, und verhielt sich gerade dann schon wie der Seminarleiter, wenn er zunächst nichts sagte, aber er verkörperte zugleich eine andere Ordnung, in der am Ende nicht das Wort den Ausschlag gab. Das Universitätsseminar war ein Ort, an dem Helmut Kohl nicht der Erste sein konnte. Auf Zeit spielte er den Zweiten, weil er damit rechnete, anderswo der Erste zu werden. Ein politikwissenschaftliches Seminar, in dem Kohl Arkana der Parteienfinanzierung offenlegte, war eine Art großer Koalition von Theorie und Praxis. Da Kohl hier wirklich der Jüngere war, konnte ihm der Part des Juniorpartners genügen.
Karriere in der Honoratiorenpartei
Der Ton, in dem Kohl als Bundeskanzler einen Feldzug gegen die «Akademisierung» des Berufslebens ankündigte, verriet die gemischten Gefühle, die seinen Rückblick auf ausgedehnte Studienjahre an einer berühmten Universität in geistig bewegter Zeit bestimmten. Ihn störte an der Bevorzugung von Akademikern, die im Staatsdienst vorgeschrieben und in Unternehmen üblich war, sowie an der Angleichung nichtakademischer Ausbildungswege an das akademische Modell, dass der quasi natürliche Prozess des Aufstiegs der Begabten und Fleißigen durch künstliche Hierarchien gehemmt wurde. Wenn er Ratschläge seines Rivalen Kurt Biedenkopf als Meinungen eines Professors abtat, sprach daraus die Verachtung einer Lebensform, die Sozialprestige aus formalen Qualifikationen zog, aus Titeln und Abschlussarbeiten. Die Ordinarienuniversität hatte im rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten der Jahre 1969 bis 1976 keinen Schutzherrn. 1976 nannte Kohl es eine «sozialistische Überlegung, dass nur das, was ein Dokument ist und ein Zertifikat und einen Stempel hat, Glück verheißt».
Ein Landtagsmandat erhielt auch Kohl erst, als er einen akademischen Grad erworben hatte; diesen Tribut musste er dem Fachmenschentum zollen. Dass Journalisten ihn zwei Jahrzehnte lang mit Herr Doktor Kohl anredeten, zeugte vom Überleben einer bürgerlichen Welt der Prüfungen und Berechtigungen, der er selbst innerlich nicht mehr angehörte. Der Doktortitel als Namensbestandteil, der gleichsam beglaubigt, dass der Träger durch das Studium ein neuer Mensch geworden ist, war der Kohlschen Anthropologie, die von der Konstanz der Charaktere ausging, eigentlich fremd. Als Kohl sich zur Doktorprüfung meldete, hatte er nicht alle notwendigen Scheine erworben. Seine Persönlichkeit musste ersetzen, was er auf dem Papier nicht vorweisen konnte. Walther Peter Fuchs, der Doktorvater, erinnert sich: «Was zunächst für Helmut Kohl einnahm, war sein Auftreten. Klar und offen legte er seinen Werdegang, seine Studienleistungen und seine Absicht dar, ohne die fehlenden Testate in seinem Studienbuch zu verschweigen.» Wer sich in der Politik um Vertrauen bewarb, hatte keine Vorleistungen zu erbringen. Es war denkbar, mochte auch niemand daran zu denken gewagt haben, dass ein Student gegen einen Oberbürgermeister für einen Platz im Bezirksvorstand kandidierte. Kohl tat es 1953 und gewann mit einer Stimme Mehrheit. Bei der Bundestagswahl am 6. September 1953 blieb die Ludwigshafener CDU 11 Prozent hinter dem Bundesergebnis zurück. Fünf Tage später machte Kohl Vorschläge, wie sich «Parteiarbeit besser leisten» lasse. Der Kreisvorstand solle einmal im Monat zusammentreten und nicht nur einmal im Jahr. Die «Parteidemokratie», deren Ausbau Kohl forderte, brauchte also Parteifunktionäre, die bereit waren, zwölfmal mehr Zeit zu investieren als bisher. Über die lokalen Sonderbedingungen in der Industriestadt wie die alte soziale Frage griff die organisatorische Phantasie des Dreiundzwanzigjährigen hinaus: Kohl schwebte eine «Partei neuen Stils» vor.
Wenn er der erste Mann im Land werden wollte, durfte die CDU keine Honoratiorenpartei bleiben, denn er hatte keine gesellschaftlichen Ehren zu erwarten, die seinen politischen Ehrgeiz hätten rechtfertigen können. Solange in der Führungsschicht einer bürgerlichen Gesellschaft geistige Autorität und wirtschaftlicher Einfluss zusammenfielen, führten die Wohlhabenden und Gebildeten, Verleger oder Notare, wie selbstverständlich auch die politischen Geschäfte. Soziales Ansehen verlieh politische Legitimation: Nur wer in der Welt etwas war, konnte im Staat etwas darstellen. Mit der Demokratie scheint sich die Beschränkung der politischen Möglichkeiten durch die soziale Wirklichkeit schwer zu vertragen. Aber darin kam die Vorstellung zum Ausdruck, dass die Macht der Honoratioren nur geliehen war. Sie waren Treuhänder einer Schicht, die wiederum im Interesse des Ganzen zu handeln glaubte. Das bürgerliche politische Denken misstraute jener Handlungsfreiheit, die zuerst die absoluten Fürsten für sich in Anspruch genommen hatten. Es wollte die Politik auf die Moral verpflichten, die im Alltag galt, auf Treu und Glauben, Argument und Rechenschaft. In England büßt der Bankrotteur sein Unterhausmandat ein. Wie sollte den Versuchungen der Macht widerstehen, wer keine bürgerliche Sicherheit hatte?
In der bürgerlichen Geschichtsschreibung gibt es den Typus des korrupten Ratgebers, des Spekulanten und Projektemachers, der keinen Namen und kein Vermögen hat und sein Glück am Hof machen muss. Diese Abenteurer waren die ersten Berufspolitiker. Günter Gaus porträtierte Kohl 1967 als Repräsentanten seiner Generation und möglichen Kanzler der siebziger Jahre; er charakterisierte ihn als einen Mann, der von sich selbst sage, er habe Fortune. Nicht dass Kohl Glück hatte, ist bezeichnend, sondern dass er sich dieser Gabe brüstete, als wäre er ein Spieler. Die bürgerliche Ethik war auf das Gegenteil des Glücks gegründet, auf das Verdienst. Die Ehre der Honoratioren war der Zins, den die Gesellschaft ihnen für ihre akkumulierten Dienste zahlte. Doch wer noch keine Zeit hatte, sich um das Vaterland verdient zu machen, erkennt im gestrigen Verdienst leicht die Entschuldigung für heutiges Nichtstun. In diesem Sinne hielt Kohl der CDU 1955 auf dem Landesparteitag in Ludwigshafen vor, zehn Jahre nach Kriegsende habe sie «Elan» und «Dynamik» verloren. Die «Laxheit», die der stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Union beklagte, brachte er auf einen soziologischen Begriff: Es sei «so etwas eingetreten wie eine Verbürgerlichung unserer Partei». Mancher der 350 Delegierten mag bei sich gedacht haben, dass der Bürgerschreck doch besser bei der SPD Radau machen solle. Schwang in der Rede auf heimatlichem Boden nicht womöglich Bewunderung mit für Disziplin und Enthusiasmus der in Ludwigshafen so mächtigen Partei der Arbeiterbewegung? Wer eine Versammlung der Sozialdemokraten besuchte, trat in eine Gegenwelt zu den herrschenden Verhältnissen ein. Insofern die CDU eine bürgerliche Partei sein wollte, hatte sie keinen Grund, durch Rituale der Kommunikation ihre Distanz zur Gesellschaft zu markieren.
Kohl beschwerte sich über den Zeitplan des Parteitags: Obwohl Landtagswahlen bevorstanden, sollten «in nur zwölf Arbeitsstunden alle Probleme endgültig und einigermaßen schlüssig» gelöst werden. Sieht eine Partei ihre Aufgabe darin, die Ordnung der Dinge zu erhalten, wird ihr Diskussionsbedarf begrenzt sein. Es liegt ihr nichts daran, die Aufregung der Gründerjahre künstlich zu verlängern; das erste Bürgerrecht ist Ruhe. Wird dagegen die Bewegung zum Ideal erhoben und die Stille als Krisenzeichen gedeutet, sind die Tage der Honoratiorenpolitik gezählt. Die permanente Diskussion kann man nicht im Nebenamt leiten. Je mehr Zeit die Politik fordert, desto weniger nützen die Erfahrungen in einem ordentlichen Beruf. So machte sich schon der junge Parteirebell, der bei den Vorstandswahlen in Ludwigshafen vergeblich gegen Adenauers Familienminister Franz-Josef Wuermeling als Bewerber um den Posten des stellvertretenden Landesvorsitzenden antrat, die Sache der Partei zu eigen. Er vertrat die Logik eines Apparats, der noch fast gar nicht existierte, und damit den Eigensinn der Politik gegenüber philosophischen Vorurteilen, konfessionellen Rücksichten und ökonomischen Interessen.