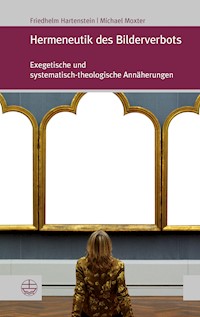
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Forum Theologische Literaturzeitung
- Sprache: Deutsch
Das biblische Bilderverbot hat in der Geschichte der jüdischen und der christlichen Religion eine wichtige Rolle für die Abgrenzung der eigenen Identität gegenüber den Bilderkulten gespielt und den byzantinischen Bilderstreit ebenso befeuert wie den Bildersturm der Reformationszeit. Was waren die leitenden Intentionen bei der Ablehnung bildlicher Vergegenwärtigungen Gottes? Und wie verträgt sich diese Ablehnung mit der durch den Gedanken der Inkarnation ermöglichten Tradition des Christusbildes als Repräsentation des unsichtbaren Gottes? Welche Abgrenzungen vollziehen die alttestamentlichen Formulierungen des Bilderverbotes und wie ist es religions- und theo-logiegeschichtlich zu beurteilen? Was folgt aus den neueren archäologischen Einsichten zur Ikonographie Palästinas für die Auslegung des Bilderverbotes? Welche Bedeutung hat es in Religionsphilosophie, Ästhetik und Systematischer Theologie und wie stellt sich die Theologie heute zur Nicht-Bildlichkeit Gottes? Die Annäherungen aus der Sicht eines Exegeten und eines Systematikers sind von der gemeinsamen Überzeugung getragen, dass eine sachgemäße Hermeneutik des Bilderverbotes angesichts des iconic turn in Kulturwissenschaft und Theologie ebenso lohnend wie nötig ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Forum Theologische Literaturzeitung
ThLZ.F 26 (2016)
Herausgegeben von Ingolf U. Dalferth in Verbindung mit Albrecht Beutel, Beate Ego, Andreas Feldtkeller, Christian Grethlein, Friedhelm Hartenstein, Christoph Markschies, Karl-Wilhelm Niebuhr, Friederike Nüssel und Nils Ole Oermann
Friedhelm Hartenstein Michael Moxter
Hermeneutik des Bilderverbots
Exegetische und systematischtheologische Annäherungen
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2016 by Evangelische Verlagsanstalt
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlag und Entwurf Innenlayout: Kai-Michael Gustmann, Leipzig
Coverfoto: © Aintschie – Fotolia.com
Satz: Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
ISBN 978-3-374-03619-6
www.eva-leipzig.de
Vorwort
Dieses Buch ist das Resultat einer Zusammenarbeit zwischen (alttestamentlicher) Exegese und systematischer Theologie zu einem aktuellen und – wie wir meinen – theologisch und anthropologisch fundamentalen Thema. Sie begann mit gemeinsamen Seminaren in Hamburg, weshalb die Wurzeln des Unternehmens und die Verabredungen über die Vorgehensweise schon einige Jahre zurückliegen. Die gegenwärtige Brisanz der Themenstellung in Kultur und Politik unterstreicht die Bedeutung des Themas, hat uns aber nicht davon abgehalten, unsere eigene Arbeitskraft und Aufmerksamkeit vor allem auf den Problemkreis des biblischen Bilderverbots zu richten. Es ging und geht uns um Sondierung und Sortierung von historischen und gegenwärtigen Deutungsschichten an einem exemplarischen Fall, um den sich implizit oder explizit Bildkonzepte und Bildtheorien angelagert haben. ,Hermeneutik‘ dient dabei als eher pragmatisches Schlüsselwort für eine gemeinsame Verständigungsbemühung zwischen Text und Bild, zwischen den Disziplinen und über die Fächergrenzen hinaus.
Der Genese des Bandes geschuldet sind einige „Ungleichzeitigkeiten“ (manche Abschnitte und Teile lagen schon länger vor, andere wurden erst kurz vor Abschluss geschrieben). Es würde die Autoren freuen, wenn das Buch als „dialogisches“ Unternehmen wahrgenommen würde. Man kann und soll seine beiden unterschiedlich situierten Hauptteile (II und III) stets aufeinander hin lesen und bedenken (dazu helfen die wechselseitigen Verweise). Die Einleitung (I) und der Ausblick (IV) werden von beiden Autoren gemeinsam verantwortet, wobei Ersteres in seiner Grundfassung von M. Moxter, Letzteres von F. Hartenstein geschrieben wurde. Der Prozess eines solchen Buchprojekts „zu zweit“ ist deutlich aufwändiger, bietet aber einen Zugewinn an Perspektiven und Argumenten, den die Autoren und – hoffentlich – auch die Leserinnen und Leser nicht missen möchten.
Dass der Band nun fertiggestellt werden konnte, verdankt sich auch der Mitarbeit vieler Personen. Wir danken sehr herzlich für alle Anregungen, Gespräche, Anmerkungen und Korrekturen aus Hamburg: Nina Heinsohn, Markus Firchow und Olivia Brown (die sich auch um die redaktionelle Seite kümmerte), aus München: Ann-Cathrin Fiss, Elisabeth Kühn sowie Mathias Neumann und Susanne Schleeger (die die Endkorrektur von Teil II und IV gelesen haben). Ein wichtiges Gesprächsforum bildete zudem das DFG-Projekt „Bild und Zeit. Exegetische, hermeneutische und systematisch-theologische Untersuchungen zur Bildlichkeit religiöser Repräsentationsformen“. Schließlich danken wir den Herausgebern der Reihe ThLZ.F, insbesondere Ingolf U. Dalferth, die den Band angeregt haben, sowie der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig, vor allem Frau Dr.Annette Weidhas, für ihre engagierte Unterstützung und für die Geduld angesichts einer langen Inkubationszeit.
Im Februar 2016
Friedhelm Hartenstein, Michael Moxter
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
I Einleitung
II Exegetische und religionsgeschichtliche Perspektiven
1. Religionsgeschichtliche Kontexte
1.1 Grundzüge altorientalischer Bilderkulte
a) Was ist ein Heiligtum?
b) Anthropomorphe Kultbilder: Herstellung, Verehrung, Bedeutung
c) Göttersymbole: gleichwertige oder konkurrierende Medien?
d) „Anikonische“ Kultsymbole: komplementär oder konträr zu Bildern?
e) Was wissen wir über die Kultsymbolik Jerusalems?
1.2 Der Vorstellungsrahmen des Kultes: die „mentale Ikonographie“
a) Die Körper der Götter
b) Die Transzendenz der Gottheiten
2. Das Bilderverbot: Eigenart und Entstehung
2.1 Die Bilderkritik der Vorsokratiker
2.2 Antike jüdische Bilderkritik
a) Hellenistisch-römische Autoren über Monotheismus und Bilderverbot: Der Blick von außen
b) Die Bilderkritik in antiken jüdischen Zeugnissen und in Texten der nachexilischen Zeit (5.-3. Jh. v. Chr.): Der Blick von innen
b1) Antike jüdische Texte
b2) Alttestamentliche Bilderkritik aus nachexilischer Zeit
2.3 Das Bilderverbot: Entstehung, Varianten, Begründung
a) Das dekalogische Bilderverbot
b) Die weiteren expliziten Bilderverbote des Alten Testaments und ihr Verhältnis zum Dekalog
2.4 Die Entstehungsvoraussetzungen des Bilderverbots
a) Der judäisch-babylonische Kulturkontakt und die Entstehung des Bilderverbots
b) Zwei ältere Voraussetzungen einer Bilderkritik in Israel und Juda
b1) Das Stierbild von Bethel im Nordreich Israel: Hoseabuch und Exodus 32 (8./7. Jh. v. Chr.)
b2) Die Reformmaßnahmen Joschijas von Juda (Ende 7. Jh. v. Chr.)
3. Folgerungen für eine Hermeneutik des Bilderverbots aus exegetischer Perspektive
3.1 Das Bilderverbot und sprachlich vermittelte Gottesbilder
a) Biblische Metaphorik als Grenzbegrifflichkeit b) Ikonik der Psalmen
3.2 Modelle einer kritischen Bildhermeneutik im Alten Testament
a) Die Sinaitheophanie: Transitorische Bildlichkeit und das Bild im Wort
b) Das „bleibende Vergehen“ der Theophanie als Erinnerungs-„Figur“
c) Gottebenbildlichkeit des Menschen in der Priesterschrift und ihre bildhermeneutische Relevanz
III Systematische Perspektiven
1. Kontexte
2. Bilder der Macht
2.1 Herrschaftsrepräsentation
2.2 Königskörper und Königsbild
2.3 Bilderverbot als Machtkritik
3. Bild und Leiblichkeit
3.1 Leiblosigkeit Gottes?
3.2 Negative Bewertung der Leiblichkeit
3.3 Philosophische Bilderkritik (Platon)
3.4 Philosophische Kritik der Imagination (Descartes)
3.5 Verdrängung des Sinnlichen
3.6 Leib als Imago Dei
3.7 Leiblichkeit und Christologie
3.8 Christentum als Körperkrise?
3.9 Zwischenfazit
4. Bilderverbot, Monotheismus und negative Theologie
4.1 Hermeneutik des Bilderverbots als Hermeneutik der Gewalt
4.2 Hermeneutik des Bilderverbots als rationalistische Apologetik
4.3 Hermeneutik des Bilderverbots als Phänomenologie der Alterität
4.4 Negative Theologie – vorsokratisch
4.5 Transzendenz als Negativität und Andersheit
4.6 Darstellung des Undarstellbaren: Kants Rezeption des Bilderverbots
4.7 Bilderverbot und Medienrevolution
5. Unsichtbarkeit oder Verborgenheit Gottes?
5.1 Unsichtbarkeit Gottes
5.2 Dimensionen des Bildverständnisses in Luthers Theologie
5.3 Bilderverbot und Ebenbildlichkeit
5.4 „Bilder geben zu sehen“
6. Die Macht der Bilder: Vergegenwärtigung und Präsenzverdichtung
6.1 Ambivalente Präsentationsleistungen
6.2 Verschränkung von Anwesenheit und Abwesenheit
6.3 Präsenz und Magie
6.4 (Re-)Präsentation und Bild
6.5 Zwischenfazit
6.6 Präsenzverdichtung und Verfügbarkeit
6.7 Bild und Sakrament
7. Sehen versus Hören, Bild versus Wort: Protestantische Konstellationen einer Theologie des Bildes?
8. Christologische Rehabilitierung der Bilder: Systematische Überlegungen zum Bilderverbot im antiken Christentum
8.1 Didaktische Rehabilitierung der Bilder
8.2 Theologische Perspektiven
8.3 Partizipation am Heiligen
8.4 Bildtheologie und Christologie
9. Ästhetik im Horizont des Bilderverbots
9.1 Das Bilderverbot in der Kritischen Theorie
9.2 Bildproduktive Dimensionen reformatorischer Theologie
9.3 Ikonoklasmus als ästhetische Strategie
9.4 Noch einmal: Die Darstellung des Undarstellbaren
9.5 Das Ende des Bildes?
10. Schlussreflexion des systematischen Teils
IV Ausblick
Weitere Bücher
Fußnoten
I Einleitung
„Verstehst Du auch, was Du liest?“ fragt Philippus den über eine Prophetenrolle gebeugten Kämmerer aus dem Morgenland (vgl. Apg 8,26–40). Theologische Hermeneutiken zitieren das gerne. Denn mit dieser Frage ist ein elementarer Bereich ihrer Aufgabe benannt, Missverständnisse auszuräumen, die sich zwischen Text und Rezeption ergeben und nicht nur die Kommunikation, sondern mitunter schon die Lust am Weiterlesen blockieren. In mancher Hinsicht ist die hier vorgelegte Skizze einer Hermeneutik des Bilderverbots an diese Frage des Philippus gut anschließbar. Zwar ist mit dem Abschnitt der Tora (sei es in Gestalt von Ex 20,4–6 oder Dtn 5, 8–10) ein anderer Text einschlägig, aber eigentlich müsste man den Textabschnitt der lukanischen Inszenierung nur etwas erweitern. Denn wenn der Kämmerer vor der Frage steht, wen der Prophet mit der Rede vom leidenden Gottesknecht eigentlich meine, so setzt dies eine Lektüre von Jes 53 voraus, in deren Kontext ihm kurz zuvor auch der Spott des Prophetenbuches über die wirkungslosen Götzenbilder der Heiden untergekommen sein muss (Jes 44). Ob es ihm gelungen sein mag, die Kritik der Götterstatuen, der anderen Kulte und Religionen mit dem Bilderverbot zu verbinden oder in ihm ein Alleinstellungsmerkmal monotheistischer Religion zu erkennen?
Es wäre also nicht aus der Luft gegriffen, die lukanische Geschichte auch in dieser Variante zu erzählen und in der Folge einer Hermeneutik des Bilderverbots die Aufgabe zuzuweisen, das Verständnis biblischer Textstellen, ihre Ausstrahlung auf andere Bereiche der Schrift und ihre Bedeutung für Kultstreitigkeiten, Bilderstürme und religiös motivierte Gewalt zu klären. Man könnte auch die für eine hermeneutische Theologie wichtige Frage nach dem Verhältnis von Textverstehen und Selbstverständnis aufnehmen. Denn nur Weniges irritiert das gläubige Bewusstsein stärker als das Zwielicht, in das Monotheismus und Bilderverbot, Rigorismus und Exklusivismus geraten sind. Wie oft in der Kirchen- und Theologiegeschichte fallen auch in unserer Gegenwart an biblischen Texten Entscheidungen über die eigene religiöse Orientierung. Sind Bilderverbot und Bilderkritik Ausdruck einer besonderen Vernünftigkeit (Intellektualität) und eines typischen Freiheitssinns monotheistischer Religionen – weil sie sich nicht länger in der Sinnlichkeit und ungeschützten Konkretion polytheistischer Kulte bewegen – oder bildet eine solche Vorstellung den Nährboden für Überlegenheitsgefühle und religiöse Intoleranz? Vor allem aber: Verstehen wir den Text überhaupt richtig, wenn wir ihn in diesem Sinne lesen?
Zu diesen und verwandten Fragen nehmen die vorliegenden Studien Stellung. Jedoch konnten und wollten sie auch der anderen Frage nicht ausweichen: ,Verstehst Du, was Du siehst?’ – Sie erinnert daran, dass das biblische Verbot der Anfertigung und Anbetung von Götterstatuen der Macht der Bilder nachhaltige Aufmerksamkeit verschafft. Wie man das Bilderverbot versteht, enthält eine Stellungnahme zu der Frage, was am Bild eigentlich so problematisch und verwerflich oder genauer: so unvereinbar mit dem Gott Israels ist oder sein soll. Die Auslegungsgeschichte zeigt, dass es auf diese Frage ganz unterschiedliche Antworten gibt und sich diese stillschweigend, d.h. oft ohne methodische Klarheit und ausdrückliche Reflexion, der Interpretation des Textes oktroyiert haben. Spezifische Bildtheorien bestimmen das Textverständnis kaum weniger als die Art und Weise, wie Gott gedacht wird.
Ob man versteht, was man sieht, wirft darüber hinaus die Frage auf, wie sich Begriff und Anschauung zueinander verhalten, ob Denken und Erkennen erschöpfend erfassen können, was anschaulich gegeben ist. Und weiter: Welchen Status hat Bildlichkeit für den humanen Weltumgang? Sind Bilder Steigerungsformen visueller Wahrnehmung, die nicht nur etwas zu sehen geben, sondern anderes auch dem Blick verweigern und unsichtbar machen? Dann etablierten Bilder – weit davon entfernt, die Wirklichkeit bloß zu reproduzieren und abzubilden – selbst Grenzen zwischen Sichtbarem und Verborgenem.
Eine Hermeneutik des Bilderverbots erweitert deshalb die methodische Arbeit am Textverständnis. Sie lässt sich von der Schrift (und ihrer Wirkungs- und Auslegungsgeschichte) auf den Pfad einer allgemeinen Hermeneutik des Bildes locken. War der protestantischen Theologie am Zusammenhang von Text-, Sach- und Selbstverständnis gelegen, so entstehen ihr neue Aufgaben aus den Einsichten der Bildwissenschaften.
Vor allem in der Exegese des Alten Testamentes hat sich die Einschätzung des Bilderverbots gewandelt. Historische Beobachtungen zur altorientalischen Religionsgeschichte und also zu den Bilderwelten, in denen sich die antike Kultur artikuliert, haben die Vorstellung einer unvergleichbaren Sonderrolle Israels fragwürdig werden und vor allem die prägnante Formel des Bilderverbots als eine späte Erscheinung innerhalb der alttestamentlichen Theologiegeschichte erkennen lassen. Debattiert wird zur Zeit, ob das Bilderverbot aus der Not eine Tugend machte, ob es etwa den Verlust eines einst vorhandenen Kultbildes JHWHs durch die Fiktion kompensierte, eine Götterstatue sei noch nie mit dem Gott Israels vereinbar gewesen. Die Mehrzahl exegetischer Stimmen vertritt die Meinung, der Kult im Jerusalemer Tempel sei de facto stets ohne ein anthropomorphes Kultbild ausgekommen, also in dieser Hinsicht „bildlos“ gewesen, aber dies aus kontingenten Gründen. Dann, so die auch von uns vertretene These, habe sich im Zusammenhang mit dem expliziten Monotheismus das Nichtvorhandensein eines JHWH-Bildes als Identifikationsmerkmal aufgedrängt, um eine prinzipielle Differenz dieses Gottes von allen anderen Göttern zu markieren. Authentizität und Souveränität des Schöpfergottes verlangten, dass ausgeschlossen wird, was ihm nicht zukommt, und stattdessen an dem festzuhalten, was er in seiner (Selbst-) Offenbarung zu erkennen gibt. Das Verbot eines (menschen- oder tiergestaltigen) Kultbildes erscheint so als sekundäre Rationalisierung einer Lage, die in exilischer Zeit im Selbstvergleich mit der babylonischen Religion erst als Mangel erfahren, hernach aber als Vorzug interpretiert werden konnte.
Eine solche Herleitung mahnt zur Vorsicht, aus dem Bilderverbot keine zu weitreichenden Schlüsse hinsichtlich der Frage zu ziehen, welche Bedeutung Visualität und Bildlichkeit in der altisraelitischen Gottesverehrung im Ganzen innehatten. Tempelkult, Ritus, Opfer und performatives gottesdienstliches Handeln sind jedenfalls immer an Sichtbarkeit gekoppelt, so dass Bildlosigkeit ein zu weit gefasster, abstrakter Begriff bleibt, um als Kennzeichnung der Religion alttestamentlicher Texte dienen zu können. Nicht allein die Theophanieerzählungen des Alten Testaments, sondern noch stärker die poetische Sprache, vor allem der Psalmen und der Prophetenbücher, lebt von mentalen Bildern, in denen der Glaube an JHWH sich ausspricht. Dürfte man also sagen: ein spezifisches Gottesbild verbietet die Götterbilder? Oder prägt gar der jüdisch-christliche Gottesglaube das, was in Bildern gesehen wird?
Auch an den historischen Kontexten bestätigt sich also, dass Interpretationen des Bilderverbots einen Begriff der Bildlichkeit mit sich führen. Das Verstehen des Textes verknüpft sich mit einer Hermeneutik des Bildes.
Gottfried Boehm hatte diesen Disziplinentitel eingeführt wie auch den vielzitierten Begriff eines iconic turn der Kulturwissenschaften. Beide Begriffe hatten entscheidenden Anteil an der Etablierung der sogenannten Bildwissenschaft(en). Sie enthalten aber auch Begrenzungen und Einseitigkeiten, auf die kurz einzugehen ist.
Nach Maßgabe des linguistic turn wurde der Begriff iconic turn geformt. Als Richard Rorty unter dem (Buch-)Titel „The linguistic turn“ den Paradigmenwechsel von einer mentalistischen Bewusstseinsphilosophie zu Logik und Sprachphilosophie beschrieb und mit der Sammlung einschlägiger Beiträge forcierte, war seine spätere Angleichung von Philosophie und Literaturwissenschaft nicht absehbar. Die Ausrichtung des Denkens an den Formen der Sprache und den Regeln der Sprachspiele sowie der Vorrang öffentlicher Bedeutungssetzung vor dem solipsistischen Akt des Meinens sollten eine Wende der Philosophie, ihrer Methode wie der Ausrichtung ihrer Inhalte, kennzeichnen. Alles kam auf die These an, das Verhältnis zur Wirklichkeit sei sprachlich geprägt, die Kategorien der Erkenntnis in die Kommunikationsformen eingelassen. Die für Paradigmenwechsel empfängliche akademische Öffentlichkeit konnte deshalb die spätere Aufforderung zum iconic turn kaum anders denn als die Einladung verstehen, das zuvor erreichte Reflexionsniveau noch einmal zu überbieten und die Analyse basaler Voraussetzungen zu vertiefen. Nicht erst die Sprache, sondern zuvor schon das Bild wurde als das Medium identifiziert, in dem und durch das sich der menschliche Weltzugang vermittelt.
Die methodische Abkünftigkeit des iconic turn von der Theorie der Sprache und der in ihr fundierten Darstellungsformen prägte den Titel, den Boehm (zunächst) zur Kennzeichnung derjenigen Disziplin wählte, die die involvierten Aufgaben übernehmen sollte: eben die einer Bildhermeneutik. Mit diesem Disziplinentitel war die Überzeugung markiert, dass Bilder Erkenntnis konstituieren, Sinn manifestieren und Wirklichkeit erschließen, aber auch mit welchen geisteswissenschaftlichen Methoden dies dargelegt werden sollte. Die Schnittstelle zwischen Bildlichkeit und Sprache bestimmte darum auch das Sachprogramm: „Die Hermeneutik des Bildes hat ihren Ursprung, wo die Bilderfahrung des Auges in das Medium der Sprache übergeht.“1 Dass Boehm Bildern eine der Leistung der Sprache analoge Funktion zuschrieb, bedeutete freilich eine implizite methodische Anpassung der neuen Disziplin der Bildwissenschaft an die ,Logik‘ der Sprachwissenschaften, so sehr in der Sache die Behauptung eines Primats des Bildes gegenüber der Sprache betont wurde. Die darin angelegte Spannung tritt noch deutlicher zutage, wenn Boehm schreibt, das Bild sei „kein Ding unter Dingen […], sondern eine eigene Sprache“2 und zwar näherhin eine stumme, eine schweigende Sprache.3 Hermeneutik sollte vor diesem Hintergrund die wechselseitige Übersetzbarkeit4von Wort und Bild entfalten, ohne freilich der Programmatik einer Ikonologie im engeren Sinne (welche die Bedeutungen einzelner Bildelemente zu identifizieren versucht) zu folgen.
Die Frage legt sich nahe, ob Visualität und Bildlichkeit hinreichend zur Geltung gebracht werden, wenn man den methodischen Zugang an der Sinnorientierung der Sprache ausrichtet und gegenüber der Sinnlichkeit und Materialität der Bilder priorisiert. Geben Bilder nicht gerade deshalb zu denken, weil sie ein Nicht-Begriffliches repräsentieren, das sich der Einholung ins Verstandene widersetzt? Dann wäre dem iconic turn mit einer Bildhermeneutik nicht wirklich gedient.
Dieses Problem wird nicht dementiert oder bagatellisiert, wenn wir im Folgenden von einer Hermeneutik des Bilderverbots sprechen. Die Arbeitsgemeinschaft zwischen alttestamentlicher und systematischer Theologie, die in der vorliegenden Publikation ihren Niederschlag findet, begann mit einem gemeinsamen Hamburger Hermeneutik-Seminar, an dessen Ausklang die Arbeit am programmatischen Aufsatz Gottfried Boehms zur Bildhermeneutik stand. Da die hermeneutische Frage eine bewährte Basis der Zusammenarbeit zwischen Exegese und Systematik bildet, lag es nahe, die damals beschlossene gemeinsame Studie zum Bilderverbot unter den Leitbegriff einer Hermeneutik zu stellen und andere (zu umfassende und anspruchsvolle: ,Das Bilderverbot‘ oder falsche Erwartungen weckende: ,Verbotene Bilder‘) zu vermeiden. Die problemorientierte Skizze ist ein Versuch des Textverstehens wie der interdisziplinären Verständigung. Dass die Autoren in diesem Sinne am Titel ,Hermeneutik‘ festhalten, heißt aber nicht, dass sie für Bedenken unzugänglich wären.
Die ,Wut des Verstehens‘5 wissenschaftlich (und lebenspraktisch) zu disziplinieren, wäre durchaus eine – und nicht die schlechteste – Definition hermeneutischer Aufgaben. Jene Wut bricht aus im übereilten Zugriff auf die Sache, die sie deutend identifiziert, ohne Alternativen gründlich geprüft, den Umhof der Möglichkeiten hinreichend gewichtet zu haben.
Hermeneutik als Kunstlehre des Verstehens ist ein Gegenmittel, das durch Verzögerung eine methodische Anstrengung zugunsten des Anders-Verstehen-Könnens auf den Weg bringen will. Diese Kunst einzuüben erscheint uns wichtiger als eine programmatische Beanspruchung des Hermeneutikbegriffs. Manches, was im Folgenden vorgetragen wird, ließe sich wohl auch unter den Titel einer Auslegungs- und Rezeptionsgeschichte des Bilderverbots stellen. Entscheidender als die Nomenklatur ist für die vorliegenden Studien jedoch die Frage, ob die historische Interpretation biblischer Texte im Horizont kulturwissenschaftlicher Fragestellungen so durchgeführt werden kann, dass sich Aufgaben einer Theologie des Alten Testaments abzeichnen – bzw. ob und wie es der systematischen Theologie gelingt, ihr Verhältnis zur Schrift nicht nur im abstrakten Streit um Prinzipien (im Prolegomena-Teil der Dogmatik) zu traktieren, sondern bestimmte biblische Texte, die sich aufdrängen, denkend ernst zu nehmen. Diesen Zusammenhang von Exegese, Hermeneutik und Systematik zu wahren, war eines unserer Interessen. Dass Interdisziplinarität sich vor allem im wechselseitigen kritischen Vorhalt zuvor unbedachter Fragen zeigt, muss nicht verschwiegen werden. Doch auf diesen Austausch kam es gerade an.
Gemeinsam ließen wir uns von der Behauptung Hans Blumenbergs leiten, symbolische Formen vermöchten Prägnanzen herauszubilden, ohne dass diese von Haus aus in den geprägten Formen bereitliegen.6 Die Arbeit der Rezeption bringt Sinn an den Tag, den man keiner immer schon wirksamen, gleichsam a priori vorhandenen Entelechie zuschlagen kann. Letzeres ginge zu Lasten historischer Erfahrung, die zur bloßen Entwicklung herabgestuft wäre – mit dem einzigen Restrisiko, dass niemand vorhersehen kann, wann genau jedwedes sein telos erreicht. Die Geschichte wartet indes mit größeren Unsicherheiten auf und ihre Kontingenzen werfen oft Gewissheitsfragen für die Subjekte auf. Niemand wird darum die Entwicklung alttestamentlicher Theologie als eine natürliche Entfaltung immanenter Anfänge beschreiben, vielmehr findet der Gottesglaube aufgrund neuer, oft krisenhafter Erfahrungen zu Transformationsgestalten, bei denen es als falsch gestellte Frage gelten darf, ob sich das Frühere im Späteren hätte wiedererkennen können.
Die Gegenüberstellung des ,ursprünglichen‘ Textsinnes und dem, was spätere Zeiten oder andere kulturelle Kontexte unter ihm verstanden und aus ihm gemacht haben, dient der Erkenntnis des historischen Abstandes, muss aber nicht einem Positivismus der ersten Anfänge zuarbeiten. Statt die vermeintlichen Fakten und Ausgangslagen von der späteren Deutung zu trennen, verdient der Satz Beachtung: ,Im Anfang war die Umdeutung‘. Er schließt eine Zuordnung der theologischen Disziplinen aus, nach der zunächst die historische Exegese unter Zurücksetzung aller hermeneutischen Fragen und systematischen Perspektiven vervollständigt und abgeschlossen werden soll, um hernach und sekundär nach Deutung, Bedeutsamkeit und Geltung zu fragen. Den Unterschied zwischen Genesis und Geltung ernstzunehmen ist jedoch etwas anderes als mit der Trennung von Fakten und Interpretationen die Grenzen der Disziplinen zementieren zu wollen. Da Zeichen und Symbole mehr zu denken geben als ein historischer Positivismus wahrzunehmen vermag, gehört Auslegung zu den denkenden, sich den denkbaren Fragen stellenden Tätigkeiten. Gerade die Geschichte des Bilderverbots zeigt das. Trotz seiner festen Form als Rechtssatz unbedingten Gottesrechts ist es in Kontexten überliefert und wird in ihnen rezipiert, in denen sein Sinn reflektiert, präzisiert und korrigiert wurde. Die Vielzahl späterer Auslegungstraditionen spiegelt und greift auf, was in den biblischen Texten selbst beginnt. Insofern ist die Rezeptionsgeschichte des Bilderverbots mit diesem von Anfang an verbunden und ihm nicht äußerlich.
Die vorliegenden Studien zerfallen darum auch nicht in einen ersten (exegetischen) und einen zweiten (systematischen) Teil, womit der Bruch zwischen historischer Identifikation des ursprünglichen Textsinnes und gegenwärtiger Verantwortung seiner Wahrheit nur verstärkt würde. Beide Teile sind vielmehr von gemeinsamen Überzeugungen und Fragen bestimmt, die jede Disziplin mit ihren je spezifischen Mitteln vertritt bzw. stellt und die – wo immer es möglich war – abgestimmt wurden. Vor allem aber blicken sowohl der exegetische wie der systematische Teil dieser Studie vom Späteren auf Früheres zurück, sei es dass im Ausgang von monotheistischen Redaktionen auf die Schichten früher prophetischer Überlieferungen zurückgegriffen, sei es dass mit den Kategorien gegenwärtiger Bildwissenschaften die Unruhe früher Debatten ausgelotet wird. Mit diesem Zugang war darüber entschieden, dass wir nicht beanspruchen, eine umfassende Theologiegeschichte des Bilderverbots zu schreiben oder einen hinreichenden Überblick über die einschlägige Forschungsliteratur zu geben. Das entspräche im Übrigen auch nicht dem Charakter dieser Reihe, die Anstöße zu aktuellen Debatten geben und darum problemorientiert, nicht aber enzyklopädisch, informieren will.
Das historische Urteil über die theologische Arbeit, die Überlieferungs- und Redaktionsgeschichte bereits geleistet haben, steht in Nachbarschaft zur systematischen Vermutung, es werde das Wichtigste erst im Nachhinein erfasst. Luther konnte das über den Gott der Sinaitheophanie (Ex 33), Hegel über die Reflexionsbestimmung des Wesensbegriffs, Kierkegaard über die Art und Weise sagen, in der das Subjekt sich selbst erfährt, und schließlich konnte Lévinas sie in die Frage fassen: „Die großen ,Erfahrungen‘ unseres Lebens sind nie im eigentlichen Sinne des Wortes erlebt worden. Kommen nicht vielleicht die Religionen auf uns zu aus einer Vergangenheit, die nie reines Jetzt war?“7 Sie ist nicht desillusionierend gemeint, sondern gibt der Arbeit der Erinnerung einen systematischen Ort im Selbstverhältnis wie in der Religionsgeschichte.
Es verband uns schließlich auch die Absicht, den Bildbegriff möglichst offenzuhalten. Einerseits ist mit einem vieldimensionalen Bildverständnis zu rechnen, das sich nicht durch eine Definition vereinheitlichen lässt, andererseits aber auch mit der Vergeblichkeit des Verbotes, der Attraktivität des Bildes durch Entsagung zu begegnen. (Nichts dürfte die anthropologische Bedeutung des Bilderkultus deutlicher unterstreichen als die Vergeblichkeit aller Versuche, ihn zu verbieten oder im Interesse der jeweiligen Macht zu kanalisieren.) Gewiss gibt es entsetzliche Bilder, die loszuwerden man begehrt. Aber um sich gegen Bilder zu wehren, muss man der Kraft der Gegenbilder vertrauen. Diese bild-anthropo-theologische Einschätzung verbietet einen scharfen Schnitt, mit dem das Bilderverbot des Alten Testaments allein auf skulptierte Statuen konkurrierender Götter bezogen und als kulturelle Sonderentwicklung aufgefasst würde. Die Behauptung, nur darum sei es gegangen, rechnet nicht hinreichend mit der Prägnanz des Bildlichen, der Virulenz des Visiblen auch für die Gottesimaginationen biblischer Texte. Das Bilderverbot leiht seine Dramatik von der des Bildes.
Es kam deshalb darauf an, die Beziehungen zwischen Theologie und Anthropologie, zwischen ordnender Gewalt und Bildmacht, zwischen Imagination und Erkenntnis in den Blick zu nehmen, aber auch die biblischen Texte daraufhin zu befragen, was sie über die Sichtbarkeit JHWHs, sein Angesicht, seine Residenz im Tempel oder über Christus als Bild Gottes zu sagen haben.
Die Faszination des Bilderverbots, das immer wieder Interpretationen hervorruft, die weit über die Texte hinausführen, seine Kraft, unterschiedliche Gehalte der Religion zu organisieren, aber auch der Schrecken und Terror, zu deren Rechtfertigung es diente und dient, standen uns am Ende unserer Arbeit noch deutlicher vor Augen als zu Beginn. Wenn sie bei der Lektüre des entstandenen Textes noch erkennbar sein sollten, wäre das Projekt nicht verunglückt.
II Exegetische und religionsgeschichtliche Perspektiven1
Das alttestamentliche Bilderverbot gehört zu den wichtigsten Besonderheiten der jüdischen Tradition. Seine Wirkung in der Religions-, Kultur- und Philosophiegeschichte ist kaum zu ermessen (vgl. III). Durch die christlichen Transformationen hindurch hat es etwa im byzantinischen Bilderstreit oder im Bildersturm der Reformation hohe Bedeutung erlangt (s. III 5.2; 8). Unter Berufung auf das Bilderverbot wurde um Gottesvorstellungen gerungen und die Frage nach der Angemessenheit visueller Vermittlungsformen für Gott/das Göttliche begrifflich zu erfassen versucht. Mit Blick auf das Bilderverbot wurden aber auch Kunstwerke zerstört und geschaffen (s. III 9). Die folgenden Überlegungen zu einem reflektierten Umgang mit dem Bilderverbot aus exegetischer Perspektive verfolgen einen doppelten Zugang:
a) Denjenigen einer Religionsgeschichte des antiken Israel, die Perspektiven einer historisch-kritisch rekonstruierten Theologiegeschichte des Alten Testaments und die Auswertung außerbiblischer Quellen vereinigt. Dazu muss besonders auch der weitere kulturelle Kontext über Palästina hinaus (vor allem altorientalische Tempel und ihre Kultbilder) betrachtet werden.
b) Denjenigen einer hermeneutischen Reflexion des Bilderverbots aus der Position einer christlichen (evangelischen) Theologie, unter Aufnahme der exegetisch-religionsgeschichtlichen Ergebnisse.
1.RELIGIONSGESCHICHTLICHE KONTEXTE
Um die Frage nach dem alttestamentlichen Bilderverbot bearbeiten zu können, soll zunächst der Rahmen skizziert werden, in dem allein dieses Verbot angemessen verstanden werden kann: In den Religionen des Alten Orients und der klassischen Antike spielten kultisch verehrte Bilder als Medien der Gottespräsenz eine herausragende Rolle. Sie standen im Mittelpunkt der Heiligtümer und Tempel. Auf sie waren Opfer, Gebete und Feste ausgerichtet. Deshalb kommen im Folgenden zunächst die Tempel als Hauptkontext der Bilder zur Sprache (1.1a). Anschließend werden die Bilder und ihre wichtigsten Formen (menschengestaltig, symbolisch, anikonisch) sowie ihre Herstellung und Funktionen in den Blick genommen (1.1b–e). Schließlich ist über die mit dem Kult verbundene „mentale Ikonographie“, die visuelle Imagination der Kultteilnehmer vom Körper der Götter und von deren Transzendenz, zu handeln (1.2).
1.1 Grundzüge altorientalischer Bilderkulte
a) Was ist ein Heiligtum?
Wenn man über einen chronologisch und regional stark unterschiedlichen Kulturraum wie den der altorientalischen Antike in einer auf gemeinsame vergleichbare Strukturen abhebenden Perspektive etwas sagt, besteht die Gefahr der Pauschalisierung. Dennoch ist es hilfreich, sich für unsere Fragestellung einige Grundzüge vor Augen zu führen, die für die Kulturen Vorderasiens und Ägyptens im Ganzen gelten:
Seit den ältesten neolithischen Heiligtümern in Anatolien (Göbekli Tepe, Nevali Çori) lassen sich im Alten Orient Tempel(-gebäude) nachweisen.2 Es ist bemerkenswert, dass dies so früh (um 9500v.Chr.) bereits der Fall ist. Schon vor der Entstehung von Dauersiedlungen und sogleich mit ihrer Etablierung entstanden auch Heiligtümer (außerhalb und innerhalb von Dörfern/Städten). Sie wurden als architektonische Räume aus umliegenden Landschaften (bzw. aus den Ortschaften) „herausgeschnitten“ (vgl. griechisch temenos und lateinisch templum „Herausgeschnittenes“ für einen heiligen Bezirk). In der elementaren räumlichen Unterscheidung zwischen innen und außen zeigt sich der religiös-kulturelle Symbolbereich der Schwelle.3 Er ist fundamental für alles, was im Folgenden entfaltet werden soll. Mit Schwellen werden sowohl Grenzen/Abschrankungen als auch Überlappungen/Zugänge markiert: Ein Heiligtum stellt insofern vor allem eine Übergangszone zwischen Göttlichem und Menschlichem, zwischen Reinem/Heiligen und Unreinem/Profanen dar.4 Es vereinigt in sich auch das Zusammentreffen von horizontaler und vertikaler Symbolachse bzw. mit dem Ägyptologen und Kulturwissenschaftler Jan Assmann gesprochen, von „Zentrum“ und „Weg“.5
Die horizontale Bewegungsrichtung führt über die Schwelle(n) eines Tempels hinweg immer weiter nach innen; sie folgt dabei meistens einem geradlinigen Weg, der in beiden Richtungen benutzt werden kann (wobei offen bleibt, ob die Subjekte jeweils dieselben sind; oft führt vor allem der Weg der Menschen nach innen6). Die Wegachse des Heiligtums endet an einem letzten Punkt: der entscheidenden Schnittstelle zwischen außen und innen, die durch die stärkste Präsenz des Göttlichen gekennzeichnet ist. Es handelt sich um die heikelste und wichtigste Grenzmarkierung eines Heiligtums, den räumlichen Punkt, an dem „hier“ und „dort“, diese und eine andere („jenseitige“) Welt am stärksten zueinander durchlässig sind. An dieser letzten Schwelle, meist eigens als Naos oder Cella markiert, wird oft die vertikale Dimension bestimmend.
Ein berühmtes Beispiel ist die Vision des Propheten Jesaja in Jes 6,1–11 aus der zweiten Hälfte des 8. Jh.s v. Chr.7 In ihr erscheinen die Dimensionen des irdischen Tempelgebäudes von Jerusalem transparent für den kosmischen Wohnsitz JHWHs: einen himmelhoch aufragenden Königsthron, von dem aus der Erdkreis seine Ordnung und Stabilität erhält (vgl. dazu, ebenfalls aus der staatlichen Zeit Judas, Ps 93*). Auch der Haupttempel der Weltstadt Babylon (Zeit NebukadnezarsII., 605–562v.Chr.) hatte eine ähnliche Symbolik, die auf zwei Gebäudekomplexe innerhalb des Heiligtumsbezirks verteilt war: Esangil, der sogenannte „Tieftempel“, bildete die horizontale Achse mit der geregelten Zugänglichkeit des Reichsgottes Marduk (täglicher Opfer- und außeralltäglicher Festkult). Das Etemenanki „Haus, Fundament von Himmel und Erde“, die berühmte sechsstufige Zikkurrat, war ein künstlicher Berg und verkörperte die vertikale Achse zwischen den Schichten der Welt. Auf seiner Spitze stand ein durch blaue Lasurziegel wahrscheinlich als dem inneren Himmelsbereich zugehörig markiertes Tempelgebäude, der sogenannte „Hochtempel“. Der Tempelturm galt als „Abbild“ des kosmologisch im „unteren Himmel“ verorteten Heiligtums Enlils/Marduks mit Namen Ešarra „Haus der Gesamtheit“.8
Besonders eindrücklich sind die bis heute erhaltenen ägyptischen Tempel der Ptolemäerzeit (hellenistisch-römisch). In ihnen, so etwa im großen Horustempel von Edfu9 (Bild 1), markierte zunächst eine Umfassungsmauer die Grenze zwischen dem Bereich des Gottes und der Außenwelt/seiner Stadt.
Bild 1: Horustempel von Edfu
Seitenansicht und Grundriss des Tempelgebäudes: Von den Eingangspylonen führt der Weg durch mehrere Säle und Vorhallen zum eigentlichen Kultzentrum, dem kleinen, für sich stehenden Naos/Schrein, in dem sich das Hauptkultbild befand und der von einem Korridor und einem Kranz von 13 Räumen umgeben ist.
Quelle: J. Assmann, Ägypten. Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur, UT 366, Stuttgart u.a. 1984, 40, Abb.2 (= S. Sauneron, H. Stierlin, Die letzten Tempel Ägyptens, 1975, 36f.).
Der Eingang zum eigentlichen Tempelgebäude wurde durch zwei mächtige Pylone, riesige künstliche Berge, flankiert, die den Aufgangspunkt der Sonne zwischen den Horizontbergen darstellten und Unheil abwehrende und Ordnung stiftende Bildprogramme trugen. Hatte man sie passiert, bewegte man sich auf einem immer mehr verengten (unter zunehmend abgesenkten Decken leicht ansteigenden) Weg durch ein System von Höfen und Hallen, wobei deren Größe nach hinten abnahm.10 Mit jeder Schwellenüberschreitung nahm in sozialer Hinsicht die Zugangsbeschränkung zu – den innersten Tempelbereich durften nur noch die stellvertretend für den Pharao und zugleich in Götterrollen agierenden Priester betreten. Am Ende des Weges befand sich der Naos (für das Kultbild). Es handelte sich um ein in der dunklen Cella/dem Sanktuar für sich stehendes kleines Gebäude, einen „Tempel im Tempel“11. Dieser war mit Flügeltüren versehen, so dass die in ihm befindliche Präsenz der Gottheit zwar zugänglich, vor allem aber verborgen erschien. Die Entzogenheit des Kultbildraums konnte im alten Ägypten so beschrieben werden:
„Es ist unzugänglicher, als was im Himmel ist, verhüllter als die Dinge der Unterwelt, verborgener als die Bewohner des Urwassers.“12
Weil die Bilder auf diese Weise „entrückt“ waren, wurde der (indirekte) Kontakt mit ihnen manchmal auch durch einen sogenannten „Gegentempel“ ermöglicht, welcher der Cella außerhalb des Tempels gegenüberlag, oder aber durch eine mit „Ohren“ (für die Erhörungsbereitschaft des Gottes) versehene Kultstelle an der Umfassungsmauer.13
Knapp zusammengefasst: Die grundlegende Struktur eines altorientalischen Heiligtums war die einer Schwelle. Sie vereinigte dabei in sich die räumlichen Symboliken von Zentrum und Weg.
Wichtig ist, sich nochmals die möglichen Blick- und Aktionsrichtungen deutlich zu machen: Wir denken – vor dem Hintergrund christlicher Kirchengebäude – vor allem von außen nach innen, imaginieren also den Weg zum Altar/Chorraum. Diese Aktionsrichtung traf im Alten Orient für die vielen Riten zu, die sich im „alltäglichen“ Tempelkult auf die Kommunikation mit den Gottheiten richteten (Opfer als Gabe und Audienzgeschenk, Bitten um Erhörung, Ehrerweis). Die außerordentlichen Rituale der Feste nahmen dagegen oft die umgekehrte Aktionsrichtung. Bei den altorientalischen Festen, kollektiven Inszenierungen einer „anderen Zeit“, traten Gottheiten (in ihren Kultbildern, die bei Prozessionen mitgeführt wurden) aus ihren Tempeln auch nach außen und wurden dort „epiphan“. Dabei blieben sie dennoch zumeist dem direkten Blick entzogen (abgeschirmt durch transportable Schreine und Vorhänge). Sie sakralisierten im Vollzug des Festes durch ihr Herauskommen kurzzeitig die Landschaft/Siedlungen, und das ansonsten „Profane“ wurde in ihre „heilige“ Präsenz mit einbezogen.14
Wie ein menschlicher Herr wohnten auch die Götter in „Häusern“. Das schließt nicht aus und ist bei den großen kosmischen Gottheiten (wie Sonnen- und Mondgottheiten, Wettergöttern etc.) auch klar gesagt, dass sie zugleich über hintergründige „Wohnorte“ in der Tiefe der Welt verfügten, die dem menschlichen Zugriff entzogen waren. Diese transzendenten Räume (im Himmel, auf Bergen, in der Unterwelt und anderswo) werden z.B. in Hymnen und Gebeten beschrieben oder vorausgesetzt.16 Anfangs- und Schöpfungs-Mythen erzählen, wie die Götter lange vor der Erschaffung der Menschen dort ihre Sitze etablierten.17 Es gab also ein deutliches Bewusstsein für die Übergröße und Ferne der Götter. Die „irdischen“ Heiligtümer erschienen in diesem Licht vor allem als Kontaktstellen aus der Initiative der Gottheiten heraus, die sich mittels eines „joint venture“ (A. S. Kapelrud: „temple building: a task for gods and kings“18) in der Welt der Menschen ansiedelten. Damit banden sie sich bewusst an die Menschen. Es blieb aber – auch das macht die Schwellen-Struktur eines altorientalischen Heiligtums deutlich – ein in Krisenfällen (wie Katastrophen, Stadteroberungen) offen zutage tretendes Wissen um das Prekäre der Präsenz der Götter. Positiv pries man die Gottheiten in Hymnen und Gebeten als übermächtig und gütig, negativ schilderte man sie in Klagen und Krisenritualen als abgewendet, zornig und undurchschaubar.19
Ein Heiligtum war ein asymmetrischer Ort von Herrschaft und Gaben-Zirkulation, aber auch Markierung einer Anwesenheit, die in Abwesenheit umschlagen konnte. Diese ungleichgewichtige Ambivalenz kennzeichnete einen altorientalischen Tempel – modern gesprochen – als ein Medium, einen in unserer Sicht ebenso realen wie imaginären Ort der Vermittlung zwischen dieser und jener Welt. Als solcher war er Gabe der Götter, aber auch bleibende Aufgabe der Menschen. Die Herrscher pflegten in Bau und Renovierung von „Gotteshäusern“ die Beziehung zu den Göttern und vermehrten so ihr eigenes Prestige (königsideologisch natürlich auch stellvertretend für das Kollektiv).
Bisher wurden bewusst die im Zentrum der Heiligtümer verehrten Bilder bzw. Kultsymbole noch nicht ausführlich erwähnt. Ihnen ist jetzt genauere Aufmerksamkeit zu schenken. Im Kultbild wiederholte sich nämlich in nuce alles, was bisher über das Heiligtum gesagt wurde: Das Götterbild war selbst Schwelle und Medium par excellence, es war die wichtigste Verkörperung von Gottespräsenz, aber zugleich spannungsvoller Ausdruck von deren Transzendenz. Was die Riten beim Bau und der Erhaltung von Tempeln kennzeichnete, galt verstärkt für die zentralen kultischen Objekte, um die herum ein altorientalischer Tempelkult inszeniert und ein Tempelgebäude errichtet wurde (vgl. den mittelalterlichen Kathedralbau, der mit dem Chorraum begonnen wurde, dem architektonischen Rahmen für die Gottespräsenz im Altar, in den Sakramenten und Reliquien; wie im Alten Orient baute man gewissermaßen von innen nach außen)20.
b) Anthropomorphe Kultbilder: Herstellung, Verehrung, Bedeutung
Altorientalische und antike Kultbilder waren die herausragenden Medien der Gottespräsenz.21 Sie standen im Zentrum des gesamten religiösen Symbolsystems. Archäologisch sind Kultbilder aus Mesopotamien (Sumer, Babylon, Assur) und Syrien/Palästina kaum überliefert (auch aus Ägypten gibt es nur wenige Beispiele)22. Das verwundert angesichts ihrer Bedeutung und der verwendeten wertvollen Materialien nicht. Vielleicht ist die hervorragend gearbeitete große Bronzestatue eines thronenden Gottes (36cm) aus dem Haupttempel der Akropolis der spätbronzezeitlichen Stadt Hazor in Galiläa (Gebäude 7050), als zentrales Tempelkultbild anzusprechen (Bild 2).
Zumeist ist die Forschung, was die äußere Erscheinung der zentralen Kultbilder angeht, auf literarische Beschreibungen, ikonographische Götterdarstellungen auf Roll- und Stempelsiegelbildern sowie auf Informationen aus den mit den Bildern befassten Ritualtexten angewiesen:23
Bild 2: Bronzestatue eines Gottes aus Hazor
Die Bronzefigur ist detailliert ausgestaltet. Eine Besonderheit ist die Dekoration ihrer Kopfbedeckung mit einem stilisierten Palmettebaum und daran fressenden Capriden (= Ziegen oder Steinböcke), einem uralten vorderasiatischen Symbol für Lebensfülle und Weltordnung, das auch zur Ikonographie des Jerusalemer Tempels gehörte. Die Statue aus Hazor dürfte einen Wettergott (Ba‘al, Hadad?) repräsentieren.
Quelle: S. Zuckerman, The Temples of Canaanite Hazor, in: J. Kamlah (Hrsg.), Temple Building and Temple Cult. Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.–1. Mill. B. C. E.), ADPV 41, Wiesbaden 2012, 99–125:115, Fig. 4.1 (= T. Ornan, „Let Ba‘al Be Enthroned“. The Date, Identification, and Function of a Bronze Statue from Hazor, JNES 70, 2011, 253–280, Fig. 2a–3).
„Zusammenfassend ist zu sagen, daß ein Kultbild nicht als ,Ähnlichkeitsbild‘ oder ,Portrait‘, sondern als ,Repräsentationsbild‘ verstanden wurde. Es ließ eine eindeutige Identifizierung der dargestellten Gottheit nur dann zu, wenn man es mit seinem Umfeld (Podest, Cella, Attributtieren) und den Paraphernalia (Szepter, Symbole, Kleider, Schmuck) zusammen sah. Letztere beinhalteten häufig eine Anspielung an den Wirkungsbereich des jeweiligen Gottes; Identität und Verantwortungsfeld waren daher eng aufeinander bezogen.“24
Die erste Bemerkung im angeführten Zitat zielt darauf ab, dass eine „klassische“ Definition des Bildes anhand von Ähnlichkeit die Beziehung des Bildes zum „Dargestellten“ im Alten Orient nicht trifft. Vielmehr ist das Bild ein Ort der Gottespräsenz, ohne dass die Frage nach Übereinstimmung mit dem Vorbild/Urbild eine eigenständige Rolle spielte.25 Um welche Göttergestalt genau es sich bei einem bestimmten Bild handelte, war daher nicht schon am anthropomorphen Äußeren als solchem abzulesen; auch wenn die Gottheiten der altorientalischen Panthea in manchen Texten individuelle Züge trugen, so waren sie doch in ihrer Erscheinung vor allem funktional unterschieden (teils aber auch austauschbar und miteinander identifizierbar).
Ähnlich wie ein mesopotamisches Heiligtum durch bestimmte Elemente seiner Baugestaltung (etwa die Nischengliederung an Fassaden und Eingängen oder die mit ihm verbundenen Tempeltürme/Zikkurrate) als der Götterwelt zugehörig markiert wurde,26 hatte das Kultbild göttliche Merkmale allgemeiner Art: Es trug, jedenfalls meistens, eine sogenannte (einfache oder mehrfache) Hörnerkrone und bestimmte nur Göttern vorbehaltene Gewänder (etwa das Falbelgewand). Seine Farbgebung wich von der gewöhnlicher Menschen ab: Die Bilder hatten blaue (die Himmelsfarbe des Lapislazuli nachahmende) Haare und Bärte27 und eine überirdische Ausstrahlung durch Edelmetallüberzug (Gold, Elektron, Silber). Letzterer ist wohl auch auf den aus vielen Textquellen bekannten „Schreckensglanz“ der Gottheiten zu beziehen (sumerisch ME.LÁM, akkadisch melammu, pulḫu etc.). Dieser verwies auf überirdische Vitalität und zugleich furchterregende Alterität – eine kulturelle Grundvorstellung der „mentalité mésopotamienne“, der Elena Cassin die bis heute beste Studie gewidmet hat.28 Angelika Berlejung führt dazu im Blick auf die Wirkung der Bilder auf die Betrachter aus:
„[Z]udem gibt es auch einen Hinweis, wie die Bilder von ihren Verehrern wahrgenommen wurden: Die leuchtenden Gesichter wurden mit Lichterscheinungen in Zusammenhang gebracht, die in den Menschen Ehrfurcht und Schrecken auslösten. Der Glanz der polierten Steine und der Edelmetalle, die für das Kultbild verwendet worden waren oder die sich in Form der Kleider und des Schmuckes an ihm anbringen ließen, blendete und bannte den Betrachter. Die Kostbarkeit und die Seltenheit der Bestandteile des Bildes zeigten seine göttliche Qualität an.“29
Wenn man nun ein Kultbild nicht aus einer individualisierten Ikonographie heraus identifizieren konnte, so half dafür entscheidend sein Kontext, denn jedes Hauptkultbild wurde nach feststehenden Regeln für ein bestimmtes Heiligtum und seine Riten und Feste angefertigt. Hier „zeigte seine Aufstellung, was seine Bedeutung war“ – so einst völlig zutreffend schon W. Robertson Smith in seinen berühmten „Lectures on the Religion of the Semites“ (1888–1891).30 Denkt man etwa an das Ebabbar, das große Sonnenheiligtum von Sippar in der Nähe von Babylon, über dessen zentrales Kultbild wir gut unterrichtet sind (Relief des Nabû-apla-iddina, Bild 3), so war der thronende Sonnengott Šamaš anhand mehrerer „features“ eindeutig erkennbar:
Bild 3: Relief des Sonnengottes Šamaš aus Sippar
Die neubabylonische Steintafel (853v.Chr.) enthält neben dem Relief eine lange Inschrift, die der Erneuerung des Kultbilds des Šamaš gewidmet ist. Das Bild ist einerseits bewusst traditionell bzw. archaisierend (Motiv einer Einführungsszene vor den thronenden Gott). Andererseits trägt es singuläre Züge, vor allem die gleichzeitige Darstellung des Gottes (bzw. seines Kultbildes) und eines ihn verkörpernden Symbols (Sonnenscheibe).
Quelle: F. Hartenstein, Das Angesicht JHWHs. Studien zu seinem höfischen und kultischen Bedeutungshintergrund in den Psalmen und in Exodus 32–34, FAT 75, Tübingen 2008, 298, Tf.4.1 (= J. Black, A. Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary, London 1992, 94, Fig. 73, Zeichnung: T. Rickards).
Šamaš (rechts) saß auf einem kosmisch dimensionierten Thronsitz, der als Horizonttür des Sonnenaufgangs mit Stiermenschen (kusarikku) gestaltet war – ikonographisch ein eindeutiger Identifizierungsmarker.31 Zum links vor seinem Schrein befindlichen Sonnensymbol, zu dem ein menschlicher Adorant eingeführt wird, vgl. unten 1.1c.
Entscheidend für die Funktionalität des Tempelkultbilds war seine Kommunikationsfähigkeit, die durch die Frontalität der Aufstellung und die betonte Hervorhebung der Gesichtszüge (Augen, Mund, Ohren, freundliche Mimik) sowie durch die Gestik (oft zu Gruß/Segen geöffnete Hand, s. Bild 2) sicher gestellt wurde (hier setzte die spätalttestamentliche Bilderkritik an, indem sie dies als Illusion vorführte, s. u. 2.2b). Ein auf das Bild zutretender Bittsteller (vgl. das unter 1.1a zum Weg im Tempel Gesagte) trat zu ihm in Beziehung. Die Bilder agierten in einem Handlungszusammenhang und ihre Herstellung und Aufstellung diente allein diesem Zweck. Das tägliche Tempelritual, wie wir es etwa aus dem seleukidischen Uruk (3./2. Jh. v. Chr.) kennen,32 beinhaltete umfangreiche Bekleidungs- und Speiseriten für das Bild. Der Herrscher hatte durch sie an der Tafel des Gottes Anteil (reziprokes System von Opfergaben), und die Priester des Tempels lebten stellvertretend für die Stadt/das Reich/den König im „Haus des Gottes“ in Gemeinschaft mit ihm (Leo Oppenheim überschrieb deshalb ein einschlägiges Kapitel seiner mesopotamischen Kulturgeschichte „The Care and Feeding of the Gods“33). Zumeist hatte allerdings die weitere Öffentlichkeit keinen direkten Zugang zu den Tempelkultbildern (vgl. den assyrischen Titel erib bīti „Tempelbetreter“34). Die Bilder befanden sich im hinteren unzugänglichen Bereich des Adyton (Kultnische), oft auch hinter Vorhängen.35 Dennoch wusste man, auch wenn man des Bildes nicht direkt ansichtig wurde, um die lebenswichtige Gottespräsenz, die sich mit ihm verband, und hatte – aufgrund der Feste und der „Massenmedien“ (vor allem Siegelbilder) – eine visuell recht genaue Vorstellung vom Aussehen z.B. der Göttin Ištar (dies zeigt etwa der Bericht über eine Traumvision für den assyrischen König Assurbanipal, in dem die Göttin dem Herrscher sichtbar erscheint36). Der Kontakt mit den Bildern konnte also sowohl direkt wie (wohl häufiger) indirekt sein.37 In jedem Fall war er von zentraler Bedeutung für die soziale und kosmische Ordnung. Denn der Verlust eines Tempelkultbildes, wie er am häufigsten im Kriegsfall eintrat (Entführung, teils auch Zerstörung feindlicher Kultbilder), war eine Katastrophe für Land und Volk. Hier finden sich je nach Perspektive in den Quellen unterschiedliche Deutungen, besonders aus Babylon: Triumphierten die Sieger (Elamer, Assyrer) darüber, dass sie den Hauptgott entmächtigt ins Exil führten, so deuteten die Verlierer (Babylonier) dies unter Umständen als eine freiwillige Abwendung Marduks von seinem Volk wegen dessen Übertretungen (s. u. 2.4a).38 Man sieht auch daran, wie stark die Gleichsetzung von Gott und Bild gedacht war: Im Bild war der Gott da und ansprechbar. Auch wenn dies gleichzeitige gegenläufige Symboliken von Entzogenheit sowie andere Verkörperungen des Gottes nicht ausschließt, war das Kultbild für einen heilvollen und die kosmische Ordnung stabilisierenden Gotteskontakt entscheidend.
In den mesopotamischen Ritualen zu seiner Herstellung und Einweihung, die Angelika Berlejung in ihrer wichtigen Monographie „Die Theologie der Bilder“39 bearbeitet hat, wird ein genaues Bewusstsein dafür deutlich, dass erst im Augenblick der Mundöffnung im Rahmen des abschließenden Mundwaschungsrituals und somit der endgültigen Einbindung in den Kommunikationszusammenhang des Tempels das Bild kein Artefakt mehr war, sondern eine übermenschliche Erscheinungsform des Gottes.40 Zuvor wurde das Bild von den weisen Handwerkern, die zugleich auch Ritualspezialisten waren, sukzessive aus dem Kontext der Menschenwelt herausgelöst und in den götterweltlichen Handlungszusammenhang hinein transferiert, der von Anfang an alle Arbeitsschritte begleitete (zu Jes 40,18–20, wo dies polemisch aufgenommen wird, s. u. 2.4a).41 Ein Handerhebungsgebet zur Mundöffnung des Kultbildes lautet:
„Als der Gott geschaffen war, als die reine Statue vollendet war. Reine Statue, in ehrfurchtgebietendem Glanz vollendet. Bei deinem Hervorgehen. Statue, an einem reinen Ort geboren. Statue, im Himmel geboren.“42
Das Bild ist zwar „geschaffen“ und „vollendet“, aber eben auch „im Himmel geboren“, es ist wie es im Ritual heißt „Geschöpf des Gottes, Werk der Menschen“43. Es hat Anteil an beiden Seinsbereichen. In ihm fokussieren sich die horizontale und die vertikale Achse des Symbolsystems. Es steht im Zentrum aller religiösen Handlungen und die bei seiner Herstellung verwendeten Materialien spiegeln seine Verbindung zu allen kosmischen Regionen (Himmel, Erde, unterirdischer Süßwasserozean/Apsû; zur Abwehr dieser Vorstellung in Dtn 4 und in der Erweiterung des dekalogischen Bilderverbots s. u. 2.3a). Es ist wie der Tempel kosmischer Kreuzungspunkt und hat wie er Anteil an der Stabilisierung der Weltordnung (Jan Assmann hat im Blick auf den in ägyptischen Tempeln rituell unterstützten Sonnenlauf treffend von einer „Inganghaltung“ der Welt gesprochen)44. Was hier vor allem am Beispiel der Keilschriftkulturen Mesopotamiens demonstriert wurde, gilt mit Variationen ebenso für Ägypten, Syrien/die Levante, teils auch für Griechenland45.
Entscheidend für unsere weiteren Überlegungen ist die sowohl im Umgang mit den Bildern wie in der Reflexion auf ihre Herstellung/Herkunft mehr oder minder bewusste Realisierung ihrer „Doppelnatur“: Als Präsenzmedien einer Gottheit konnte man direkt mit ihnen interagieren und folgte dabei den sozialen Regeln eines Kontakts mit Höhergestellten; hier stellte sich im Normalfall die Frage nach dem „Wesen“ der Bilder nicht. Zugleich aber entzog sich die im und mit dem Bild gegebene Präsenz jeder letzten Fixierung, nicht nur weil es sich um eine Gottheit handelte, sondern auch, weil im Medium des visuellen Objekts (in seinem Kontext) besondere Differenzwahrnehmungen mitgesetzt waren. Der Altphilologe Fritz Graf bringt das in einem wichtigen Beitrag, der dem „Eigensinn der Götterbilder in antiken religiösen Diskursen“ und damit der in den Bildern zum Ausdruck kommenden Ambivalenz gewidmet ist, auf folgenden Nenner:
„Die Ambivalenz hat letztlich zu tun mit dem Gottesbild. Mensch und Gott sind fundamental unvereinbar: In Mekone, als Prometheus das Opfer einrichtete, hatten sich ihre Wege getrennt, sagte schon Hesiod, und seitdem sind die Kommunikationswege des Menschen mit dem Göttlichen schwierig geworden. Gewöhnlich sind es die Tempel, in denen diese Kommunikation in Gebet und Opfer stattfindet; fokussiert sind diese Aktivitäten immer wieder eben auf das Kultbild. In einem gewissen Sinn ist das Bild die Verbindung (sozusagen das Interface) zwischen beiden letztlich unvereinbaren Welten. Als solches ist es ein Ort von Spannungen und unvereinbaren Widersprüchen – die Bilder stellen Götter dar, die letztlich doch jenseits der Darstellung stehen, schon weil sie unvergänglich und zeitlos sind.“46
Genau an dieser Stelle – der Unverzichtbarkeit bei gleichzeitigem Ungenügen der Kultbilder als Medien des Gotteskontakts – lässt sich die Problematik des „Bildes“ genauer eingrenzen, wie sie in antik-philosophischer Bilderkritik und im alttestamentlich-jüdischen Bilderverbot ihren Ausdruck fand (vgl. weiter die religionsphilosophischen Überlegungen unter III 4.3). Doch zunächst muss in Annäherung an das komplexe Problemfeld der Blick auf den Alten Orient noch einmal vertieft werden. Denn neben den anthropomorphen Kultbildern gab es komplementäre visuelle Repräsentationen: symbolische und „anikonische“ Darstellungen, die regional und zeitlich verschieden von erheblicher Wichtigkeit waren.
c) Göttersymbole: gleichwertige oder konkurrierende Medien?
Altorientalische Tempel und Heiligtümer beherbergten nicht nur die zentralen Kultbilder der Gottheiten, denen sie geweiht waren, sondern verfügten auch über Verehrungsstellen anderer Götter und ihrer Bilder. Hier bildet sich ein Wesensmerkmal polytheistischer Symbolsysteme ab, bei denen Götter immer in Verwandtschafts- und Herrschaftsbezüge eingebunden sind. Bekanntlich ist es diese Vielfalt zusammen mit den definierten Funktionsbereichen großer Gottheiten, die es ermöglichte, dass historisch und regional Götter miteinander identifiziert wurden und die Panthea von Städten und Reichen füreinander offen waren.47 Eine ähnliche Vielfalt (vgl. Henri Frankforts berühmtes Diktum von der „multiplicity of approaches“48) galt auch für die Götterkulte eines Tempels, die verschiedene Repräsentationsformen für denselben Gott, seinen Götterkreis und weitere Gottheiten vereinigen konnten.
Eine weitere Voraussetzung für das Nebeneinander verschiedener Repräsentationsformen war die Ausdehnung der Göttlichkeit auf Dinge, die nach modern westlichem Verständnis „unbelebt“ waren. So konnten z.B. Waffen oder Musikinstrumente wie Kesselpauken (dLILISSU) oder ein Saiteninstrument (dBALAG) mit dem Gottesdeterminativ geschrieben werden (dem Keilschriftzeichen d=DINGIR für „Gott/Göttliches“).49 Diese sakralen Objekte wurden namentlich angesprochen und beopfert. Ganz analog konnten im Tempelritual auch metonymische (pars pro toto) oder abstrakte Symbole (als Skulpturen/Artefakte) eine kultische Funktion erhalten (oft mit akkadisch šurinnu „Gottesemblem“ bezeichnet). Ihre diesbezügliche Gleichwertigkeit mit Kultbildern zeigt sich daran, dass man an einem Göttersymbol, z.B. einer Mondsichel, dasselbe Mundwaschungs- und Mundöffnungsritual vollzog wie an anthropomorphen Bildern (s. o.):
„Diese Mondsichel riecht ohne Mundöffnung keinen Weihrauch, ißt kein Brot [und trinkt kein Wasser].“50
Der Herstellungsprozess der Mondsichel, einem vor allem mit dem großen Mondgott des Westens, Sîn von Harran˘, verbundenen verbreiteten Symbol, wurde ebenfalls simultan im göttlichen und menschlichen Handlungszusammenhang wahrgenommen („Die Mondsichel, Geschöpf Gottes, das die Menschheit machte“51).
Manchmal, wohl auch aufgrund kultureller Eigenarten, wechselten in Mesopotamien die Vorlieben für anthropomorphe oder symbolische Darstellungen von Gottheiten. Ab der Herrschaft der Kassiten im Kernland Babyloniens (Mitte 2. Jt. v. Chr.) war es weit verbreitet, etwa auf Grenzsteinen und Vertragsurkunden (kudurru) Götter durch Symbole zu repräsentieren.52 Entsprechende Ikonographien waren stabil und schöpften aus einem Bildinventar, das in vielen Fällen komplementär zu den menschengestaltigen Tempelkultbildern bestand. Auch im ersten Jahrtausend gab es beides nebeneinander, wobei sich in Babylonien erneut eine Bevorzugung von Symbolen auf Bildzeugnissen feststellen lässt. Ob dabei auch bewusste theologische Gründe eine Rolle spielten, lässt sich schwer entscheiden. Eine Wertung wird aus Textquellen kaum ersichtlich.53 Wenn der Ort der Gottespräsenz im Ritual durch das Ganze des Kults, den symbolischen Interaktionszusammenhang und seinen architektonischen Rahmen, bestimmt wurde, war der Unterschied der Repräsentationsformen vermutlich nicht fundamental. Das ist wahrscheinlich, wenn man zwei für unseren weiteren Argumentationsgang wichtige Gesichtspunkte einbezieht:
a) Weil die Objekte der Gottespräsenz Medien für Handlungen/Kommunikation waren und nicht maßgeblich durch eine Ähnlichkeitsbeziehung konstituiert wurden, konnte ein Symbol pars pro toto den Gott vertreten, jedenfalls wenn es rite funktionsfähig gemacht wurde.
b) Zusammen mit den sichtbaren (visuellen, architektonischen und mimisch-gestischen) Vollzügen eines Kultes spielte eine gemeinsame bildhafte Vorstellungswelt eine entscheidende Rolle, die Rituale und Feste begleitete und strukturierte. Sie war vor allem durch Sprache und Texte geprägt. Deren (metaphorische) Bildlichkeit entschied genauso über Erleben und Verstehen wie äußerlich sichtbare Phänomene. Man kann hier mit Tryggve N. D. Mettinger von einer „mentalen Ikonographie“54 sprechen, einer konventionellen Vorstellungswelt, in der die vorrangige Gestalt der Götter körperhaft und menschlich war. Hierzu trägt auch das Phänomen des Eigennamens bei.55 Der Name machte einen Gott zur individuell ansprechbaren Instanz. Mit der Namensanrufung verband sich unwillkürlich eine „Verortung“. Insofern stehen Gestalt(vorstellung) und Name in Beziehung. Zusammen verleihen sie wie das Kultbild der Gottheit ihre Kommunikationsfähigkeit.
Ein berühmtes Beispiel aus mittelassyrischer Zeit (13. Jh. v. Chr.) vermag das schön zu illustrieren (Bild 4): Auf dem Berliner Kultsockel des Königs Tukulti-NinurtaI. ist in zwei Phasen die Proskynese des Herrschers vor einem Göttersymbol dargestellt, das sicher einmal real auf dem Podest gestanden hat:56
Bild 4: Symbolsockel des Tukulti-NinurtaI.
Der Sockel eines Kultsymbols aus mittelassyrischer Zeit zeigt als Seitenrelief das einstmals auf ihm befestigte Göttersymbol sowie zwei Phasen des Verehrungsgestus des Herrschers Tukulti-NinurtaI. (1244–1208v.Chr.) vor dem Symbol (stehend und kniend).
Quelle: F. Hartenstein, Das Angesicht JHWHs. zu seinem höfischen und kultischen Bedeutungshintergrund in den Psalmen und in Exodus 32–34, FAT 75, Tübingen 2008, 299, Tf. 5.1 (= J. Black, A. Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary, London 1992, 29, Fig. 20, Zeichnung: T. Rickards).
Auf der Seite sind sowohl der Sockel selbst wie das einstmalige Göttersymbol abgebildet: Es handelt sich vermutlich um einen Schreibgriffel (stilus) vor einer rechteckigen (Schrift-) Tafel. Beides sind Attribute des Gottes Nabû, passen aber auch für den in der Inschrift des Sockels genannten Wesirgott Nusku, „der vor (dem Angesicht von) Assur und Enlil steht“ und „der alltäglich die Gebete Tukulti-Ninurtas [I.], des von ihm geliebten Königs, vor Assur und Enlil wiedergibt“57. Nusku wurde dabei sicherlich nicht „in Form“ des Symbols imaginiert, sondern durch dieses vertreten und dabei menschengestaltig vor den hohen Götterherren stehend gedacht, wie wir es aus Audienzszenen auf Siegelbildern kennen.
Noch einmal komplexer verhält es sich mit einem zweiten Beispiel für Göttersymbole: der oben bereits erwähnten Tafel des babylonischen Herrschers Nabû-apla-iddina aus dem Jahr 853v.Chr. (Bild 3),58 die viel Beachtung gefunden hat, weil sich hier eine Inschrift zusammen mit einem Bildrelief auf denselben Vorgang bezieht. Es geht um den Verlust des zentralen Tempelkultbildes des Sonnenheiligtums von Sippar, das einst von den Sutäern zerstört worden war. An seiner Stelle wurde im 11. Jh. v. Chr. eine (Sonnen-)Scheibe als Kultsymbol installiert. Die Interimssituation dauerte bis Mitte des 9. Jh. v. Chr., als unter Nabû-apla-iddina ein Modell für die Wiederherstellung des verlorenen anthropomorphen Kultbildes gefunden wurde und der König die Kultrestauration durchführen ließ. Die zweihundertjährige Abwesenheit des Kultbildes wird in der Inschrift geschichtstheologisch als „Zürnen mit Akkad“ und als „Abwenden des Nackens“ des Šamaš gedeutet. In der göttlichen Gabe des richtigen Vorbildes für die Erneuerung des Kultbilds wird die erneute Zuwendung des Gottes deutlich. Hier scheint eine Bewertung vorzuliegen, wonach das Symbol nur als unvollständiger Ersatz für das anthropomorphe Kultbild galt. Das Bildrelief der Tafel lässt davon allerdings nichts erkennen, vielmehr erscheint hier beides als komplementär. Was die Inschrift aber klar voraussetzt, ist die anthropomorphe Gottesvorstellung als solche (Ab- und Zuwendung des Gesichts), die den Sonnengott hintergründig in seinem kosmischen Bereich verortet und das Kultbild als Gabe um der Menschen willen erscheinen lässt.
d) „Anikonische“ Kultsymbole: komplementär oder konträr zu Bildern?
Dasselbe wie bei den Symbolen, die offenbar anthropomorphen Tempelkultbildern funktional gleichwertig waren, gilt schließlich auch für sogenannte „anikonische“, also „bildlose“ sakrale Objekte. Ihnen wurde im Blick auf die Herkunft des Bilderverbots bzw. die Abgrenzung gegenüber bildhaften Repräsentationen von Göttern in Judentum und Islam in den letzten Jahren vermehrte Aufmerksamkeit zuteil.59 Sie sind vor allem im Norden Mesopotamiens (Assyrien) und in Syrien/der Levante einschließlich Palästinas bis nach Arabien, aber auch in Kleinasien belegt. Zumeist handelt es sich um senkrecht aufgerichtete bearbeitete Steine, deren Größe von unter einem Meter bis zu übermenschlicher Höhe reicht.60
Die Formen variieren von einer einfachen Pfeiler- oder Rechteckform zur häufigen Stele (Tafelform mit oben gerundeten Ecken bzw. halbrunder Oberseite), aber auch zum Obelisken (Byblos). Gemeinsam ist diesen „standing stones“ (akk. sikkānum, hebräisch maṣṣēba, arabisch nuṣb61), dass bei ihnen Materialität (dauerhafter Stein) und vertikale Ausrichtung die entscheidenden Merkmale sind. Philon von Byblos (2. Jh. n. Chr.) nennt sie mit einer schon älteren griechischen Bezeichnung baitylos,62 ein Fremdwort, abgeleitet aus dem semitischen bēt ’ēl/bīt īli; „Haus Gottes“ (s. o. 1.1a). Sie galten – wie es auch inschriftlich bezeugt ist – als Wohnung eines Gottes oder eines (vergöttlichten) Ahnen; dementsprechend finden sie sich sowohl in sakralen wie in sepulkralen Kontexten. Ihre außerdem belegten Funktionen als Memorialstelen oder Urkunden für Verträge erklären sich ebenfalls aus ihrem „belebten“, mit göttlicher Präsenz „beseelten“ Charakter. Es gab sie in Koexistenz mit anthropomorphen Kultbildern prominent seit der Frühbronzezeit (3. Jt. v. Chr.) bis in die römische Zeit. Sie gehörten einzeln oder zu mehreren (oft Stelenreihen, in Palästina etwa in Gezer) sowohl zur Ausstattung von Freiluft-Heiligtümern wie von Tempeln. In Letzteren fand man sie einerseits in Hofanlagen, andererseits in klarem Bezug auf die oder direkt in der Tempelcella. In einigen Fällen nahmen sie die Position des zentralen Kultsymbols ein (etwa im bronzezeitlichen Obeliskentempel von Byblos oder im eisenzeitlichen judäischen Festungstempel von Arad, Bild 5):
Bild 5: Kultnische des Festungstempels von Arad
In der erhöhten Kultnische des kleinen eisenzeitlichen judäischen Tempels, der in die NW-Ecke





























