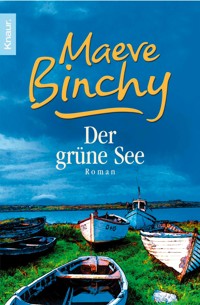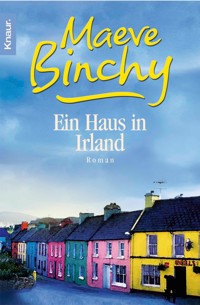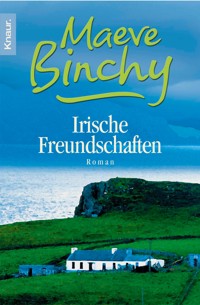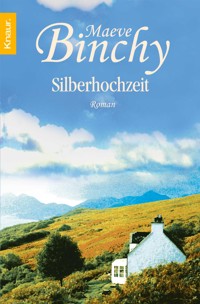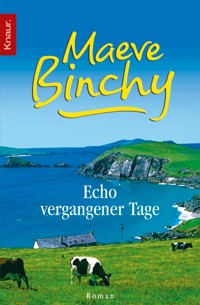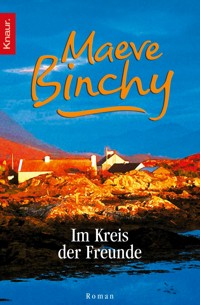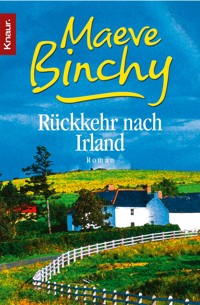
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Rückkehr nach Irland, einer Sammlung von Erzählungen, führt uns die Bestsellerautorin Maeve Binchy das Leben in seiner ganzen Vielfalt vor: Scheue Verlierer und Sekretärinnen mit stillen Leidenschaften, geistesabwesende Ehemänner und träumerische Fremde, die mit der Verwechslung ihrer Koffer auch ihr Leben tauschen... Sie alle jonglieren zwischen Glück und Lebenslügen, frühen Verzückungen und späten Enttäuschungen. Sie feiern Taufen und Beförderungen, leben mit ihren Familiengeheimnissen und stemmen sich mutig gegen den Alltagstrott.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Maeve Binchy
Rückkehr nach Irland
Roman
Aus dem Englischen von Christa Prummer-Lehmair, Sonja Schuhmacher und Robert A. Weiß (Kollektiv Druck-Reif)
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In Rückkehr nach Irland, einer Sammlung von Erzählungen, führt uns die Bestsellerautorin Maeve Binchy das Leben in seiner ganzen Vielfalt vor: Scheue Verlierer und schüchterne Sekretärinnen mit heimlichen Leidenschaften, geistesabwesende Ehemänner und träumerische Fremde, die mit der Verwechselung ihrer Koffer auch ihr Leben tauschen … Sie jonglieren zwischen Glück und Lebenslügen, frühen Verzückungen und späten Enttäuschungen. Sie feiern Taufen und Beförderungen, richten sich ein mit Familiengeheimnissen und stemmen sich mutig gegen den Alltagstrott.
Inhaltsübersicht
Widmung
Die Rückkehr
Der Falsche Koffer
Miss Vogel macht Urlaub
Die Haushüterin
Pauschalreise, Rücktritt inbegriffen
Die Lehrzeit
Die Geschäftsreise
Die Überfahrt
Die Frauen mit den Hüten
Etwas Aufregendes
Urlaubswetter
Victor und der Valentinstag
Begegnungen
Ein Urlaub mit Vater
Für Gordon, mit all meiner Liebe
Die Rückkehr
Liebste Mutter,
es ist hier ja noch grüner und schöner, als Du erzählt hast. Ich genieße meinen Aufenthalt wirklich sehr. Demnächst mehr. Bleib gesund und munter.
Freda,
die Karte gestern habe ich Dir nur wegen der Nachbarn geschickt. Besser gesagt, wegen Deiner Paranoia, was die Nachbarn betrifft. Nun, jedenfalls ist sie dazu gedacht, daß Du sie herumliegen läßt, damit jeder einen Blick darauf werfen, sie umdrehen und heimlich lesen kann. In Wahrheit ist es hier einfach fürchterlich, und es regnet in Strömen, so daß ich kaum erkennen kann, ob die Gegend nun grün oder braun ist. In Wahrheit bin ich immer noch tief gekränkt und unglücklich und ganz und gar nicht in der Stimmung, Briefe zu schreiben. Und tatsächlich muß mir an Dir wohl eine ganze Menge liegen, sonst würde mir dieser Anruf vom Flughafen nicht so nahegehen. Du hast gesagt, daß Du auf Post von mir wartest, und das glaube ich Dir. Deshalb schreibe ich Dir, doch im Augenblick habe ich nichts zu sagen.
Hör endlich auf, Dir den Kopf darüber zu zerbrechen, was die Leute wohl denken oder reden. Ehrlich, sie denken sich nicht viel und reden auch kaum über uns, dazu haben sie zu viele eigene Probleme.
Liebe Gina,
Du hast mich Freda genannt, nicht Mom wie sonst, und darüber habe ich lange nachgegrübelt. Es bedeutet wohl, daß Du erwachsen wirst und Deiner eigenen Wege gehst. Zuerst habe ich daraus geschlossen, daß Du mich jetzt lieber magst, mich als Ebenbürtige, als Freundin betrachtest. Dann wieder sagte ich mir, es bedeutet, daß Du mich nicht mehr so gerne hast und Dich von mir entfernst.
Für jemanden, der angeblich nichts zu sagen hat, hast Du doch eine ganze Menge zu sagen. Du behauptest, ich sei paranoid wegen der Nachbarn. Nun, dann solltest Du wissen, daß Mrs. Franks vorhin hereingeschneit kam und meinte, sie habe einfach nicht anders gekonnt und Deine Karte lesen müssen, und wie schön es doch sei, daß es Gina so gut gehe. Also: Spionieren sie nun oder nicht? Da siehst Du mal!
Du schreibst, der Anruf vom Kennedy Airport sei Dir so nahegegangen. Aber angerufen hast Du, Gina, nicht ich. Dabei habe ich Dich nur gebeten, mir öfter mal zu schreiben. Du warst diejenige, die geheult hat, obwohl ich nur gesagt habe, was jede normale Mutter zu ihrer Tochter sagen würde, die ins Ausland geht … nach Europa. Ich würde mich freuen, wenn Du mir schreibst – das waren meine Worte. Belastet Dich das so sehr? Mußt Du mich deswegen so abkanzeln, mir eine Strafpredigt darüber halten, daß ich mir von anderen Leuten vorschreiben lasse, wie ich zu leben habe?
All das schreibe ich nur, damit Du weißt, daß ich noch immer dieselbe bin, dieselbe komplizierte, nervöse, dünnhäutige Mutter wie eh und je. Es gefällt mir, daß Du mich Freda nennst. Hör bloß nicht damit auf, nur weil Du denkst, ich würde mir etwas darauf einbilden und etwas hineininterpretieren, was gar nicht da ist. Und schreib mir auch weiterhin, Gina. Wie Du weißt, wollte ich nicht, daß Du nach Irland gehst. Aber ich habe immer dazugesagt, daß es nur meine eigenen irrationalen Vorbehalte sind. Es gibt so vieles, was ich über Irland erfahren möchte, und so vieles, was ich lieber nicht wissen will.
Wahrscheinlich möchte ich, daß Du mir schreibst, es sei wunderschön und traurig und daß ich das einzig Richtige getan hätte, nämlich fortzugehen. Fortzugehen für immer. Ja, das würde ich wohl gern in Deinen Briefen lesen. Und es von Dir hören, wenn Du nach Hause kommst. Ich habe Dich lieb, Gina, und hoffe, daß Dich dieses Eingeständnis nicht allzusehr belastet.
In diesem Brief verzichte ich auf die Anrede, um uns weitere lange Analysen zu ersparen. Heute war ein seltsamer Tag. Ich hatte gerade die Frühstückspension verlassen, die übrigens ganz nett ist, ein kleines Zimmer in einem kleinen Haus. Die Zimmerwirtin ist eine freundliche Frau, sie erzählt mir pausenlos von ihrem Sohn, der in Boston lebt und ein »Illegaler« ist. Ich dachte erst, sie spricht von der IRA, tatsächlich meinte sie aber, daß er ohne gültiges Visum und ohne Arbeitserlaubnis in einer Bar jobbt. Jedenfalls ging ich die Straße entlang, an lauter kleinen Häusern vorbei, und wahre Horden von Kindern trieben sich nach der Schule draußen herum. Das Land kommt mir manchmal vor wie ein riesiger Schulhof. Und da sah ich einen Bus, auf dem »Dunglass« stand. Er war zur Hälfte voll. Als ich die Hand ausstreckte, hielt er an. Ich fragte den Fahrer: »Wo ist Dunglass?«, und er sagte es mir … »Aber ist Dunglass nicht nur ein einzelnes großes Haus?« wollte ich wissen. Nein, antwortete er, es sei eine Stadt. Mom, warum hast Du mir nicht erzählt, daß es sich um eine Stadt handelt? Was hast Du mir noch alles verschwiegen? Ich bin dann ausgestiegen und habe dem Fahrer gesagt, ich hätte es mir anders überlegt.
Als ich in die Pension zurückkam, war die Wirtin in Hochstimmung. Sie hatte Nachricht von ihrem Sohn, dem Illegalen, erhalten. In Boston sei es kalt, viel Eis und Schnee. Ich erkundigte mich nach Dunglass. Sie sagte, es sei ein Dorf; ein hübscher Ort, ruhig und friedlich, aber mitten im Winter würde sie nicht hinfahren, da sei es zu deprimierend. Warum hast Du mir nie gesagt, daß es ein deprimierendes Dorf ist? Warum hast Du mich jahrelang in dem Glauben gelassen, es handle sich um ein großes altes Haus, an dessen Tor »Dunglass« steht? Du hast mir sogar mal erklärt, was es bedeutet: »Dun« heißt Festung, »Glass« heißt grün. Das zumindest stimmt, ich habe es nachgeprüft. Aber was stimmt sonst noch?
Gina, meine Liebe,
wenn Du doch anrufen würdest! Ich habe versucht, Deine Nummer herauszubekommen, aber im Unterschied zu hier gibt es dort kein nach Straßennamen geordnetes Telefonverzeichnis. Fünf Tage sind vergangen, seitdem Du geschrieben hast. Es wird weitere fünf Tage dauern, bis Du diesen Brief in Händen hältst. Zehn Tage, in denen sich alles verändert haben kann. Möglicherweise bist Du inzwischen schon dort gewesen.
Ich habe nie behauptet, es sei ein Haus. Niemals. Unser Haus trug keinen Namen. Es war groß, mit Toren davor, das größte Haus in Dunglass, was allerdings nicht viel heißt. Aber von all dem habe ich nie etwas erzählt. Es gibt eben Dinge im Leben, an die man nicht ständig erinnert werden will. Fahr einfach mal hin und sieh Dir Dunglass an, wenn es klar ist und vielleicht sogar eine blasse Wintersonne scheint, so daß Du unten am See entlangspazieren kannst. Schau Dir das Haus an. Im Kirchhof auf dem Hügel findest Du das Grab Deiner Großmutter. Es wird Dich niemand kennen, aber wenn Du willst, sag den Leuten, wer Du bist. Sag ihnen ruhig, daß Deine Mutter aus Dunglass stammt und fortgezogen ist. Aber wahrscheinlich wirst du nichts von all dem sagen, da Du ja so fest davon überzeugt bist, daß sich niemand auch nur im geringsten für das Leben anderer Leute interessiert.
Ich habe Dich lieb, und Du sollst von mir alles erfahren, was Du wissen möchtest.
Deine Mutter Freda (falls Du meinen Namen vergessen haben solltest)
Freda,
hör auf mit diesen albernen Spielchen. Und laß uns aufhören, in unseren Briefen miteinander zu streiten. Ja, ich werde nach Dunglass fahren. Wenn ich soweit bin.
Und schreib mir nichts über meine Großmutter. Sie hat mir nie eine Großmutter sein dürfen. In meiner Gegenwart fiel niemals ihr Name, ich bekam keine Briefe, keine Geschenke von ihr … auf dieser Seite des Atlantiks gab es kein Familienalbum mit Fotos von mir, die eine Oma stolz vorzeigen konnte. Die Frau, die auf dem Kirchhof begraben wurde, ist Deine Mutter. Das ist es, was Dich mit ihr verbindet, warum siehst Du dieser Tatsache nicht ins Auge? Was mich betrifft, so weiß ich nur, daß sie Mrs. Hayes hieß. Du warst Freda Hayes, deshalb war meine Oma Mrs. Hayes. Spar Dir Deine Sticheleien darüber, daß ich Deinen Namen vergessen hätte, Freda, denn Du hast mir niemals auch nur ihren Namen gesagt.
Liebe Gina,
ich habe diesen Brief zwölfmal angefangen, das ist jetzt der dreizehnte Versuch, und ich werde ihn auf jeden Fall abschicken. Sie hieß Annabel, war eine große Frau mit stolzer, aufrechter Haltung. Von ihrem Auftreten her hätte man meinen können, ganz Dunglass gehöre ihr. Was auch in gewisser Weise zutraf, denn ihre Familie besaß das große Haus. Mein Vater hatte eingeheiratet, wie man so sagt. Warum sie mich auf ein Internat schickten, fort von diesem wunderbaren Haus, war mir immer unbegreiflich. Peggy, mein Kindermädchen, erzählte mir oft im Flüsterton von Streitigkeiten, bei denen Schmuckgegenstände zu Bruch gegangen seien, aber ich konnte ihr nicht glauben, daß mein Dad ein ganz anderer Mensch sein sollte, wenn er getrunken hatte. Jeder bewunderte meine Mutter, weil sie ganz allein mit allem fertig wurde. Selbst als mein Vater fortging, verbat sie es sich, von den Leuten bemitleidet zu werden. Sie verhärtete sich, Gina, sie wurde kalt und gefühllos. Zu mir sagte sie immer, auf das Mitgefühl und die Anteilnahme der Leute könnten wir verzichten, alles, was wir wollten, sei ihre Bewunderung. Vielleicht hat das ein bißchen auf mich abgefärbt, vielleicht lege ich zu großen Wert darauf, was andere von mir denken, anstatt einfach ich selbst zu sein. Sie hatte nur eine Tochter, so wie ich. Wir haben wahrscheinlich mehr miteinander gemein, als mir je bewußt geworden ist. Mehr kann ich nicht schreiben. Ich liebe Dich. Wenn Du doch hier wärst. Oder ich bei Dir. Nein, ich möchte gar nicht dort sein, ich kann niemals nach Dunglass zurück. Aber ich möchte, daß Du hinfährst, daß Du dort Frieden und ein Stück Deiner eigenen Geschichte findest.
Liebe Freda,
danke für Deinen Brief. Ich denke, die Emotionen sind letzthin ein bißchen hochgekocht, deshalb versuche ich diesmal, ganz sachlich zu bleiben. Vergiß nicht, daß ich ja auch italienisches Blut in mir habe. Das ist eine ziemlich brisante Mischung, und womöglich geht mein Temperament noch mit mir durch. Es wird allmählich Frühling, und ich war oft in Wicklow, dort ist es so wundervoll … ich bin auch weiter nach Süden gefahren, nach Wexford … das Flußufer ist wie eine Filmkulisse … und nach Waterford. Der Illegale ist inzwischen aus Boston zurückgekehrt, er heißt Shay. Über Boston erzählt er eine Menge lustiger Sachen, aber ich glaube, er war dort nicht glücklich. Sein Traum, sagt er, wäre eine kleine Kate in Wicklow, wo er Lieder schreiben kann. Das ist kein schlechter Traum. Ich selbst habe eigentlich gar keine Träume.
Ich mache gerade einen Volkshochschulkurs über irische Geschichte, und darin wimmelt es nur so von Träumen. Für den Fall, daß Du traurig bist oder Dich einsam fühlst, gebe ich Dir die Telefonnummer. Aber ruf nicht an, nur um zu plaudern, am Telefon geht das nicht so.
Shay sagt, wenn er und seine Mutter miteinander telefonieren, knallen sie am Ende beide den Hörer hin und fühlen sich miserabel. Das wollen wir doch vermeiden, Freda, jetzt, da wir ganz gut miteinander auskommen. Ja, und natürlich habe ich Dich lieb.
Gina,
damals war alles so anders, das kannst Du Dir nicht vorstellen. Ich erinnere mich noch an das Jahr, als ich Deinen Vater kennenlernte – schon gut, ich meinte: das Jahr, in dem ich Gianni kennenlernte, meinen späteren Ehemann. Bist Du damit zufrieden? Es schien, als würde man in jenem Jahr nichts anderes tun, als Berühmtheiten zu Grabe tragen. Brendan Behan starb, Sean O’Casey starb. Und Roger Casement … nein, ich weiß, er starb nicht in jenem Jahr, aber sein Leichnam wurde nach Irland überführt, und da begegnete ich Gianni. An diesem kalten, regnerischen Tag saßen wir in einem Café, und ich versuchte ihm das alles zu erklären. Er war ein Amerikaner italienischer Abstammung und versuchte mir das mit dem Vietnamkrieg zu erläutern. Das war 1964. Ich erzählte ihm von den irischen Truppen, die zur Friedenssicherung nach Zypern geschickt wurden, und zeigte ihm, wo die neue amerikanische Botschaft gebaut wurde. Im selben Jahr gingen die Beatles auf Amerika-Tournee … es kommt mir vor, als wäre das hundert Jahre her.
Als Gianni wissen wollte, woher ich stamme, nahm ich ihn nach Hause mit, nach Dunglass. Und Mutter lachte ihn aus, als er erzählte, wie arm seine Eltern gewesen waren, als sie von Italien nach Amerika auswanderten.
Ich wollte nicht mit ihm schlafen, Gina. Damals war ich dreiundzwanzig, so wie Du heute, aber in jener Zeit sah man die Dinge anders. Nicht nur ich … alle Leute, das mußt Du mir glauben. Aber ich haßte Mutter dafür, daß sie ihn so von oben herab behandelte. Und ich verachtete sie, als sie sagte, sie habe mich nicht mit viel Mühe großgezogen, damit ich mich dem Sohn eines Zimmermädchens und eines Hoteldieners an den Hals werfe. Zuvor hatte Gianni voller Stolz erzählt, wie seine Eltern, Deine Großeltern, diese Stellen bekommen hatten. Und das sagte Mutter in Peggys Gegenwart, nur um sie spüren zu lassen, wie wenig sie von Peggys Berufsstand hielt.
Ich war froh, Gina, wirklich froh, als ich schwanger wurde, obwohl mich die Vorstellung, mein ganzes Leben mit Gianni zu verbringen, erschreckte. Mir schien, unsere Beziehung könne nicht von Dauer sein, wir wüßten zu wenig voneinander, und wenn wir uns besser kennen, würden wir es bereuen. Tatsächlich haben wir es jedoch nie bereut, denn wir hatten Dich.
So schwierig und stur ich auch sein mag, wirst Du doch zugeben müssen, daß ich von Deinem Vater niemals schlecht gesprochen habe. Er dachte, er könne in Dunglass wohnen und einheiraten, wie mein Vater es getan hat. Doch meine Mutter ließ ihm keine Ruhe, und mir auch nicht, weil ich mich weigerte, mir auch nur eine Minute lang ihre Schimpftiraden anzuhören.
Ich ließ mein Zimmer zurück, wie es war, mitsamt meinen Büchern, Briefen und persönlichen Dingen. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Bis heute nicht. Ich schloß jene Tür hinter mir, ohne sie je wieder zu öffnen.
Als Gianni mich verließ, war ich keineswegs so traurig, wie die Leute glaubten, denn es war für mich schon lange absehbar gewesen. Ich hatte mein Zuhause in Amerika, meine Tochter, meine Arbeit im Buchladen, meine Freunde. Und ich könnte ja wieder heiraten.
Das tue ich natürlich nicht, aber ich sage mir fröhlich die Worte vor, die ich so oft von Peggy gehört habe: Vielleicht scheint am Ende doch die Sonne, kleine Freda. Wenn ich an Peggy denke, wird mir das Herz schwer. Ich habe ihr nicht geschrieben, weil ich das große Haus als Adresse hätte angeben müssen; das wäre für meine Mutter zu verletzend gewesen.
Ihr Name war Peggy O’Brien, Gina, und sie wohnte in einer Kate am See. Nach Mutters Tod habe ich versucht, ihr zu schreiben, aber mir fehlten einfach die Worte. Du konntest immer gut mit Worten umgehen, Gina.
Herzliche Grüße,
Hier eine Postkarte aus dem Dorf Dunglass. Ich habe sie in einem Geschäft in Dublin gekauft. Hat es sich sehr verändert, Mutter? Morgen fahre ich hin. Dann schreibe ich Dir und berichte Dir alles ganz genau. Du fehlst mir.
Die zeitliche Verzögerung ist einfach zu groß. Ich wollte Dich anrufen, aber Shays Mutter sagte mir, daß ihr noch nicht zurück seid. Du hast mir gar nicht gesagt, daß Du mit Shay hinfährst. Beinahe ein Vierteljahrhundert ist es her, daß ich mit Gianni dort war. Kann es sein, daß sich die Geschichte wiederholt? Dunglass hat sich nicht sonderlich verändert. Erst jetzt wird mir wieder bewußt, wie klein es war. Ich bin gespannt, was Du mir alles schreiben wirst.
Liebste Freda,
Dein Brief klang kühl, ohne Anrede, kein »liebe Gina«, keine Grüße. Hast Du Angst, daß ich in die Fußstapfen meiner Mutter und meiner Großmutter trete, daß ich voreilig den Falschen heirate und sitzengelassen werde, so wie Du und Annabel? Neulich bin ich zu ihrem Grab gegangen und habe einen großen Strauß Frühlingsblumen niedergelegt. Die Landschaft ist herrlich. Auf dem See schwimmen kleine Entchen, Teichhühner und zwei riesige Schwäne. Von all dem hast Du nie etwas erwähnt. Auch nicht, daß Du ein Pony hattest und Dir bei einem Sturz den Arm gebrochen hast. Und Du hast mir nie von Peggys großem, weichen Busen erzählt, an dem ich mich ausgeweint habe, so wie Du einst. Als Deine Sachen versteigert wurden, hat Peggy vieles davon gekauft. Sie sagte, sie wollte nicht, daß Deine Bücher und Deine Schätze wildfremden Leuten in die Hände fielen. »Schätze«, ja, so hat sie es genannt, Freda, und sie verwahrt sie immer noch in einem Zimmer. Und wartet darauf, daß Du zurückkommst und sie Dir holst. Annabel hat ihr nichts hinterlassen, sie hat alles der Wohlfahrt vermacht. Also hat Peggy die Sachen von ihrem Lohn gekauft, weil sie wußte, daß Du eines Tages zurückkehren und sie holen würdest.
Ich habe ihr gesagt, im Juni würde es wahrscheinlich soweit sein. Wenn spät abends noch die Sonne über dem See scheint und die Rosen vor ihrer Kate blühen. Nur ein paar Schritte weiter steht das Häuschen, auf das Shay und ich ein Auge geworfen haben, und wir sind voller Zuversicht.
Schick mir eine Postkarte ohne Umschlag an Shays Adresse, damit seine Mutter erfährt, wie sehr wir uns lieben. Siehst Du, letztlich bin ich nicht anders als Du. Ich möchte, daß die Leute nur Gutes von mir denken. In vielerlei Hinsicht bin ich froh, daß Du mir nichts von den dunklen Wolken der Vergangenheit gesagt hast, so habe ich hier einen Regenbogen des Glücks gefunden. Aber Du solltest auch selbst nicht mehr davor weglaufen. Es gibt keine Geister in Dunglass. Nur Hecken und Blumen und Deine guten Freunde Peggy, Shay und
Der Falsche Koffer
Annie war beim Einchecken früh dran. Sie hatte für die Fahrt zum Flughafen reichlich Zeit eingeplant, um jede Hektik zu vermeiden. Als sie ihre Bordkarte entgegennahm und den schicken neuen Koffer mit dem kleinen Gepäckaufkleber, der London Heathrow als Zielflughafen angab, davonrollen sah, seufzte sie erleichtert auf; jetzt ging alles seinen Lauf, nichts konnte sie mehr aufhalten. Diesmal würde sie sich ausnahmsweise den Luxus leisten können, in aller Ruhe den Duty-free-Shop zu durchstöbern und vielleicht das eine oder andere Parfüm auszuprobieren. Ja, sie könnte sich auch mal die Fotoapparate und Armbanduhren anschauen – einfach nur so, nicht um etwas zu kaufen.
Alan hatte sich verspätet, er erschien immer erst in letzter Minute am Schalter. Doch er hatte so ein freundliches Lächeln und wirkte so aufrichtig zerknirscht, daß ihm das niemand übelzunehmen schien. Man sagte ihm, er solle sich unverzüglich zum Flugsteig begeben, was er auch tat – mehr oder weniger. Schließlich konnte niemand von ihm erwarten, am Duty-free-Shop vorbeizugehen, ohne eine Flasche Wodka zu kaufen, nicht wahr? Ohne Hast oder Hektik schlüpfte er als letzter ins Flugzeug, aber irgend jemand mußte ja der letzte sein. Mit der Routine eines vielgereisten Mannes verstaute er seinen Aktenkoffer und den Wodka oben in der Gepäckablage und machte es sich in seinem Sitz in der Business Class bequem. Dann schnallte er sich an, so daß der Gurt für die Stewardeß gut sichtbar war, und schlug seine Time auf. Für ihn begann wieder einmal eine Geschäftsreise.
Annie lächelte erleichtert, als sie ihren Koffer auf dem Gepäckausgabeband des Londoner Flughafens erblickte. Sie befürchtete stets, er könnte womöglich nicht angekommen sein, ebenso wie sie immer damit rechnete, daß die Sicherheitsbeamten sie aufhielten und nach dem Grund ihres Aufenthalts in England fragten; oder daß die Zollfahnder ihren Koffer aufschlitzten, weil sie irgendwo verstecktes Heroin vermuteten. Annie war eben ein ängstlicher Mensch, doch sie war sich dessen völlig bewußt und fand, es habe auch seine guten Seiten, weil man nämlich oft angenehme Überraschungen erlebte, wenn diese schlimmen Befürchtungen nicht eintrafen. Tatsächlich gelangte sie mit ihrem Koffer unbehelligt durch den Zoll. Sie folgte den Wegweisern zur U-Bahn und stieg in einen Zug, der ihr wie ein Fahrstuhl im Gebäude der Vereinten Nationen vorkam: Menschen aus aller Herren Länder drängten sich hier, und ihre Koffer hatten die unterschiedlichsten Aufkleber. Glücklich schloß Annie die Augen, während der Zug sie nach London brachte.
Alan schnappte sich lässig seinen Koffer, als dieser gerade an ihm vorbeirollen wollte. Dann half er einer Familie, die mit all ihren gleichzeitig ankommenden Gepäckstücken überfordert war. Mühelos hob er einen Koffer nach dem anderen vom Transportband, und als er einen erwischte, der der Familie nicht gehörte, stellte er ihn prompt wieder zurück. Die Frau dankte ihm seine Hilfsbereitschaft mit einem überaus freundlichen Lächeln. Alan sah gut aus, besser als so mancher der anwesenden Ehemänner. In einem Zeitschriftenladen kaufte er sich den Evening Standard und setzte sich in ein Taxi. Sogleich bat er den Fahrer, ihm für die Fahrt eine Quittung auszustellen, denn manche reagierten ungehalten, wenn man sie erst am Zielort darauf ansprach. Am besten sagte man immer frisch von der Leber weg, was man wollte, und zwar in einem freundlichen Ton. Das war Alans Motto. Sein Erfolgsgeheimnis. Beiläufig wanderte sein Blick über die Autobahnen und die entfernteren Häuser mit den hübschen Gärten, die im Licht der Abendsonne lagen. Es war schön, wieder in London zu sein, wo nicht jeder jeden kannte.
An der Gloucester Road stieg Annie aus der U-Bahn und marschierte flotten, beschwingten Schrittes zu dem Hotel, in dem sie schon oft gewohnt hatte. Der neue Koffer ließ sich gut tragen. Nun, er war auch recht teuer gewesen, aber sei’s drum, dafür würde er ewig halten. Für das gute Stück hatte sie eigens zwei dieser kleinen Kofferinitialen gekauft: »A. G.« Zu Anfang hatte sie deswegen Bedenken – erkannte denn nicht jeder sofort an den unterschiedlichen Initialen, daß sie nicht verheiratet waren? Doch der Mann ihres Herzens hatte nur gelacht, ihr einen Stubs auf die Nase gegeben und erwidert, sie sei schon ein komisches kleines Frauchen, und ihre Ängstlichkeit sei wirklich übertrieben. Das hatte Annie Grant eingesehen und sich mit dem Gedanken getröstet, daß sich heutzutage kaum noch jemand um derlei Dinge scherte. Wirklich kaum jemand.
Das Taxi brachte Alan nach Knightsbridge zu seinem Hotel, wo sich das Personal noch an ihn erinnerte – oder zumindest diesen Eindruck vermittelte. Alan stellte sich vorsichtshalber immer namentlich vor. »Mr. Green, natürlich«, meinte der Portier lächelnd. »Schön, daß Sie wieder bei uns sind.« Während Alan seine Taxiquittung zusammenfaltete und in seine Brieftasche steckte, folgte er dem Mann zur Rezeption. Mit seiner Zimmerreservierung war alles in Ordnung. Er bedachte die Empfangsdame mit einem gefälligen Kompliment, so daß sie sich geschmeichelt übers Haar strich und sich wieder einmal fragte, warum so nette Herren wie Mr. Green nie mit ihr ausgehen wollten, wohingegen sie von Männer der widerlichen Sorte dauernd angemacht wurde. In seinem Zimmer angekommen, nahm sich Alan eine Flasche Tonic aus der Minibar. Als er aber feststellte, daß es nicht kalorienreduziert war, entschied er sich für Mineralwasser. Alan achtete auf solche Details.
In dem kleinen Hotelzimmer, das sie für eine Nacht gebucht hatte, öffnete Annie ihren Koffer. Als erstes wollte sie ihre Kleider herausnehmen, damit sie sich aushängen konnten. Dann würde sie ein Bad nehmen und all die hübschen Lotionen und Badeöle benutzen, damit sie morgen nicht mehr wie frisch gekauft aussahen. Sie sperrte das Schloß auf und klappte den Deckel hoch. Doch da waren weder ihre Kleider noch ihre Schuhe. Auch nicht die beiden neuen Nachthemden und der todschicke Kulturbeutel mit den Guerlain-Artikeln, die sie noch nie ausprobiert hatte. Statt dessen erblickte sie Akten, Mappen, Herrenhemden, Herrenunterwäsche, Socken und weitere Akten. Einige Augenblicke lang schlug ihr Herz so heftig, daß es beinahe wehtat. Sie hatte immer gewußt, daß es eines Tages so kommen würde: Sie hatte den falschen Koffer erwischt. Voller Schrecken betrachtete sie ihn – und fand ihre Initialen. Jemand anderer mit Namen A. G. hatte ihren Koffer genommen. »O Gott«, schluchzte Annie Grant »mein Gott, warum hast du mir das angetan? Warum? Lieber Gott, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich habe doch niemandem etwas zuleide getan.« Heiße Tränen fielen in den Koffer.
Mechanisch öffnete Alan seinen Koffer, um seine Unterlagen auf dem großen Tisch auszubreiten und seine Anzüge aufzuhängen. Marie packte seinen Koffer stets perfekt, das hatte er ihr schon früh beigebracht. Das arme Ding hatte damals geglaubt, man brauche die Sachen nur irgendwie hineinzustopfen. Aber, hatte Alan ihr dann in ganz vernünftigem Ton erklärt, wozu bügelte sie seine Hemden so schön, wenn sie danach nicht ebenso makellos aus dem Koffer kamen, wie sie sie hineingelegt hatte? Doch nun starrte er ungläubig auf die oberste Lage im Koffer. Kleider, Unterwäsche – Damenunterwäsche, sorgsam zusammengelegt. Schuhe in Plastiktüten, ein eleganter Toilettenbeutel mit Kosmetikartikeln darin. Herrgott, er hatte den Koffer verwechselt! Aber das konnte doch nicht sein. Es waren sogar seine Initialen daran: A. G. Dabei hatte er sich neulich noch überlegt, ob er sich nicht bessere besorgen sollte, diese hier wirkten ein bißchen gewöhnlich. Verflixt, warum hatte er nicht rechtzeitig daran gedacht? In seiner anfänglichen Verwirrung fragte er sich, ob sich Marie einen Scherz mit ihm erlaubt hatte. Sie hatte in letzter Zeit ständig so finster vor sich hingebrütet und gesagt, sie wolle ihn auf seinen Geschäftsreisen begleiten. Hatte sie womöglich einen Koffer für sich gepackt? Nein, das war Unsinn; es waren nicht Maries Sachen, sie gehörten irgendeiner Fremden. Mist, schimpfte Alan Green immer wieder vor sich hin. Himmel, ausgerechnet jetzt! Ausgerechnet auf dieser Reise mußte er seinen Koffer verlieren.