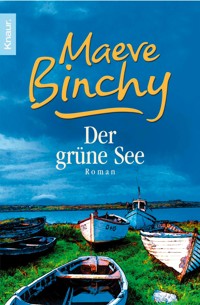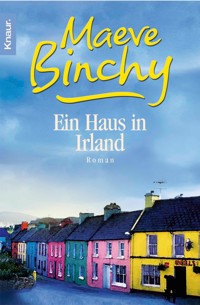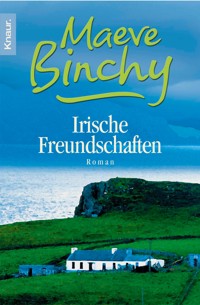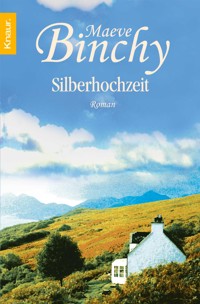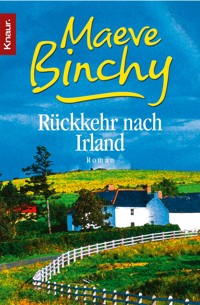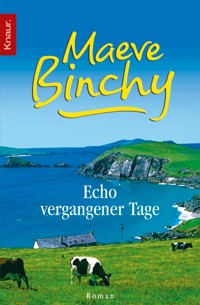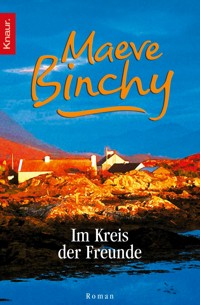6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Blicken Sie hinter die Türen der Chestnut Street in Dublin: Mit ihrem unnachahmlichen Gespür für das Erzählenswerte im Alltäglichen, das Anrührende und Unterhaltsame im Leben ganz gewöhnlicher Menschen gewährt die irische Bestsellerautorin Maeve Binchy ihren Lesern Einblick in die Schicksale der Bewohner der Chestnut Street. Teils romantisch, teils tragisch, teils heiter und immer warmherzig und berührend sind die Momentaufnahmen, die Maeve Binchy in "Zeit der Kastanienblüte" vereint hat. Die Autorin lässt die Leser und Leserinnen teilhaben am bunten Treiben, am Weinen und Lachen, Lieben und Streiten von Menschen, die sich bald nicht mehr wie Figuren in einem Buch anfühlen, sondern wie Freunde. Wie auch schon ihre anderen Romane, darunter "Der grüne See", "Die irische Signora" und "Ein Haus in Irland", die in England, den USA und in Deutschland zu Bestsellern wurden, geht Maeve Binchys Roman "Zeit der Kastanienblüte" zu Herzen und begeistert durch seine besondere Atmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Maeve Binchy
Zeit der Kastanienblüte
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In einem kleinen Vorort von Dublin liegt die fiktive Chestnut Street mit ihren bunten Häuschen. Maeve Binchy lässt 36 höchst unterschiedliche Bewohner der Allee zu Wort kommen und aus ihrem Leben erzählen – z.B. Nessa, deren verrückte Tante sie jeden Sommer für 6 Wochen besucht und ihr Leben damit auf den Kopf stellt, oder Lilian, die sich mit ihrem Freund verlobt, obwohl sie schon lange unglücklich ist. Alle 36 Stimmen haben – neben derselben Adresse – eines gemeinsam: Sie alle möchten ihr Leben verändern.
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Dolly und ihre Mutter
Nur ein Tag im Leben
Fays neuer Onkel
Ein Problem für mich allein
Worauf es ankommt
Joyce und ihr Blind Date
Liberty Green
Eine Kur gegen Schlaflosigkeit
Eine Belohnung für Miss Ranger
Entscheidung in Dublin
Die falsche Bildunterschrift
Star Sullivan
Taxifahrer sind unsichtbar
Eine Karte zum Vatertag
Eine Frage der Würde
Eine gute Investition
Ein Sprung ins kalte Wasser
Lilians goldfarbenes Haar
Blumen von Grace
Die Bauarbeiter
Bucket Maguire
Ein älterer Herr
Philip und die Kunst des Blumensteckens
Umgangsrecht
Bis wir in Clifden sind
Die Rache der Frauen
Die Entdeckung
Die Lotterie der Vögel
Madame Magic
Schweigen ist Gold
Sie meint es nur gut
Plötzliche Erkenntnis
Ein fairer Tausch
Der Blumenkasten
Finns Zukunft
Ein Abend im Jahr
Gordon Snell
Dalkey
Dublin
Knockglen, Castlebay, Mountfern – all die Orte, die Maeve in ihren Romanen und Geschichten erschuf, waren für ihre Leser ebenso real wie jede andere Kleinstadt in Irland. Oft genug musste das irische Fremdenverkehrsamt interessierten Besuchern erklären, dass sie leider keinen Bus oder Zug besteigen könnten, um dorthin zu gelangen.
So ist auch die Chestnut Street ein fiktiver Ort, aber das darin porträtierte Dublin ist äußerst real: eine Stadt im Wandel der Zeit, zum Leben erweckt in den Geschichten, die sich um die Bewohner dieser Straße und ihre Familien ranken.
Maeve schrieb über mehrere Jahrzehnte hinweg an diesen Erzählungen, in denen sich die Stadt und die Menschen der jeweiligen Epoche widerspiegeln. Stets präsent war dabei der Wunsch, sie eines Tages als Sammlung herauszugeben, mit der Chestnut Street im Mittelpunkt. Deshalb freut es mich sehr, dass ihre Verleger sie nun – ganz in ihrem Sinn – zu Maeve Binchys Zeit der Kastanienblüte im vorliegenden Band vereint haben.
Gordon Snell
Dolly und ihre Mutter
Nur weil ihre Mutter schön war, hatte sie es so schwer. Wäre ihre Mutter rund und pummelig oder dürr und voller Falten gewesen, hätte Dolly sich mit dem Erwachsenwerden um einiges leichter getan, aber so gab es nicht die geringste Hoffnung für sie. Mutter war groß und gertenschlank, und ihr Lächeln wirkte auf jeden ansteckend. Und wenn sie lachte, drehten sich sogar Fremde mit einem beifälligen Blick nach ihr um. Zudem war Mutter eloquent und nie um eine Antwort verlegen. Sie besaß das Talent, ihre langen, lilafarbenen Seidenschals so elegant zu drapieren, dass sie beim Gehen schmeichelnd ihre Figur umspielten. Band Dolly sich einen Schal um den Hals, sah sie damit aus, als sei sie bandagiert oder ein Fußballfan. Dick, untersetzt, farblos und uncharmant, wie sie war, fiel es ihr bisweilen nicht schwer, ihre eigene Mutter zu hassen.
Allerdings hielt dieses Gefühl meist nie lang an, und von Hass konnte eigentlich auch nicht die Rede sein. Niemand vermochte Mutter zu hassen – schon gar nicht ihre linkische Tochter, die von ihr stets wie eine Prinzessin behandelt wurde und deren Vorzüge hervorzuheben Mutter nicht müde wurde. Dollys schöne, dunkelgrüne Augen zum Beispiel, in denen man sich Mutters Ansicht nach so leicht verlieren konnte. Doch Dolly hatte ihre Zweifel. Bisher war weit und breit niemand in Aussicht, der lang genug hineingeschaut hätte, um festzustellen, dass ihre Augen tatsächlich grün waren. Ganz zu schweigen davon, hoffnungslos in deren Tiefen zu versinken. Und immer wieder musste Vater herhalten, um Dollys wunderbares Haar zu bewundern. »Sieh doch nur, wie dick und gesund es ist. Shampoo-Hersteller werden unsere Doll noch auf Knien anflehen, Reklame für sie zu machen.« Mit milder Überraschung, aber gehorsam, wandte Vater dann seine Aufmerksamkeit Frau und Tochter zu, mit staunenden Augen, als wäre dem Hobbyornithologen der Anblick eines seltenen Eisvogels vergönnt. O ja, was für ein prachtvolles Gefieder. Nicht eine kahle Stelle, pflegte er zerstreut zu erwidern.
Dolly war weniger begeistert von ihrem mausgrauen Haar. Außer dass es dicht und üppig wuchs, gab es nicht viel Positives darüber zu berichten. Und genau das hob Mutter in ihren überschwenglichen Komplimenten immer wieder hervor.
Alle Mädchen an ihrer Schule liebten Dollys Mutter. Sie war stets freundlich zu ihnen, interessierte sich für ihre Angelegenheiten und vergaß nie ihre Namen. Die Mädchen kamen gern in das Haus in der Chestnut Street, vor allem am Samstagnachmittag. Dollys Mutter stellte ihnen dann ihre ausgemusterten Schminkutensilien zur Verfügung: alte Lippenstiftstummel, fast leere Lidschattendöschen, eingetrocknete Puderreste. Im Haus gab es einen großen Spiegel mit Beleuchtung wie in einer Künstlergarderobe; vor dem konnten die Mädchen ausgiebig üben. Dollys Mutter stellte nur eine Bedingung. Bevor sie nach Hause gingen, mussten alle Spuren der Kriegsbemalung mit Kleenex und Coldcream wieder getilgt sein. Mutter überzeugte sie davon, dass auf diese Weise ihre Haut frisch und gesund bleiben würde, so dass Dollys Freundinnen das Abschminken fast ebenso viel Spaß machte wie das Bemalen ihrer jungen Gesichter.
Hin und wieder fragte Dolly sich, ob ihre Freundinnen tatsächlich ihretwegen oder doch nur wegen ihrer Mutter kamen. In der Schule ignorierten sie sie meistens, und nach dem Unterricht blieb Dolly meist allein zurück, während die anderen Arm in Arm davoneilten. Nie war sie auf dem Pausenhof von einer Gruppe lachender Mädchen umringt, niemand wollte mit ihr nach der Schule zum Bummeln gehen, und im Sportunterricht wurde sie normalerweise stets als Letzte in eine Mannschaft gewählt. Sogar die arme Olive, die richtig schwabbelig war und dicke, runde Brillengläser trug, wurde oft noch vor Dolly auserkoren. Wäre Mutter nicht gewesen, hätte in der Schule wahrscheinlich niemand Notiz von ihr genommen. Eigentlich hätte Dolly dankbar sein müssen, denn im Gegensatz zu allen anderen in ihrer Umgebung hatte sie eine Mutter, die allgemein beliebt und anerkannt war. Normalerweise wusste Dolly das auch sehr zu schätzen, aber am glücklichsten war sie doch, wenn sie mit ihrer Katze spielte.
Für den Wohltätigkeitsbasar ließ sich Mutter immer einen anderen originellen Kuchen einfallen, jedoch nie üppig verzierte Torten, die die anderen Mütter in Verlegenheit gebracht hätten, oder trockene Napfkuchen, für die Dolly sich hätte schämen müssen. Mal war der Kuchen über und über mit Smarties dekoriert, ein andermal mit Kapuzinerkresseblüten, die man bedenkenlos mitessen konnte – zumindest laut Zeitungsartikel, den Mutter beigelegt hatte. Für das Schultheater stellte Mutter stets die tollsten Utensilien zur Verfügung und beschwerte sich nie, wenn sie die Sachen nicht mehr zurückbekam. Einmal hatte Mutter Miss Power sogar um das Strickmuster ihres Pullovers gebeten und das gute Stück tatsächlich nachgestrickt. Aber in einer anderen Farbe, wie sie Miss Power erklärte, damit sie nicht wie Zwillinge aussahen. Die arme Miss Power – im Gegensatz zu Mutter ein unscheinbares Mauerblümchen – hatte vor Freude rosige Wangen bekommen und auf einmal richtig sympathisch gewirkt.
Nun stand Dollys sechzehnter Geburtstag bevor, der groß gefeiert werden sollte. Mutter besprach alles ausgiebig mit ihrer Tochter.
»Sag mir doch mal, wie du dir deine Party vorstellst, und dann will ich noch wissen, wie die anderen aus deiner Klasse feiern werden. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Mutter, die völlig danebenliegt und ihre Tochter ins Kino oder zu McDonald’s schleppt wie ein kleines Mädchen.«
»Du machst doch nie was falsch, Mutter«, erwiderte Dolly dumpf.
»O doch, das kann mir auch passieren, Doll, Schätzchen. Ich bin immerhin gefühlte hundert Jahre älter als du und alle deine Freundinnen zusammen. Meine Ideen stammen quasi noch aus dem letzten Jahrhundert. Deshalb bin ich darauf angewiesen, dass du mir genau sagst, wie du dir das vorstellst.«
»Du bist doch keine hundert Jahre älter als wir.« Dolly räusperte sich. »Du warst dreiundzwanzig bei meiner Geburt, und jetzt bist du noch keine vierzig Jahre alt.«
»Oh, aber bald werde ich es sein.« Mutter seufzte und warf einen kurzen Blick in den Spiegel, aus dem ihr ein makelloses Gesicht entgegensah. »Bald bin ich eine runzlige, bucklige, exzentrische Vierzigjährige.« Sie brach in perlendes Gelächter aus, und Dolly stimmte mit ein. Diese Vorstellung war einfach lächerlich.
»Was hast du eigentlich an deinem sechzehnten Geburtstag gemacht?«, fragte Dolly. Panisch versuchte sie, den Moment so lang wie möglich hinauszuzögern, an dem sie zugeben musste, dass sie keine Ahnung hatte, wie ihre Party aussehen sollte, und dass sie sich im Grunde schrecklich davor fürchtete.
»Ach, Liebes, das ist schon eine Weile her. Ich weiß aber noch, dass es ein Freitag war, weshalb wir dasselbe getan haben wie alle anderen auch. Das heißt, wir haben uns eine Musiksendung im Fernsehen angeschaut, Ready, Steady, Go!. Und dazu gab es Würstchen und eine Geburtstagstorte und Musik von den Beatles auf meinem alten Plattenspieler. Anschließend sind wir in einen Coffeeshop weitergezogen, wo viel gelacht wurde und wir einen Eiskaffee nach dem anderen tranken. Und dann sind wir alle mit dem Bus wieder nach Hause gefahren.«
»Das hört sich lustig an«, sagte Dolly sehnsüchtig.
Mutter seufzte. »Na ja, damals herrschte noch tiefstes Mittelalter. Heutzutage ist man viel fortschrittlicher. Wahrscheinlich wollt ihr alle in die Disko gehen, oder? Was haben denn die anderen Mädchen an ihrem Geburtstag gemacht? Jenny ist doch bereits sechzehn, Mary auch. Und Judy?« Fragend sah Mutter sie an, während sie die Namen von Dollys Freundinnen auflistete. Ihr lag sehr viel daran, dass sich ihre Tochter auf keinen Fall ausgeschlossen fühlte.
»Ich glaube, Jenny ist einfach ins Kino gegangen«, erwiderte Dolly.
»Sie hatte natürlich auch Nick.« Dollys Mutter nickte weise. Die Mädchen vertrauten ihr alle ihre kleinen Geheimnisse an.
»Und was Judy gemacht hat, weiß ich nicht«, antwortete Dolly verstockt.
»Wieso denn nicht, Schätzchen? Sie ist doch deine Freundin.«
»Ich weiß es trotzdem nicht.«
Mutters Gesichtsausdruck wurde merklich weicher. Offensichtlich hatte sie sich für eine andere Vorgehensweise entschieden, als sie beschwichtigend fortfuhr: »Ist schon gut, vielleicht hat sie ja gar nichts unternommen. Oder nur im Kreis ihrer Familie gefeiert. Und das kannst du selbstverständlich nicht wissen.«
Dolly fühlte sich schlechter denn je zuvor. Wie stand sie nun da vor ihrer Mutter? Ihre Freunde feierten ohne sie, und sie selbst war so bedauernswert, dass sie eine peinliche Party geben musste, um sich deren Freundschaft zu erkaufen. Dolly wurde das Herz schwer. Sie wusste, dass man ihren hängenden Mundwinkeln ansah, wie sie sich fühlte. Wie gern hätte sie ihrer klugen, liebenswerten Mutter ein Lächeln geschenkt, die nur versuchte, ihr zu helfen. Sie hatte ihr immer geholfen, sie aufgebaut, sie bewundert. Doch Dolly wollte einfach kein Lächeln gelingen.
Mutter hätte jeden Grund gehabt, sich bei dieser zutiefst undankbaren Tochter als Märtyrerin zu fühlen. Aber dafür war sie nicht der Typ. Ganz im Gegensatz zu Judys Mutter, die permanent jammerte und sich über ihre Töchter beklagte, die ihr das Leben schwermachten. Und was Jenny betraf – deren Mutter konnte einem manchmal vorkommen wie eine Geheimagentin, so argwöhnisch überwachte sie auch noch die harmlosesten Aktivitäten ihrer Tochter. Marys Mutter wiederum war völlig anders: Gramgebeugt unter der Last der Verantwortung für eine Tochter im Teenageralter, vermittelte sie das Bild einer mittelalterlichen Madonna. Dollys Mutter war die Einzige, die stets optimistisch, heiter und voller Pläne war. Leider hatte sie kein Glück gehabt, als das Schicksal ihr statt einer lebhaften Tochter nur die langweilige, farblose Dolly zugeteilt hatte.
»Warum bist du eigentlich immer so nett zu mir, Mutter?« Dolly war es ernst mit ihrer Frage, und sie wollte endlich wissen, woran sie war.
Mutter schien nicht sonderlich überrascht zu sein über die Frage. Munter lächelnd ging sie darauf ein wie auf jede andere Bitte, die an sie herangetragen wurde.
»Ich bin doch nicht nett zu dir, Schätzchen. Ich benehme mich ganz normal … aber dein sechzehnter Geburtstag soll ein besonderer Tag werden, an den du immer gern zurückdenkst … so wie meiner, auch wenn das vielleicht kindisch ist. Wenigstens habe ich ihn nicht vergessen, und auch nicht die albernen Kleider und Frisuren von damals. Und deshalb wünsche ich mir auch für dich, dass du einen glücklichen Tag erlebst.«
Dolly überlegte einen Moment, ehe sie antwortete. Alle ihre Freundinnen, die sie zu Hause besucht hatten, waren voll des Lobes für ihre Mutter gewesen und hatten gemeint, dass sie eigentlich eher wie eine große Schwester sei. Ihr könne man alles anvertrauen, und sie habe für alles Verständnis.
»Mutter, bitte, lass es sein. Im Ernst. Ich werde nie einen glücklichen Tag erleben. So etwas wird es für mich nicht geben. Glaub es mir. Es ist nicht mehr so, wie es für dich war oder auch jetzt noch für dich ist. Ich will ja nicht jammern. Ich sage nur, wie es ist.«
Dolly zwang sich, nicht in Tränen auszubrechen, und betete darum, dass sich so etwas wie Verständnis auf dem Gesicht ihrer Mutter abzeichnen möge. Stattdessen sah Mutter sie nur tief besorgt an, aber mit echtem Verständnis für ihre Lage hatte das nichts zu tun. So war es immer gewesen.
Und so ließ sie den tröstenden Wortschwall ihrer Mutter über sich ergehen: Jede Fünfzehnjährige fühle sich deprimiert, in diesem Alter sei man schließlich weder Fisch noch Fleisch. Aber bald schon würde die Welt anders aussehen, Dollys wunderschöne grüne Augen würden wieder leuchten, und sie würde sich mit wehendem Haar und voller Vorfreude in die Abenteuer stürzen, die das Leben für sie bereithielt.
Dolly starrte auf die schlanken, weißen Finger mit den perfekt geformten, langen, rosigen Fingernägeln, als ihre Mutter nach ihrer Hand griff. Sie betrachtete die Ringe, die zwar nicht übermäßig groß waren, Mutters kleine Hand aber noch zarter erscheinen ließen. Und diese Hand streichelte nun Dollys klobige Hand mit den abgekauten Fingernägeln, den Tintenflecken und den Kratzern, die sie sich an den Brombeerbüschen geholt hatte.
Das ist alles nur meine Schuld, dachte Dolly. Mutter konnte nichts dafür, sie war diejenige, die schlecht war. Böse und verrottet bis ins Innerste ihres Herzens, dem es an Feinfühligkeit und Sanftmut mangelte.
Auch ihr Vater wirkte oft melancholisch, dachte Dolly, wenn er sich mit hängenden Schultern müde den Hügel vom Bahnhof heraufschleppte, die Aktenmappe in der Hand. Doch seine Miene heiterte sich auf, sobald er Mutter erblickte, die an einem der oberen Fenster stand und ihm zuwinkte, ehe sie leichtfüßig die Treppe hinunterlief, um ihm um den Hals zu fallen, kaum dass er an der Tür war. Und sie beschränkte sich nicht auf einen flüchtigen Kuss, sondern umarmte ihn fest samt Aktenmappe, Regenmantel, Abendzeitung und allem Übrigen. War sie in der Küche, ließ sie alles stehen und liegen und rannte zu ihm. Dolly fiel auf, wie froh und sogar überrascht er jedes Mal wieder zu sein schien. Er selbst war nicht der Typ für spontane Gesten, reagierte darauf aber wie eine Blume auf die Sonne, wenn sie hinter den Wolken hervortrat. Schlagartig verschwand der bekümmerte Ausdruck von seinem Gesicht. Mutter belästigte ihren Mann nie mit Problemen, wenn er nach einem harten Arbeitstag nach Hause kam. Sogar wenn es einen Wasserrohrbruch gegeben haben sollte, erfuhr er erst später davon. Viel später.
Und deswegen kam Mutter nun auch voller Vorfreude auf ihren sechzehnten Geburtstag zu sprechen, den sie nicht als Problem ansah, sondern dem sie – im Gegenteil – mit glänzenden Augen entgegenfieberte. Der sechzehnte Geburtstag eines Mädchens war so etwas wie ein Symbol, eine Landmarke, ein Meilenstein und musste schließlich gebührend gefeiert werden. Was also sollten sie tun, um ihrer Tochter einen unvergesslichen Tag zu bereiten?
Dolly sah einen zärtlichen Ausdruck über Vaters Gesicht huschen. Er kannte sicher auch andere Familien, in denen die Mütter so ganz anders waren als ihre, Familien, in denen es ein Anlass zum Streit war, wenn die Kinder eine Party feiern wollten. Vater konnte sich glücklich schätzen, mit einer Ausnahmefrau wie Mutter verheiratet zu sein, der einzigen Frau auf der Welt, die sich darauf freute, eine Party für ihre Teenagertochter zu geben.
»Na, da wird uns schon was einfallen.« Er strahlte über das ganze Gesicht. »Du bist ein echtes Glückskind, Dolly. Das steht schon mal fest. Selbstverständlich bekommst du eine Party zum sechzehnten Geburtstag.«
»Aber es macht mir nichts aus, wenn wir uns das nicht leisten können«, wagte Dolly zaghaft einzuwenden.
»Selbstverständlich können wir uns das leisten. Wozu arbeiten deine Mutter und ich schließlich, wenn wir uns nicht hin und wieder etwas Besonderes gönnen würden?«
Sofort fühlte Dolly sich schuldig. Sollte sie das glauben? Nahm Vater tatsächlich die tägliche Fahrerei in das gesichtslose Büro auf sich, aus dem er abends todmüde nach Hause zurückkehrte, nur um sich teure Geburtstagsfeiern leisten zu können? Bestimmt nicht. Und wie war das mit Mutter, die vormittags in einem großen Blumengeschäft aushalf? Tat sie das alles nur, um hin und wieder finanziell ordentlich über die Stränge schlagen zu können? Dolly hatte immer gedacht, dass Mutter gern in dem Laden mit all den schönen Pflanzen arbeitete. Mittags konnte sie sich mit ihren Freundinnen zum Essen treffen, und aus dem Geschäft brachte sie oft welke Blumensträuße mit nach Hause, die sie wieder aufpäppelte. Und ihr Vater ging zur Arbeit, weil Männer das nun mal so taten. Sie fuhren in ein Büro und bearbeiteten Akten. Dolly stellte fest, dass sie wohl nicht viel über die Dinge des Lebens wusste. Kein Wunder, dass sie sich nicht so gut mit anderen Menschen unterhalten konnte. Nicht so wie Mutter. Erst neulich hatte sie mit angehört, wie Mutter mit dem Postboten ein Gespräch über das Thema Glück geführt hatte. Unvorstellbar, sich mit einem Mann, der die Post brachte, über ein so ernstes Thema zu unterhalten. Und dabei hatte er sehr interessiert gewirkt und bedauert, dass es leider nicht genügend Leute gebe, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzten.
»Mutter, ich weiß nie, was anderen gefallen könnte. Dir fällt doch immer etwas ein. Was würden meine Freundinnen wohl gern unternehmen?«
Dolly fühlte sich klein und unbedeutend wie nie im Leben. Wer, um alles in der Welt, würde jemandem wie ihr auch nur ein Quentchen Sympathie entgegenbringen? Ein verwöhntes Gör sei sie, würden sie bestimmt sagen. Ein Mädchen, das alles hatte und es nicht zu schätzen wusste. Mutter hatte natürlich keine Ahnung von diesen Gedanken. Sie war viel zu sehr damit beschäftigt, anderen behilflich zu sein.
»Wie wäre es mit einem Mittagessen?«, sagte sie plötzlich. »Lunch am Samstag im The Grand Hotel – ihr könntet euch alle so richtig schick machen und dürftet euch sogar eine Flasche Wein teilen. Unter der Bedingung natürlich, dass ihr viel Mineralwasser dazu trinkt. Ihr könntet à la carte bestellen … alles, was ihr wollt. Was hältst du davon?«
Das klang nicht schlecht und war mal etwas anderes.
»Würdest du denn mitkommen?«, fragte Dolly.
»Unsinn, Schätzchen. Deine Freundinnen wollen bestimmt keine alte Tante wie mich …«
»Bitte, Mutter«, flehte Dolly.
Nun gut. Mutter ließ sich überreden. Da sie am Samstag ohnehin arbeitete, könne sie sich ja einen albernen Hut aufsetzen und ihnen auf ein Glas Wein Gesellschaft leisten.
Dollys Freundinnen waren begeistert. Eine großartige Idee. Die Gelegenheit, ihr neues Kleid auszuführen, dachte Jenny; und wenn Nick erfuhr, dass sie im The Grand Hotel lunchten, würde er sterben vor Neid. Mary wollte sich gleich die Speisekarte anschauen, damit sie wussten, was sie bestellen sollten. Und vielleicht wären sogar Leute vom Film da oder Modelagenturen, die Nachwuchs suchten, wie Judy hoffte. Dass Dollys Mutter so etwas eingefallen war – genial.
»Wieso hat deine Mutter eigentlich immer so tolle Ideen?«, fragte Jenny.
Dolly verzog das Gesicht. »Ich wohl nicht, wie?«
»Ach, du nervst, Dolly«, erwiderten Jenny und Mary wie aus einem Mund, spazierten aus dem Klassenzimmer und ließen Dolly, die sich wünschte, die Welt würde auf der Stelle als riesiger Feuerball untergehen, allein zurück. Dolly sah mit einem Mal keinen Sinn mehr darin, an einem Ort zu leben, an dem die eigenen Eltern es für eine gute Idee hielten, viel Geld auszugeben, um andere zum Lunch einzuladen, die in einem sowieso nur eine Nervensäge sahen. Als Miss Power ins Zimmer kam, saß Dolly immer noch da.
»Jetzt häng hier nicht so herum, Dolly. Geh raus an die frische Luft, damit du etwas Farbe ins Gesicht bekommst. Außerdem ist dein Uniformrock schon wieder am Saum eingerissen, und dein Pullover hat Flecken. Deine Mutter ist in deinem Alter bestimmt nicht so herumgelaufen.«
»Nein, sie war sicher damals schon perfekt«, erwiderte Dolly gekränkt. Missbilligend schüttelte die Lehrerin den Kopf.
Samstagvormittag, am Tag des Geburtstagsessens, hatte Mutter einen Termin beim Friseur und bei der Maniküre für ihre Tochter ausgemacht. Dolly hatte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, ebenso wenig wie sie den Gutschein für ein neues Kleid hatte haben wollen.
»Das wird sicher ein Reinfall, Mutter«, hatte sie gesagt. »Das läuft doch immer so bei mir.«
Bildete sie sich das nur ein, oder wurde Mutters Blick tatsächlich ein wenig hart?
»Soll ich dir vielleicht etwas zum Anziehen aussuchen?«, hatte Mutter daraufhin vorgeschlagen. Und natürlich hatte sie ein entzückendes grünes Kostüm gefunden, genau in der Farbe ihrer Augen, wie sie Dolly versicherte. Es passte wie angegossen, und den anderen Mädchen gefiel es auch. Selbstverständlich waren sie höflich zu ihr, ihnen blieb gar nichts anderes übrig. Schließlich wurden sie von ihr in The Grand Hotel eingeladen. Dennoch schienen sie von ihrem Anblick beeindruckt zu sein. Ihr Haar schimmerte seidig, ihre Fingernägel waren zwar kurz, aber sauber und rosig; die Kosmetikerin hatte sie sogar lackiert, so dass Dolly nicht mehr darauf herumkauen konnte.
Die Reservierung war auf Dollys Namen erfolgt, und der Manager des Hotels hieß sie auf das Herzlichste willkommen.
»Und Ihre entzückende Mutter wird später auch noch vorbeischauen«, hatte er gesagt.
»Ja, sie muss noch arbeiten, wissen Sie«, erklärte Dolly.
»Arbeiten?«
»Ja, im Blumenladen«, fügte Dolly hinzu.
Aus irgendeinem Grund fand er das offensichtlich äußerst amüsant. Er lächelte, beschwichtigte sie aber sofort. »Aber natürlich. Sie ist eine wunderbare Frau, Ihre Mutter. Sie stattet uns hin und wieder einen Besuch ab. Leider viel zu selten.«
Als Mutter den Raum betrat, zog sie die bewundernden Blicke aller auf sich. Ihre Vorfreude schien groß, als sie sich zu der Gruppe junger Mädchen setzte. Man hätte meinen können, es handele sich dabei um eine höchst illustre Runde und nicht um vier verlegen dreinblickende Teenager, die fast ein wenig verloren wirkten inmitten all der Pracht. Aber als die vier Mädchen mit einem Schluck Wein auf die frischgebackene Sechzehnjährige in ihrer Mitte anstoßen durften, sah die Welt mit einem Mal freundlicher aus, und sie fühlten sich beinahe erwachsen, so, als würden sie tatsächlich hierhergehören. Dolly entging nicht, dass sie sich viel selbstbewusster im Speisesaal umsahen. Diesen Tag würde bestimmt keine von ihnen je vergessen. Ich auch nicht? fragte sich Dolly. Würde sie sich noch nach Jahren daran erinnern, so wie ihre Mutter, die weder die Schallplatten, die sie gespielt hatten, noch das Fernsehprogramm oder den Coffeeshop vergessen hatte?
Mutter hatte vorgeschlagen, nach dem Essen gemeinsam in der Stadt zu bummeln und bei den Straßenmusikern und Tänzern am Brunnen vorbeizuschauen. Später habe sie allerdings noch ein paar Dinge zu erledigen und müsse sie deshalb eine Weile allein lassen. Als die Mädchen ihre Mäntel aus der Garderobe holten, kamen sie sich sehr erwachsen und selbständig vor.
Dolly hatte keinen Mantel dabeigehabt; das grüne Kostüm war warm genug. Also wartete sie draußen, während die anderen kichernd in der Tür zur Damentoilette verschwanden. Erst schlenderte Dolly ein wenig hin und her, ehe sie, ohne sich etwas dabei zu denken, die Tür zum Büro des Managers aufstieß. Sie hatte ihre Mutter, die die Rechnung persönlich begleichen wollte, hineingehen sehen. Dolly wollte sich bei ihr bedanken und ihr sagen, wie sehr sie diesen Tag genossen hatte und wie gut ihr das neue grüne Kostüm gefiel. Mutter und der Manager standen dicht beieinander. Er hatte einen Arm um Mutter gelegt und streichelte mit der anderen Hand ihr Gesicht. Sie lächelte ihn zärtlich an.
Dolly konnte gerade noch zurückweichen, schaffte es aber nicht mehr, die Tür zu schließen. Erschrocken ließ sie sich auf eines der Brokatsofas in der Lobby fallen.
Mutter und der Manager hatten die offene Tür anscheinend sofort bemerkt und wirkten ziemlich aufgelöst, als sie herauskamen. Die Angst, ertappt worden zu sein, vergrößerte sich noch, als sie das Mädchen vor dem Büro auf dem Sofa sitzen sahen. Im gleichen Augenblick jedoch traf die schnatternde Schar der Schulfreundinnen ein. Man verabschiedete sich, bedankte sich, und dann kehrten die Mädchen mit Dolly und ihrer Mutter in die Stadt zurück. Jenny, Judy und Mary liefen voraus. Dolly ging nachdenklich neben ihrer Mutter her.
»Wieso heiße ich eigentlich Dolly?«, fragte sie unvermittelt.
»Na, um deinem Vater einen Gefallen zu tun, haben wir dich nach seiner Mutter Dorothy benannt, aber mir hat der Name nie gefallen. Und da du ein richtiges kleines Püppchen warst, habe ich dich Dolly genannt.« Wie jede Frage hatte Mutter auch diese arglos und ohne lang zu überlegen beantwortet.
»Versuchst du eigentlich immer, es allen Menschen recht zu machen?«
Erstaunt sah ihre Mutter sie an.
»Ja, ich denke schon. Das habe ich bereits früh gelernt. Es anderen Menschen recht zu machen, erleichtert das Leben kolossal.«
»Aber es ist nicht immer ehrlich gemeint oder entspricht dem, was du gerade fühlst, oder?«
»Nein, nicht immer.«
Dolly hätte sicher auch eine Antwort bekommen, wenn sie Mutter nach dem Hotelmanager gefragt hätte. Das wusste sie. Doch was sollte sie fragen? Liebst du ihn? Wirst du Vater verlassen und mit ihm zusammenleben? Nehmen dich auch noch andere Männer in den Arm? War es das, was du noch zu erledigen hattest?
Und plötzlich war es Dolly klar, dass sie nichts sagen würde. Nicht eine Frage würde sie stellen. Aber sie würde darüber nachdenken, ob der Weg, den Mutter eingeschlagen hatte, tatsächlich der richtige war. Das Leben war kurz, warum also nicht lächeln und es anderen Leuten recht machen … Menschen wie ihrer Schwiegermutter Dorothy, die mittlerweile längst verstorben war; Menschen wie Miss Power, deren Pullover man nachstrickte; Menschen wie Vater, den man liebevoll am Tor begrüßte. Oder auch ihrer mürrischen, uncharmanten Tochter, für die man eine Geburtstagsparty organisierte.
Als Dolly sich bei Mutter unterhakte, um mit ihr zum Brunnen zu gehen, traf es sie wie ein Schock, und sie wusste, dass sie ihren sechzehnten Geburtstag niemals vergessen würde. Für sie würde dies stets der Tag sein, an dem sie erwachsen geworden war. Der Tag, an dem ihr klargeworden war, dass es viele Möglichkeiten gab, das Leben zu bewältigen, und dass Mutters Weg nur einer von vielen war. Nicht unbedingt der richtige und auch nicht der falsche. Nur einer von vielen, für die man sich entscheiden konnte.
Nur ein Tag im Leben
Schulmädchen in einer kleinen Stadt – es war kaum zu glauben, aber irgendetwas hatten sie immer zu schnattern. Die Nonnen dachten, sie würden Pläne für ein christliches Leben schmieden und sich Gedanken über ihren zukünftigen Beruf machen. Ihre Eltern glaubten, sie würden besprechen, wie sie gute Noten in ihrem Abschlusszeugnis erzielten. Die Schuljungen bei den Ordensbrüdern hingegen vermuteten, dass Maura, Deirdre und Mary nur Kleider und Schallplatten im Kopf hatten, denn das war das Einzige, das sie von den Gesprächen mitbekamen, wenn ihnen ein Grüppchen junger Mädchen in Schuluniformen über den Weg lief.
In Wirklichkeit kannten die Mädchen nur ein Thema: die Liebe und die Ehe in allen ihren Aspekten. Vor dem Heiraten kam natürlich die Liebe. Und davon gab es jede Menge Spielarten – die erste Liebe, die falsche Liebe, Liebe, die nur geheuchelt war, Liebe, die nicht erwidert wurde, Liebe, die sich gegen Widrigkeiten aller Arten zu behaupten hatte. Doch die Krönung einer jeden Liebe war die Hochzeit.
Wie es danach mit der Liebe weiterging, darüber machten sich Maura und ihre Freundinnen Mary und Deirdre nicht viele Gedanken. Denn nach der Hochzeit fügte sich bestimmt alles problemlos zusammen, und man lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage. Wozu sonst der ganze Aufwand?
Es gab sicher nichts Besseres, als verheiratet zu sein. Man lebte in seiner eigenen Wohnung und konnte kommen und gehen, wie es einem beliebte. Und vor allem aufstehen, wann man Lust dazu hatte. Und essen, was einem schmeckte. Wenn man wollte, konnte man sich sieben Abende die Woche von Pommes frites ernähren. Und zur Hochzeit bekam man Geschenke und viele neue Sachen. Keine Kissen, in denen bereits Generationen vor einem geschlafen hatten, oder Töpfe mit geschwärzten Böden. Alles war glänzend und neu, wenn man heiratete. Also gab es nichts Schöneres, als sich zu verlieben und zu heiraten.
Die Mädchen waren vierzehn Jahre alt, als sie so dachten. In dem Alter glaubte man noch, dass es im Lebens nichts Erstrebenswerteres gab, als nach Hause kommen zu können, wann man wollte.
Als sie fünfzehn waren, gesellte sich ein weiterer Aspekt hinzu. Maura, Mary und Deirdre machten sich erste Gedanken über passende Kandidaten auf dem Markt. Die Auswahl schien nicht sehr groß, wie man allgemein der Ansicht war, um nicht zu sagen sehr begrenzt, wenn man einmal genauer hinsah. Nur wenige junge Frauen hatten sich je mit einem so unergiebigen Forschungsgebiet zufriedengeben müssen wie sie, fanden die Mädchen.
Im Film standen den Heldinnen stets Hunderte von Kandidaten zur Auswahl, oder wenigstens kam ab und an ein gutaussehender Fremder in die Stadt geritten. Im echten Leben gab es bloß die Jungs bei den Ordensbrüdern, die immer nur blöd grinsten und dumm daherredeten. In so einen konnte man sich doch nicht verlieben.
Mit sechzehn Jahren wurde die Angelegenheit bereits spezifischer. Die körperliche Seite der Liebe, ihr Vollzug und wie man sich dabei zu benehmen hatte – all das trat in den Vordergrund.
Vor allem die Hochzeitsnacht, denn in der würde man ja zum ersten Mal miteinander schlafen. Unmöglich, an das eine ohne an das andere zu denken. Sogar in den fortschrittlichen fünfziger Jahren würde nur eine Idiotin das tun, was die arme Orla O’Connor getan hatte. Ihr Freund hatte sich nach England abgesetzt, sobald er erfahren hatte, dass sie in anderen Umständen war. Und dann war da Katy, die überstürzt den ältesten Murphy-Sohn hatte heiraten müssen. Tagaus, tagein saß sie nun zu Hause und versorgte ihr dickes Baby, das nach sechs Monaten Ehe verfrüht zur Welt gekommen war, während ihr Mann jeden Abend um die Häuser zog. Aber er hatte sie immerhin geheiratet. Er hatte seine Pflicht getan, das, was von ihm erwartet wurde. Man konnte kaum etwas gegen ihn sagen. Vor allem sie nicht. Katy würde niemals ein schlechtes Wort gegen einen Ehemann vorbringen, der trotz der Schande zu ihr gehalten hatte. Da spielte es keine Rolle, dass er Stammgast in jedem Pub von einem Ende der Grafschaft bis zum nächsten war.
Die leichtsinnige Orla und die dankbare Katy – nicht unbedingt Vorbilder für Maura und ihre Freundinnen Mary und Deirdre –, die als lebende Beispiele in ihrer eigenen Heimatstadt viel stärker abschreckend wirkten, als es eine Predigt von der Kanzel, von den Lehrern oder Eltern je vermocht hätte.
Für Maura, Mary und Deirdre war die Sache klar. Sollte man sich vor der Hochzeitsnacht auf Sex, Liebe oder sonstige Abenteuer einlassen, gab es nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren.
Immer wieder versuchten die Mädchen, sich vorzustellen, was am ersten Abend ihrer Flitterwochen im Hotel wohl passieren würde. Wahrscheinlich würden sie erst einmal auspacken, vielleicht ein wenig herumknutschen und sich gegenseitig beteuern, was für ein schöner Tag das gewesen sei.
»Vergiss nicht, du bist verheiratet – du musst jetzt nichts mehr tun, weder Koffer auspacken noch sonst etwas«, wandte Mary aufgeregt ein.
»Ja, schon, aber du musst doch deine Sachen aus den Koffern holen. Sonst läufst du die ganzen Flitterwochen in zerknitterten Kleidern herum«, meinte Deirdre, die stets am besten von allen angezogen war.
»Und du willst doch nicht, dass er denkt, er hätte eine Schlampe geheiratet«, sagte Maura, deren Mutter immer sehr viel Wert auf das legte, was die Leute sagten oder dachten.
So einigten sich die Freundinnen darauf, dass man zuerst auspacken, sich für das Abendessen umziehen und gemeinsam in den Speisesaal des Hotels gehen würde, wo der Kellner sie als »Mister« und »Mistress« anredete. Diese Vorstellung entlockte den Mädchen leises Kichern. Aber schließlich konnte das Abendessen nicht ewig dauern, und man musste irgendwann wieder nach oben gehen. Und hier schieden sich die Geister.
Wie verhielt man sich denn nun als Frau? Ging man zuerst ins Bad, kam zurück und wartete, dass der Mann es einem gleichtat? Und wenn ja, legte man sich dann sofort ins Bett, oder sah das so aus, als könnte man es kaum mehr erwarten? Oder wirkte es gar wie Unwissenheit, wenn man sich in einen Sessel setzte?
Oder ließ man ihm den Vortritt im Bad, um noch frischer und anziehender zu wirken, wenn es dann so weit war? Das war natürlich eine Möglichkeit. Aber die Mädchen hatten von einem Paar gehört, da war der Mann eingeschlafen, als die junge Frau endlich aus dem Bad herausgekommen war. Nun wusste sie nicht, ob sie ihn wecken sollte, und es war alles ganz schrecklich gewesen.
Aufgeregt spekulierten die Freundinnen, ob es weh tun würde beim ersten Mal, ob es schnell vorüber wäre oder ob es lang dauerte. Und dann? Bedankte er sich danach bei ihr oder sie sich bei ihm? Oder beteuerte man sich gegenseitig, wie wunderbar es gewesen sei?
Selbstverständlich malten sie sich auch lang und breit das eigentliche Hochzeitsfest aus.
So wünschte Mary sich als Auftakt ihres Festmenüs nicht die obligatorische Suppe, sondern Melone mit Ingwer. Das kostete zwar einen Shilling mehr als die Pilzsuppe, war aber um einiges exotischer.
Deirdre wollte es bei der Suppe belassen, da ihre Familie sich bestimmt an dem Ingwer verschlucken und sie vor allen Leuten blamieren würde. Ebenso plante sie, einen Akkordeonspieler zu engagieren, um die Gesprächspausen während des Essens zu füllen und um danach den Lärm zu überdecken, wenn die Gäste lebhafter wurden.
Maura stellte sich vor, dass bei ihrer Hochzeit alle Frauen große Hüte mit breiten Krempen, Blumen und Bändern tragen sollten. Keine kleinen, eng am Kopf anliegenden Velourskappen in Dunkelblau oder Weinrot, wie sie die älteren Frauen in der Kirche immer aufhatten, sondern große, bunte Wagenräder aus Stroh oder Seide, wie man sie aus den Filmen oder aus der Wochenschau über die Hochzeit von Hoheiten oder Leuten aus dem Showbusiness kannte. Und in der Kirche sollte jeder Mann eine Blume im Knopfloch tragen.
Mary fand das albern. Welcher Mensch in ihrem Ort würde sich schon so herausputzen? Die anderen würden Maura sicher für überspannt halten, gab Deirdre zu bedenken, und ihr vorwerfen, sie wolle die Gewohnheiten der britischen Aristokratie nachäffen. Wie es sich bei einer traditionellen Hochzeit gehörte, würden die Männer ihren guten Anzug anziehen und nach dem zweiten Drink den obersten Kragenknopf öffnen und die Krawatte ablegen. So hatte man es immer gehalten. Die Frauen würden sich ein neues Kostüm zulegen, vielleicht sogar einen passenden kleinen Hut, wahrscheinlich aber eher nicht. Nur in der Kirche würden sie eine Spitzenmantilla tragen. Maura solle sich dieses Gartenparty-Zeug besser gleich aus dem Kopf schlagen.
Maura war verunsichert, reagierte aber schnell und tat ihrerseits Marys Melonen-Ingwer-Vorspeise und Deirdres Akkordeonisten als überspannte Kleinmädchenträume ab.
Und dann feierten die Freundinnen siebzehnten Geburtstag und zerstreuten sich danach in alle Winde. Deirdre ging nach Wales, um dort Krankenschwester zu lernen, Mary machte eine Ausbildung zur Buchhalterin, um eines Tages im elterlichen Geschäft zu arbeiten, und Maura zog es nach Dublin, wo sie eine Sekretärinnenschule besuchte und Abendkurse am UCD belegte.
Einmal im Jahr, im Sommer, trafen sie sich und lachten und schwatzten wie in alten Zeiten. Deirdre wusste aus Wales zu berichten, dass dort alle sexbesessen seien und keiner bis zur Hochzeitsnacht warte. Oft bekäme man dort folgenden Dialog zu hören:
»Blodwyn heiratet.«
»So, tatsächlich – ich wusste nicht einmal, dass sie schwanger ist.«
Mit offenem Mund lauschten Maura und Mary diesen Erzählungen aus einer freizügigen, zwanglosen Gesellschaft.
Doch Mary hatte auch eine Überraschung auf Lager. Man könne über Paudie Ryan sagen, was man wolle, meinte sie beiläufig, aber mittlerweile habe er keinen einzigen Pickel mehr im Gesicht und sähe sogar recht passabel aus.
»Paudie Ryan?«, erwiderten Maura und Deirdre unisono ungläubig. Doch Mary blieb hart. Die beiden Freundinnen seien immerhin nach Wales und Dublin gegangen und hätten sie allein zurückgelassen. Mit irgendjemandem habe sie nun einmal ins Kino gehen müssen. Da Paudie Ryans Vater der zweite Lebensmittelladen im Ort gehörte, ahnten Maura und Deirdre, dass man wohl mit einer Fusion der beiden Betriebe rechnen könne.
Eine baldige Hochzeit zwischen Mary und Paudie sei tatsächlich nicht auszuschließen, meinte Mauras Mutter. Und dabei nickte sie so begeistert, dass es Maura ganz übel wurde.
»Das ist das Beste für die beiden. Sehr vernünftig. Das Beste, was sie für ihre Familien und für ihre Zukunft machen können.«
Und zur Untermauerung ihrer Zustimmung nickte sie heftig. Inzwischen schäumte Maura vor Wut.
»Um Himmels willen, Mam, du sprichst über die beiden, als wären sie zwei gekrönte Häupter aus europäischen Herrscherfamilien.«
»Bei den beiden handelt es sich immerhin um die Erben zweier Lebensmittelgeschäfte, die noch in privater Hand sind. Über ihnen und uns allen schwebt das Damoklesschwert der Supermarktketten. Warum sollten wir uns darüber nicht freuen?«
Maura wusste, dass es wenig Sinn hatte, mit ihrer Mutter über Liebe zu sprechen. Weit kam sie damit nicht bei ihr. Normalerweise endete ein solches Gespräch immer in einem erbosten Schnauben. »Ach was, Liebe. Liebe hat schon so manche ruiniert, lass dir das gesagt sein.«
Doch mehr gab ihre Mutter nie preis. Und Maura wollte es im Grunde auch nicht wissen. Es hätte nur bestätigt, was sie ohnehin zu wissen glaubte. Ihre Eltern, die einander nur noch zu tolerieren schienen, lebten in einem Status strikter Neutralität nebeneinanderher, den sie als ihr Schicksal ansahen.
Und mit Liebe hatte es in der Tat wenig zu tun, was die beiden zusammengebracht hatte – zum einen die Mitgift ihrer Mutter und zum anderen das Geschick ihres Vaters, eine Eisenwarenhandlung zu führen. Liebe war also kein Thema, über das Maura mit ihrer Familie diskutieren konnte. Ihre älteste Schwester war Nonne, ihr großer Bruder, wortkarg wie der Vater, schuftete Tag und Nacht im Laden, und ihr kleiner Bruder, Brendan, zwölf Jahre jünger als sie und ein unerwünschter Nachkömmling, war der reinste Alptraum.
Je mehr Jahre vergingen, desto mehr hatte Maura das Gefühl, dass sich ihr eigentliches Leben in Dublin abspielte. Hier verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt durch das Abtippen von Abschlussarbeiten und Buchmanuskripten. Hier kam sie mit Menschen zusammen, mit denen sie zu Hause nie etwas zu tun gehabt hätte: Professoren, Schriftsteller, alles Leute, die tagsüber oft Stunden im Pub verbrachten und die ganze Nacht über aufblieben, um zu schreiben oder zu studieren. Menschen, die nicht zur Messe gingen und wenig von der Ehe hielten.
Maura traf Menschen, die beim Fernsehen und beim Radio arbeiteten; sie lernte Schauspieler und Politiker kennen, alles vollkommen normale Leute, wie sie bald feststellte, mit denen man sich ungezwungen unterhalten konnte. Viele von ihnen führten ein ziemlich flottes Leben und verbrachten oft ganze Nächte nicht zu Hause.
Maura ließ sich nicht anmerken, wie schockiert sie anfangs von alledem war, doch man schrieb schließlich die sechziger Jahre, und sogar Irland veränderte sich.
Sie verliebte sich in einen verheirateten Mann, gab ihm nach einer Weile aber zu verstehen, dass sie ihn nicht mehr sehen könne, weil ihr Verhältnis seine Ehe zerstören würde, und das sei nicht fair. Voller Zorn bemerkte Maura, dass er nach ihr noch jede Menge andere Geliebte hatte und trotzdem weiterhin mit seiner Ehefrau bei Premieren und Cocktailpartys auftauchte. Liebe und Ehe – was für ein Quatsch! Aber vielleicht waren sie und ihre Freundinnen Mary und Deirdre einfach nur naiv gewesen, damals in den schrecklich altmodischen fünfziger Jahren.
Nachdem Paudie Ryan endlos lang um Mary geworben hatte, heirateten die beiden schließlich, und Deirdre kam aus Wales nach Hause – in einem sehr kurzen Minirock, der die anderen zu jeder Menge böser Kommentare inspirierte. Paudie Ryans Schwester Kitty, die sie nie hatten leiden können, fungierte als Brautjungfer. Ihr pinkfarbenes Kleid war von so erlesener Hässlichkeit, dass sogar Maura schmunzeln musste. Mary schien zumindest einigen ihrer Prinzipien treu geblieben zu sein und hatte die Brautjungfer, die sie ebenso wenig leiden konnte, so scheußlich wie möglich ausstaffiert. Und statt Suppe gab es Melonenscheiben.
Mauras hoffnungslosen Bruder Brendan und seinen fürchterlichen Freunden fiel während der Feier nichts Besseres ein, als Maura und Deirdre mit ihrer Fragerei zu nerven, ob sie jetzt wohl Torschlusspanik bekämen und Angst hätten, als alte Jungfern zu enden. Das allein war schon schlimm genug, aber einige der älteren Herrschaften waren genauso unverschämt und taktlos.
»Jetzt wird es aber Zeit, dass ihr zwei endlich unter die Haube kommt«, stichelten sie und wiegten bedenklich die Köpfe. Maura hätte am liebsten geschrien.
»Die sind einfach zu wählerisch, die zwei«, warf Mauras Vater missmutig ein.
»An deiner Stelle würde ich trotzdem nicht mehr allzu lang warten«, gab Mauras Mutter zu bedenken.
»Gibt es hier in der Gegend zufälligerweise eine Eisenwarenhandlung, in die ich deiner Meinung nach einheiraten sollte?«, fuhr Maura sie an, bereute es jedoch sofort.
»Du könntest es schlechter erwischen«, erwiderte ihre Mutter und presste die Lippen zusammen.
Später nahm Deirdre Maura beiseite und flüsterte ihr zu, dass sie vielleicht selbst bald heiraten werde. Aber Davids Familie seien Protestanten und hätten es nicht so mit katholischen Priestern. Die Situation sei sehr problematisch. Anschließend gingen sie in Marys Zimmer, da Mary sich für die Reise umziehen wollte.
»Tja, jetzt werde ich als Erste erfahren, wie es ist«, sagte Mary aufgeregt.
»Wie was ist?«
»Na, die erste Nacht«, antwortete sie, als wäre es das Offensichtlichste von der Welt. Man schrieb immerhin Mitte der befreiten sechziger Jahre, der Swinging Sixties.
Entgeistert schaute Deirdre ihre Freundin an. Sieben Jahre in einem freizügigen Land wie Wales hatten ihre Spuren hinterlassen.
Auch Maura warf Mary nach sieben Jahren im eher unkonventionellen Dublin und nach drei alles andere als platonischen Romanzen einen ungläubigen Blick zu. Aber beide fingen sich rasch wieder, schließlich war das Marys Hochzeitstag. Und dann lachten sie verlegen, wie sie es zehn Jahre zuvor getan hatten.
»Stellt euch das mal vor«, meinten sie kichernd. »Na, so was!«
An diesem Wochenende empfand Maura ihre Familie als besonders anstrengend. Sogar ihre Schwester, die Nonne, war aus dem Kloster nach Hause gekommen. Neugierig wollte sie jedes Detail der Trauungszeremonie wissen, vor allem, ob Mary ihrem Mann Gehorsam versprochen habe. Sie hatte – wie schön. Heutzutage würden die Leute nämlich jede Menge Unsinn reden, klagte Mauras Schwester. Und diese Weiber von der Frauenbewegung würden mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Nur weil Nonnen ein Gehorsamsgelübde ablegten, hieß das noch lang nicht, dass die Hälfte der Menschen, nämlich die weibliche Hälfte, dies ebenfalls tun müsse, herrschte Maura sie an. Ihre Schwester schaute gekränkt und unglücklich drein, und Maura fiel auf, dass ihre Mutter heftig gestikulierend auf sie deutete. So als wollte sie ausdrücken: »Lass doch die arme Maura in Ruhe – sie ist offenbar eifersüchtig, weil Mary heiratet.«
Und das verärgerte sie noch mehr.
»Was sollen die Grimassen, Mam?«, fragte sie.
Ihre Mutter verdrehte die Augen. »Ach, bist du wieder mal empfindlich«, erwiderte sie.
Auch Mauras älterer Bruder nervte sie gehörig. »Deine Freundin, diese Deirdre, die ist ja ein ganz schönes Flittchen – die hätte mal lieber in Wales bleiben sollen.« Am liebsten hätte Maura ihm eine Ohrfeige verpasst. Ihr Bruder war zu dieser Erkenntnis gelangt, nachdem er unter Deirdres Minirock gegriffen und sie ihm daraufhin ihr Knie in den Unterleib gerammt hatte.
Und ihr kleiner Bruder Brendan, der leider völlig unmusikalisch war, nichtsdestotrotz aber immer jede Menge Lieder auf seiner Gitarre klimperte, hatte heute nur einen Song auf Lager. Und dessen Refrain lautete: »Du wirst noch als alte Jungfer auf dem Dachboden versauern.«
Ihr Vater sagte wie gewöhnlich nichts und hatte zu keinem Thema eine Meinung. Und das Gesicht ihrer Mutter drückte Missbilligung pur aus.
Maura konnte es also kaum erwarten, wieder nach Dublin zurückzukommen. Nach Dublin und zu Larry. Larry, die Liebe ihres Lebens. Zu Hause hatte Maura keinem Menschen von Larry erzählt, und ihm lieferte sie eine sorgfältig überarbeitete Version der Geschehnisse an diesen Tagen. Maura legte es nicht bewusst darauf an, gewisse Dinge zu verschweigen oder zwei getrennte Leben zu führen, indem sie sich verschiedenen Menschen gegenüber unterschiedlich verhielt. Es fehlten ihr einfach nur die Worte, um sich zu erklären. Sie wusste nicht, wie sie es ihrer Mutter erklären sollte.
»Hör mal, du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Ich bin nicht im mindesten eifersüchtig darauf, dass die arme Mary diesen Paudie Ryan heiratet. Ich habe selbst einen wunderbaren Mann in Dublin, und wir leben praktisch zusammen. Er ist oft in meiner Wohnung und ich in seiner, und es läuft großartig.«
Ebenso gut hätte sie zu ihrer Mutter sagen können, dass Marsmenschen mit einer Bestellung für ihr Raumschiff in ihrer Eisenwarenhandlung gelandet seien.
Und obwohl sie mit Larry wirklich über alles reden konnte und sie in jeder Beziehung gut miteinander auskamen, war es ihr nicht möglich, ihm zu erklären, wie ihre Mutter tickte, die automatisch an ihren Fingern bis neun zählte, wenn sie von einer Schwangerschaft erfuhr. Nur um sicherzugehen, dass auch alles seine Ordnung hatte. Wie hätte sie Larry von ihrer ältesten Schwester, der Nonne, erzählen können, die ständig ein ernstes Gesicht machte und die Frauenbewegung für Teufelszeug hielt. Oder von ihrem wortkargen Vater oder ihrem unzufriedenen Bruder, der permanent Frauen dumm anmachte, im Grunde genommen aber Angst vor ihnen hatte. Oder von Brendan, diesem verzogenen Rotzbengel, der sich alles leisten konnte.
Die beiden Welten würden also auch weiterhin in getrennten Umlaufbahnen existieren müssen. Seufzend stieg Maura in ihren Wagen, um nach Dublin zurückzufahren.
»Könnte es sein, dass manche Männer es nicht gern sehen, wenn du Auto fährst?«, bemerkte ihre Mutter spitz. Offensichtlich hatte sie sich Gedanken über dieses Thema gemacht.
»Könnte sein«, erwiderte Maura und schaffte es nur, sich zu beherrschen, indem sie ein idiotisches Grinsen auf ihr Gesicht zauberte.
»Könnte doch sein, dass es das ist, was die Männer an dir abschreckt«, spekulierte ihre Mutter weiter.
»Vielleicht sollte ich den Wagen auf den Platz fahren und symbolisch verbrennen. Würde das reichen, was meinst du?«, fragte Maura, noch immer dümmlich grinsend.
»Oh, warte du nur, bis du so endest wie deine Tante Anna. Dann wird dir das Lachen schon noch vergehen«, sagte ihre Mutter.
Auf der Fahrt zurück nach Dublin überlegte Maura, ob ihre Mutter den wortkargen Mann unten in der Eisenwarenhandlung wohl jemals geliebt hatte. Wie waren sie nur zu vier Kindern gekommen, wovon sie eines noch dazu in einem Alter in die Welt gesetzt hatten, von dem man vermuten könnte, dass sich dieses Thema längst für sie erledigt hatte. Es war ihr ein Rätsel.
An dem Abend wurde sie von Larry bekocht. »Du siehst wunderschön aus, wenn du müde bist«, sagte er und erzählte, dass eine Kurzgeschichte von ihm angenommen worden war. Mit dem Geld könnten sie nach Griechenland in Urlaub fahren, meinte er und schwärmte ihr von dem grandiosen Licht auf den griechischen Inseln vor. Er beteuerte, wie sehr er sie liebe, und an dem Abend schlief sie in seinen Armen ein.
Wenige Monate später erhielt Maura einen Brief von Deirdre, in dem sie ihre Hochzeit mit David ankündigte. Davids Vater und sein Bruder waren begeisterte Angler, und wenn sie eine Woche an einem Flussufer mit der Hochzeit kombinieren könnten, würden sie sogar eine katholische Trauung in Kauf nehmen und mit dem Wagen nach Irland kommen. Ob sie mit Maura als Brautjungfer rechnen könne? Sie dürfe auch anziehen, was sie wolle, großes Ehrenwort, und müsse sich nicht bis zur Unkenntlichkeit verkleiden, wie Mary es Paudies unglücklicher Schwester zugemutet hatte. Ob Maura ihr diesen Gefallen wohl erweisen könne? Es handele sich schließlich nur um einen Tag in ihrem Leben, danach könnten sie alle wieder tun und lassen, was sie wollten. Für immer.
Maura las den Brief mehrmals. Etwas daran rührte sie. Deirdre, die unbeschwerte Deirdre, die in Wales das Leben einer emanzipierten Frau führte, wollte ihren Eltern diesen einen Tag schenken, den sie sich so sehnlich gewünscht hatten und der sie als respektable Mitglieder ihrer Gemeinde ausweisen würde. Sie würden ihre Tochter in der Kirche vor den Traualtar führen. Alle würden kommen und hören, wie sie ihr Ehegelübde ablegte. Deirdre war das nicht wichtig, sie lebte bereits seit zwei Jahren mit David zusammen und würde danach niemals mehr in ihren Heimatort zurückkehren. Sie hatte es also nicht nötig, vor den Nachbarn gut dazustehen.
Und dieser David aus Wales ließ sich offenbar auf dieses Spiel ein, auch wenn er es als Angelurlaub kaschierte. Maura verspürte einen Stich. Wie illoyal von ihr, den bloßen Gedanken, irgendwann einmal selbst zu heiraten, überhaupt zuzulassen. Seit Beginn ihrer Beziehung waren sie und Larry sich stets einig gewesen – Liebe braucht keine Fesseln, Feste und Rituale sind nichts anderes als Zäune und Riegel. Damit gibt man der Gesellschaft nur zu verstehen: Na gut, jetzt haben wir unser Versprechen vor euch allen gegeben, und jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Ihr alle seid Zeugen unserer Abmachung, und wenn einer von uns den anderen jemals betrügen sollte, wird uns der Bannstrahl der öffentlichen Verachtung mit voller Wucht treffen.
Sich in aller Öffentlichkeit mit abgedroschenen Worten und inhaltsleeren Ritualen ewige Treue zu schwören, das machte die Liebe zu einer Farce und reduzierte sie auf eine Reihe hohler Phrasen.
Larry und Maura liebten sich – selbstverständlich waren sie einander treu, in guten wie in schlechten Tagen, in Krankheit und Gesundheit. Larry hatte den Urlaub in Griechenland mit Hilfe seines neuen Vertrags finanziert; Maura hatte ihn nicht verlassen, als er mit Lungenentzündung im Bett lag. Sie hatte sich neben ihn gesetzt, bis es ihm wieder besserging.
Liebe war kein Vertrag mit Seiten voller Kleingedrucktem, ausgehandelt von zwei argwöhnischen Parteien, die Angst hatten, übers Ohr gehauen zu werden.
Und die Ehe reduzierte die Liebe zur Nebensächlichkeit.
Larry und Maura kannten zu viele Ehepaare, die zwar nach den Buchstaben des Gesetzes lebten, ihren Bund aber nicht mit Leben füllten. Ihre Liebe würde nicht darauf reduziert werden.
Dies war unzweifelhaft alles richtig. Und deshalb fühlte Maura sich schuldig, als sie darüber nachdachte, ob sie und Larry ihrer Mutter und ihrem Vater nicht auch einen Tag – nur einen – ihres Leben schenken könnten. Ihre Schwester könnte aus dem Kloster nach Hause kommen, und Brendan könnte sie womöglich bestechen, damit er sich nicht vollständig danebenbenahm. Doch das widersprach allem, an das sie glaubte, und so verbannte sie diesen Gedanken rasch wieder aus ihrem Kopf.
Sie fühle sich geehrt, schrieb sie Deirdre, ihre Brautjungfer zu werden, und sie würde ein zitronengelbes Leinenkostüm und einen großen, weißen Hut mit zitronengelben Bändern tragen. Deirdre antwortete umgehend. Sie freue sich sehr, schrieb sie zurück und fügte hinzu, dass Maura schon immer ein Faible für Hüte gehabt habe, schon damals als Mädchen in der Klosterschule.
»Ich sterbe vor Neugier, dich in dieser Aufmachung zu sehen«, meinte Larry.
»Ich werde extra für dich eine Modenschau veranstalten, bevor ich fahre«, erwiderte sie.
»Ja, komme ich denn nicht mit?«, fragte er.
Seine Frage verunsicherte Maura. Das Leben hatte es nie besser mit ihnen beiden gemeint als im Augenblick; sie lebten jetzt fast permanent in Larrys Wohnung in der Chestnut Street. Seit ihrer Rückkehr aus Griechenland war es ihnen unsinnig erschienen, weiterhin getrennt zu wohnen. Und so hatte Maura nach und nach ihre Kleidung, ihre Fotos und Bücher zu Larry geschafft, und nun überlegten sie, ob sie ihr Apartment nicht untervermieten sollten.
Larry hatte inzwischen großen Erfolg als Schriftsteller, und Mauras Geschäft lief so gut, dass sie ein Büro eröffnet und eine Schreibkraft eingestellt hatte.
Ihr Leben verlief in ruhigen Bahnen. Warum musste Larry alles wieder aufwühlen mit seiner Bitte, sie in ihre Heimatstadt zu begleiten?
»Es würde dir dort nicht gefallen. Zu viel katholischer Pomp und Tradition«, meinte sie.
»Na und? Du machst das deiner Freundin zuliebe mit, und deswegen begleite ich dich und halte Händchen.«
Er verstand es wirklich nicht. Ihm war nicht bewusst, welche Erwartungen und Spekulationen sein Besuch auslösen würde. Man würde ihm Löcher in den Bauch fragen und alles über ihn wissen wollen – wo er wohne, welche Absichten er habe –, und er würde noch lang nach ihrer Abreise für Gesprächsstoff sorgen.
Für ihn lag die Sache natürlich anders. Larrys Mutter war schon länger tot, seine Geschwister hatten sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Sein Vater, ein distanzierter, stiller Mann, schien sich zwar jedes Mal zu freuen, wenn er seinen Sohn sah, aber richtig Anteil an dessen Leben nahm er nie. Woher sollte Larry also wissen, welch wahnsinniges Interesse sein Besuch auslösen würde?
Aber er ließ nicht locker.
»Ich liebe dich, ich will dich da vorn in der Kirche stehen sehen, von Kopf bis Fuß in Zitronengelb und mit einem Wagenradhut auf dem Kopf, während alle dich bewundern. Nimm mich mit. Ich werde so stolz auf dich sein.«
Frustriert sah sie ihn an. Wenn er sie schon in Zitronengelb bewundern würde, warum dann nicht in Elfenbeinweiß in einer echten Hauptrolle? Es war doch nur ein Tag, ein Tag in ihrem Leben.
Von da an würde ihre Mutter sie in Ruhe lassen, die Nonnen im Kloster ihrer Schwester würden keine Novene mehr für sie beten, Mary, nun glücklich verheiratete Mrs. Paudie Ryan, würde aufhören, ihr einen gewissen Handlungsreisenden schmackhaft zu machen, der sich im Ort ansiedeln wollte, ihr Bruder Brendan würde sie nicht wie bisher und mit abscheulicher Regelmäßigkeit mit der Frage nerven können, ob ihre Familie überhaupt normal sei – eine Schwester im Kloster, ein Bruder ein eingefleischter Junggeselle, die andere Schwester eine alte Jungfer.
Dann würde eben sie ihn fragen. Maura würde Larry einen Heiratsantrag machen. Hier und jetzt. Mehr als nein konnte er schließlich nicht sagen.
»Was hältst du davon, wenn wir zwei auch heiraten?«, hörte sie sich durch das dröhnende Rauschen in ihren Ohren sagen.
Larry schien nicht schockiert zu sein, er wirkte auch nicht schuldbewusst oder vorwurfsvoll. Nicht einmal Bedauern sprach aus seinem Blick, nur mildes Interesse.
»Wozu?«, fragte er.
»Um Ordnung in die Dinge zu bringen«, erwiderte sie lahm.
»Ist das dein Ernst?«
»Ja, halb und halb.«
»Aber ich liebe dich, du liebst mich – wozu brauchen wir das dann?«
Sein Gesicht, das sie so sehr liebte, strahlte Offenheit und Ehrlichkeit aus. Er war ernsthaft verwirrt.
»Wenn du mich wirklich liebst«, begann Maura langsam, »und ich glaube, dass du das tust, dann würde es dir nichts ausmachen, einen Tag lang dieses Zeremoniell samt Eheversprechen und all dem übrigen Unfug über dich ergehen zu lassen, nur damit andere zufrieden sind.«
»Aber es ist unser Leben!«, rief Larry. »Wir waren uns doch immer einig, dass die Welt nur deshalb so ist, wie sie ist, weil die Leute einfach gedankenlos irgendwelche Dinge tun, nur damit andere zufrieden sind. Und so verliert auch die Liebe ihre Bedeutung.«
»Ich weiß.« Mauras Seufzer kam aus tiefstem Herzen.
Sie wusste es, und sie war seiner Meinung. Deirdres Entscheidung, ihre Hochzeit Davids Familie gegenüber als Angelurlaub zu deklarieren, nur damit ihre eigene Familie nachts ruhig schlafen konnte, hatte nichts mit echter Liebe zu tun.
Als Maura am nächsten Wochenende nach Hause fuhr, kündigte sie ihrer Mutter an, dass sie zu Deirdres Hochzeit jemanden mitbringen würde.
»Sie wird bei dir im Zimmer schlafen müssen«, entgegnete Mauras Mutter. »Deine Schwester kommt an dem Wochenende auch. Du weißt doch, sie liebt Hochzeiten.«
»Sie ist ein er – ein Freund«, erklärte Maura und registrierte mit Vergnügen, wie das Gesicht ihrer Mutter die Farbe wechselte.
»Guter Gott, warum hast du das nicht eher gesagt, dann hätten wir im Hotel reserviert. Jetzt ist alles ausgebucht von diesen Walisern, die zur Hochzeit kommen.«
»Kann sich die heilige Nonne nicht ein Zimmer mit mir teilen? Es ist doch nur für eine Nacht.«
»Maura, ich bitte dich, mach dich nicht lustig über deine Schwester und ihr Gelübde. Du weißt doch, dass sie sich kein Zimmer teilen kann, seit sie ihre Zelle im Kloster bezogen hat.«
»Himmel, Mam, es ist nicht so wichtig, wo er schläft. Er kann doch auch im Esszimmer auf der Couch übernachten!«
»Kann er nicht. Aber sag mir, ist er zufälligerweise dein Verlobter?«
»Mam, ich bin fünfundzwanzig, fast sechsundzwanzig Jahre alt. Man verlobt sich heutzutage nicht mehr.«
»Und wie nennst du ihn dann, wenn ich fragen darf?«
»Einen Freund, wie ich schon sagte. Larry ist ein Freund.«
»Es geht auf keinen Fall, dass man deinen Namen in Verbindung mit einem Mann bringt und den Leuten dann nur sagt, dass er ein Freund ist. Und außerdem weiß ich wirklich nicht, was dein Vater dazu sagen wird.«
»Ich weiß nicht, was du mit ›meinen Namen in Verbindung bringen‹ ausdrücken willst, und außerdem wissen wir beide ganz genau, was mein Vater dazu sagen wird – nämlich nichts, wie in den vergangenen dreißig Jahren auch.«
»Du bist wirklich ein schwieriger Fall, Maura. Kein Wunder, dass sich bisher noch kein Mann auf dich eingelassen hat.«
»Mam, Larry kommt zu Deirdres Hochzeit. Punkt. Es ist mir völlig egal, ob er bei dir, bei mir oder bei der Nonne nächtigt, aber könnten wir vielleicht mit diesem Theater aufhören?«
Zu Hause sagte Larry zu ihr: »Ich freue mich schon auf die Hochzeit. Und wenn ich irgendwie helfen kann, sag es mir.«
Es war zu spät, ihm zu erklären, dass es am hilfreichsten wäre, wenn er in Dublin bliebe, und so lächelte Maura nur matt.
»Kümmere dich ein wenig um die Waliser«, antwortete sie. »Das ist vielleicht am besten.«
Maura und Larry fuhren mit dem Auto, und es blieb kaum Zeit, ihn richtig vorzustellen, bevor Maura weiter zu Deirdres Haus aufbrach, um sich umzuziehen. Deirdre war stark geschminkt, und ihr weißes Spitzenkleid umspielte locker ihre Taille, wohl um die freudige Nachricht zu kaschieren, die bereits ein paar Monate alt war.
»Wie ich höre, hast du einen Kollegen mitgebracht«, sagte sie, während sie eine weitere Lage Lidschatten auflegte.
»So was in der Art«, stammelte Maura. Sie wagte nicht, daran zu denken, welche Unterhaltung sich in eben dieser Sekunde zwischen ihrer Mutter und Larry entspinnen mochte. »Du siehst hinreißend aus, Deirdre.«
Aber die Braut hatte keine Zeit für Komplimente.
»Bete lieber, dass Davids Familie bei Laune bleibt«, sagte sie. »Du kennst sie nicht, wenn sie schlecht drauf sind. Die reinste Hölle.«
Wie vor Jahren geplant, hatte Deirdre einen Akkordeonspieler engagiert. Beim Anblick seines hochroten Kopfes beschlichen sie allerdings leise Zweifel, ob er durchhalten würde.
»Mach dir seinetwegen keine Sorgen«, sagte Maura zu ihr. »Der macht schon nicht schlapp.«
Maura hielt es für unnötig, die Braut, die auf dem Weg zur Kirche war, darüber aufzuklären, dass der Akkordeonist bereits Posten auf einem Barhocker im Hotel bezogen hatte und sich in Stimmung brachte. Die ersten Töne, die er seinem Instrument entlockte, waren dementsprechend desaströs, und bald wurde ringsum verlegenes Räuspern laut. Irgendwo zwischen all diesen Menschen saß Larry und erkundigte sich leise bei seinen Sitznachbarn, ob vielleicht jemand eine Gitarre dabeihabe. Und zu ihrem größten Entsetzen musste Maura vom Ehrentisch aus mit ansehen, wie ihr Liebhaber und ihr schrecklicher kleiner Bruder Brendan gemeinsam den Saal verließen. Sie hätte sich kein schlimmeres Szenario vorstellen können. Minuten später beobachtete sie ungläubig, wie Larry anfing, zaghaft in die Saiten zu greifen und mit unsicherer, zittriger Stimme die ersten drei Zeilen von »Men of Harlech« zu intonieren. Wie von Zauberhand füllten sich die Lungen der Waliser mit Luft, und der Speisesaal des Hotels hallte wider von den Stimmen eines Männerchors, der sich die Seele aus dem Leib sang. Die Männer gönnten sich kaum eine Pause für die Suppe und das gebratene Huhn, bevor sie mit »The Ash Grove« und »We’ll Keep a Welcome in the Hillsides« ihre Darbietung fortsetzten. Vor der Torte und den Reden stimmte Larry noch »Bread of Heaven« an. Die Hochzeitsfeier war inzwischen ein rauschender Erfolg, so dass Davids Familie gar nicht mehr daran dachte, in den Angelurlaub zu fahren, sondern am liebsten die ganze Woche weiter singend im Hotel verbracht hätte.
Die Anspannung war zu viel für sie, und Maura, die an Alkohol nicht gewöhnt war, bekam dessen Wirkung nun voll zu spüren. Gnädigerweise blieb ihr auf diese Weise verborgen, dass Larry, die große Liebe ihres Lebens, sich für die Nacht ein Zimmer mit ihrem Bruder Brendan, dem unangenehmsten Menschen in ganz Irland, teilen musste.
Maura verbrachte eine unruhige Nacht und schreckte immer wieder aus dem Schlaf hoch. Beim Aufwachen stellte sie fest, dass sie entsetzlichen Durst hatte. Zu dem Zeitpunkt konnte sie nicht ahnen, dass ihr Bruder Brendan Larry, den er für einen der Waliser hielt, mittlerweile über die Situation aufgeklärt und versucht hatte, ihm zu veranschaulichen, wie Irland funktionierte. So erzählte er ihm alles über die Eisenwarenhandlung und seinen Vater, der zu Hause kaum den Mund aufbekam, sich dafür umso lieber mit den Farmern über Traktoren unterhielt.