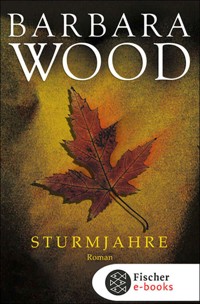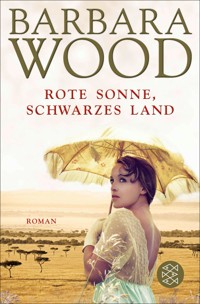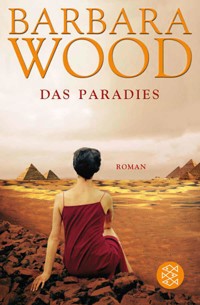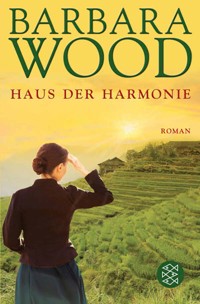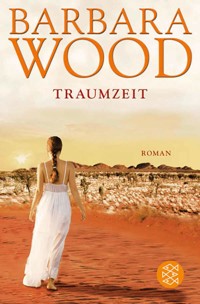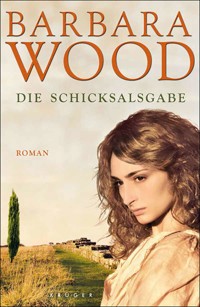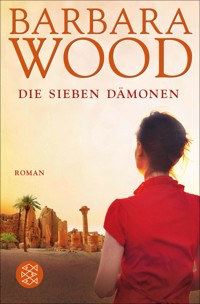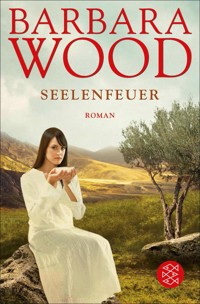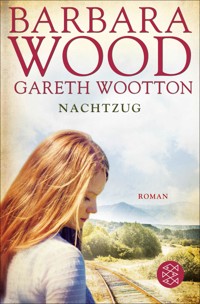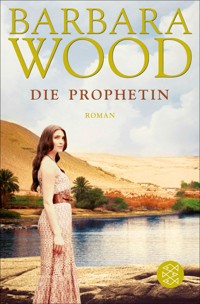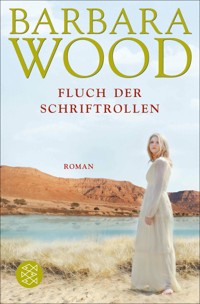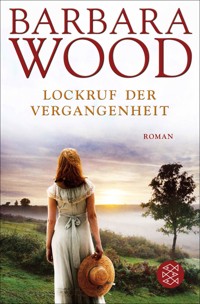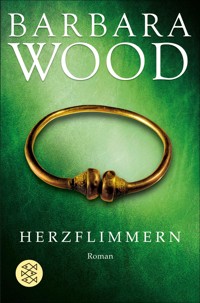
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei junge Frauen begegnen sich während des Medizinstudiums in den späten sechziger Jahren, bereit, um ihren Platz in der Männerwelt der Medizin zu kämpfen. Jede will einer schmerzvollen Vergangenheit entrinnen, jede einen persönlichen Traum verwirklichen. Nach der gemeinsamen Zeit des Medizinstudiums gehen die drei Freundinnen getrennte Wege, im Laufe zweier Jahrzehnte bleiben ihre Schicksale jedoch auf dramatische Weise verflochten. Mickey, einst durch ein Muttermal im Gesicht entstellt, findet in der plastischen Chirurgie ihre Berufung; Sondra, die schöne Exotin, wuchs als Adoptivkind auf. Ihre medizinische Laufbahn wird zur Suche nach der eigenen Identität, die sie schließlich als Missionsärztin in die kenianische Wildnis führt. Die hochbegabte, ehrgeizige Ruth hat der chauvinistischen Vaterwelt etwas zu beweisen, Ruth will das Leben erobern, will sowohl den Anforderungen einer Familie als auch ihrer Karriere gerecht werden. Nach Jahren treffen die Frauen wieder zusammen. Und diese einfühlsam geschilderte Zusammenkunft wird zur allgemeinen Standortbestimmung. Ein Roman, der wichtige Lebensfragen der modernen Frau aufwirft: Fragen der Emanzipation, der Selbstverwirklichung, des Glücks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Barbara Wood
Herzflimmern
Roman
Roman
Über dieses Buch
Drei junge Frauen begegnen sich während des Medizinstudiums in den späten sechziger Jahren, bereit, um ihren Platz in der Männerwelt der Medizin zu kämpfen. Jede will einer schmerzvollen Vergangenheit entrinnen, jede einen persönlichen Traum verwirklichen. Nach der gemeinsamen Zeit des Medizinstudiums gehen die drei Freundinnen getrennte Wege, im Laufe zweier Jahrzehnte bleiben ihre Schicksale jedoch auf dramatische Weise verflochten. Mickey, einst durch ein Muttermal im Gesicht entstellt, findet in der plastischen Chirurgie ihre Berufung; Sondra, die schöne Exotin, wuchs als Adoptivkind auf. Ihre medizinische Laufbahn wird zur Suche nach der eigenen Identität, die sie schließlich als Missionsärztin in die kenianische Wildnis führt. Die hochbegabte, ehrgeizige Ruth hat der chauvinistischen Vaterwelt etwas zu beweisen, Ruth will das Leben erobern, will sowohl den Anforderungen einer Familie als auch ihrer Karriere gerecht werden. Nach Jahren treffen die Frauen wieder zusammen. Und diese einfühlsam geschilderte Zusammenkunft wird zur allgemeinen Standortbestimmung. Ein Roman, der wichtige Lebensfragen der modernen Frau aufwirft: Fragen der Emanzipation, der Selbstverwirklichung, des Glücks.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Barbara Wood wurde in England geboren, lebt aber seit ihrer Kindheit in den Vereinigten Staaten. Sie arbeitete u.a. als Kellnerin und Hunde-Sitterin, dann zehn Jahre lang als technische Assistentin im OP-Bereich eines Krankenhauses. Seit 1980 widmete sie sich dem Schreiben. Die Recherchen für ihre Bücher führten sie um die ganze Welt. Barbara Woods Romane sind internationale Bestseller und in 30 Sprachen übersetzt. 2002 wurde sie für ihren Roman ›Himmelsfeuer‹ mit dem Corine-Preis ausgezeichnet.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe
erschien unter dem Titel ›Vital Signs‹
bei Doubleday & Company Inc., New York 1985
© Barbara Wood 1985
Copyright für die deutsche Übersetzung:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1990
Digitalisierung: pagina GmbH, Tübingen
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400237-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1968–1969
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
1971–1972
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
1973–1974
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
1977–78
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
1980. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
1985–1986
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Erster Teil
1968–1969
1
In einer langen Reihe defilierten sie in die Aula und suchten sich so zaghaft, als gähnten Abgründe unter ihnen, ihre Plätze. Fünf Frauen und fünfundachtzig Männer. Die Begrüßungen waren scheu, das Lächeln auf den jungen Gesichtern nervös. Für viele war dies der aufregendste Moment ihres Lebens – der Morgen, auf den sie sich jahrelang vorbereitet hatten. Nun endlich war er da, und sie konnten es kaum glauben.
Die fünf Frauen kannten einander nicht, dennoch setzten sie sich in der obersten Reihe des Saals nebeneinander, in die Ecke gedrängt, als wollten sie gegen die überwältigende Mehrheit der männlichen Studenten einen Block bilden. Leise sprechend schlossen sie erste vorsichtige Bekanntschaft miteinander, ehe die Einführung begann.
Die neunzig Studenten, die, unter dreitausend Studenten ausgewählt, an diesem Tag ihr Medizinstudium in der Eliteschule in Palos Verdes am Pazifischen Ozean aufnahmen, waren als Beste von den Colleges abgegangen, wo sie ihr Grundstudium absolviert hatten. Mit Ausnahme von einem Schwarzen, zwei Mexikanern und den fünf Frauen in der letzten Reihe wirkten die Studienanfänger des Jahres 1968 am Castillo Medical College wie aus einem Guß: junge männliche Weiße der Mittel- und Oberschicht. Die Atmosphäre knisterte; Ängste und Beklommenheit der neunzig jungen Leute waren beinahe greifbar.
Papier raschelte, während die Studenten die Bögen durchblätterten, die man ihnen an der Tür ausgehändigt hatte. Eine Geschichte der Schule – Castillo war früher eine riesige Hazienda gewesen, Eigentum eines alten kalifornischen hidalgo; ein Willkommenschreiben, in dem die einzelnen Abteilungen und ihr Personal vorgestellt wurden; eine Liste der Schulvorschriften (kurzes Haar, keine Bärte, Jacketts und Krawatten für die Männer; für die Frauen keine langen Hosen, keine Sandalen, keine Miniröcke).
Endlich erloschen die Lichter im Saal, der Schein eines einzigen starken Scheinwerfers fiel auf ein Pult, das in der Mitte des Podiums stand. Als Ruhe eingekehrt und aller Aufmerksamkeit auf das Podium gerichtet war, trat eine Gestalt aus dem Schatten ins Licht. Anhand der Fotografie auf der Personalliste erkannten sie alle den Mann. Es war Dekan Hoskins.
Einen Moment stand er ganz ruhig, die Hände auf dem Pult, während er langsam die Sitzreihen musterte. Es war, als wolle er sich jedes gespannte neue Gesicht einprägen. Als es schon schien, als wolle er niemals zu sprechen beginnen, als die erste feine Welle der Unruhe durch die Reihen ging, neigte sich Dekan Hoskins zum Mikrofon und sagte langsam und nicht übermäßig laut: »Ich schwöre …« Ein schwaches Echo vibrierte nach jeder Silbe hoch oben in der Kuppel des Saals, »… bei Apollon, dem Arzt, bei Asklepios, Hygieia, Panakeia –« Er holte tief Atem, und seine Stimme schwoll an, »und rufe alle Götter und Göttinnen zu Zeugen an, daß ich diesen Eid und meine Verpflichtung nach Fähigkeit und Einsicht erfüllen werde.«
Die neunzig jungen Leute starrten ihn an wie gebannt. Seine Stimme hatte ein beeindruckendes Timbre, die Worte waren wohlgesetzt; er sprach mit den Intonationen und Schwingungen eines meisterhaften Redners und schuf bei jedem seiner Zuhörer die Illusion, er spreche einzig zu ihm.
»Nämlich den, der mich in dieser Kunst unterwiesen hat, gleich meinen Eltern zu achten, sein Lebensschicksal zu teilen.« Dekan Hoskins hielt inne, schloß die Augen und artikulierte jedes Wort mit Nachdruck. »Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil; drohen ihnen aber Gefahr und Schaden, so werde ich sie davor bewahren.«
Die Atmosphäre in der Aula lud sich mit den Energien neunzig entschlossener Ärzte in spe auf. Alle Unsicherheiten und Ängste, die sie vielleicht beim Betreten der Aula geplagt hatten, bannte Dekan Hoskins mit der Deklamation des Eides. »Lauter und fromm werde ich mein Leben gestalten und meine Kunst ausüben. In alle Häuser aber, in wie viele ich auch gehen mag, will ich kommen zum Nutzen der Patienten, frei von jedem bewußten, Schaden bringenden Unrecht; insbesondere mich aber fernhalten von jedem Mißbrauch an Männern und Frauen, Freien und Sklaven.«
Er zeigte ihnen die Zukunft und er zeigte ihnen, daß es ihre Zukunft war. »Was ich während meiner Behandlung sehe und höre …«, wieder eine Pause, dann schwoll die Stimme von neuem an, »… werde ich als Geheimnis hüten. Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht breche, so sei mir ein glückliches Leben und eine erfolgreiche Ausübung der Heilkunst beschieden, auf daß ich bei allen Menschen für alle Zeit Ansehen gewinne!«
Sie saßen mit angehaltenem Atem.
Dekan Hoskins trat ein wenig vom Mikrofon zurück, richtete sich auf und sagte mit lauter, dröhnender Stimme: »Meine Damen und Herren, willkommen am Castillo Medical College!«
2
Sondra Mallone brauchte eigentlich keine Hilfe mit ihrem Gepäck, aber es war eine ungezwungene Art, mit einem neuen Nachbarn Bekanntschaft zu schließen. Er war auf sie zugekommen, als sie auf dem Parkplatz ihre Sachen aus dem roten Mustang geholt hatte, und bestand darauf, alle vier Koffer allein zu tragen. Er hieß Shawn, war Studienanfänger wie Sondra und war der irrigen Auffassung, sie wäre zu zart, um mit dem ganzen Gepäck allein fertigzuwerden.
Das ging den meisten Männern so, wenn sie Sondra sahen. Ihr Aussehen täuschte. Keiner konnte ahnen, welche Kraft in diesem schlanken Körper steckte, der durch jahrelanges Schwimmen in der Sonne Arizonas trainiert war. Vieles an Sondra Mallone täuschte. Der Name Mallone paßte überhaupt nicht zu ihrer dunklen, exotischen Schönheit. Aber sie war ja auch in Wirklichkeit keine Mallone.
An dem Tag, als Sondra, gerade zwölf Jahre alt, die versteckten Adoptionsdokumente entdeckt hatte, war ihr plötzlich etwas über sich selbst klargeworden. Sie begriff schlagartig, was diese bisher unerklärliche Grauzone tief in ihrem Inneren zu bedeuten hatte, dieses unbestimmte Gefühl, das sie stets begleitete, daß sie nicht heil war, ihr etwas fehlte, was eigentlich zu ihr gehört hätte. Diese Papiere hatten ihr gesagt, daß sie wirklich nicht heil war; daß ein Teil ihres Selbst erst noch gefunden werden mußte, irgendwo in der Welt.
Shawn redete fast unaufhörlich, während sie die Treppe zum ersten Stock des Wohnheims hinaufstiegen. Er konnte kaum den Blick von Sondra wenden. Niemand hatte ihm gesagt, daß er in einem gemischten Wohnheim leben würde. Da, wo er herkam, gab es so etwas nicht; um so erfreulicher zu entdecken, daß zu seinen Hausgenossinnen ein Mädchen gehörte, das aussah wie die Frau seiner Träume.
Sie sprach nicht viel, aber sie lächelte häufig. Er fragte, woher sie käme, und konnte es kaum glauben, als sie Phoenix, Arizona sagte. Mit diesem dunklen Teint und den Mandelaugen! Sondra fand ihn angenehm; ein netter Kerl, gegen dessen Freundschaft nichts einzuwenden war. Aber mehr würde nicht daraus werden. Dafür würde sie sorgen.
»Wie steht es mit Ihrem Sexualleben? Ist es sehr aktiv?« hatte einer der Prüfer sie im vergangenen Herbst gefragt, bei dem persönlichen Gespräch, nach dem die endgültige Entscheidung darüber fallen sollte, ob ein Bewerber angenommen wurde. Sondra wußte, daß man männlichen Bewerbern diese Frage niemals stellte. Nur eine Frau konnte Schwierigkeiten bereiten, wenn sie zur Promiskuität neigte. Sie konnte schwanger werden, das Studium aufgeben, was eine Verschwendung für die Schule von Zeit und Geld bedeutete.
Sondra hatte wahrheitsgemäß »Nein«, gesagt.
Doch als man sie gefragt hatte, ob sie Verhütungsmittel nähme, hatte sie einen Moment überlegen müssen. Sie gebrauchte keine, weil sie es nicht nötig hatte. Doch man mußte diesen Leuten das beruhigende Gefühl geben, daß man eine Frau war, die ihren Uterus und somit ihr Leben unter Kontrolle hatte; darum hatte Sondra »Ja«, geantwortet. Und es entsprach ja auch der Wahrheit. Enthaltsamkeit war die beste Verhütung.
»Wie fandst du die Einführung heute morgen?« fragte Shawn, als sie den ersten Stock erreichten.
Sondra griff in ihre Chaneltasche und zog ihren Zimmerschlüssel heraus. Sie hätte eigentlich schon am Tag zuvor ins Heim einziehen sollen, aber sie hatte die Fahrt nach Los Angeles zu spät angetreten – eine SurpriseParty, die ihre Freunde für sie gegeben hatten – und war erst diesen Morgen, gerade noch rechtzeitig zur Einführung hier angekommen.
»Ich war ziemlich baff, als ich hörte, daß es. hier Kleidervorschriften gibt«, antwortete sie, während sie die Tür aufsperrte und zurücktrat, um Shawn mit ihren Koffern vorbeizulassen. »So was hab ich seit meinen high-school Tagen nicht mehr gehört.«
Er stellte die drei großen Koffer auf den Boden und das Kosmetikköfferchen auf das Bett. Sondras Gepäckstücke waren alle weiß und mit ihren Initialen versehen.
»Oh«, rief sie und lief an ihm vorüber zum Fenster über dem Schreibtisch. Genau das, was sie sich erhofft hatte: hinter Palmen und Pinien konnte sie einen blauen Streifen Meer sehen.
Sondra, die ihr zweiundzanzigjähriges Leben lang im trockenen Arizona gelebt hatte, wo es keine größeren Gewässer gab, hatte sich bei den medizinischen Fakultäten beworben, wo Wasser in der Nähe war; ein großes Gewässer, ein Meer oder ein Fluß, der sich in der Ferne verlor. Es sollte ihr eine ständige Erinnerung daran sein, daß jenseits ein anderes Land lag, ein neues Land, ein Land fremder Menschen mit eigenen Sitten und Gebräuchen, ein Land, das winkte und lockte, sie gelockt hatte, so weit sie zurückdenken konnte. Und eines Tages in naher Zukunft, wenn sie die Ausbildung hinter sich und ihre Promotion in der Hand hatte, würde sie dort hinausziehen, in die Welt …
»Warum wollen Sie Ärztin werden?« hatten die Prüfer sie im vergangenen Herbst gefragt.
Sondra hatte gewußt, daß sie ihr diese Frage stellen würden. Ihr Berater an der Universität von Arizona hatte sie auf das Gespräch vorbereitet und ihr gesagt, was für Antworten die Prüfer hören wollten. »Sagen Sie nur nicht, daß sie Ärztin werden wollen, weil Sie den Menschen helfen wollen«, hatte der Berater sie gewarnt. »Das hören sie gar nicht gern. Schon weil es so pathetisch klingt. Außerdem ist es nicht originell. Und schließlich wissen sie verdammt gut, daß nur eine Handvoll Studenten aus rein altruistischen Gründen Medizin studieren. Sie bevorzugen eine ehrliche Antwort, direkt aus dem Kopf oder aus der Brieftasche. Sagen Sie, Sie streben berufliche Sicherheit an oder Sie haben ein wissenschaftliches Interesse an der Ausrottung von Krankheiten. Sagen Sie nur nicht, daß Sie der Menschheit helfen wollen.«
Sondra hatte ruhig und fest geantwortet: »Weil ich den Menschen helfen möchte«, und die sechs Prüfer hatten gemerkt, daß es ihr ernst war. Sondras Augen besaßen starke Überzeugungskraft; ihr Blick war klar und offen und ohne Furcht.
In Wahrheit hatte sie tiefere Gründe, aber es war nicht notwendig, darauf einzugehen. Sondras Wunsch, den Menschen zu helfen, von deren Stamm sie kam – wer immer sie sein mochten –, war für die sechs Prüfer nicht von Interesse. Es reichte, daß sie ihn spürte, daß er sie vorwärts trieb und ihr eine unerschütterliche Selbstgewißheit und Sicherheit über den Sinn ihres Lebens einflößte. Sondra wußte nicht, wer ihre Eltern waren und warum sie sie fortgegeben hatten, doch an ihrer dunklen Hautfarbe und dem schwarzen Haar, das sie lang und glatt trug, an ihren langen Gliedern und kräftigen Schultern war leicht zu sehen, was für Blut in ihren Adern floß. Und nachdem sie die Adoptionsunterlagen gefunden und erfahren hatte, daß sie in Wirklichkeit nicht die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns aus Phoenix war, sondern das Kind einer unbekannten Tragödie, hatte sie gewußt, wohin es sie trieb. »Ich will nicht in einer Nobelklinik arbeiten«, hatte sie ihren Eltern erklärt. »Ich schulde es ihnen, dorthin zu gehen, wo ich gebraucht werde.«
»Du kannst froh sein, daß du ein Auto hast«, sagte Shawn hinter ihr.
Sie drehte sich lächelnd um. Er lehnte, die Hände in den Taschen seiner Jeans, am Türpfosten.
»Ich hatte zwar gehört, daß Los Angeles eine Riesenstadt ist«, fuhr er fort, »aber auf das hier war ich nicht gefaßt. Ich bin jetzt vier Tage hier, aber ich hab immer noch keinen Schimmer, wie die Leute von einem Ort zum anderen kommen.«
Sondras Lächeln vertiefte sich. »Du kannst jederzeit mein Auto leihen.«
Shawn starrte sie an. »Vielen Dank!«
Gehetzt von der Befürchtung, sie könnte es nicht schaffen, an diesem ersten Tag alle Formalitäten zu erledigen, rannte Ruth Shapiro, in weißen Jeans und schwarzem Rolli, den gepflasterten Weg zum Verwaltungsgebäude entlang. Kurzbeinig und etwas rundlich jagte sie zwischen den Grünanlagen hindurch, um ja noch rechtzeitig zur Kasse zu kommen, und dabei fiel ihr ein anderes Rennen ein, das sie vor langer Zeit gelaufen war.
Ein pummeliges kleines Ding, mit flatterndem braunen Haar, von zehn Jahren war sie damals gewesen, als sie schnaufend und prustend wie eine kleine Lokomotive um die matschige Bahn der Grundschule in Seattle gekeucht war, eisern entschlossen zu siegen – für Daddy. Sie mußte diesen Preis unbedingt gewinnen. Sie wollte ihn ihrem Vater wie ein Opfer bringen, um ihm zu zeigen, daß er sich in ihr getäuscht hatte, daß sie doch keine Versagerin war. Am Ende war sie nicht als erste oder zweite eingelaufen, sondern als dritte, aber das machte nichts, weil es auch für die Drittplacierte einen Preis gab, einen großen, teuren Malkasten, den Ruth unter ihrem Regenmantel nach Hause trug. Als ihr Vater aus dem Krankenhaus heimgekommen war, hatte sie ihm den Preis scheu auf den Schoß gelegt, und zum erstenmal in Ruths zehnjährigem Leben war ihr Vater stolz auf sie gewesen.
Keine geringe Leistung, sich die Bewunderung und den Beifall des Mannes zu erwerben, der es ihr zehn Jahre lang nachgetragen hatte, daß sie als Mädchen zur Welt gekommen war. Dr.Mike Shapiro hatte den Malkasten auf das Kaminsims gelegt, wo die Fotografien und Ehrenurkunden von Ruths drei Brüdern standen, und hatte in den folgenden Tagen jedem, der zu Besuch ins Haus kam, den Preis mit der Bemerkung gezeigt: »Man sollte es nicht für möglich halten! Unsere dicke kleine Ruth hat dieses Prachtstück beim Langstreckenlauf gewonnen.«
Sechs herrliche Tage lang hatte sich Ruth im Stolz ihres Vaters gesonnt, überzeugt, daß jetzt alles gut werden, es keine kritischen Bemerkungen und keine enttäuschten Blicke mehr geben würde. Bis ihr Vater sie eines Tages beim Mittagessen ganz beiläufig gefragt hatte: »Übrigens Ruthie, wie viele Kinder haben eigentlich an dem Rennen teilgenommen?«
An diesem grauenvollen Tag war sie von ihrer rosaroten Wolke gefallen, und alles war mit einem Schlag und für immer wieder beim alten gewesen. »Drei«, hatte sie gepiepst, und ihr Vater hatte so laut gelacht wie nie zuvor und nie mehr danach. Die Episode war ins Schatzkästlein der Familienanekdoten gewandert, die im Lauf der Jahre immer wieder zum besten gegeben wurden, und Dr.Shapiros Gelächter war immer gleich herzhaft gewesen.
»Au!« schrie sie jetzt auf, machte einen einbeinigen Sprung und ließ sich ins Gras fallen, um den spitzen Kieselstein zu entfernen, der ihr in die Sandale gerutscht war.
Zu Ruths großer Überraschung war ihr Vater am Vortag zum Flughafen mitgekommen. Sie hatte geglaubt, nur ihre Mutter würde sie begleiten, und ihr Vater würde es bei einer kurzen Umarmung und einem flüchtigen Kuß an der Haustür bewenden lassen. Doch er hatte sich wie selbstverständlich ans Steuer des Wagens gesetzt, als sie losgefahren waren, und sie hatte sich voll ängstlicher Erregung der Hoffnung hingegeben, dies könnte die langersehnte Versöhnung sein. Aber es war wieder eine Illusion gewesen. Er hatte ihr Gepäck aufgegeben, war mit ihr zum Flugsteig gegangen und hatte, nachdem er ihr kurz die Hand gedrückt hatte, gesagt: »Ich geb dir bis Weihnachten, Ruthie. Spätestens dann wirst du gemerkt haben, daß ich recht hatte.«
Weihnachten. Fünfzehn Wochen waren es bis dahin; bis sich zeigen würde, ob Mike Shapiros Vorhersage sich bewahrheiten würde. »Du willst Medizin studieren? Ach, Ruthie, du bist eine richtige Träumerin. Geh auf Nummer sicher und mach etwas, das deinen Fähigkeiten entspricht. Wenn man zu hoch hinaus will, ist der Sturz um so tiefer. Du weißt doch, wie schlecht du Niederlagen erträgst. Du warst nie eine gute Verliererin, Ruth. Du glaubst wohl, so ein Medizinstudium wäre eine Kleinigkeit? Nein, nein, hör nicht auf mich, ich bin ja nur Arzt, was weiß ich schon darüber? Versuch’s ruhig. Denk nur daran, daß es kein Kinderspiel ist.«
Es war ungerecht. Mit Joshua und Max redete er nie so, nahm ihnen niemals gleich von vornherein allen Wind aus den Segeln. Selbst Judith, die Jüngste, wurde von ihm stets ermutigt, nach den Sternen zu greifen. Warum hat er es immer nur auf mich abgesehen? Warum kann er mich nicht lieben?
Als Ruth endlich wieder auf den Füßen stand und den Kleinkram eingesammelt hatte, der ihr aus der Schultertasche gefallen war, läutete es vom Glockenturm die Mittagsstunde. Ruth schimpfte vor sich hin. Die Kasse war von zwölf bis zwei geschlossen.
Mickey Long trat durch die Glastür der Manzanitas Hall in den milden Septembermittag hinaus und blieb stehen, um sich umzusehen. Dann beugte sie sich von neuem über den Lageplan des Colleges.
Die Manzanitas Hall war, seitdem sie am Morgen die Aula verlassen hatte, das fünfte Gebäude, in das ihre Suche sie geführt hatte, und sie war wieder nicht fündig geworden. Das Campus war nicht groß, es waren nicht mehr viele Gebäude übrig, wo sie suchen konnte. Der Verdacht, der sich in ihr regte, beunruhigte sie tief, und beinahe panisch rannte sie weiter zur Encinitas Hall, dem Flachbau im spanischen Stil, der Freizeitaktivitäten und gesellschaftlichen Veranstaltungen vorbehalten war.
Ein merkwürdiges Campus, schoß es ihr durch den Kopf, während sie am Glockenturm vorübereilte, ganz anders als alles, was sie gewohnt war. Wo waren die Klapptische der verschiedenen Studentenverbände mit ihren Werbeplakaten? Wo waren die Redner und Agitatoren? Was war aus Vietnam, Black Power und der Free-Speech-Bewegung geworden? Es war, als wäre sie über eine Zeitschwelle in die Vergangenheit eingetreten, in die verschlafenen Fünfzigerjahre, wo Studenten nur studierten und man die Professoren noch Sir nannte. Das Castillo Medical College war idyllisch, mit gepflegten Blumenbeeten und smaragdgrünen Rasenflächen, gepflasterten Wegen und plätschernden Springbrunnen, weißen Gebäuden mit roten Dächern und maurischen Bögen. Eine alte Schule mit Tradition; eine Schule, die förmlich nach Geld und konservativer Lebensart stank.
Welch ein Unterschied zu ihrer eigenen University of California in Santa Barbara, wo die Jungs die Bank of America in Brand gesteckt hatten. Wie sollte sie auf diesem verschlafenen Campus untertauchen? Sie vermißte das Geschiebe und Gedränge der Studenten, die Scharen von Radfahrern, die Pärchen und heiß diskutierenden Gruppen, die auf Rasenflächen und unter Bäumen lagerten. Sie hatten ihr die Möglichkeit geboten, sich zu verstecken und unsichtbar zu machen. Hier, stellte sie mit Erschrecken fest, gab es diese Möglichkeit nicht. Als Mickey sich um die Aufnahme im Castillo College beworben hatte, hatte sie keine Ahnung gehabt, daß es dort so geordnet und ruhig zuging. Hier würde sie auffallen; man würde sie bemerken.
Ob es nicht ein Fehler gewesen war, hierher zu kommen?
Endlich fand sie, was sie gesucht hatte: eine Damentoilette. Wie ein Wüstenwanderer, der eine Oase gesichtet hat, stürzte sie zum Waschbecken.
Immer waren die ersten Tage an einem neuen Ort eine Tortur für Mickey Long. Bis ihre neuen Gefährten sich an ihr Gesicht gewöhnt hatten, mußte sie zuerst ihre verdutzten Blicke ertragen, dann ihre unverhohlene Neugier, dann das versteckte Mitleid, und zuletzt ihre Verlegenheit, wenn sie beim Anstarren ertappt wurden und ihr ungeschicktes Bemühen, so zu tun, als wäre ihnen gar nichts besonderes aufgefallen. Aus diesem Grund kleidete Mickey Long sich stets unauffällig, griff zu Grau- und Brauntönen, weil sie hoffte, dann nicht beachtet zu werden. Ihr wirksamster Schutz waren größere Menschenmengen.
Sie schob jetzt das seidige blonde Haar, das ihr weit ins Gesicht fiel, hinter die Ohren, schraubte das Make-up-Fläschchen auf und vollzog das Ritual. Als sie fertig war, das Haar ihr wieder wie ein Vorhang über die Wangen fiel, legte sie einen Hauch zartrosa Lippenstift auf. Sie hätte sich gern so kühn und auffallend geschminkt, wie viele andere Mädchen das taten, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen; aber mit ihrem Gesicht!
Sie trat aus dem Gebäude ins Freie und sah wieder auf ihren Lageplan. Es mußte auf dem Gelände doch mehr als eine Damentoilette geben! Sie beschloß, das Mittagessen im Speisesaal auszulassen und statt dessen sämtliche Damentoiletten auf dem Campus ausfindig zu machen und in ihren Plan einzutragen. Zielstrebig machte sie sich auf den Weg zur Rodriguez Hall, die hoch über dem Meer auf den kahlen Felsen von Palos Verdes stand.
Sondra stand noch lachend und schwatzend mit Shawn an der offenen Tür ihres Zimmers, als sie eine der anderen Studentinnen durch den Flur kommen sah, ein mausgraues Ding, das eine große Strohtasche wie einen Schild an ihre Brust gedrückt hielt. Das bißchen Gesicht, das zwischen dem weit nach vorn fallenden honigblonden Haar zu sehen war, war knallrot.
»Hallo«, sagte Sondra, als die junge Frau näher kam, und bemerkte, daß die Röte im Gesicht merkwürdig einseitig war. »Ich bin Sondra Mallone« und streckte ihre Hand aus.
»Hallo.« Mickey ergriff scheu Sondras schmale, aber kräftige Hand. »Ich bin Mickey Long.«
»Und das ist Shawn. Er wohnt ein paar Türen weiter.«
Shawn musterte Mickey mit einem kurzen, neugierigen Blick und wandte sich leicht verlegen ab.
Sondra flippte mit lebhafter Bewegung das lange schwarze Haar über ihre Schulter nach rückwärts. »Ich glaube, ich bin die letzte, die hier einzieht«, meinte sie. »Shawn hat mir netterweise mit dem Gepäck geholfen. Ich hab mal wieder viel zu viel eingepackt.«
Mickey stand unsicher im Flur und hob immer wieder die Hand an die Wange, um sich zu vergewissern, daß das Muttermal verdeckt war. Aus den Nachbarzimmern drangen gedämpfte Stimmen, während die drei auf dem Gang sich in peinlich verlegenem Schweigen gegenüber standen. Dann sagte Sondra: »Also! Ich glaube, wir müssen uns jetzt zum Tee umziehen, nicht, Mickey?«
Mickey nickte voller Erleichterung und steuerte sofort auf ihr Zimmer zu.
Sobald sie verschwunden war, murmelte Shawn: »Die Arme! Ich dachte, solche Muttermale könnte man heutzutage wegoperieren.« Dann wechselte er das Thema und begann von den Gerüchten zu erzählen, die er über das Castillo College gehört hatte. Doch Sondra hörte ihm nur mit halbem Ohr zu. Sie dachte über Mickey Long nach. Ein merkwürdiges Mädchen, so schüchtern und zaghaft, für eine Ärztin doch sicher nicht das geeignete Naturell.
Während Shawn noch mitten im Erzählen war, legte Sondra ihm die Hand auf den Arm und und sagte: »Wir Frauen sind nachher zum Tee bei Mrs.Hoskins eingeladen, der Frau des Dekans. Da muß ich mich langsam fertigmachen.«
Er warf ihr einen Blick zu, als wollte er sagen: Wieso, du siehst doch großartig aus. Aber dann nickte er. »Okay. Heute abend nach dem Essen ist im Speisesaal eine Fete. Kommst du?«
Sondra schüttelte lachend den Kopf. »Ich bin praktisch die ganze Nacht gefahren. Spätestens um acht ist bei mir das Licht aus.«
Er machte immer noch keine Anstalten zu gehen, sondern sah sie mit seinen blauen Augen eindringlich an. Was er sich erhoffte, war deutlich zu erkennen. Als sie nicht reagierte, sagte er leise: »Wenn ich was für dich tun kann, wenn du irgendwas brauchst, ich bin in zweihundertdrei.«
Sie sah ihm einen Moment lang nach, als er durch den Flur davonging, ein großer netter Junge, dann wandte sie sich der Tür zu Mickeys Zimmer zu. Nach kurzer Überlegung ging sie hin und klopfte.
Die Tür öffnete sich nur einen Spalt.
»Ich bin’s nur«, sagte Sondra lächelnd beim scheuen Blick der grünen Augen. »Ich wollte dich fragen, was du zu dem Tee bei Mrs.Hoskins anziehst. Ich hab keine Ahnung, was da angebracht ist.«
Mickey zog die Tür ganz auf, musterte Sondra mit skeptischem Blick und sagte: »Das soll wohl ein Witz sein? Du kannst doch gehen, wie du bist.«
Sondra sah an sich hinunter. Sie hatte noch das ärmellose Minikleid aus cremefarbenem Voile und die hochhackigen weißen Sandaletten an, die sie zur Einführung angezogen hatte.
»Ich hab überhaupt nichts Elegantes mit«, sagte Mickey und griff schon wieder an ihr Haar, um es weiter ins Gesicht zu ziehen.
Sondra hatte schon erkannt, daß sie sich das Make-up nur deshalb pfundweise ins Gesicht schmierte, das blonde Haar nur deshalb auf einer Seite so weit nach vorn kämmte, weil sie hoffte, dadurch das Muttermal zu verdecken. Aber es klappte nicht; im Gegenteil, gerade Mickeys angestrengtes Bemühen, das große Feuermal auf ihrer Wange zu verstecken, lenkte erst recht die Aufmerksamkeit darauf. Blau oder Türkis sollte sie mit ihrem hellen Haar und den grünen Augen tragen, dachte Sondra, nicht dieses fade Braun.
»Komm, schauen wir mal, was du zu bieten hast«, meinte sie.
Mickey hatte nur einen Koffer, ein abgewetztes, altes Stück. Drinnen stapelten sich braune und beigefarbene Blusen und Pullover über Röcken und Kleidern in den gleichen Tönen. Die Etiketten trugen die Namen billiger Versandhäuser. Alles war altmodisch und verwaschen.
»Ich hab eine Idee«, sagte Sondra. »Du kannst was von mir anziehen.«
»Ach nein, ich –«
»Klar, komm schon.« Sondra faßte Mickey kurzerhand beim Arm und zog sie mit sich in ihr eigenes Zimmer, wo sie mit Schwung einen ihrer großen Koffer aufs Bett hievte und öffnete.
Mickey riß die Augen auf, als sie die Stapel von Blusen und Röcken aus Seide und Baumwolle in allen erdenklichen Farben und Mustern sah. Sondra riß achtlos ein Stück nach dem anderen heraus und warf es aufs Bett, hielt nur ab und zu inne, um Mickey einen Pulli oder ein Kleid anzuhalten und mit kritischer Miene die Wirkung zu begutachten.
»Wirklich, ich zieh lieber was von meinen eigenen Sachen an«, sagte Mickey.
Sondra schüttelte ein Mary Quant Kleid aus türkisblauem Leinen aus und hielt es Mickey unters Kinn.
»Das paßt mir doch gar nicht«, protestierte Mickey. »Die Sachen passen mir alle nicht. Ich bin größer als du.«
Sondra sah sie einmal von unten bis oben an, dann nickte sie und warf das Leinenkleid aufs Bett. »Na ja, so wichtig sind Klamotten auch wieder nicht. Ich bin nur in der Hinsicht richtig verwöhnt, weißt du. Ist der ganze Krempel nicht widerlich?« Sie machte einen vergeblichen Versuch, die Sachen wieder in den Koffer zu stopfen und gab dann kopfschüttelnd auf. »Manchmal ist es mir richtig peinlich, daß ich so viel Zeug habe.« Sie schwieg einen Moment, und ihr Gesicht wurde ernst. »Ich habe immer alles bekommen, was ich wollte«, sagte sie leise. »Ich mußte nie auf etwas verzichten …«
Aus dem Flur kam wieherndes Männergelächter, und sie blickten beide zur offenen Tür.
»Ich hatte keine Ahnung, daß hier die Wohnheime nicht getrennt sind«, bemerkte Mickey mit einem Anflug von Verzweiflung.
»Und ich hatte keine Ahnung, daß die Zimmer so klein sein würden. Wo, zum Teufel, soll ich die Sachen alle unterbringen?«
Sondra dachte an die Villa in Phoenix, wo sie ein großes Zimmer mit Bad und einen Ankleideraum hatte, der beinahe so groß war wie dieses Zimmer hier. Sie war zum erstenmal für längere Zeit von zu Hause weg. Während ihrer Collegezeit hatte sie bei ihren Eltern gelebt, da sie nie das Bedürfnis gehabt hatte, auszubrechen, Nächte durchzufeiern, junge Männer einzuladen. Sondra hatte nur ein Ziel, und um dieses Ziel zu erreichen, war sie hierher nach Castillo gekommen. Alles übrige – Partys, Kneipenbummel, junge Männer – war nebensächlich.
Aus dem Flur hörten Mickey und Sondra plötzlich einen lauten Knall, dann ein unterdrücktes »Ach, verdammt!« und als sie hinausschauten, sahen sie eine junge Frau in weißen Jeans und schwarzem Rolli, die auf dem Boden kniete und einen Haufen Bücher einsammelte, die ihr hinuntergefallen waren. Lachend blickte sie auf und fuhr sich mit einer Hand durch das kurze braune Haar.
»Ich hab immer schon zwei linke Hände gehabt«, erklärte sie.
Während Mickey und Sondra ihr beim Einsammeln der Bücher halfen, machten die drei sich miteinander bekannt und witzelten über diesen ersten Tag im Castillo.
»Ich komm mir vor wie ein kleines Kind«, meinte Ruth Shapiro, nachdem sie ihre Tür aufgesperrt hatte und die drei in ihr Zimmer traten. »Alle vier Jahre wieder ein Schulanfang. So geht das praktisch schon mein Leben lang.«
»Ja, aber das hier ist hoffentlich die letzte Etappe«, versetzte Sondra lachend, während sie sich im Zimmer umsah und feststellte, daß Ruth, genau wie Mickey und sie, sich noch nicht häuslich eingerichtet hatte.
Ruth warf ihre Schultertasche aufs Bett und fuhr sich wieder durch das kurze Haar. Der Anhänger an ihrem Hals, ein stilisiertes Waagezeichen, blitzte in der späten Nachmittagssonne auf.
»Ich hab das Gefühl, mein ganzes Leben besteht nur aus Lernen und Lesen.«
»Du hast deine Bücher schon?« fragte Sondra und warf einen Blick auf die Titel, als sie sie auf den Schreibtisch legte. »Wie hast du die Zeit gefunden?«
»Ich hab sie mir genommen. Und ich werde gleich heute abend anfangen zu pauken. Komm, setzt euch.« Ruth schleuderte ihre Sandalen von den Füßen. »Als erstes muß ich mir ein paar solide Schuhe besorgen, damit ich hier nicht gegen die Kleidervorschrift verstoße. Und meine Mutter muß ich anrufen, damit sie mir ein paar Röcke schickt.«
Sondra hockte sich auf den Bettrand. »Und ich muß alle meine Kleider und Röcke auslassen.«
»Seid ihr beide aus Kalifornien?« fragte Ruth.
»Ich komme aus Phoenix«, antwortete Sondra.
Sie sahen beide zu Mickey auf, die immer noch stand. »Ich bin hier aus der Gegend«, sagte diese so leise, als lege sie ein Mordgeständnis ab.
»Ach, da kennst du dich hier wenigstens aus«, meinte Sondra, die versuchte, Mickey ihre Befangenheit zu nehmen.
»Hast du einen Freund in der Nähe?« fragte Ruth, während sie völlig ungeniert Mickeys Wange musterte.
»Einen Freund?« Beinahe hätte Mickey gelacht. Als hätte sie mit so einem Gesicht bei Männern eine Chance. »Nein, nur meine Mutter.«
»Wo wohnt sie?« fragte Sondra.
»In Chatsworth. Sie ist in einem Pflegeheim.«
»Und dein Vater?«
Mickey starrte auf die leuchtende Bougainvillea, die Ruths Zimmerfenster umrankte. »Mein Vater ist gestorben, als ich noch ganz klein war. Ich habe ihn nie gekannt.« Es war eine Lüge. Mickeys Vater hatte seine Frau und seine einjährige Tochter wegen einer anderen Frau verlassen und sich nie mehr um die beiden gekümmert.
»Da geht’s dir so ähnlich wie mir«, bemerkte Sondra. »Ich habe meinen richtigen Vater auch nie gekannt. Und meine Mutter ebensowenig. Ich bin adoptiert.«
»Als ich dich heute morgen bei der Einführung sah«, sagte Ruth, während sie eine Packung Zigaretten aus ihrer Tasche kramte, »dachte ich, du wärst Polynesierin. Jetzt wirkst du eher wie eine Süditalienerin oder Spanierin auf mich.«
Sondra lachte. »Du hast keine Ahnung, wofür mich die Leute schon gehalten haben! Einer erklärte sogar mal steif und fest, ich müßte Inderin sein.«
»Du weißt überhaupt nicht, wer deine Eltern waren?«
»Nein, aber ich habe eine Ahnung, wie sie aussahen. Bei mir auf der Schule war ein Mädchen, das mir sehr ähnlich sah. Viele hielten uns für Schwestern. Aber sie kam aus Chikago. Ihre Mutter war eine Schwarze und ihr Vater ein Weißer.«
»Ach so.«
»Ich hab’s inzwischen kapiert, weißt du. Aber meine Mutter hatte Riesenprobleme mit meinem Aussehen, als ich größer wurde. Meine Adoptivmutter, meine ich. Als sie mich adoptierten, war ich noch ein Säugling, und sie hofften wohl, ich würde mich so entwickeln, daß man mit ein bißchen gutem Willen eine Ähnlichkeit mit meinem Vater erkennen könnte. Er hat auch schwarzes Haar. Aber ich entwickelte mich ganz anders, von Ähnlichkeit zu meinen Eltern konnte keine Rede sein, und das machte meiner Mutter schwer zu schaffen. Sie ist Mitglied in allen möglichen Klubs, bewegt sich in den vornehmsten Kreisen, und ich weiß, daß sie eine Zeitlang richtige Ängste hatte. Besonders als mein Vater beschloß, in die Politik zu gehen. Aber dann kam zu meinem Glück die Bürgerrechtsbewegung. Plötzlich war es in, den Schwarzen zu helfen, und meine Mutter brauchte nicht mehr von irgendwelchen italienischen Vorfahren zu flunkern, um mein Aussehen zu erklären.«
Ruth und Mickey starrten Sondra erstaunt an. Sie konnten sich nicht vorstellen, daß ihr Aussehen ein Handicap gewesen sein sollte. Ruth, die ständig mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte, und Mickey, die unter der Verunstaltung ihres Gesichts litt, fanden Sondras exotische Schönheit und langgliedrige Geschmeidigkeit nur beneidenswert.
»Bist du ein Einzelkind?« fragte Ruth.
Sondra nickte. »Meine Mutter wollte nicht mehr Kinder. Aber ich hab immer von einem Haufen Geschwistern geträumt.«
Ruth zündete sich eine Zigarette an. »Ich hab drei Brüder und eine Schwester. Ich hab immer davon geträumt, ein Einzelkind zu sein.«
»Ich hätte auch gern Geschwister gehabt«, sagte Mickey leise und ließ sich endlich, den Rücken an die Schranktür gelehnt, auf dem Boden nieder.
Ruth starrte auf die Zigarette in ihrer Hand. Der Blick ihrer braunen Augen war hart. Geschwister schön und gut, aber vorausgesetzt, es war genug Vaterliebe für alle da.
»Hallo! Hallo!«
Die drei drehten die Köpfe. An der offenen Tür stand eine junge Frau mit einer Flasche Sangria und vier Gläsern. »Ich bin Dr.Selma Stone, viertes Jahr. Ich bin euer persönliches Empfangskomitee hier.«
Sie war mit klassischer Eleganz gekleidet: Tweedrock, Seidenbluse und Perlenkette; konservativ wie das ganze College. Sie holte sich den Schreibtischstuhl und setzte sich zu den anderen.
»Du bist im vierten Jahr?« fragte Ruth und nahm ein Glas Wein entgegen. »Wieso bist du dann schon Doktor Stone?«
Selma lachte. »Ach, im dritten Jahr fängt die klinische Ausbildung im Krankenhaus an – drüben, im St. Catherine’s –, und da verlangen sie, daß man sich den Patienten als Doktor vorstellt. Das beruhigt die Patienten. Ich tu das jetzt seit einem Jahr, darum kam es ganz automatisch. Mein Examen mache ich erst in neun Monaten.«
Ruth wußte nicht recht, was sie von dieser Unehrlichkeit den Patienten gegenüber halten sollte, und sagte nichts.
»Ich hab mich angeboten, euch vor dem Tee heute nachmittag persönlich willkommenzuheißen. Das gehört hier zur Tradition, seit auch Frauen zugelassen werden. Vor drei Jahren, als ich anfing, war ich die einzige Frau in meinem Jahrgang. Ich kann euch nicht sagen, was für Angst ich hatte! Ich war froh, als eine von den älteren Studentinnen zu mir kam und ein bißchen mit mir redete.«
Sondra sah Selma aufmerksam an und versuchte, sich vorzustellen, wie es gewesen sein mußte, unter neunzig Studenten die einzige Frau zu sein.
»Ihr habt sicher eine Menge Fragen«, fuhr Selma fort. »Das geht allen Neuen so.«
Abwartend, taxierend betrachtete sie die drei jungen Frauen. Die kleine Brünette würde hier in Castillo überhaupt keine Schwierigkeiten haben; der Blick ihrer Augen verriet den eisernen Willen zum Erfolg. Und die schöne Exotin würde entweder Riesenprobleme mit den Männern bekommen oder aber im Vorteil sein, je nachdem wie selbstsicher und zielstrebig sie war. Die dritte, die Blonde, die sich hinter ihrem Haar versteckte, die wirkte wie ein gehetztes Tier. Selma bezweifelte, daß sie es schaffen würde.
Gerade da sagte das Mädchen: »Ja, ich habe eine Frage. Wo sind eigentlich die Damentoiletten?«
»Da gibt’s überhaupt nur eine einzige in den Unterrichtsgebäuden. In der Encinitas Hall.«
»Nur eine einzige? Wieso?«
»Weil der Anteil von Frauen pro Studienjahrgang acht Prozent nie überstiegen hat. In den vierziger Jahren, als zum erstenmal Frauen zugelassen wurden, war die Quote sogar auf zwei Frauen pro Jahrgang beschränkt. Und da es keine weiblichen Lehrkräfte gab und immer noch nicht gibt, wäre es absolut unrentabel gewesen, in sämtlichen Gebäuden neue Toiletten zu installieren.«
»Ja, aber wie –« begann Mickey.
»Man gewöhnt sich daran, morgens auf Tee oder Kaffee zu verzichten, und wenn man kurz vor der Menses ist, beugt man eben vor, weil man nicht die Zeit hat, während eines Seminars oder einer Vorlesung zu verschwinden und über das ganze Campus zur Encinitas Hall zu laufen.«
Mickey war niedergeschmettert.
»Und wie werden Frauen hier behandelt?« fragte Sondra.
»Soviel ich weiß, gab’s am Anfang ziemlich heftigen Widerstand gegen die Frauen. Man hatte Sorge, die Zulassung von Frauen könnte das Ansehen des Colleges mindern. Bei den älteren Dozenten spürt man das auch heute noch. Es sind ein paar da, die es darauf anlegen, einen fertigzumachen. Fangt bloß nicht an zu weinen! Da bekommt ihr gleich typisch weibliche Hysterie vorgeworfen.«
Ruth hob ihr Glas an die Lippen, entschlossen sich vom Unken dieser Kassandra nicht einschüchtern zu lassen. Nichts und niemand würde sie daran hindern, ihr Ziel zu erreichen.
»Aber ihr werdet’s schon schaffen«, meinte Selma tröstend. »Wichtig ist eine professionelle Haltung. Und vergeßt nicht, daß Castillo ganz anders ist als die liberalen Colleges, von denen ihr sicher gerade gekommen seid. Hier geht es so steif und konservativ zu wie in einem englischen Männerklub. Wir Frauen sind Eindringlinge.«
»Und die Studenten?« fragte Sondra. »Wie stehen die zu uns?«
»Die meisten akzeptieren uns als Gleichgestellte; aber man trifft natürlich immer wieder welche, die sich durch uns bedroht fühlen. Die versuchen dann, einen runterzumachen und einem zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Ich glaube, einige haben sogar richtig Angst vor uns. Aber wenn man sich freundlich, aber bestimmt von ihnen abgrenzt und sich auf das konzentriert, wozu man hier ist – um Medizin zu studieren –, dann hat man eigentlich keine Probleme.«
Laute Rockmusik und männliches Gelächter empfingen Sondra, Ruth und Mickey, als sie, vom Tee bei Mrs.Hoskins zurückkehrend, die hell erleuchtete Tesoro Hall erreichten.
»Ich möchte wissen, wie man bei dem Krach konzentriert lernen soll«, sagte Ruth. »Was haltet ihr beiden eigentlich von dem Wohnheim?«
»Wie meinst du das?« fragte Sondra.
»Na, wir bezahlen doch einen Haufen Geld für die Unterkunft. Und hört euch das Getöse an. Wollen wir nicht versuchen, uns zu dritt eine Wohnung zu nehmen?«
»Eine Wohnung?«
»Ja. Außerhalb vom Campus. Wir würden bestimmt was finden, und gedrittelt wäre die Miete bestimmt viel niedriger als der Preis, den wir hier im College bezahlen – wo man nicht mal Ruhe hat.« Ruth wies mit dem Kopf in die Richtung, aus der Musik und Gelächter kamen. »Hier müssen wir außerdem für Reinigung und Wäscherei bezahlen. Eine Wohnung könnten wir leicht selber sauberhalten, und unsere Wäsche können wir auch selber waschen. Und was sie hier für das Essen verlangen, finde ich sowieso unverschämt. Oder wie fandet ihr das Mittagessen heute?« Sie versuchten beide, sich zu erinnern. Es war irgendein bräunlicher Auflauf gewesen.
»Ich kann ganz gut kochen«, fuhr Ruth fort, »außerdem esse ich keine drei Mahlzeiten am Tag. Hier bezahlen wir für Frühstück, Mittag- und Abendessen, ganz gleich, ob wir es nehmen oder nicht. Überlegt mal, wieviel Geld wir sparen würden.« Sie machte eine kurze Pause. »Aber am wichtigsten erscheint mir, daß wir in einer Wohnung für uns wären und nicht dauernd irgendwelche Knaben durch den Flur trampeln.«
Mickeys Augen leuchteten auf. »Ja, ich finde, das ist eine gute Idee.«
Sondra sah ihr winziges Zimmer vor sich und dachte an die übermäßig hilfsbereiten jungen Männer wie Shawn, die sicher vom besten Willen beseelt waren, aber eben doch störten. »Gegen ein bißchen mehr Platz hätte ich nichts einzuwenden«, meinte sie. »Aber ich möchte gern in der Nähe vom Meer wohnen.«
Sie einigten sich darauf, daß Ruth sich umsehen würde. Die Lehrveranstaltungen sollten erst in zwei Tagen beginnen; es blieb also noch genug Zeit, sich nach einer Wohnung umzuschauen und mit der Collegekasse um die Rückerstattung der Gebühren für Unterkunft und Verpflegung zu kämpfen. Sie besiegelten die Vereinbarung mit Handschlag.
3
In Südkalifornien kommt der Hochsommer im September, und am Mittwoch nachmittag, als die drei sich wieder trafen, war es glühend heiß. Nicht das kleinste Lüftchen wehte vom Meer her. In Sondras Mustang fuhren sie los, die Avenida Oriente hinunter.
Als sie wenige Minuten später die Treppe zu der Wohnung hinaufstiegen, die Ruth ausgekundschaftet hatte, zog Ruth einen kleinen Block aus ihrer Tasche und reichte ihn Sondra.
»Da sind die Zahlen. Die Vermieterin wollte eigentlich eine Kaution, aber ich habe sie davon überzeugt, daß wir die Wohnung pfleglich behandeln werden. Die Miete kostet hundertfünfzehn im Monat, und sie sagte, die Nebenkosten würden nicht mehr als zehn Dollar betragen. Ich hab nochmal hundertfünfzig pro Monat für Lebensmittel angesetzt, das heißt, daß wir pro Person nicht einmal hundert Dollar im Monat zahlen. Im Wohnheim kostet es uns achthundert Dollar pro Semester; wir sparen also jede ungefähr dreihundert Dollar.«
Ruth zog den Wohnungsschlüssel aus ihrer Jeanstasche und sperrte auf. »Bitte sehr! Unser eigenes Reich.«
Die Wohnung war klein, aber freundlich eingerichtet mit hellen Möbeln und Spannteppichen. Regale und Wände waren kahl, doch die drei Frauen hatten gleich eine klare Vorstellung davon, wie die Räume wohnlich werden würden. Sondra stellte sich Kissen und Poster vor, Ruth verteilte im Geist Pflanzen und Bilder, und Mickey sah die kleine Wohnung als rettende Zuflucht.
»Na, wie findet ihr es?« fragte Ruth.
»Mir gefällt’s«, antwortete Sondra. »Ich hab einen Haufen tolle Poster dabei. Die können wir hier an die Wände pinnen, dann sind wir überall von großartigen Landschaften und herrlichen Sonnenuntergängen umgeben. Und aufs Sofa gehören ein paar Kissen. Das macht es gemütlicher.« Sie trat in die Mitte des Wohnzimmers und sah sich um. »Vielleicht können wir hier sogar einen schönen, dicken Berberteppich reinlegen.«
»Moment mal!« Ruth hob abwehrend die Hand. »So was kann ich mir nicht leisten. Ich muß mein Studium selber finanzieren. Da zählt jeder Penny.«
»Ach, das macht nichts«, versetzte Sondra vergnügt. »Ich hab Geld. Ich übernehm die Inneneinrichtung.«
Ruth beobachtete Mickey, die so zaghaft und vorsichtig zum Flur ging, als vermute sie dort in den Schatten ein gefährliches Ungeheuer. Sie stemmte beide Hände in die rundlichen Hüften und sagte: »Und was meinst du zu der Wohnung, Mickey?«
Mickey nickte nur. Sie war glücklich und erleichtert. Die Wohnung war schön, gemütlich und heimelig, ein Ort, wo sie sich zurückziehen konnte. Und dank den geringeren Ausgaben konnte sie nun auch hoffen, mit ihrem Geld auszukommen. Ihr Stipendium und das, was sie sich in den Sommerferien verdient hatte, würde ausreichen das College zu bezahlen und ihre Mutter im Pflegeheim zu unterstützen.
»Ich schlage vor, wir losen um die Zimmer«, sagte Ruth und kramte schon in ihrer Tasche nach Streichhölzern.
Doch Mickey wehrte ab. Sie nähme gern das Zimmer ohne Fenster, sagte sie. Glas und Spiegel waren ihr ein Greuel.
In der Mittagshitze fuhren sie wieder ins Wohnheim, packten ihre Sachen und verstauten sie in Sondras Mustang. Die feurige Sonne des Spätnachmittags in den Augen, kehrten sie in ihre neue Wohnung zurück.
»Die Vermieterin hat mir versprochen, daß morgen früh der Strom eingeschaltet wird«, bemerkte Ruth, während sie in jedes Zimmer ein paar Kerzen legte. »Am Wochenende können wir zusammen die Sachen besorgen, die wir noch für Küche und Bad brauchen.«
Sondra richtete in aller Ruhe ihr Zimmer ein, obwohl die Sonne schon untergegangen war, und es schnell dunkel zu werden begann. Das Poster mit der Dschungelkatze hängte sie an die Wand gegenüber von ihrem Bett, so daß sie es morgens beim Erwachen gleich sehen konnte; die Schreibgarnitur aus Leder, die sie zum Schulabschluß bekommen hatte, kam auf den Schreibtisch und daneben ein Foto ihrer Eltern; die Kleider wurden rechts im Schrank aufgehängt, Röcke und Blusen links, die Schuhe wurden darunter aufgereiht. Sie breitete die Decken aus, die die Vermieterin ihnen geliehen hatte, bis sie sich eigene besorgen konnten, schüttelte das Kopfkissen auf und trat zurück, um ihr Werk zu betrachten.
Der erste Schritt, dachte sie befriedigt. Der erste Schritt auf der letzten Etappe …
Ehe sie wieder zu Ruth und Mickey hinausging, trat sie ans Fenster. Das Meer konnte sie, wie Ruth sie schon vorher gewarnt hatte, von hier aus nicht sehen, aber es war ganz in der Nähe, gleich hinter den Palmen und den Dächern der Häuser. Sie spürte seinen Pulsschlag und den Hauch seines Atems. Wenn sie die Augen schloß und konzentriert lauschte, konnte sie die Brandung hören, den Schlag der Wellen, der so viel verhieß – die weite, lockende Welt auf seiner anderen Seite. Eines Tages würde sie – Sondra – in diese Welt hinausziehen, daran gab es für sie nicht den geringsten Zweifel. Unrecht mußte wiedergutgemacht werden, eine Schuld an den Menschen, von denen sie abstammte, mußte beglichen werden. Es galt für sie, ihre Identität zu finden, ihren Platz in der Welt, darum mußte sie zu der dunklen Rasse zurückkehren, wie fern sie auch sein mochte, der sie verwandt war. Sondra Mallone fühlte sich am Beginn eines abenteuerlichen, unwiderstehlich lockenden Wegs, und dieses Gefühl erfüllte sie mit der gleichen Erregung wie am Dienstag morgen die Deklamation des hippokratischen Eides.
In der Küche deckte Ruth den Tisch. Sie hatte zwei Kerzen angezündet und arbeitete allein. Mickey war noch im Badezimmer.
Ruth wunderte sich, daß ihre Hände so ruhig waren; innerlich zitterte sie. Sie hatte sich durchgesetzt und den kühnen Schritt gewagt. Trotz meines Vaters, dachte sie. Ich werde nicht versagen. Und wenn es mich umbringt, ich werde bis zum Ende durchhalten, und ich werde als Beste meines Jahrgangs abschließen.
Mike Shapiro, einer der bekanntesten und meistbeschäftigsten Allgemeinärzte in Seattle, war tief enttäuscht gewesen, als seine Frau damals, vor dreiundzwanzig Jahren, all seinen Wünschen und Plänen entgegen ein Mädchen zur Welt gebracht hatte. Doch schon elf Monate danach war Joshua gekommen, und alles war verziehen. Dann war Max geboren worden und nach ihm David. Das letzte Kind, das Nesthäkchen, war wiederum ein Mädchen gewesen. Als existierte die Erstgeborene gar nicht, als hätte Mike Shapiro sich seine ganze Liebe für dieses letztgeborene Kind aufgehoben, gab er der kleinen Judith all seine Wärme und Zuneigung, hob sie auf den Platz der Prinzessin, der, wie Ruth meinte, eigentlich ihr zugestanden hätte.
In gewisser Weise konnte sie es ihm nicht einmal verübeln. Sie war ein dickliches, tolpatschiges Kind gewesen, das immer irgend etwas umstieß und ständig mit bekleckertem Kleidchen umherlief. Heute, als Erwachsene, konkurrierte sie mit ihren Brüdern; Joshua war in West Point; Max studierte an der Northwestern University und bereitete sich darauf vor, in die Praxis seines Vaters einzutreten; David wollte Rechtsanwalt werden.
»Das schaffst du doch nicht, Ruthie«, hatte Mike Shapiro erklärt, als sie die Bewerbungen für das Medizinstudium ausgefüllt hatte. »Warum nimmst du dich nicht als das an, was du bist? Such dir einen netten Mann. Heirate. Setz Kinder in die Welt.«
Doch das, was Ruth vorwärtstrieb, war die Tatsache, daß sie in Wirklichkeit niemals versagt hatte. Sie mochte in ihrer Kindheit und Pubertät vielleicht manchmal auf das Niveau unverzeihlicher Mittelmäßigkeit abgesunken sein, aber gescheitert war sie nie. Sie war nur einfach kein begabtes Kind. Es war nicht ihre Schuld, daß an dem einzigen Wettkampf, in dem sie sich je placiert hatte, wegen des Regens nur drei Konkurrentinnen teilgenommen hatten, so daß sie ihren Preis auch bekommen hätte, wenn sie mit halbstündiger Verspätung eingelaufen wäre. Ein Gutes hatte jenes Debakel immerhin gehabt: Für kurze Zeit hatte Ruth die Süße väterlicher Bewunderung kosten dürfen. Und einmal auf den Geschmack gekommen, wollte sie mehr.
Diesmal, dachte sie, während sie die Kräcker auf einen Pappteller legte, laufe ich nicht als Dritte ein. Diesmal werde ich Erste. Die erste von neunzig.
Mickey blieb lange im Badezimmer. Sie tat nichts, sondern stand nur da und starrte auf das Gesicht der Frau im Spiegel.
Bei ihrer Geburt war das Muttermal stecknadelkopfgroß gewesen, ein Kuß von der guten Fee, hatte ihre Mutter gesagt. Aber mit den Jahren hatte es sich vergrößert und bedeckte nun fast ihre ganze Gesichtshälfte vom Ohr bis zum Nasenflügel und vom Unterkiefer bis zum Haaransatz. Die Kinder in der Grundschule waren oft grausam gewesen. »He, Mickey«, sagten sie wohl, »du hast Marmelade im Gesicht.« Oder sie erklärten sie zur Aussätzigen und sagten, niemand dürfe in ihre Nähe kommen. Sie schlossen Wetten ab, wer von ihnen es wagen würde, zu Mickey hin zu laufen und das Feuermal zu berühren. Stanley Furmanski behauptete, sein Vater hätte gesagt, solche Muttermale würden immer größer, bis sie schließlich platzten und das ganze Gehirn herausspritzte. Die Lehrer hielten dann wohl der Klasse einen Vortrag darüber, daß man zu Menschen, die das Schicksal weniger begünstigt hätte als einen selber, besonders nett sein müsse, und Mickey hätte sich vor Scham am liebsten ins nächste Mauseloch verkrochen. Schluchzend pflegte sie nach Hause zu laufen, um sich von ihrer Mutter trösten zu lassen.
In der High school wurde es nicht besser. Manche Mädchen freundeten sich nur mit ihr an, um ihr Fragen über ihr Gesicht stellen zu können; wohlmeinende Lehrer demütigten sie mit ihrer übertriebenen Freundlichkeit; die Jungens machten sich an sie heran, weil ihre Freunde ihnen fünf Dollar versprochen hatten, falls sie es über sich brachten, diese entstellte Wange zu küssen.
Ihre Mutter war mit ihr von einem Arzt zum anderen gelaufen. Die meisten stellten fest, das Mal sei zu vaskulös und schickten sie wieder fort; einige experimentierten mit Skalpell und flüssigem Wasserstoff und Trockeneis, ohne daß es den geringsten Erfolg hatte. Ihr Gesicht war nur durch Narben noch mehr entstellt worden.
Aber die schlimmsten Narben trug Mickey nicht im Gesicht. Nach den langen Jahren grausamer Quälerei, die sie von ihrer Umwelt erfahren hatte, war sie nun überzeugt von ihrer eigenen Minderwertigkeit; überzeugt, daß sie einzig dazu bestimmt sei, ganz in der Arbeit aufzugehen, die sie sich wählen würde.
Im ersten Moment hatte sie es gewundert, daß die sechs Prüfer im vergangenen Herbst sie nicht gefragt hatten, warum sie Ärztin werden wollte; sie hatte geglaubt, diese Frage würde man jedem Bewerber stellen. Dann aber hatte sie sich überlegt, daß sie ihr wahrscheinlich nur ins Gesicht hatten sehen müssen, um den Grund zu erraten. Sie waren schließlich Ärzte. Sie konnten sich gewiß vorstellen, wie viele Ärzte Mickey in den vergangenen Jahren aufgesucht hatte. Immer wieder die fremden kalten Hände in ihrem Gesicht; immer wieder das bedauernde Kopfschütteln. Viel zu oft hatte sie die niederschmetternden Worte ›Keine Hoffnung‹ gehört. Jedem, der sie genauer ansah, mußte offenkundig sein, daß Mickey irgendwann beschlossen hatte, einen Beruf zu ergreifen, der es ihr ermöglichen würde, Menschen zu helfen, die so geschlagen waren wie sie selbst, auch wenn es für sie selber zu spät war.
Sie fuhr zusammen, als es draußen klopfte, und öffnete hastig die Tür. Sondra stand vor ihr, das lächelnde Gesicht von Kerzenschimmer erleuchtet.
»Entschuldige, daß ich so lang gebraucht habe«, sagte Mickey. »Das kommt bestimmt nicht wieder vor.«
»Ach, das macht nichts. Ich wollte dir nur sagen, daß unser Festessen auf dem Tisch steht.«
Ruth hatte Käse und Kräcker hingestellt und goß Cola in die Pappbecher.
»Ich muß mich mit dem Zeug zurückhalten«, sagte sie, während die beiden anderen sich im flackernden Kerzenlicht an den Tisch setzten. »Bei mir schlägt alles gleich an. Als ich klein war, hat mir mein Vater jedesmal, wenn er mich mit einem Cola erwischt hat, fünf Cents vom Taschengeld abgezogen. Und als ich in der siebten Klasse war, hat er mir zehn Dollar ausgesetzt, falls ich es schaffen sollte, zehn Pfund abzunehmen.«
»Wenn wir am Wochenende einkaufen«, meinte Sondra und stopfte sich einen Kräcker in den Mund, »besorgen wir uns einen Haufen Diätgetränke und Mineralwasser. Was haltet ihr davon, wenn wir abwechselnd kochen? Jeder immer eine Woche lang.«
Beide sahen Mickey an, doch die schwieg.
»Hör mal, Mickey«, sagte Ruth, während sie sich ein paar Krümel von ihrem T-Shirt streifte, »du mußt ein bißchen kontaktfreudiger werden, wenn du Ärztin werden willst. Wie willst du denn mit deinen Patienten reden, wenn du immer so still bist?«
Mickey hüstelte ein wenig und senkte den Kopf.
»Ich will keine Praxis. Ich möchte in die Forschung.«
Ruth nickte. Sie hatte verstanden. In einem Labor sind Persönlichkeit und Aussehen nicht von Bedeutung; da kommt es nur auf Intelligenz und Hingabe an.
»Und du, Ruth?« fragte Sondra. »Was willst du mal machen?«
»Allgemeinmedizin. Ich möchte in Seattle eine Praxis aufmachen. Du?«
»Ich möchte raus in die Welt«, antwortete Sondra. »Das drängt mich eigentlich schon mein Leben lang – ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Seit ich denken kann, hab ich eigentlich immer den Drang gehabt, rauszukommen und zu sehen, was hinter der nächsten Ecke wartet.« Das Kerzenlicht schimmerte in ihren topasbraunen Augen. »Ich weiß nicht, warum meine richtige Mutter mich weggegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht bei meiner Geburt gestorben ist oder ob sie mich einfach nicht bei sich behalten konnte. Manchmal quälen mich diese Gedanken. Ich bin 1946 geboren, damals galten Mischehen ja noch als etwas Unerhörtes. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie es gewesen sein mag. Ob sie sich vielleicht in meinen Vater verliebte und dafür von ihrer Familie ausgestoßen wurde; ob die beiden zusammengeblieben sind, oder ob er sie verlassen hat. Ich weiß nicht einmal, ob meine Mutter oder mein Vater schwarz war. Nach meiner Assistenzzeit möchte ich nach Afrika gehen. Um meine andere Hälfte kennenzulernen.«
Der Wind draußen hatte aufgefrischt und rüttelte jetzt an den Fensterscheiben, als wolle er eingelassen werden. Die drei am Tisch schwiegen, nachdenklich, den Blick nach innen gerichtet. Vor wenigen Tagen waren sie einander noch fremd gewesen, hatten nichts voneinander gewußt; nun würden sie ein Stück Wegs gemeinsam gehen, in eine unbekannte Zukunft, an die sie große Erwartungen, vor der sie aber auch ein wenig Furcht hatten.
Ruth räusperte sich und hob ihren Becher. »Also dann, auf uns! Auf die drei zukünftigen Ärztinnen.«
4
In das Steinsims über dem zweiflügeligen Portal der Mariposa Hall waren die Worte mortui vivos docent eingehauen. Oft waren die Studienanfänger in den vergangenen sechs Wochen unter ihnen hindurchgegangen, doch erst an diesem Tag, an dem sie zum erstenmal sezieren sollten, wurde ihnen die Bedeutung der Worte voll bewußt: Die Toten lehren die Lebenden.
Ruth setzte sich wie immer in die oberste Reihe der Anatomie und zog, da sie früh daran war, Guytons Physiologie des Menschen aus ihrem Beutel. Seit dem ersten Tag am College, als Dekan Hoskins mit solcher Eindringlichkeit den hippokratischen Eid gesprochen hatte, las und lernte Ruth mit wilder Entschlossenheit und benützte jede freie Minute, um zu büffeln. Während die anderen Studenten gemächlich in den Saal schlenderten und ihre Plätze einnahmen, hockte Ruth über ihrem Buch und versuchte, die zwanzig Aminosäuren auswendig zu lernen, aus denen sich alle bekannten Eiweiße zusammensetzten.
»Hallo!«
Ruth blickte auf, als Adrienne, eine hübsche Frau mit rotem Haar, sich neben sie setzte. Adrienne war wie sie im ersten Jahr und war mit einem Studenten verheiratet, der kurz vor dem Examen stand.
»Ich schwitze Blut«, sagte Adrienne. »Mein Mann hat zwar versucht, mich seelisch auf diese Seziererei vorzubereiten, aber mir graut trotzdem. Ich hab noch nie im Leben einen Toten gesehen.«
»Ach, das wird schon«, meinte Ruth, pragmatisch wie immer. »Man muß sich nur sagen, daß es nicht anders geht, dann klappt’s schon.«
»Er hat mir erzählt«, fuhr Adrienne mit gesenkter Stimme fort, »daß einer der Anatomiedozenten unheimlich frauenfeindlich ist. Wenn eine von uns diesen Kerl erwischt, Moreno heißt er, blüht ihr einiges.«
»Wieso?«
»Er führt jedes Jahr das gleiche Theater auf. Man geht nach dieser Vorlesung ins Labor, und garantiert fehlt auf einem seiner Tische eine Leiche. Immer ist es ein Tisch, der einer Frau zugeteilt ist. Er wählt dann mit großem Brimborium und scheinbar völlig unparteiisch jemanden aus, der ins Souterrain gehen und den fehlenden Leichnam holen muß. Aber es ist unweigerlich eine Frau.«
Ruth starrte sie ungläubig an. »Ach, ich kann mir nicht vorstellen –«
»Doch, es ist wahr. Mein Mann hat mir erzählt, daß damals, als er das erstemal im Labor war, eine Frau runtergeschickt wurde. Sie ist überhaupt nicht mehr zurückgekommen.«
»Wieso? Was war mit ihr?«
»Als sie das Becken sah, wo die Leichen drin rumschwimmen, kriegte sie einen totalen Zusammenbruch und rannte weinend ins Wohnheim.«
»Hat sie danach weitergemacht?«
»O ja. Sie ist jetzt im vierten Jahr. Du kennst sie. Selma Stone.«
Ruth ließ sich diese unerfreuliche Information durch den Kopf gehen und sagte sich grimmig, das soll der Kerl nur bei mir versuchen. Dann sah sie, daß ein Formular durch die Reihen ging, auf dem jeder Student sich einschrieb.
»Was ist denn das?« fragte sie.
»Ach, so eine Art Anwesenheitsliste.«
»Ich dachte, so was gibt’s hier nicht.«
»Normalerweise nicht. Das gilt nur für die Laboreinteilung.«
Ruth fand das Formular, als es sie ereichte, höchst verwunderlich. Man sollte, wie die Anweisungen besagten, nur seinen Namen und seine Körpergröße eintragen. Sie setzte also ihren Namen auf das Blatt und schrieb dahinter 1,60 m.
Nach Adrienne kam das Formular zu Mickey, die gerade noch den letzten Platz in der Reihe ergattert hatte, nachdem sie wegen des unvermeidlichen Abstechers in die Damentoilette in der Encinitas Hall wieder einmal beinahe zu spät gekommen wäre. Sie unterschrieb hastig und kritzelte 178 cm neben ihren Namen. Als letzte bekam Sondra das Formular, die in angeregtem Gespräch mit ihrem Nachbarn war. Zerstreut setzte sie ihren Namen aufs Papier und daneben ihr Gewicht, 50 Kilo.
Dann trat schon Dr.Morphy auf das Podium und begann ohne Umschweife seine Vorlesung. Nach einstündigem dichtem Vortrag, den er mit schnell an die Tafel geworfenen Diagrammen und Schaubildern illustrierte, schickte er die Studenten in die Labors.
Kaum einer sprach etwas, während sie durch einen langen, kalten Gang geführt wurden. Beklommen schlüpften sie in die Laborkittel. Die Frauen, abgesehen von Mickey, hatten Mühe, Mäntel zu finden, die ihnen paßten, und behalfen sich schließlich damit, daß sie die Ärmel aufkrempelten.
Ein Assistent mit dem Formular in der Hand, das zu Beginn der Vorlesung durch die Reihen gegangen war, rief in schneller Folge Namen und Tischnummern auf. Als die Studenten sich an ihre Plätze begaben, begriffen sie, warum sie ihre Körpergröße hatten angeben müssen. Des Rätsels Lösung war einfach: Die Tische waren auf unterschiedliche Höhen eingestellt, damit die Studenten an Tischen arbeiten konnten, die ihrer Größe angepaßt waren. Die Folge war, daß Mickey allein mit drei Männern zusammenarbeitete, während Sondra, Ruth und die beiden anderen Frauen zusammen an einem Tisch waren.
Unglücklicherweise landeten die Frauen alle in Dr.Morenos Labor.