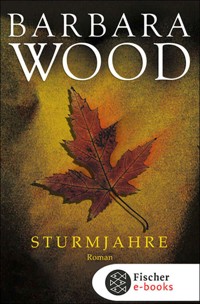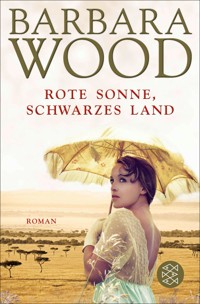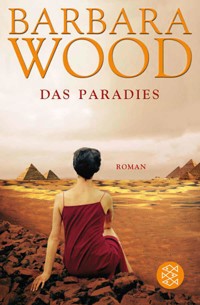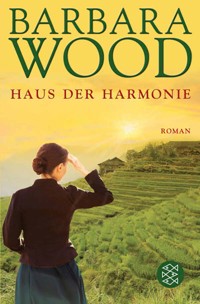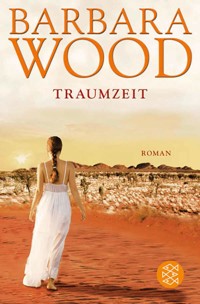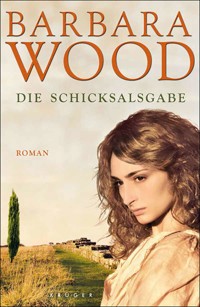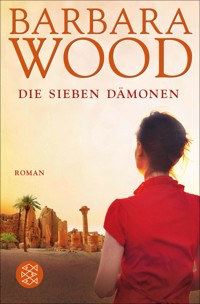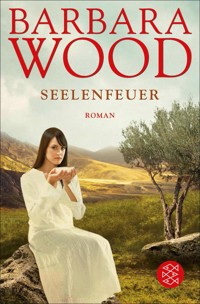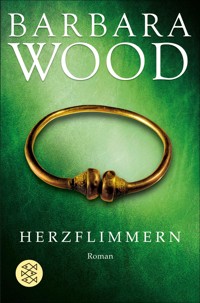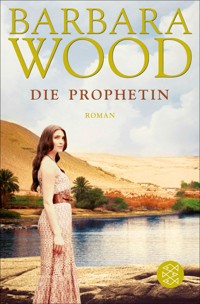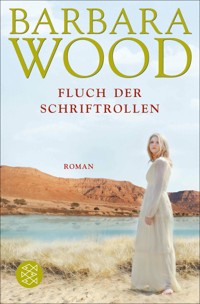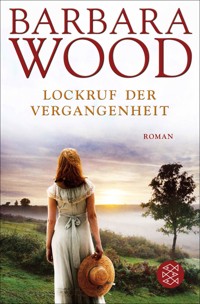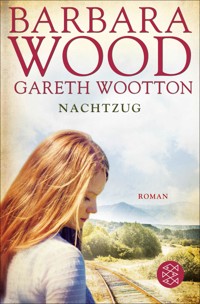
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Bestsellerautorin Barbara Wood: Jan und Maria, zwei polnische Ärzte, entwerfen einen genialen Widerstandsplan, um ihre Stadt gegen Übergriffe der deutschen Besatzer zu schützen. Diese wenig bekannte Episode aus dem Zweiten Weltkrieg ist eine dramatische Geschichte um Hoffnung und Verzweiflung, Mut und List, tragische Verstrickung und aktiven Widerstand und um die Menschlichkeit mitten in höchster Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Barbara Wood | Gareth Wootton
Nachtzug
Roman
Roman
Über dieses Buch
In der von Deutschen besetzten Kleinstadt Sofia in Polen nimmt der Naziterror immer brutalere Formen an. Dr. Jan Szukalski und Dr. Maria Duszynska, zwei polnische Ärzte, denken sich einen genialen Widerstandsplan aus, um die Stadt vor den Übergriffen des SS-Kommandanten Dieter Schmidt zu schützen. Sie wollen eine Fleckfieberepidemie vortäuschen, um die Deutschen zum Abzug aus Sofia zu zwingen. Als erster Proband bei diesem äußerst riskanten Vorhaben stellt sich ihnen ein junger Wehrmachtssoldat zur Verfügung, der in den Konzentrationslagern bereits die Verbrechen des Regimes erkannt hat.
Torpediert wird dieser Plan jedoch auf tragische Weise von einer jüdischen Partisanengruppe, deren Mitglieder genau wissen, was in den düsteren, nachts vorbeirollenden Zügen gen Osten transportiert wird ... Dieser Roman beruht auf einer wenig bekannten Episode aus dem Zweiten Weltkrieg. Aktiver und passiver Widerstand, Mitmenschlichkeit und Unmenschlichkeit sind die Themen der hochdramatischen Handlung.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Barbara Wood wurde in England geboren, lebt aber seit ihrer Kindheit in den Vereinigten Staaten. Sie arbeitete u.a. als Kellnerin und Hunde-Sitterin, dann zehn Jahre lang als technische Assistentin im OP-Bereich eines Krankenhauses. Seit 1980 widmete sie sich dem Schreiben. Die Recherchen für ihre Bücher führten sie um die ganze Welt. Barbara Woods Romane sind internationale Bestseller und in 30 Sprachen übersetzt. 2002 wurde sie für ihren Roman ›Himmelsfeuer‹ mit dem Corine-Preis ausgezeichnet.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe
erschien unter dem Titel ›Night Trains‹
bei William Morrow and Company, Inc., New York 1979
© Barbara Wood and Gareth Wootton 1979
Published by Arrangement with Authors
Copyright für die deutsche Übersetzung:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1995
Digitalisierung: pagina GmbH, Tübingen
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400240-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Dieses Buch ist gewidmet [...]
Buenos Aires – Die Gegenwart
Polen, Dezember 1941
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
New York City – Die Gegenwart
Dieses Buch ist gewidmet Alfons Lewandowski: der dort war, als es passierte, und dessen Erfahrungen uns etwas vermittelten, was nicht in Geschichtsbüchern steht; und Papst Johannes Paul II.; und den Tausenden von Namenlosen, die wie er im polnischen Widerstand kämpften.Dies zu ihrem Gedenken.
Buenos Aires – Die Gegenwart
Adrian Hartmann verließ seine palastartige Villa an der Avenida del Libertador Nr. 3600 durch den Nebeneingang und trat hinaus an die frische Morgenluft. Er war ein begeisterter Jogger und Fitneß-Fanatiker, der sich eine strenge Disziplin auferlegte und stets zur gleichen Zeit seine Streckübungen begann, bevor er den Lauf gegen die Stoppuhr aufnahm. Er wurde unruhig und konnte es nicht mehr abwarten.
»Mein Gott, Ortega«, drängte er seinen Leibwächter, »wo bleiben Sie denn?«
Er hüpfte auf seinen Fußballen auf und ab und streckte seine Arme nach hinten, während er die kühle Luft begierig aufsog. Was für ein herrlicher Morgen! Aber wo blieb denn nur Ortega? Er rief noch einmal durch die halb geöffnete Tür.
»Wo bleiben Sie denn, Mensch?« Widerlich, dachte Hartmann. Vor zehn Jahren noch war Ortega einer der besten Fußballspieler in Argentinien gewesen, und nun mußte man ihn förmlich aus dem Bett zerren, damit er seinen Arbeitgeber beim morgendlichen Lauftraining begleitete.
Adrian Hartmann setzte seine Aufwärmübungen fort. Er spielte mit dem Gedanken, ohne seinen Leibwächter loszulaufen, aber in letzter Zeit hatte es in Buenos Aires einige Entführungsfälle gegeben, und er war einer der reichsten Juwelenhändler Südamerikas. Der Gedanke an eine Entführung behagte ihm nicht sonderlich.
Endlich erschien Ortega an der Tür und schickte sich an, die Laufschuhe, die er noch in den Händen hielt, anzuziehen. Der Anblick seines übergewichtigen Leibwächters, für den es schon eine Mühe bedeutete, wenn er sich bücken mußte, um sich die Schuhe anzuziehen, machte Hartmann noch ungeduldiger. Er beugte sich hinunter, zog die Reißverschlüsse seines Jogginganzugs über den Fußknöcheln zu und wandte sich dann an Ortega. »Ich laufe jetzt los. Die gleiche Strecke wie immer, durch den Park und um den See herum. Fünf Kilometer.« Er blickte auf die Uhr, die Viertel vor sechs anzeigte. Er drückte den Knopf seiner Stoppuhr und joggte den serpentinenartigen Weg von der Villa zur Avenida del Libertador hinunter, in die er nach rechts einbog.
Hartmann hatte schon ungefähr dreihundert Meter auf der Straße zurückgelegt, als Ortega das Tor zum Anwesen erreichte. Er legte sein Pistolenhalfter um und verstaute seine schwere Neun-Millimeter-Waffe gewissenhaft, damit sie ihm unterwegs nicht herausfiel. »Verrückter Alter«, murmelte Ortega vor sich hin, als er sah, daß er Hartmann nur noch dann einholen konnte, wenn er quer durch den Park lief. Dieses Wagnis aber wollte er nicht eingehen, denn es hätte bedeutet, seinen Arbeitgeber aus den Augen zu verlieren.
Die Sonne, die noch nicht aufgegangen war, färbte den Himmel im Osten bereits feuerrot. Hartmann, dessen Laufstil etwas Verkrampftes an sich hatte und von seinem ungeduldigen Wesen und seiner Härte gegen sich selbst zeugte, bemerkte, daß die Eukalyptusbäume ein frisches Grün anlegten. Er lebte nun schon so lange in Buenos Aires, und doch hatte er sich nie daran gewöhnen können, daß der Oktober hier ein Frühlingsmonat war.
An der Avenida Sarmiento bog er nach links ab und lief in die ausgedehnte Parkanlage, wo Wiesen und Büsche in üppiger Blüte standen. Er lief jetzt etwas schneller und sah in der Ferne das Klubhaus am Ufer des Sees, das erst kürzlich wieder eröffnet worden war. Unter der Militärjunta war es geschlossen worden, kurz nachdem der Jokkey-Klub durch Brandstiftung in Schutt und Asche gelegt worden war. Hartmann kochte vor Wut und dachte: Diese verdammten Kommunistenschweine haben wirklich allen nur Probleme bereitet!
Während er weiterlief, drückte Hartmann seine Hand an den Hals und warf einen Blick auf die Stoppuhr, um seinen Puls zu messen. Er zählte zehn Sekunden lang. »Zweiundzwanzig«, murmelte er und atmete dabei aus. Einhundertzweiunddreißig Pulsschläge pro Minute, das war gar nicht übel. Mit diesem Herz konnte er gut und gerne hundert Jahre alt werden. Vielleicht sogar einhundertundfünfzig, wie einige dieser Bauern im Kaukasus, von denen er gehört hatte. Unsinn, sagte er sich, während er weitertrabte. Das Geheimnis ihrer einhundertundfünfzig Jahre liegt darin, daß sie jedes Jahr doppelt zählen!
Hartmann bog nach links ab, als er die Avenida Infanta Isabel erreichte, eine kleine, staubige Straße, die noch weiter in den Park hineinführte. Er warf einen Blick zurück in Richtung Avenida Sarmiento und bemerkte den keuchenden Ortega, der sich immer noch knapp dreihundert Meter hinter ihm abquälte. Mit seinen mechanischen Armbewegungen erinnerte er ihn an eine Dampflokomotive, die unter Höchstleistung den Kampf mit einer Steigung aufnimmt.
Die Sonne ging inzwischen über dem Horizont auf und erhellte den Himmel mit einem Licht, das einen für diese Jahreszeit ungewöhnlich heißen Tag verhieß. Als er sich dem See näherte, ließ Hartmann den Blick kurz über den gesamten Park schweifen und stellte zu seiner Zufriedenheit fest, daß er noch fast menschenleer war. Außer ihm war nur noch eine weitere Person zu sehen, auch ein Jogger mit seinem Hund, der auf der anderen Seite des Sees in die entgegengesetzte Richtung lief. Ein einziges Auto befand sich auf der Straße außerhalb des Parks. Es stand auf der Avenida del Libertador an der Abzweigung zur Avenida Sarmiento; anscheinend saß niemand darin. Am See wandte er sich nach rechts und warf einen kurzen Blick hinter sich, während er in gleichmäßigem Tempo weiter an der Avenida Infanta Isabel am Ufer des Sees entlanglief.
Der Mann mit dem Hund hatte inzwischen den See umrundet und joggte nun ebenfalls an der Avenida Infanta Isabel entlang, ungefähr einhundert Meter hinter Hartmann und zweihundert Meter vor Ortega.
Der Hund, ein riesiger Dobermann, trottete neben seinem Herrn her und zerrte gelegentlich voller Ungeduld so kräftig an der Leine, daß er diesen fast aus dem Gleichgewicht riß.
»Ruhig, Drum.« Der Mann versuchte, den Hund zu beruhigen und faßte die Leine fester. »Ganz ruhig.«
Die Straße, die hier von ziemlich dicht hintereinander stehenden Eukalyptusbäumen gesäumt war, verlief am anderen Ende des Sees in einem Bogen. Als Hartmann diese Kurve erreichte, schloß der Jogger mit dem Hund um fünfzig Meter zu ihm auf. Hartmann schaute nach rechts hinüber und erblickte den »Hipodrómo de Palermo«, wo die Pferde gerade ihr Morgentraining absolvierten. Es war so ruhig, daß er ihre Hufschläge hören konnte, während sie ihre erste Runde vollendeten.
Als der Mann mit dem Hund hinter Hartmann in die Kurve lief, blickte er nach hinten. Ortega war nicht zu sehen. Dann hob er den Arm, als wolle er jemandem ein Zeichen geben, und befreite, immer noch im gleichen Rhythmus weiterlaufend, seinen Hund von der Leine. »Los, Drum, faß ihn!«
Der Dobermann hechtete in gewaltigen Sätzen los und näherte sich Hartmann. Währenddessen setzte sich der in der Kurve auf der Avenida del Libertador geparkte Wagen in Bewegung, beschleunigte und raste Richtung Parkeingang. Die Reifen quietschten beim Einbiegen in die scharfe Rechtskurve.
Hartmann hörte, wie der Hund über das Pflaster auf ihn zustürmte, konnte das Geräusch aber zunächst nicht von den Hufschlägen der Pferde in der Ferne unterscheiden. Als er den Hund endlich bemerkte, war es bereits zu spät, denn das schwere Tier hatte schon Anlauf genommen und sprang ihm mit der Wucht seiner dreißig Kilogramm in Höhe der Schultern auf den Rücken, während es gleichzeitig seine mächtigen Kiefer in sein Genick grub.
Durch den kräftigen Stoß des Hundes geriet Hartmann ins Straucheln, fiel mit ausgestreckten Armen vornüber und schlug mit dem Kopf auf dem Weg auf.
Der Hundehalter hatte inzwischen zu Hartmann und dem Dobermann aufgeschlossen. Er hielt eine großkalibrige Pistole in der rechten Hand und befahl seinem Hund: »Faß ihn, Drum, faß ihn!«
Adrian Hartmann, der immer noch unter dem Dobermann lag, fuhr den Mann eher wütend als verängstigt an: »Nehmen Sie endlich diese Bestie weg. Sie bringt mich noch um!«
Doch plötzlich wurde Hartmann klar, daß es sich nicht um einen Unfall handelte.
Inzwischen hatte der Wagen die Kurve hinter sich gebracht und befand sich ungefähr siebzig Meter hinter Hartmann. Ortega war völlig überrascht, als er sah, was sich vor seinen Augen abspielte. Dann blieb er stehen und griff mit einer raschen, aber ruhigen Bewegung nach seiner Waffe. Schwer atmend, bemühte er sich, genau zu zielen, und es gelang ihm noch, einen Schuß abzugeben, bevor er durch zwei Gewehrschüsse in die Brust getötet wurde, die aus dem Wagen abgefeuert wurden. In dem Augenblick als die Gewehrschüsse peitschten, lockerte der Hund seine Kiefer, und Hartmann nutzte sofort die Gelegenheit, um nach seinem handlichen kleinen Revolver zu greifen, den er hinten an der Hüfte trug. Er feuerte wahllos auf die beiden Männer, die auf ihn zurannten, und auf den Hundehalter, den er am Knie verwundete. Doch schon hatte ihn der Angreifer mit dem Gewehr erreicht und schoß direkt auf seinen Kopf. Hartmanns Blut zerfloß im Straßenstaub zu einer grauroten Lache.
Nachdem sie einen raschen Blick über den menschenleeren Park geworfen hatten, bestiegen die drei Männer den Wagen. Der Verwundete hielt sein Knie, während die beiden anderen ihm halfen. Der Dobermann kletterte hinten hinein. Noch bevor die Türen richtig zugeschlagen waren, jagte der Wagen schon los und raste aus dem Park.
»Hier, nimm!« sagte der Gewehrschütze und langte unter den Sitz, wo er ein Tuch hervorzog. Er reichte es dem Hundehalter, der sein Bein krampfhaft umfaßt hielt. »Das muß als Verband reichen, es wird noch eine Weile dauern, bis uns ein Arzt helfen kann.«
»Du hast es vermasselt, Mann!« rief einer der anderen Männer und griff nach dem Tuch. »Warum mußtest du ihn gleich erschießen? Ihn zu verletzen hätte doch gereicht!«
Der Mann mit dem Gewehr strich sich mit der Hand über seine schweißnasse Stirn. Das noch friedlich und ruhig im Morgenschlaf liegende Buenos Aires zog rasch an ihnen vorbei. »Ich mußte irgendwas unternehmen. Noch ein Schuß, und einer von uns wäre vielleicht tot gewesen. Betrachte es mal so rum. Wir haben allen die Mühe des Prozesses erspart. In sechs Monaten wäre er doch sowieso hingerichtet worden.«
»Da ist was dran«, brummte der andere Mann, der dabei war, das Knie seines Freundes provisorisch zu verbinden. »Aber jetzt können wir der Welt nichts vorweisen. Wir hätten jedem zeigen können, was für ein Schwein er war. Wir brauchen doch die Publicity.«
»Zumindest wird die Polizei in diesem Fall Terroristen aus der linken Szene verdächtigen«, meinte der Fahrer mit tiefer Stimme. »Hartmann war ein Konservativer. An uns wird dabei keiner denken.«
»Ist das wirklich so vorteilhaft?«
Die Frage blieb unbeantwortet, denn die Männer konzentrierten sich nun auf ihr Ziel.
Als sie mit quietschenden Reifen auf dem Vorfeld des Aeroparque Ciudad de Buenos Aires angekommen waren, stürmten sie Hals über Kopf aus dem Wagen und eilten zu einem wartenden DC-3-Frachtflugzeug. Zuerst ließen sie den Hund über die Gangway hochlaufen, dann folgten sie ihm ins Flugzeug. Als die Luke verschlossen war, verließ das Flugzeug das Vorfeld, rollte auf die Startbahn und beschleunigte rasch.
Bevor er das Sprechzimmer betrat, um seinen letzten Patienten an diesem Tag zu untersuchen, machte Dr.John Sukow am Fenster seines kleinen Labors eine Pause und blickte hinaus, um die Stimmung dieses Spätnachmittags auf sich wirken zu lassen. Für einen Oktobertag war es sehr angenehm: Die Sonne lachte, Kinder spielten vergnügt im Central Park. Es war ein wunderschöner Tag, eigentlich viel zu schön, um sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Der Sommer schien New York etwas länger als sonst verwöhnen zu wollen.
An der Tür klopfte es leise. Eine grauhaarige Frau in weißem Kittel sagte lächelnd: »Sie wissen doch, daß in Ihrem Sprechzimmer noch jemand auf Sie wartet, Dr.Sukow?« Er drehte sich um und erwiderte ihr Lächeln. »Ja, danke, Natascha. Ich habe es nicht vergessen. Aber heute ist es so wunderschön da draußen. Schauen Sie nur über den Park. Jeder genießt das wunderbare Wetter.«
Der Doktor begab sich nach draußen ins Vorzimmer. Er blickte auf die Uhr, es war fast vier. Vielleicht würde diese Untersuchung nicht zu lange dauern, und er könnte anschließend unten im Park einen Spaziergang machen. Wie oft bot sich ihm schon die Gelegenheit dazu? Dr.Sukow strich das Revers seines Arztkittels glatt und machte sich leicht humpelnd zu seinem Sprechzimmer auf. Bevor er eintrat, verweilte er kurz, um die Krankenkartei zu studieren, die Natascha für ihn bereitgelegt hatte.
Die Kartei enthielt nur einen Auskunftsbogen, der unvollständig ausgefüllt war und keine Eintragung im Feld »Anlaß des Arztbesuchs« aufwies. Name: Mary Dunn. Angaben zum Personenstand: keine. Geburtsdatum: 22.02.1916. Anschrift: Americana Hotel. Beruf: Verwaltungsangestellte im Krankenhaus. Geburtsland: Polen.
Die letzte Angabe ließ Dr.Sukow aufmerken, denn sie rief für einen kurzen Moment eine verschwommene Erinnerung in ihm hervor. Dann steckte er den Auskunftsbogen in die Kartei zurück und betrat das Sprechzimmer.
»Guten Tag, Mrs.Dunn«, wandte er sich an die Dame und reichte ihr die Hand. Die gutgekleidete, sehr rüstig wirkende Frau ergriff seine Hand und drückte sie kräftig: »Guten Tag, Herr Doktor.«
»Nehmen Sie doch bitte Platz.« Sukow zog einen Stuhl unter seinem Schreibtisch vor und faltete die Hände. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Es fällt mir etwas schwer, es zu sagen, Herr Doktor. Einen Augenblick, bitte.« Sie sprach mit leichtem Akzent. »Darf ich das hier ablegen?« Sie wies auf ihre Handtasche und eine zusammengefaltete Zeitung.
»Selbstverständlich.«
Sie legte die Handtasche und die Zeitung auf den Tischrand. Als sie die Hand zurückzog, faltete sich die Zeitung auf, und das Titelblatt kam zum Vorschein. »Ich bin mir nicht sicher, ob Sie mir überhaupt helfen können, Dr.Sukow«, sprach sie ruhig und blickte ihn dabei an. »Mein Problem ist etwas ungewöhnlich, und ich bin schon bei so vielen Ärzten gewesen.«
John Sukow nickte. Diese Art von Einleitung kannte er von unzähligen Patienten. »Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Sprechen Sie nur weiter.« Bei diesen Worten schweifte sein Blick zu der Zeitung, an der ihm plötzlich etwas auffiel. Er beugte sich leicht nach vorne.
»Man hat Sie mir empfohlen, Dr.Sukow«, fuhr sie im gleichen Tonfall fort. »Und ich weiß auch gar nicht, wo ich eigentlich beginnen soll.«
»Ja, und was …?« Das Foto auf der Titelseite interessierte ihn. Unwillkürlich runzelte er die Stirn. »Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich einen kurzen Blick in Ihre Zeitung werfen?«
»Aber sicher.«
Er griff nach der Zeitung und betrachtete das Foto ganz genau. Dann las er die Bildunterschrift: »Adrian Hartmann, ein prominenter Juwelenhändler aus Buenos Aires, wurde am frühen Morgen von unbekannten Tätern erschossen.«
»Entschuldigen Sie bitte«, meinte Dr.Sukow. »Einen Augenblick dachte ich, daß …« Erneut richtete er seinen Blick auf die Zeitung und las genau jedes Wort des Artikels, der unter der Abbildung stand.
Der Artikel war ziemlich lang und beschrieb größtenteils die Geschäfte Hartmanns in Südamerika sowie das, was man über die mehr als zwanzig Jahre wußte, die er in Buenos Aires verbracht hatte. Der Bericht endete mit der Feststellung, daß sein Tod höchstwahrscheinlich in Zusammenhang mit den jüngsten Terroranschlägen in Argentinien gesehen werden müsse, da Hartmann weithin als Erzkonservativer bekannt gewesen sei.
»Interessant …«, murmelte John Sukow.
»Wie bitte?«
Er wandte sich wieder Mrs.Dunn zu. »Oh, entschuldigen Sie bitte. Es kommt nur selten vor, daß man in New York auf ein Exemplar des Buenos Aires Herald stößt. Kommen Sie gerade von da unten?«
»Nun …« Sie wählte ihre Worte mit Bedacht, »das Problem, das ich habe, hat damit zu tun … Wissen Sie …, ich suche jemanden, der …«
John Sukow lehnte sich wieder zurück und studierte das Gesicht der Frau, die ihm gegenübersaß. Irgendwie war alles merkwürdig. Ihre Züge waren ihm ebenfalls auf unbestimmte Weise vertraut und riefen dieselben beklemmenden Erinnerungen in ihm hervor wie die Abbildung in der Zeitung. Vertraut und doch nicht …
Während er das Bild noch einmal ganz genau betrachtete, es in sich aufnahm und jede Einzelheit von Hartmanns Gesicht analysierte, spürte er, wie er unwillkürlich erschauerte. Nein! durchfuhr es ihn panikartig. Es ist unmöglich! Nicht nach all den Jahren!
Schließlich legte er die Zeitung wieder hin und beugte sich über den Schreibtisch. Er faltete die Hände. »Mrs.Dunn«, fragte er ohne Umschweife, »kennen wir uns?«
Polen, Dezember 1941
1
Um sechs Uhr früh stand SS-Rottenführer Hans Keppler auf dem Bahnsteig des Bahnhofs von Oświęcim und wartete auf seinen Zug. Dem jungen Unteroffizier, der an diesem bitterkalten Morgen auf die Schneeflocken starrte, die auf dem feuchten Holz der Gleisbohlen zusammenschmolzen, wurde die Zeit allmählich zu lang. Seit fast drei Stunden befand er sich nun schon auf dem Bahnsteig und blickte durch den gleichmäßig rieselnden Schnee die Gleise entlang. Wann würden die Lichter der Lokomotive endlich auftauchen? Er lauschte gespannt auf das ersehnte Pfeifen aus der Ferne.
Weihnachten stand vor der Tür, doch dem jungen Soldaten war nach Feiern nicht zumute. Der Gedanke an die vor ihm liegenden freien Tage bedrückte ihn genauso wie die Stimmung auf diesem tristen Bahnhof. Den einzigen Bezug zu der festlichen Zeit bildeten hier die protzigen Büschel aus Kiefernzweigen, mit denen man jede Hakenkreuzfahne behängt hatte. Die anderen Wartenden, die zum Fest verreisen wollten, schlichen stumm durch den Bahnhof; man hatte sich inzwischen daran gewöhnt, daß die Züge keinen Fahrplan mehr einhielten; die Menschen ließen ihre Blicke wie geistesabwesend durch das fahle Morgenlicht schweifen.
Hans Keppler, dessen Nase und Wangen vor Kälte rot angelaufen waren, stampfte kräftig mit den Füßen auf dem Bahnsteig auf, um sich zu wärmen. Dies war wirklich der schlimmste Winter, den er je erlebt hatte, und nicht einmal sein schwerer Militärmantel konnte die Kälte von ihm fernhalten. Keppler reckte noch einmal den Hals, um die Gleise entlangzublicken. Möglicherweise war es ja auch gar nicht die eisige Morgenluft, die ihn frösteln ließ, dachte er, sondern die Kälte, die sich in seiner Seele ausbreitete. Dies war nicht der erste harte Winter in Polen, aber SS-Rottenführer Hans Keppler hatte niemals zuvor einen Wintertag als eisiger empfunden.
Man hörte ein Pfeifen aus der Ferne, und kurz darauf ließ sich schon das gepreßte Zischen einer Lokomotive vernehmen, die langsam in den Bahnhof ratterte. Während die Scheinwerfer der Lokomotive allmählich den Schleier des niederrieselnden Schnees durchbrachen, überlegte Keppler, warum der Zug mit Verspätung eintraf. Vielleicht hatte man ihn auf ein Nebengleis umgelenkt, um andere Züge, die aus dem Norden kamen, durchzulassen. Während er auf dem Bahnhof gewartet hatte, hatte er drei Güterzüge aus Richtung Krakau durchfahren sehen. Mit ihren versiegelten Waggons waren sie durch den Bahnhof gerumpelt, unterwegs zu Orten der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, wovon das schrille Pfeifen der Lokomotive unheilvoll kündete. Das einzige, was sie zurückgelassen hatten, waren die Schneehaufen neben den Gleisen, die durch den beiseite gepflügten Schnee entstanden waren.
Von den wenigen schweigsamen Reisenden, die auf dem eisigen Bahnsteig warteten, wußte Keppler als einziger, was in den finsteren Zügen transportiert wurde.
Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, nahm SS-Rottenführer Keppler seinen Koffer und ging schnell zur Waggontür, wo er dem Schaffner seine Papiere zeigte. Dieser forderte ihn nach sorgfältiger Prüfung zum Einsteigen auf. Während er sich mit seinem sperrigen Koffer durch den engen Gang zwängte, warf Keppler einen kurzen Blick in jedes der Abteile. Er wollte unbedingt ein Abteil für sich alleine und zweifelte gleichzeitig, ob die Ablenkung durch andere nicht doch der Beschäftigung mit seinen eigenen Gedanken vorzuziehen war. Beim vorletzten Abteil blieb er kurz stehen und ließ seinen Koffer los, um ihn in die andere Hand zu nehmen. Drinnen saßen sich vier Wehrmachtssoldaten auf zwei Holzbänken gegenüber. Sie hatten es sich bequem gemacht und ließen leise eine Flasche kreisen.
Als er den zögernden Keppler auf dem Gang bemerkte, riß einer der Soldaten, der gerade seine Stiefel polierte, den Arm hoch und rief:
»Heil Hitler!«
Keppler blickte nun ebenfalls den Soldaten an und starrte auf das zarte Gesicht, das so jung war wie das seine, und erwiderte murmelnd:
»Hitler!«
»Wollen Sie sich zu uns setzen, Herr Rottenführer?«
Keppler schüttelte den Kopf. »Nein, danke, es warten noch ein paar Freunde auf mich …«
»Sind Sie auch auf dem Weg an die Front?«
Keppler hob sein schweres Gepäck hoch, trat einen Schritt zurück und entgegnete dann mit schwacher Stimme: »Nein, ich habe Urlaub. In Krakau werde ich umsteigen und den Zug nach Sofia nehmen.« Während er sich entfernte, konnte er den Blick nicht von dem Gesicht des jungen Soldaten lösen. An die Front, hatte er gesagt. Die Front! Mit welch einem Stolz hatte er dieses Wort ausgesprochen! Der Gedanke an den Ruhm hatte seine Augen leuchten lassen! Hans Keppler erkannte sein eigenes Gesicht wieder, wie es vor achtzehn Monaten wohl gewirkt haben mußte. Seinen Idealismus. Seine Begeisterung.
Er machte kehrt und taumelte zum nächsten Abteil, das zu seiner unendlichen Erleichterung leer war.
Dort nahm er Platz und legte seinen Koffer neben sich auf die Bank. Er drückte die Stirn gegen das Fenster. Dann vernahm er das Zischen der Luftdruckbremse, und mit einem Ruck setzte sich der Zug in Bewegung. Der Aufenthalt war überraschend kurz gewesen, und es waren nur wenige Passagiere zugestiegen. Es war eben nicht die Zeit für große Reisen. Wohin hätte man auch fahren sollen?
Während der Zug langsam beschleunigte, drückte Keppler sein Gesicht weiter gegen das kalte Glas und starrte immer noch durch das Fenster in den finsteren Morgen. Er bemühte sich, seine Gedanken auf Sofia zu richten, seine Geburtsstadt, in der er seine Kindheit und die schönsten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Er versuchte, sich den Anblick der Weichsel im Sommer ins Gedächtnis zurückzurufen, in der er immer mit anderen Spielkameraden geschwommen war. Die Weichsel im Frühjahr, deren anschwellendes Hochwasser stets für helle Aufregung gesorgt hatte, trat vor sein geistiges Auge und die Weichsel im Winter in dem Zustand, in dem sie sich nun wohl befand: zugefroren, von einer dicken Eisschicht bedeckt, so daß man darauf Schlittschuh laufen konnte. Dann dachte er an seine Großmutter, eine herzliche alte Dame, eine Polin, die eine kleine Backstube besaß und in deren Herz ihr Enkel stets einen besonderen Platz einnahm – egal, welche Uniform er trug. Hans Keppler seufzte auf. Welche Ironie, dachte er, daß er zwei Jahre zuvor noch geglaubt hatte, das Anlegen dieser Uniform bedeute einen Höhepunkt in seinem Leben. Und nun mußte er feststellen, daß die Totenkopfinsignien ihm eigentlich nur ängstliche Blicke oder Gelächter hinter seinem Rücken einbrachten und eine unüberbrückbare Kluft zu den anderen darstellten, die jede Freundschaft ausschloß.
Er kniff die Augen zusammen, um die Erinnerungen zu vertreiben, die er mit sich trug, und wußte doch, daß es vergebens war. In seinem Ringen mit sich selbst fühlte Keppler sich wie ein angeketteter Hund, der immer wieder dieselben Runden dreht. All sein Grübeln und Sinnen in den letzten, für ihn so schweren Monaten hatte ihn nicht einen Schritt weitergebracht. Es gab keine Lösung, und immer wieder drängte sich ihm die Frage auf: Wie hatte es dazu kommen können?
Stets kehrte er an den Ausgangspunkt seiner Überlegungen zurück und begann dann erneut, sich die letzten zwei Jahre seines Lebens mit allen Etappen vor Augen zu führen, so als hoffte er, auf den Moment zu stoßen, ab dem das Verhängnis seinen Lauf genommen hatte.
Als Kind eines deutschen Vaters und einer polnischen Mutter war er vor zweiundzwanzig Jahren in Sofia zur Welt gekommen, einer kleinen Stadt genau zwischen Warschau und der tschechoslowakischen Grenze gelegen, und hatte die ersten zwölf Jahre seines Lebens in dieser ländlichen Gegend an der Weichsel verbracht. Dann war sein Vater, ein Hütteningenieur, mit seiner Familie nach Essen in Deutschland gezogen, wo er eine bedeutende Position bei Krupp bekleidete, so daß er seinem einzigen Sohn das behagliche Leben des gehobenen Mittelstands bieten konnte. Einige Zeit nachdem Hans in die Hitlerjugend eingetreten war, hatte er den Wunsch geäußert, später zur Wehrmacht zu gehen, und sich dabei von allerlei Gedanken an das Eiserne Kreuz und andere ruhmreiche Auszeichnungen leiten lassen, die ihn in seinem patriotischen Idealismus noch bestärkten. Doch sein Vater, der mit seinem Sohn Höheres im Sinn führte, hatte darauf bestanden, daß Hans weiterhin zur Schule ging, bis sich ihm eine bessere Perspektive bot.
Und diese »bessere Perspektive« hatte sich ihm auch schon bald eröffnet, indem er sich zur SS gemeldet hatte und angenommen worden war, jedoch nicht in der Schutzstaffel, dieser Eliteeinheit in ihren schicken schwarzen Uniformen, deren Anblick bei jedermann Schaudern und Bewunderung zugleich hervorrief, sondern in der kurz zuvor gebildeten Verfügungstruppe, deren Verbände später im bewaffneten Zweig der SS aufgingen. Diese dann als Waffen-SS bekannte Untergliederung war gerade erst durch Freiwilligenanwerbung verstärkt worden, um den zunehmend steigenden Bedarf an Kämpfern an der unlängst eröffneten russischen Front zu decken. Und auch wenn Hans Keppler nicht die begehrte schwarze Uniform trug und er sich in der Rangordnung relativ weit unten befand, so zierte ihn immerhin doch das Totenkopfemblem an der Mütze, und er war dem »Reichsführer SS« Himmler unterstellt.
Wie stolz war er gewesen, als er den Gestellungsbefehl erhalten hatte, ein unbekümmerter, von Selbstvertrauen überschäumender junger Mann mit hohen Stiefeln, von Idealen bewegt und darauf brennend, dem Führer zu dienen. Er sah sie noch vor sich, seine Eltern, wie sie sich achtzehn Monate zuvor mit einem strahlenden Lächeln am Bahnhof von ihm verabschiedet, ihn umarmt und getröstet hatten. Hans hatte an diesem sonnigen Tag seinem Vater und seiner Mutter immer wieder beteuert, daß er mit dem Eisernen Kreuz zurückkehren und es einen Ehrenplatz über dem Kamin einnehmen werde, um dort die Bewunderung von Freunden und künftigen Generationen auf sich zu ziehen.
Während er, dem gleichmäßigen Holpern des Zuges folgend, sanft hin und her schaukelte, starrte er unbewegt auf den Schnee, der sich wie ein Vorhang am Abteilfenster niedergeschlagen hatte. Hans spürte, wie sein Herz von Traurigkeit und Reuegefühlen erfaßt wurde.
Er schloß die Augen. Nein … Kein Eisernes Kreuz … Seine »Belohnung« aus Oświęcim war lediglich eine goldene Uhr, die er einem toten Juden abgenommen hatte.
»O mein Gott!« flüsterte er und entfernte sich vom Fenster. Er fuhr sich über die Stirn und stellte fest, daß er stark schwitzte. Die Erinnerungen stiegen wieder in ihm auf, sie waren zu bewegend für ihn. Wenn er doch nur mit jemandem sprechen könnte! Aber mit wem denn? Wer im Reich hätte ihm denn geglaubt, hätte ihn verstanden, wenn er ihm das furchtbare Geheimnis anvertraut hätte, das er kannte? Und selbst wenn es jemanden gäbe, wie sollte er, der SS-Rottenführer Hans Keppler, sich denn offenbaren, ohne damit zum Verräter an seinem Vaterland zu werden?
»O mein Gott! …« seufzte er erneut.
Der Zug stampfte weiter durch den schneeverhangenen Morgen, und Keppler, immer noch alleine in seinem Abteil, schwitzte und fröstelte zugleich in seiner Uniform. Zwei Wochen, dachte er bedrückt. Zwei Wochen nicht mehr an diesem Ort. Zwei Wochen, um über alles nachzudenken und wieder zu mir zu finden.
Die Bremsen des Zuges kreischten entsetzlich, und der junge Rottenführer erinnerte sich an ein anderes, ebenso entsetzliches Kreischen, da unten. Da unten in Oświęcim, in Auschwitz …
Auch in Sofia rieselte der Schnee in dichten Flocken, so daß die menschenleeren Straßen in ein besänftigendes Weiß gehüllt wurden, was diesem Vorweihnachtstag eine eigenartige Stille verlieh. Aber die Stille war trügerisch, denn an diesem Morgen war nicht jeder damit beschäftigt, Christbaumkerzen aufzustecken oder eine Weihnachtsgans zu braten. Ein Getreidebauer namens Milewski trieb hastig sein Pferd über das glatte Kopfsteinpflaster, und die Eile, die er dabei an den Tag legte, schien nicht zu dieser friedlichen Morgenstunde zu passen. Offensichtlich war die Eile aber angebracht, denn auf seinem Karren transportierte er einen Mann mit fürchterlichen Wunden.
Als er am Nebeneingang des Krankenhauses von Sofia, einem imposanten grauen Gebäude, ankam, sprang er von seinem Karren herunter in den Schnee und versuchte, sein Pferd zu besänftigen. Das Tier, das den Blutgeruch witterte, der von seiner Fracht ausströmte, gebärdete sich aufgeregt in seinem Geschirr. Gleich darauf tauchten auch schon zwei ältere Männer in weißen Sanitäteruniformen aus dem Gebäudeinnern auf und legten den Verletzten sofort auf eine Trage, ohne ein Wort dabei zu verlieren. Milewski, dem der Schrecken ins Gesicht geschrieben stand, tastete unruhig nach einer Zigarette und beobachtete schweigend, wie der in ein blutbeflecktes Leinentuch eingehüllte Mann hinten von seinem Wagen heruntergeholt und auf die Trage gelegt wurde. Er sah den beiden Sanitätern nach, wie sie, Spuren im Schnee hinterlassend, mit ihrer Last zum Eingang zurückeilten und schließlich im Gebäude verschwanden. Während er mit einer gewissen Gleichgültigkeit die Stelle betrachtete, an der der Verletzte gelegen hatte, zog er an seiner Zigarette und dachte, daß er einige der Blutflecken wohl niemals mehr würde entfernen können.
Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich einen anderen Mann neben sich, der einen weißen Arztkittel trug und sich unvermittelt an ihn wandte.
»Der Junge, den Sie da für uns gebracht haben«, fragte er mit distanzierter, von beruflichem Interesse zeugender Stimme, »ist das Ihr Sohn?«
»Ja, Herr Doktor.«
»Es war gut, daß Sie ihn gebracht haben. Der Operationssaal ist vorbereitet. Sie haben richtig gehandelt.«
»Ja, Herr Doktor.«
Beide Männer starrten auf den Wagen, auf dessen Ladefläche sich die Blutlache immer noch ausbreitete. Nach einem weiteren kurzen Schweigen meinte der Arzt: »Ihr Sohn hat uns etwas Interessantes berichtet. Eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte. Über diesen Mann.«
Der Bauer blickte das erste Mal richtig zu dem großen Arzt auf, der so vieldeutig mit ihm sprach. Dann schüttelte er seinen kantigen Kopf und entgegnete: »Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, Doktor, aber sie stimmt. Und das ist noch nicht alles.«
In dem reglosen Gesicht des Arztes zuckte es kurz. »Erzählen Sie mir, was geschehen ist.«
Als er zwei Stunden später in Krakau ankam, erfuhr Hans Keppler zu seiner Erleichterung, daß der Anschlußzug nach Sofia in Kürze eintreffen werde. Es schneite immer noch, und das graue, metallisch schimmernde Morgenlicht verhieß beständigen Schneefall für den ganzen Tag. Man konnte dem jungen SS-Mann, der mit den wenigen anderen Passagieren auf dem Bahnsteig stand, deutlich anmerken, daß er schnell weiterreisen wollte. Ein paar Meter von Keppler entfernt, der ungeduldig die Gleise beobachtete, befand sich eine junge Frau, die ihn mit flüchtigen Blicken bedachte. Irgend etwas an dem jungen Soldaten rief ihre Aufmerksamkeit hervor. Seine unstet hin und her schweifenden Blicke, das nervöse Spiel seiner Hände, und – noch ungewöhnlicher – seine schlaff herabhängenden Schultern vermittelten ihr den Eindruck unendlicher Müdigkeit, was ihr um so mehr auffiel, als es sich doch um einen Mann handelte, dessen Gang kerzengerade und aufrecht hätte sein müssen. Sie hatte in dieser Gegend Polens viele der überaus selbstbewußten, ja oftmals großspurig auftretenden Mitglieder des Schwarzen Ordens gesehen, wie sie zu zweit oder grüppchenweise einherstolzierten wie paradierende Pferde, und selbst wenn ein SS-Mann einmal alleine unterwegs war, nahm er stets eine arrogante, abweisende Haltung ein. Aber nicht dieser Soldat. Er wirkte völlig erschöpft, als seien ihm jede Kraft und Energie verlorengegangen.
Ein Pfeifen aus der Ferne verkündete den Wartenden, daß der Zug sich näherte. Die junge Frau langte nach ihren vielen Paketen, die sie alle auf ihren Armen zu verstauen versuchte, und Keppler griff rasch nach seinem Koffer.
Als die Lok sich in den Bahnhof schob und pfeifend anhielt, bemerkte Keppler zu seiner Bestürzung, daß der Zug hoffnungslos überfüllt war, vor allem mit Soldaten der Wehrmacht, die sich auf dem Weg an die Ostfront befanden. Plötzlich stürmten ein paar Soldaten aus dem Bahnhofsgebäude heraus, um zu ihren Kameraden im Zug zu stoßen, und drängten dabei die junge Polin beiseite, so daß ihre Gepäckstücke auf den Boden fielen. Als sie aufschrie, wandte Keppler sich um, und da er sah, wie sie verzweifelt über den Boden kroch und ihre Pakete zusammensuchte, ließ er seinen Koffer los, um ihr zu helfen.
»Diese Mistkerle!« zischte sie auf polnisch und versuchte, die verstreut umherliegenden Päckchen wieder auf ihren Armen zu verstauen.
»Die haben Sie eben nicht gesehen«, sagte Keppler ebenfalls auf polnisch und hob ein eingewickeltes Päckchen vom Boden auf. Dabei bemerkte er, wie sich ein Fleck auf dem braunen Packpapier ausbreitete.
»Natürlich haben sie mich gesehen!« gab sie zurück. »Diese Hunde. Die sind doch alle gleich!«
Hans hielt das feuchte Paket, bei dessen Geruch er die Nase verzog, auf Armlänge von sich. »Es tut mir leid, aber irgend etwas muß zerbrochen sein.«
Sie blickte auf das Päckchen und schrie erneut. »O nein! Ein halber Liter! Und es war doch so schwer, daranzukommen! Lassen Sie nur, Sie können nichts tun.«
Sie richteten sich gleichzeitig wieder auf. Während Keppler schweigend die übrigen Päckchen festhielt, wischte sie ihre Knie ab und brachte ihr Haar wieder in Ordnung.
»Danke schön«, keuchte sie, völlig außer Atem, und strich sich noch eine Strähne aus dem Gesicht. »Ich hätte bestimmt den Zug verpaßt, wenn Sie mir nicht …« Plötzlich hielt sie inne und starrte auf seine Uniform.
Keppler entfernte sich rasch und ging zu seinem Koffer zurück, den er mit seiner freien Hand ergriff, und bestieg dann den Zug.
Bevor er die erste Stufe betrat, hielt er kurz inne und blickte sich um. Die junge Frau war wie angewurzelt stehengeblieben. »Los, kommen Sie!« rief er ihr zu. »Schnell!« Das Pfeifen erklang, und der Zug fuhr ruckend an. Plötzlich stürzte die junge Frau auf Keppler zu, und es gelang ihr trotz der Pakete, die sie auf den Armen trug, auf den anfahrenden Zug zu springen. Gemeinsam schafften sie es gerade noch in den Waggon.
Um Atem zu holen und sich sicheren Stand zu verschaffen, ließ sich Keppler leicht gegen eine Wand im Zuginnern fallen. Dabei schaute er unentwegt die junge Frau an und dachte: Ich habe dich schon vorher gesehen.
Auch die junge Frau hatte sich an die Wand gelehnt. Sie erwiderte jedoch seine Blicke nicht, sondern schaute auf die an ihr vorbeiziehende Landschaft hinaus.
Keppler starrte sie immer noch an. Er betrachtete ihr dickes braunes Haar, das in der Mitte gescheitelt war und auf ihre Schultern herabfiel. Er registrierte ihre großen braunen Augen, die gezupften, bogenförmig verlaufenden Augenbrauen, die kleine, wohlgeformte Nase und ihren vollen Mund. Ja, er hatte sie schon vorher gesehen, bestimmt hundertmal. Sie war eine Polin bäuerlicher Abstammung, genauso wie die, die er von Oświęcim her kannte. Aber diese jungen Frauen da unten waren mit ihren leeren Blicken und ihren dünnen, leblosen Mündern nur gespenstische Abbilder der Person gewesen, die ihm hier gegenüberstand. So wie sie hatten sie wohl einst auch ausgesehen. Diese jungen Frauen da unten …
Plötzlich blickte er in eine andere Richtung.
Als sie murmelte: »Danke schön für Ihre Hilfe«, wandte er sich ihr wieder zu und zwang sich zu einem Lächeln.
»Wir wollen einen Sitzplatz suchen«, schlug er vor und löste sich von der Wand.
Er führte sie durch die zweite Klasse des Zuges, gegen dessen unruhige Bewegungen er anzukämpfen hatte. Die meisten Abteile waren von deutschen Soldaten besetzt, die sangen, Zeitschriften lasen und ihren Zigarettenqualm in die Luft bliesen. Als er schließlich am Ende des Waggons ankam und keine Lust mehr hatte, sich mit seinem schweren Koffer und den Päckchen der jungen Frau durch die Gänge zu zwängen, blieb er am Eingang zum letzten Abteil stehen, in dem ein älteres polnisches Ehepaar saß. Es handelte sich um einen weißhaarigen Mann mit seiner rundlichen Frau. Beide reagierten mit einem nervösen Lächeln und nahmen hastig ihre Sachen von der Bank herunter, als sie den Soldaten sahen.
Keppler trat ein, ließ sich auf den Sitz am Fenster fallen und legte die Päckchen neben sich ab. Dann bat er die junge Frau, auch einzutreten. Sie setzte sich ihm gegenüber hin und preßte die Sachen, die sie bei sich trug, weiterhin krampfhaft gegen ihre Brust.
»Legen Sie doch alles da oben hin«, schlug Keppler ihr vor und zeigte auf das Gepäcknetz.
Doch die junge Frau schüttelte nur den Kopf.
Er zuckte mit den Schultern. Dann blieb er ruhig auf seinem harten Platz sitzen.
Die anderen Fahrgäste im Abteil beäugten ihn argwöhnisch.
»Was war denn in dem Päckchen, in dem etwas zerbrochen ist?« wandte er sich mit einemmal an die junge Frau. »Dieser Geruch war ganz neu für mich.«
Sie antwortete ihm mit unsicherer Stimme: »Es war Äther.«
»Äther!«
»Ja, für das Krankenhaus in Sofia.«
»Und die anderen Päckchen?«
»Alle fürs Krankenhaus, vor allem Sulfonamide, ein halber Liter Äther und Verbandsmaterial. Es ist heutzutage wirklich nicht leicht, solche Dinge zu besorgen.«
Er nickte und beobachtete ihr Gesicht, auf dem er Besorgnis, Angst, aber auch eine gewisse Neugierde ausmachte. Daneben haftete diesem anziehenden bäuerlichen Gesicht aber noch etwas anderes an, etwas, was unter der Oberfläche verblieb, so als wolle sie es verbergen. War es Widerstand? Oder Haß? »Sie sprechen sehr gut Polnisch«, wagte sie zu bemerken.
»Ich bin in Sofia geboren und aufgewachsen. Ich heiße Hans Keppler.«
»Sehr erfreut, Anna Krasinska. Fahren Sie nach Sofia?«
Er nickte.
»Ich dachte, Sie sind auf dem Weg an die Front – wie die anderen hier im Zug.«
Keppler lächelte düster. »Die Waffen-SS hat noch anderes zu tun, als die Rote Armee zu bekämpfen. Ich habe zwei Wochen Urlaub. Wohnen Sie in Sofia?«
»Ja, bei meinen Eltern. Mein Vater ist Schulrektor, und ich arbeite als Schwester im Krankenhaus.«
Während er sich mit Anna Krasinska unterhielt, blickte Keppler kurz zu dem älteren Paar hinüber. Als das Gespräch einen normalen Verlauf nahm, hatten der Mann und die Frau sich entspannt. Sie hatten sich zurückgelehnt und hielten die Augen geschlossen.
Überall war es das gleiche. Unzählige Male hatte er sich schon diesem Blick gegenübergesehen, den er auch bei Anna Krasinska festgestellt hatte, als er ihr das tropfende Päckchen mit der Äther-Flasche gereicht und sie bemerkt hatte, wer, oder besser, was er war. Diese Angst, diese plötzliche Zurückhaltung, das Mißtrauen. Und am liebsten hätte er herausgeschrien: Diese Uniform ist doch nicht meine Haut! Seht doch, darunter bin ich, Hans Keppler!
Genau wie am Bahnhof konnte Anna Krasinska auch nun nicht umhin, ständig den Soldaten zu mustern, der inzwischen seine Blicke nach draußen über die winterliche Landschaft schweifen ließ. Er schien nicht alt genug für diese Uniform, und die jugendlich unschuldigen Züge auf seinem Gesicht paßten nicht zu dem TotenkopfEmblem auf seiner Mütze. Keppler hatte lockeres, blondes, zu einer knabenhaften Frisur gekämmtes Haar und kornblumenblaue Augen, doch die Unruhe seines Blicks, das Ausdruckslose darin, vermittelten ihr auch hier einen zwiespältigen Eindruck von ihm.
Der Zug nach Lublin schaukelte und wackelte, während er durch das schneebedeckte Weichseltal stampfte. Erneut mußte er auf ein Nebengleis ausweichen, um einem aus Norden kommenden Zug Platz zu machen, dessen versiegelte geheimnisvolle Güterwaggons an ihnen vorbeirumpelten. Es galt, unbedingt die unheilvollen Termine einzuhalten.
Hans Keppler schloß die Augen, um sich den Anblick zu ersparen. Warum konnte der Zug nicht schneller fahren? Bis nach Sofia würde es noch eine Ewigkeit dauern. Eine Ewigkeit …
Der große Arzt stand auf der anderen Seite der Glasscheibe, die den Operationssaal vom Waschraum abtrennte. Er hatte sich einen weißen Kittel übergezogen und eine Maske angelegt, aber er gehörte nicht zum Operationsteam. Vielmehr war er ein Zuschauer, der abseits stand und die Vorbereitungen beobachtete.
Der Patient auf dem Tisch, der von Milewski schwerverwundet ins Krankenhaus gebracht worden war, hatte seit seiner Aufnahme das Bewußtsein nicht mehr wiedererlangt. Wie eine Leiche lag er unter den weißen, sterilen Abdecktüchern. Alles Leben schien aus ihm gewichen zu sein.
Heilige Jungfrau Maria, dachte der Doktor hinter der Scheibe, während er die präzisen Handgriffe des Chirurgen verfolgte. Bitte laß ihn leben, wenigstens so lange, bis er mir erzählt hat, was passiert ist.
Er kämpfte gegen das unerträgliche Verlangen nach einer Zigarette an und biß sich krampfhaft auf die Unterlippe. Was der Bauer ihm erzählt hatte, diese unglaubliche Geschichte, die der verblutende Mann noch hatte stammeln können, bevor er ohnmächtig geworden war, war das Schrecklichste, was er je gehört hatte.
Ohne auch nur einmal zu blinzeln, blickte er auf das Skalpell, das im Lichte der OP-Scheinwerfer aufblitzte. Und immer wieder durchfuhr es ihn: »Heilige Jungfrau Maria, laß ihn leben. Die Geschichte kann nicht wahr sein. Sie kann einfach nicht stimmen.«
»Darf ich Ihnen etwas zu essen anbieten?«
Keppler blickte ruckartig auf. Er musterte die alte Polin, die auf ihrem breiten Schoß ein paar Essenssachen vor ihm ausbreitete. Sie bot ihm ein Stück Hartkäse an.
»Danke, nein.«
Keppler blickte wieder aus dem Fenster. Draußen war es inzwischen heller. Der Tag brach an. Wie spät war es wohl? Hatte er geschlafen?
Plötzlich wurde er unruhig und schaute auf die junge Frau ihm gegenüber. Ihr Gesicht war ausdruckslos, und ihr Blick versicherte ihm, daß kein Anlaß zur Sorge bestand. Wenn er aufgeschrien hätte, wenn ihm im Schlaf nur ein Wort über die furchtbare Last, die er in sich trug, über die Lippen gekommen wäre, dann hätte er ihr den Schrecken unweigerlich ansehen müssen.
»Ich habe selber …«, erklärte er und bückte sich nach dem Koffer, der neben seinen Füßen auf dem Boden lag. Nachdem er kurz am Verschluß herumgenestelt hatte, holte er eine lange Wurst und ein Stück Schokolade hervor. Sofort sah er sich drei weit aufgerissenen Augenpaaren gegenüber.
Keppler nahm nun ebenfalls ein Messer aus der Tasche und schnitt mehrere Scheiben von der Wurst ab, die er dem staunenden alten Pärchen anbot. Der Mann, schüchtern und begierig zugleich, nahm die Scheiben mit einem gemurmelten »Dziekuje« entgegen, um dann verlegen lächelnd die Scheiben noch dünner zu schneiden.
Als er Anna ein Stück anbot, willigte sie wortlos, aber mit einem Lächeln ein und begann sofort, daran zu knabbern.
Nun wurde die Schokolade in Portionen geschnitten, und als er dem Pärchen einige Stücke reichte, reagierte es mit echter Begeisterung. »Lange schon haben wir keine Schokolade mehr gesehen, mein Herr. Wir werden sie für die Bescherung unserer Enkelkinder aufbewahren.«
Anna Krasinska, die ihr eigenes Stück Schokolade in ein Taschentuch einwickelte und es in die Jackentasche steckte, freute sich: »Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Schokolade bekommen habe. So viel, wie sie kostet, kann man gar nicht arbeiten.«
»Dann nehmen Sie das auch noch«, meinte Keppler und legte die übrige Schokolade, ein großes Stück, in ihren Schoß und machte sich daran, für sich selbst ein Stück Wurst abzuschneiden. Anna schaute ihn voller Verwunderung an. »Ich kann es nicht fassen! Warum geben Sie mir denn Ihre ganze Schokolade?«
Keppler mied ihren Blick und ließ ein Stück von der krümeligen Wurst in seinem Mund verschwinden. »Ich sagte Ihnen doch, ich habe genug. Und wenn ich in zwei Wochen auf meinen Posten zurückkehre, werde ich noch mehr bekommen.«
Während sie die Leckerei in der Tasche verstaute, fragte die junge Frau unbefangen: »Ist Ihr Posten hier in der Nähe, Herr Keppler?«
Ja, dachte er bitter, ich bin Aufseher in einem Konzentrationslager, doch der jungen Frau entgegnete er: »Dreißig Kilometer von Krakau. Ich sitze an einem Schreibtisch und bearbeite Akten.«
Sie lächelte erneut, die erste warme Geste, die Keppler in achtzehn Monaten erfahren hatte.
Plötzlich blieb ihm die Wurst beinahe im Hals stecken, er mußte würgen, um sie herunterzubringen. Er dachte an den unermeßlichen Preis des Essens, das zu verschlingen er sich anschickte. Was er verteilte, war Teil der Ration der Insassen, genauso wie die goldene Uhr und die Seidenstrümpfe, die er seiner Großmutter brachte.
Er konnte nichts mehr essen und wandte sich zum Fenster. Ein paar flüchtige Blicke auf sein Spiegelbild reichten ihm, um die Schweißperlen auf seiner Stirn zu bemerken.
Zur Verwunderung seiner Mitreisenden schnellte er plötzlich hoch und warf die restliche Wurst in Annas Schoß. »Geben Sie dies Ihrem Vater, dem Rektor. Ich habe noch viel mehr davon und bin überhaupt nicht hungrig.« Er stieß diese Worte voller Anspannung aus, als müsse er sich zusammenreißen. Dann torkelte er über die Beine der Anwesenden hinweg, rannte den Gang hinunter und stürzte zur Toilette, die glücklicherweise nicht besetzt war.
Er hielt seinen Kopf über die Toilettenschüssel und wartete geduldig, bis die schwankende Bewegung des Zuges ihm half, die Wurst herauszuwürgen. Schließlich kam sie hoch und quoll aus seinem Mund und wurde sogleich durch die Toilette auf die Gleise gespült.
Hans Keppler richtete sich wieder auf und begab sich an das Ende des Waggons, wo eisige Windböen und ein paar Schneeflocken durch geöffnete Fenster in das Innere des Zuges hineinwehten. Dort geriet er erneut ins Grübeln: Warum soll es denn in Sofia anders sein? Dort geht es mir bestimmt genauso schlecht. Die Alpträume werden mir keine Ruhe lassen. Und nach zwei Wochen muß ich dann wieder zurück.
Im Abteil ließ er sich wieder in seinen Sitz fallen und wich den neugierigen Blicken seiner Begleiter aus. Er schaute nach draußen auf den Schnee und fühlte, wie Sofia näher und näher kam. Es ging kein Weg daran vorbei: Er würde irgend jemandem erzählen müssen, was er wußte. Es wurde ihm jetzt immer deutlicher, daß er sein Gewissen von der schrecklichen Last befreien mußte, wenn er nicht ganz dem Wahn verfallen wollte. Hans Keppler wußte in seinem Herzen, daß er ein Verräter war, und diese Einsicht zusammen mit dem Geheimnis, das er in sich barg, wurde eine Qual für ihn. »Eine Zigarette, Herr Keppler?« wandte sich Anna Krasinska an ihn.
Er schaute auf die Zigaretten. Es handelte sich um Damske, die jeweils zur Hälfte aus Tabak und Baumwollfiltern bestanden und eigentlich nur von Frauen geraucht wurden, doch in dieser Zeit waren es die einzigen Zigaretten, die man sich überhaupt leisten konnte. Keppler dachte an die Zigaretten in seiner Tasche, die begehrten, veredelten Plaske mit ihrer runden Form, in Schachteln, die sich auf einen leichten Fingerdruck öffnen ließen und nur noch in privilegierten Kreisen zu finden waren. Doch er akzeptierte bereitwillig, tief bewegt, daß die junge Frau ihre letzten beiden Zigaretten mit ihm teilen wollte.
Die letzten Kilometer der Reise verbrachten sie rauchend und ohne ein Wort zu wechseln. Schließlich fuhr der Zug in den Bahnhof von Sofia ein.
Anna Krasinska sammelte alle ihre Päckchen zusammen, und diesmal gelang es ihr, sie auf den Armen zu verstauen. Sie bedankte sich noch einmal bei Hans Keppler für die Hilfe und den Proviant und stieg dann eilig aus. Während er langsam seinen Militärmantel zuknöpfte, blickte Keppler noch einmal aus dem Fenster und sah der hübschen jungen Frau nach, die sich stürmisch in die Arme eines Mannes warf, der auf dem schneebedeckten Bahnsteig auf sie wartete.
Als Keppler schließlich selbst den Zug verlassen hatte und die Bahnhofshalle betrat, war er froh, daß niemand ihn abgeholt hatte. Es war Heiligabend, und bevor er das Haus seiner Großmutter betrat, mußte er noch unbedingt eine Pflicht erfüllen. Der Gedanke daran war ihm gekommen, als er sich seiner Heimatstadt näherte.
Die Sankt-Ambroż-Kirche befand sich im Stadtzentrum am einen Ende des gepflasterten Marktplatzes, gegenüber dem örtlichen Hauptquartier der Deutschen. Bei der Kirche handelte es sich um ein beeindruckendes gotisches Bauwerk mit gleich hohen, in die schneeverhangene Luft hineinragenden Türmen, dessen Portale mit Heiligenfiguren geschmückt waren und das an den Dächern ringsherum von Wasserspeiern umgeben war.
Hans Keppler blickte zu dem geschnitzten Eichenportal auf. Obwohl er in seiner Kindheit ein gläubiger Katholik gewesen war, hatte er viele Jahre lang keine Kirche mehr besucht. Aber nun, da er sich das erste Mal seit langem wieder anschickte, die Kirche zu betreten, in der er getauft worden war und seine erste heilige Kommunion empfangen hatte, fühlte er eine innere Ruhe in sich, die er seit Monaten nicht mehr gekannt hatte.
Während er die Stufen hinaufstieg, zog er seine Mütze ab. Dann öffnete er das Portal und betrat die Kirche, wo er sofort von Wärme und dem Duft von Weihrauch eingehüllt wurde. Schließlich stellte er seinen Koffer in einem finsteren Winkel ab und verharrte einen Augenblick wie gebannt. Keppler ließ den Blick durch das Kirchenschiff schweifen und gewahrte hinten zu seiner Linken die Beichtstühle aus Holz, in denen, durch einen Vorhang abgeschirmt, der Priester saß, der die Beichte abnahm. Einige wenige Gläubige standen schweigend an, während ein paar andere Kirchenbesucher vor dem Altar ihre Bußgebete murmelten.
Keppler tauchte die Finger in die Weihwasserschale, die sich rechts von ihm befand, machte das Kreuzzeichen und ließ sich mit Blick auf den Altar auf ein Knie fallen. Als er den sterbenden Jesus am Kruzifix über dem Tabernakel gewahrte, fühlte er, wie seine Handflächen feucht wurden und ihm wieder Schweißperlen auf Gesicht und Hals traten, die den Kragen seines Mantels rasch durchnäßten. Dann erhob er sich. Als er sah, daß der Beichtstuhl leer war, fühlte er, wie ihm die Knie weich wurden. Schließlich begab er sich zu dem arkadenförmigen Gang hinüber.
Er schob den Vorhang beiseite und betrat den Beichtstuhl. Dann ließ er sich auf die Knie fallen, bekreuzigte sich und berührte mit einem Finger das Kruzifix, das über der schmalen, noch verschlossenen Luke hing, hinter der sich der unbekannte Priester verbarg.
Als er noch klein war, hatte er genau hier seine erste Beichte abgelegt.
Sein Herz pochte so laut, daß er kaum wahrnahm, wie das Gitter quietschend beiseite geschoben wurde und der Priester sich ihm zuwandte. Hinter dem engmaschigen Gitterwerk, das sie voneinander trennte, vermochte Keppler gerade die Umrisse eines menschlichen Gesichts wahrzunehmen. Der Priester flüsterte die Beichtformel.
Nach nicht enden wollenden Sekunden, während derer er seine schweißnassen Hände fest zusammenballte, hörte Keppler, wie der Priester murmelte: »Ja?«
Keppler wollte sprechen, doch seine Kehle war wie zugeschnürt.
»Stimmt irgend etwas nicht mit Ihnen, mein Sohn?« flüsterte der Priester.
»Vater, ich …«
Er fuhr sich mit den Händen über seinen Mantel. Er zitterte so fürchterlich, daß er Angst hatte, den ganzen Beichtstuhl zum Beben zu bringen. »Erteilen Sie mir Absolution, Vater. Und bitte fragen Sie nicht, warum!«
»Bist du krank?« erkundigte sich der Priester mit sanfter Stimme.
»Möchtest du lieber in meinem Arbeitszimmer mit mir sprechen?«
»Vater!« sprudelte es aus ihm heraus. »Vater … Ich habe schon so lange nicht mehr gebeichtet. Vater, ich muß Ihnen etwas gestehen …«
Keppler, der sich jetzt endlich überwunden hatte, fühlte, wie es ihm auf einmal leichter fiel zu sprechen.
Der Priester hörte geduldig und mit immer größer werdender Anspannung zu. Schließlich murmelte er ein Gebet.
2
Dr.Jan Szukalski ging langsam die Treppe vom zweiten Stock des Krankenhauses hinunter. Er war alleine, und das Geräusch seiner schwerfälligen Schritte hallte in dem kahlen Treppenhaus wider. Seit er sich als Kind am Bein verletzt hatte, humpelte er, und seine Behinderung machte sich besonders dann bemerkbar, wenn er müde und von Sorgen geplagt war, und dann wirkte er auch älter als seine dreißig Jahre. Unten am Treppenabsatz angekommen, blieb er eine Weile stehen und blickte den langen, düsteren Gang entlang, an dessen Ende sein Büro lag. Obwohl alle fünfzig Betten belegt waren, war das Krankenhaus an diesem Heiligabend des Jahres 1941 geheimnisvoll ruhig. Jan Szukalski wäre jetzt gerne mit Frau und Sohn zu Hause gewesen. Aber er konnte nicht einfach heimgehen. Jetzt noch nicht und in den nächsten Stunden wahrscheinlich auch nicht. Der Zigeuner war noch nicht wieder zu Bewußtsein gekommen.
Er schaute auf die Uhr, und lief dann weiter den Gang entlang, betrat sein Büro und drückte auf den Lichtschalter. Eine einzige Birne beleuchtete die wenigen Möbel, einen einfachen Schreibtisch, einen Drehstuhl mit einer hohen Rückenlehne, zwei weitere Stühle und einen Aktenschrank aus Holz. In eine Wand war ein Marmorkamin eingebaut, den man jedoch mit Brettern abgedeckt hatte. Statt dessen hatte man eine moderne Heizung installiert, die für wohlige Wärme sorgte. Er saß müde hinter dem Schreibtisch und rieb sich die Augen. Seine Gedanken kreisten um den Zigeuner … Er starrte an die feuchte Decke. Nein, das alles ergab einfach keinen Sinn. Diese merkwürdige Geschichte, die der Bauer Milewski aus den bruchstückhaften Äußerungen des fabulierenden Verwundeten zusammengesponnen hatte, konnte einfach nicht stimmen. Aber wie waren der Zustand des Mannes zu erklären und die Umstände, unter denen Milewski ihn gefunden hatte? Und, noch verwunderlicher: Warum war der Mann alleine gewesen?
Szukalski hatte noch nie einen Zigeuner gesehen, der alleine unterwegs war. Zigeuner pflegten ausnahmslos in Gruppen zu reisen, und wenn das nicht möglich war, dann wenigstens zu zweit. Aber alleine? Niemals! Und doch hatte dieser Zigeuner bei Milewskis Hof ganz alleine im Schnee gelegen, im Kopf eine Schußwunde von einer einzigen Kugel, und hatte Unglaubliches über seine fiebrigen Lippen gebracht.
Irgendwo sollte ein Massaker stattgefunden haben …
Szukalski bewegte den Kopf hin und her, als wolle er seine Gedanken abschütteln, und wandte sich dem Radio zu, das auf dem anderen Ende seines Schreibtisches stand. Er überlegte, ob er es einschalten sollte, um die bedrückende Stille zu vertreiben und etwas Freude in sein Büro zu bringen, aber dann erinnerte er sich, daß man ja seine Lieblingssendung abgeschafft hatte. Die polnischen Tangos, komponiert und dirigiert von den großen zeitgenössischen Musikern Gold und Petersburg, wurden nicht mehr gesendet. Wahrscheinlich waren Gold und Petersburg Juden. Als er seine Hand vom Radio zurückzog, hörte er, wie es klopfte. »Ja?« rief er.
Die Tür ging langsam auf, und das vertraute Gesicht seiner Stellvertreterin, Dr.Duszynska, erschien im Türspalt. »Störe ich?«
»Nein, überhaupt nicht. Treten Sie nur ein.«
»Jan, ich komme gerade von oben. Der Zigeuner ist eben für einen Augenblick zu sich gekommen.«
Szukalski schnellte sofort hoch. »Wie bitte? Und warum hat man mich nicht gerufen?«
»Dazu reichte die Zeit nicht«, entgegnete Dr.Duszynska. »Ich war gerade dabei, nach einem Patienten im Bett nebenan zu sehen, als er die Augen aufschlug und zu sprechen anfing. Nur ein paar Sekunden später fiel er wieder ins Koma zurück.«
»Und?«
Szukalskis Stellvertreterin starrte ihn durch das fahle Licht des Büros an und bemerkte, wie sich die Furche zwischen seinen Augenbrauen vertiefte. Dann sagte sie mit ernster Stimme: »Alles, was der Bauer erzählt hat, stimmt.«
Szukalski ließ sich wieder zurückfallen und bat Dr.Duszynska, sich ebenfalls zu setzen. »Wie ist sein Zustand?«
»Nicht besonders, leider. Es blutet zwar nicht mehr aus der Kopfwunde, aber ich bin sicher, daß er eine Pneumonie hat.«
»Sie haben Ihr Bestes gegeben«, erklärte Jan. »Mehr war nicht möglich. Wie lange hat er denn eigentlich so im Schnee gelegen?«
»Vom Augenblick des Massakers bis zu dem Zeitpunkt, als Milewski ihn fand, hatte der Zigeuner fast zwölf Stunden im Schnee gelegen. Jan, kann das alles wirklich wahr sein?«
Dr.Duszynska, die auf ihre Frage keine Antwort erhielt, lehnte sich in einen Holzstuhl zurück und studierte einen Moment lang das Gesicht ihres Vorgesetzten.
»Lassen Sie uns diese unglaubliche Angelegenheit, diese Geschichte des Zigeuners, noch einmal von Anfang an durchgehen«, schlug Szukalski plötzlich vor. »Er und seine Sippe, insgesamt ungefähr hundert Männer, Frauen und Kinder, hatten in dem Wald ihr Lager aufgeschlagen, als plötzlich ein Trupp deutscher Soldaten auftauchte. Vorher war nichts Besonderes vorgefallen, sagte er. Die deutschen Soldaten seien einfach aufgetaucht, hätten ihre Gewehre auf sie gerichtet und sie gezwungen, sich in Gruppen zusammenzufinden, und sie dann zum Waldrand getrieben. Dort habe man die Zigeuner gezwungen, im Schnee einen langen, tiefen Graben zu schaufeln, eine Art Grube, an deren Rand sie sich anschließend aufstellen mußten. Dann habe man sie gezwungen, sich auszuziehen und die Kleider im Schnee sorgfältig zu Haufen zusammenzulegen. Dann hätten die Deutschen sie alle, Männer, Frauen und Kinder, einen nach dem anderen durch einen Schuß in den Hinterkopf getötet und sich dabei vergewissert, daß auch alle in die Grube fielen. Unser Zigeuner gehörte zu den letzten, die erschossen werden sollten. Wenn wir glauben können, was er sagt, dann lebte er noch, als die Deutschen anfingen, die Grube mit Erde und Schnee aufzufüllen, um ein Massengrab daraus zu machen, und daß sie gegen Ende, als eigentlich unser Zigeuner dran gewesen wäre, nachlässig geworden seien und ihn nur halb bedeckt hätten. Er erzählte, daß er unter der Leiche einer Frau gelegen und sich nicht gerührt habe, um nicht zu zeigen, daß er noch lebte. Als die Deutschen fortgegangen seien, habe er noch lange gewartet, und dann sei er unter den Leichen hervorgekrochen und habe sich durch den Schnee fortgeschleppt. Schließlich ist er dann irgendwie beim Milewski-Hof gelandet. Haben Sie seine Geschichte so verstanden?«
Maria Duszynska flüsterte zuerst, dann bejahte sie mit kräftigerer Stimme und meinte: »Aber warum? Warum sollten die Deutschen so etwas tun? Soldaten kämpfen gegen Soldaten, so ist es eben im Krieg. Aber diese sinnlosen Greueltaten an Unschuldigen?«
Jan Szukalskis Gesicht verzog sich vor Zorn. »Ich habe es auch nicht geglaubt, meine werte Duszynska, aber es gibt keinen Grund, die Geschichte des Mannes anzuzweifeln.«
Sie schwiegen eine ganze Zeitlang, dann begann Szukalski als erster wieder zu sprechen: »Ich glaube, wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, der wir nur ohnmächtig zusehen können.« Die Schatten in dem kargen Büro schienen sich zu verdüstern. »Ich möchte nach Hause«, äußerte schließlich der abgespannt wirkende Szukalski und starrte auf seine Hände.
Dr.Duszynska erhob sich und verließ wortlos den Raum.
Szukalski blieb noch ein paar Minuten sitzen und dachte über die Ironie des Lebens nach, wie er, durch die Umstände bedingt, seinen langjährigen Stellvertreter verloren hatte, wie ihn die Deutschen einfach entfernt und ihn vor knapp einem Jahr durch Dr.Duszynska ersetzt hatten, und darüber, wie schwer es ihm gefallen war, die Vorbehalte gegen seine neue Stellvertreterin aufzugeben. Es war eben nicht so einfach, sich von Vorurteilen zu lösen.