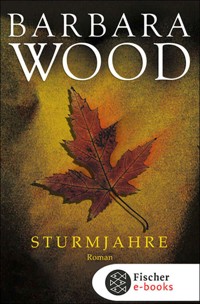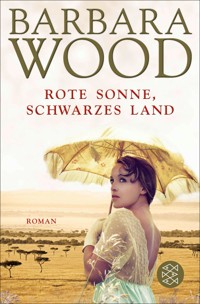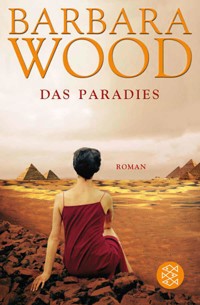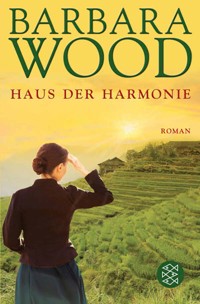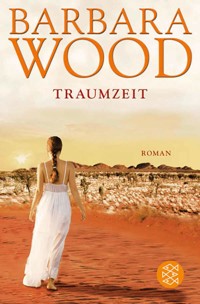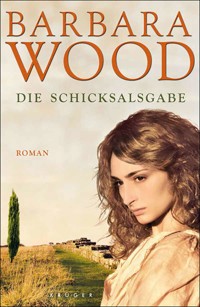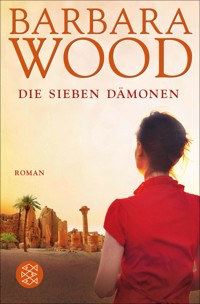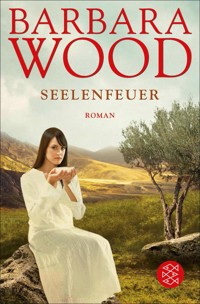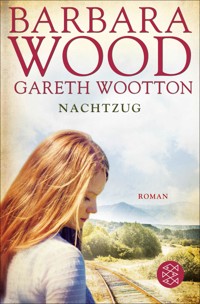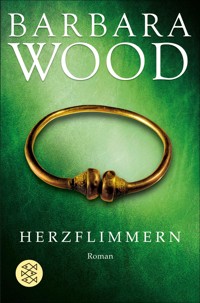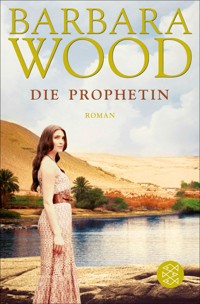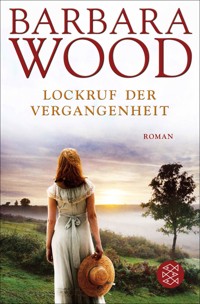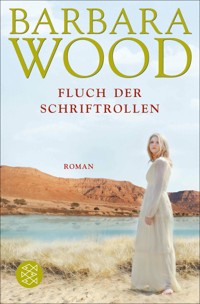
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In das geordnete Dasein von Benjamin Messer platzt eine Briefsendung aus Israel. Sein alter Professor, Dr. Weatherby, ist dort bei Ausgrabungen auf einen sensationellen Fund gestoßen: Nahezu unversehrte Handschriften, seit fast 2000 Jahren in Tonkrügen verborgen. Bens Aufgabe ist es, den Text der Handschriften zu übersetzen. Benjamin Messer, ein Mittdreißiger und selbst jüdischer Herkunft, ist Dozent für Orientalistik an der Universität von Los Angeles. Die Entzifferung alter Handschriften ist sein Spezialgebiet, und er macht sich mit Feuereifer an die herausfordernde Übersetzungsarbeit. Zu seiner Überraschung handelt es sich bei den Texten nicht um religiöse Aufzeichnungen, wie etwa bei den berühmten Qumran-Rollen, sondern um die Niederschrift einer Art Lebensbeichte. David Ben Jona, ein jüdischer Bewohner Palästinas, hat sie im ersten Jahrhundert, wenige Jahrzehnte nach Christi Tod, für seinen Sohn verfasst. Binnen kurzem ist Benjamin Messer von deren Inhalt wie verhext. Erinnerungen an seine eigene verdrängte Vergangenheit werden wach, an seine streng orthodoxe Erziehung, an den Vater, der in Majdanek ermordet wurde ... Die Texte beginnen mit einem "Fluch des Mose" gegen alle, die sich die Schriften unrechtmäßig aneignen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Barbara Wood
Der Fluch der Schriftrollen
Roman
Roman
Über dieses Buch
In das geordnete Dasein von Benjamin Messer platzt eine Briefsendung aus Israel. Sein alter Professor, Dr. Weatherby, ist dort bei Ausgrabungen auf einen sensationellen Fund gestoßen: Nahezu unversehrte Handschriften, seit fast 2000 Jahren in Tonkrügen verborgen. Bens Aufgabe ist es, den Text der Handschriften zu übersetzen. Benjamin Messer, ein Mittdreißiger und selbst jüdischer Herkunft, ist Dozent für Orientalistik an der Universität von Los Angeles. Die Entzifferung alter Handschriften ist sein Spezialgebiet, und er macht sich mit Feuereifer an die herausfordernde Übersetzungsarbeit. Zu seiner Überraschung handelt es sich bei den Texten nicht um religiöse Aufzeichnungen, wie etwa bei den berühmten Qumran-Rollen, sondern um die Niederschrift einer Art Lebensbeichte. David Ben Jona, ein jüdischer Bewohner Palästinas, hat sie im ersten Jahrhundert, wenige Jahrzehnte nach Christi Tod, für seinen Sohn verfasst. Binnen kurzem ist Benjamin Messer von deren Inhalt wie verhext. Erinnerungen an seine eigene verdrängte Vergangenheit werden wach, an seine streng orthodoxe Erziehung, an den Vater, der in Majdanek ermordet wurde ... Die Texte beginnen mit einem »Fluch des Mose« gegen alle, die sich die Schriften unrechtmäßig aneignen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Barbara Wood wurde in England geboren, lebt aber seit ihrer Kindheit in den Vereinigten Staaten. Sie arbeitete u.a. als Kellnerin und Hunde-Sitterin, dann zehn Jahre lang als technische Assistentin im OP-Bereich eines Krankenhauses. Seit 1980 widmete sie sich dem Schreiben. Die Recherchen für ihre Bücher führten sie um die ganze Welt. Barbara Woods Romane sind internationale Bestseller und in 30 Sprachen übersetzt. 2002 wurde sie für ihren Roman ›Himmelsfeuer‹ mit dem Corine-Preis ausgezeichnet.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Magdalene Scrolls« bei Doubleday & Company, Inc., New York
© Barbara Wood 1978
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer GmbH, Frankfurt am Main 1995
Digitalisierung: pagina GmbH, Tübingen
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400233-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Dieses Buch ist Dr.William [...]
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Dieses Buch ist Dr.William Robertson gewidmet, der ein guter Freund, ein guter Neurochirurg und ein großartiger Bildhauer ist.
Dank auch an Margie Dillenburg, für ihre Unterstützung, ihre Geduld und ihre heitere Gelassenheit.
Kapitel Eins
Hüte Dich vor dem Heiden und vor dem böswilligen Juden, der den Inhalt dieser Tonkrüge zu zerstören trachtet, denn der Fluch Mose wird über ihn kommen, und er wird verflucht sein in der Stadt und auf dem Land, und verflucht wird sein die Frucht seines Leibes und die seiner Felder. Und der Herr wird ihn mit einer schlimmen Feuersbrunst heimsuchen, ihn mit Wahnsinn und Blindheit schlagen und ihn für immer und ewig mit Grind und Krätze verfolgen.
Was ist das? Benjamin Messer wunderte sich. Ein Fluch? Verblüfft hielt er im Lesen der Papyrusrolle inne.
Zerstreut kratzte er sich den Kopf, während er die altertümliche Handschrift überflog. Ist es möglich? dachte er abermals verwirrt. Ein Fluch?
Diese Textstelle in dem Papyrus hatte Ben so sehr überrascht, daß er einen Augenblick überlegte, ob er sie nicht doch falsch verstand. Aber nein … Die Schrift war klar genug. Kein Zweifel.
Der Fluch Mose wird über ihn kommen …
Ben lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Die Verblüffung über das, was er da eben gelesen hatte, stand ihm ins Gesicht geschrieben. Während er auf die zweitausend Jahre alte Handschrift starrte, die im grellen Licht seiner starken Speziallampe vor ihm auf dem Schreibtisch lag, ließ der junge Schriftenkundler noch einmal die Ereignisse dieses Abends in seinem Gedächtnis vorbeiziehen: Am späten Nachmittag war unerwartet an seine Tür geklopft worden, und als er geöffnet hatte, stand ein Postbote in triefendnassem Regenumhang vor ihm, der ihm einen feuchten Briefumschlag mit israelischen Briefmarken darauf übergeben hatte. Ben erinnerte sich noch genau daran, wie er den Empfang der Eilzustellung quittiert hatte und mit dem Umschlag in sein Arbeitszimmer gegangen war. Dort hatte er ihn ungeduldig und voller Erwartung mit zitternden Händen geöffnet und schließlich die erste Zeile gelesen. Diese Worte waren eine solche Überraschung gewesen, daß Ben noch immer dasaß und auf den Fetzen Papyrus starrte, als sähe er ihn zum ersten Mal.
Was konnte dieser Fluch wohl bedeuten? Was hatte John Weatherby ihm da geschickt? In dem Begleitschreiben war von der Entdeckung einiger antiker Schriftrollen am Ufer des Sees Genezareth die Rede gewesen. »Möglicherweise sogar eine größere Entdeckung als die Qumran-Handschriften vom Toten Meer«, hatte ihm der alte Archäologe Weatherby versichert.
Ben Messer betrachtete stirnrunzelnd das vor ihm liegende Schriftstück in aramäischer Sprache. Aber nein … Nicht die Schriftrollen von Qumran am Toten Meer. Keine biblischen Texte oder religiöse Schriften. Sondern ein Fluch. Der Fluch Mose.
Die Einleitung hatte ihn überrascht. Er hatte etwas anderes erwartet. Verwirrt beugte sich Ben nun wieder vor und las weiter:
Ich bin ein Jude. Und bevor ich von diesem Leben in ein anderes hinübergehe, muß ich mein geplagtes Gewissen vor Gott und allen Menschen erleichtern. Was ich getan habe, habe ich aus freiem Willen getan. Ich behaupte nicht, ein Opfer des Schicksals oder der Umstände gewesen zu sein. Offen bekenne ich, David Ben Jona, daß ich allein dafür verantwortlich bin, was ich tat, und daß meine Nachkommen an meinen Verbrechen keine Schuld tragen. Meine Abkömmlinge sollen nicht das Schandmal der Missetaten ihres Vaters tragen. Doch ebensowenig steht es ihnen zu, über mich zu richten. Denn das ist allein die Sache Gottes.
Ich habe mich durch mein eigenes Verschulden in diese unglückliche Lage gebracht. Ich muß nun von den Dingen sprechen, die ich tat. Und dann will ich endlich durch die Gnade Gottes im Vergessen Frieden finden.
Benjamin richtete sich auf und rieb sich die Augen. Das wurde ja immer interessanter. Diese letzten paar Zeilen verblüfften ihn so sehr, daß er sich abermals über den Text der Schrift beugte, um sich von der Richtigkeit seiner Übersetzung zu überzeugen. Zum einen war er überrascht davon, wie leicht er die Papyrusrollen lesen konnte. Normalerweise war das eine schwierige Aufgabe. In den vielen alten Schriften wurden Wörter abgekürzt und Vokale ausgelassen. Es handelte sich dabei ohnehin nur um Ermahnungen an jemanden, der den Inhalt sowieso schon auswendig wußte. Auf diese Weise wurde dem modernen Schriftenkundler die Übersetzung erschwert. Doch hier war dies nicht der Fall. Und die zweite Überraschung war die Erkenntnis gewesen, daß die Rolle nicht den religiösen Text enthielt, den Ben erwartet hatte.
Aber was ist es dann? dachte Ben. Er putzte seine Brille, setzte sie wieder auf und beugte sich erneut vor. Was um alles in der Welt hat John Weatherby da gefunden?
Ich habe nur noch einen weiteren Grund, all dies niederzuschreiben, bevor ich sterbe. Möge Gott der Herr sich meiner erbarmen, aber es ist von noch größerer Wichtigkeit als das Bekenntnis meiner Schuld. Ich schreibe nämlich, damit mein Sohn verstehen möge. Er soll die Tatsachen über die Vorgänge und Ereignisse kennenlernen, und er soll auch erfahren, was mich zu meinem Handeln bewog. Er wird Geschichten darüber gehört haben, was an jenem Tag geschah. Ich will, daß er jetzt die Wahrheit erfährt.
»Das ist ja nicht zu fassen!« murmelte Ben. »John Weatherby, ich glaube kaum, daß Sie wissen, was Sie da ans Tageslicht befördert haben! Bei Gott, das ist mehr als nur eine archäologische Entdeckung, mehr als nur ein paar gut erhaltene Schriftrollen für das Museum. Es sieht so aus, als würde hier eine letzte Beichte enthüllt werden. Und noch dazu eine, die mit einem Fluch behaftet ist.«
Ben schüttelte den Kopf. »Das ist unglaublich …«
Folglich sind diese Worte für Deine Augen bestimmt, mein Sohn, wo immer Du auch sein magst. Meine Freunde haben mich als sehr sorgfältigen Menschen gekannt, und ich darf bei diesem meinem letzten Werk meine Natur nicht verleugnen. Diese Schriftstücke werden für Dich, mein Sohn, als Erbe bewahrt werden, denn ich habe wenig anderes, was ich Dir geben könnte. Einst hätte ich Dir ein großes Vermögen vermachen können, aber jetzt ist alles zerronnen, und in dieser schwärzesten Stunde kann ich Dir nur mein Gewissen hinterlassen.
Obwohl ich weiß, daß es nicht lange währt, bis wir in Zion im Neuen Israel wieder vereint sind, muß ich dennoch bestrebt sein, diese Schriftrollen zu verbergen, als sollten sie bis in alle Ewigkeit ruhen. Ich bin sicher, Du wirst sie bald finden. Es wäre indessen ein schlimmes Unglück, sollten sie vernichtet werden, bevor Dein Auge sie erblickte. Deshalb erbitte ich den Schutz Mose, auf daß sie sicher bewahrt werden.
Den Schutz Mose? wiederholte Ben in Gedanken. Er warf erneut einen Blick auf den oberen Teil der Papyrus-Rolle, las nochmals die ersten Zeilen und erkannte darin, wenn auch in etwas anderer Form, den Fluch, der auch im Alten Testament steht.
In dem Schreiben, das den Fotos der Schriftrollen beigelegt war, hatte John Weatherby die Vermutung geäußert, er und sein Team hätten allem Anschein nach einen archäologischen Fund von gewaltiger Tragweite gemacht. Doch offenbar war sich der alte Dr.Weatherby nicht genau darüber im klaren gewesen, was er da tatsächlich gefunden hatte.
Ben Messer, dessen Aufgabe es war, die Schriftrollen zu übersetzen, hatte religiöse Texte erwartet, Auszüge aus der Bibel. Wie die Qumran-Handschriften. Aber das hier? Eine Art Tagebuch? Und ein Fluch?
Er war überwältigt. Was zum Teufel konnte das bloß sein?
Nun, mein Sohn, bete ich zum Gott Abrahams, auf daß er Dich zum Versteck dieses Schatzes eines armen Mannes führen möge. Ich bete von ganzem Herzen, mit all meiner Kraft und mit größerer Inbrunst, als wenn ich um seine Gnade für meine Seele betete, daß Du, mein geliebter Sohn, eines nahen Tages diese Worte lesen wirst.
Richte nicht über mich, denn das steht allein Gott zu. Denk vielmehr an mich in Deinen schweren Stunden, und erinnere Dich daran, daß ich Dich über alles liebte. Und wenn unser Herr an den Toren Jerusalems erscheint, schau in die Gesichter derer, die sich um ihn scharen, und mit Gottes Wohlwollen wirst Du das Antlitz Deines Vaters unter ihnen erblicken.
Benjamin lehnte sich überrascht zurück. Das war ganz und gar unglaublich! Mein Gott, Weatherby, Sie hatten nur zur Hälfte recht.
Wertvolle Schriftrollen, ja. Ein archäologischer Fund, der »die zivilisierte Welt erschüttern wird«, ja. Aber da ist noch etwas anderes.
Ben sprang erregt auf und lief mit großen Schritten zur Fensterfront. Im Spiegelbild des Glases sah der sechsunddreißigjährige Schriftenkundler seinen hochgewachsenen, mageren Körper und seine weichen Gesichtszüge mit der Hornbrille und dem blonden Haar. Vor ihm funkelten die hellen, blitzenden Lichter von West Los Angeles.
Draußen war es schon dunkel. Der Regen hatte aufgehört, und leichter Dunst lag über der Stadt. Es war kalt geworden an diesem Novemberabend, ohne daß Ben es bemerkt hatte. Wie immer, wenn er einen alten Text übersetzte, hatte er sich in den Sätzen längst verstorbener Autoren verloren.
Autor unbekannt und namenlos.
Mit Ausnahme von diesem hier.
Er wandte sich langsam um und starrte eine Zeitlang auf seinen Schreibtisch. Der kreisförmige Strahl der Leselampe erhellte eine kleine Fläche, während der übrige Raum im Dunkeln lag.
Mit Ausnahme von diesem hier, wiederholte er im Geiste.
Wie erstaunlich, dachte er, daß man Schriftrollen gefunden hat, die kein Priester, sondern ein gewöhnlicher Mann verfaßt hatte und die nicht religiöse Aufzeichnungen, wie sonst, sondern so etwas wie einen vertraulichen Brief beinhalten. Ist es denn möglich? Hat John Weatherby tatsächlich die lange verlorenen Schriften eines einfachen Mannes gefunden, der vor zweitausend Jahren lebte? Wie wichtig ist diese Entdeckung? Sie wäre sicherlich ebenso einzustufen wie das Grab Tutenchamuns und Schliemanns Troja. Denn falls es sich hierbei wirklich um die Worte eines gewöhnlichen Bürgers handelte, der aus ganz persönlichen Gründen schrieb, dann wären diese Schriftrollen die allerersten ihrer Art in der Geschichte!
Ben ging zum Schreibtisch zurück. Dort nahm gerade seine geschmeidige schwarze Katze Poppäa Sabina seine neueste Arbeit in Augenschein. Das glänzende Foto, scharf und kontrastreich, war eines von dreien, die Ben an diesem Abend per Eilboten erhalten hatte. Es waren Aufnahmen von einer Schriftrolle, die zur Zeit unter der Schirmherrschaft der israelischen Regierung restauriert und konserviert wurde. Auf den Fotos war jeweils ein Drittel der gesamten Rolle zu sehen. Weitere Rollen sollten folgen, hatte man Ben gesagt. Und jedes Bild war eine getreue Wiedergabe des Originals. Nichts war daran verändert worden, und man hatte auch keine Verkleinerung vorgenommen. Wären die Bilder weniger glatt und glänzend gewesen, so hätte Dr.Messer tatsächlich geglaubt, die Original-Papyrusfragmente vor sich zu haben.
Er setzte sich wieder, stellte Poppäa sanft auf den Boden hinunter und übersetzte weiter.
Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein.
Gepriesen seist du, o Herr, unser Gott, König des Universums, der seines feierlichen Bundes stets eingedenk ist, seinem Bund treu bleibt und sein Versprechen hält; der den Unwürdigen Gutes tut und der auch mich mit allem Guten bedachte.
Er lächelte über das, was er da gerade übersetzt hatte: das Schema Israel, der Anfang des jüdischen Bekenntnisses und ein traditioneller Segensspruch, beides in Hebräisch: »Baruch Attah Adonai Elohenu Melech ha-Olam.« An so etwas war Ben schon eher gewöhnt. Heilige Texte, Gesetzessammlungen, Sprichwörter und Beschreibungen der Endzeit. Wer immer dieser David Ben Jona auch gewesen sein mochte, er muß ein äußerst frommer Jude gewesen sein, er hatte es nicht einmal gewagt, den Namen Gottes auszuschreiben, sondern hatte statt dessen die vier hebräischen Konsonanten JHWH benutzt. Beim nochmaligen Durchsehen seiner Übersetzung bemerkte Ben auch, daß es sich bei David Ben Jona um einen Mann von hoher Bildung handeln mußte.
Das Klingeln des Telefons schreckte Ben auf. Er warf seinen Kugelschreiber auf den Schreibtisch und nahm atemlos den Hörer ab.
»Ben?« Es war Angies Stimme.
»Bist du eben gerade nach Hause gekommen?«
»Nein«, entgegnete er verschmitzt, »ich habe die ganze Zeit hier am Schreibtisch gesessen.«
»Benjamin Messer, ich bin zu hungrig, um noch Sinn für Humor zu haben. Sag mir nur eines, kommst du nun vorbei oder nicht?«
»Ob ich vorbeikomme?« Er schaute auf die Uhr. »Ach du lieber Himmel! Es ist ja schon acht!«
»Ich weiß«, erwiderte sie trocken.
»Gott, das tut mir aber leid. Da bin ich ja wohl eine halbe Stunde …«
»Eine volle Stunde zu spät«, seufzte sie spöttisch. »Mutter pflegte stets zu sagen, Schriftkundler seien niemals pünktlich.«
»Das hat deine Mutter gesagt?«
Angie lachte. Sie brachte alle nur erdenkliche Geduld auf, wenn es um ihren Verlobten Ben ging. Er war so verläßlich in allen anderen Dingen, daß es ihr leicht fiel, wegen seiner notorischen Unpünktlichkeit nachsichtig zu sein.
»Arbeitest du am Kodex?« fragte sie.
»Nein«, antwortete er und runzelte die Stirn, da er sich plötzlich wieder an die Gesetzessammlung erinnerte, die er dringend übersetzen mußte. Als er Dr.Weatherbys Fotos aus Israel erhalten hatte, hatte er den ägyptischen Kodex, an dem er normalerweise gerade arbeitete, beiseite gelegt. »Etwas anderes …«
»Willst du’s mir nicht verraten?«
Er zögerte. In einem seiner Briefe hatte John Weatherby Ben gebeten, mit niemandem über sein Projekt zu reden. Es befand sich noch im streng geheimen Frühstadium, und es sollte vorerst nichts davon an die Öffentlichkeit gelangen. Weatherby wollte nicht, daß gewisse Kollegen schon jetzt davon erfuhren.
»Ich erzähl’s dir beim Abendessen. Gib mir noch zehn Minuten Zeit.«
Als er den Hörer auflegte, zuckte Ben Messer die Achseln. Angie war gewiß eine Ausnahme, ihr könnte er das Geheimnis ruhig anvertrauen.
Als er die Fotografien in den Umschlag zurückschieben wollte, hielt er von neuem inne, um das Manuskript in seiner klaren Sprache noch einmal zu bestaunen. Da lag es vor ihm in schlichtem Schwarz-Weiß. Die Stimme eines Mannes, der seit fast zwei Jahrtausenden tot war. Ein Mann, dessen Messer das Ende des Schreibrohrs angespitzt hatte, dessen Hände das vor ihm liegende Papyrus geglättet hatten, dessen Speichel den Farbstein benetzt hatte, um daraus Tinte zu machen. Hier waren seine Worte, die Gedanken, die er vor seinem Tod unbedingt noch festhalten wollte.
Eine ganze Weile stand Ben wie angewurzelt vor seinem Schreibtisch und starrte wie hypnotisiert auf die glänzenden Ablichtungen des alten Schriftstücks.
John Weatherby hatte recht. Falls noch weitere David Ben Jona-Schriftrollen gefunden würden, wäre dies eine Sensation.
»Warum?« fragte Angie, während sie ihm Wein nachschenkte. Ben antwortete nicht sofort. Geistesabwesend starrte er auf das lodernde Kaminfeuer. In dem hellen, heißen Licht sah er wieder die Handschrift David Ben Jonas vor sich, und er erinnerte sich, wie sehr es ihn am frühen Abend erstaunt hatte, zu entdecken, daß die Schriftrolle von einem Privatmann und in alltäglicher Sprache verfaßt worden war. Ben war ganz darauf eingestellt gewesen, einen religiösen Text zu übersetzen, vielleicht das Buch Daniel oder das Buch Ruth, und statt dessen war ihm die Überraschung seines Lebens bereitet worden.
»Ben?« sagte Angie ruhig. Sie hatte ihn schon einmal so gesehen, im »Schrein des Buches« in Israel, wo sie im Jahr zuvor als Touristen vor den eindrucksvollen Originalen der berühmten Schriftrollen vom Toten Meer gestanden hatten. Wenn Ben sich mit seiner einzigen großen Liebe beschäftigte – rissiges Papier und verblichene Tinte – zog er sich völlig in sich zurück und verlor den Bezug zur Wirklichkeit.
»Ben?«
»Hm?« Jäh wurde er aus seinen Gedanken gerissen. »Oh, verzeih mir, ich glaube, ich bin in Gedanken woanders.«
»Du hast mir gerade von Kopien einer Schriftrolle erzählt, die du heute abend aus Israel erhalten hast. Du hast gesagt, Dr.Weatherby hat sie dir geschickt, und alles spricht dafür, daß es sich dabei um eine sensationelle Entdeckung handelt. Warum? Stammen sie etwa vom Toten Meer?«
Ben lächelte und nippte an seinem Weinglas. Angies Kenntnis alter Manuskripte war nur laienhaft. Bestenfalls kannte sie die Qumran-Handschriften vom Hörensagen. Aber die hochgewachsene, gertenschlanke und auffallend hübsche Angie war ja schließlich Mannequin und hatte daher nur eine äußerst begrenzte Vorstellung davon, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente.
»Nein, sie stammen nicht vom Toten Meer.« Er und Angie saßen bei einem Glas edlen Weines auf dem Fußboden vor dem Feuer. Reste des Abendessens standen noch auf dem Tisch. Bevor er antwortete, drehte sich Ben ein wenig zur Seite, um ihr hübsches Gesicht besser betrachten zu können.
»Sie wurden unter den Überresten einer alten Wohnstätte gefunden, an einem Ort namens Khirbet Migdal. Sagt dir das etwas?«
Sie schüttelte den Kopf. Im Schein des Feuers schien ihr glänzendes Haar wie aus Bronze zu sein.
»Nun, vor etwa sechs Monaten teilte mir John Weatherby mit, daß er von der israelischen Regierung endlich die Genehmigung erhalten habe, in Galiläa eine Ausgrabung durchzuführen. Wie ich dir sicherlich erzählt habe, gilt Weatherbys Hauptinteresse den ersten drei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Daher beschäftigt er sich unter anderem mit dem alten Rom und seinem Niedergang, der Zerstörung Jerusalems und dem Aufstieg des Christentums. Jedenfalls zog John die richtigen Schlußfolgerungen aus den Hinweisen, die er vorfand, und konzentrierte seine Forschungen schließlich auf ein bestimmtes Ausgrabungsgebiet, auf das ich hier nicht näher eingehen will, und trug den Israelis sein Anliegen vor. Dann brach er vor fünf Monaten mit einem Archäologen-Team aus Kalifornien auf, schlug in der Nähe des Ortes Khirbet Migdal sein Lager auf und begann mit seiner Ausgrabung.«
Ben trank einen Schluck Wein und setzte sich bequem zurecht. »Ich möchte nicht im einzelnen auf seine Entdeckungen eingehen. Es sei nur so viel gesagt: Das Graben lohnte sich. Doch das, wonach er ursprünglich suchte – nämlich eine Synagoge aus dem zweiten Jahrhundert –, kam nie zum Vorschein. Er hatte sich getäuscht. Aber rein zufällig stieß er auf etwas anderes, auf etwas von solch bahnbrechender Bedeutung, daß er mich vor zwei Monaten aus Jerusalem anrief. Er habe ein Versteck mit Schriftrollen gefunden, erzählte er mir, ein Versteck, das so hermetisch abgeschlossen sei und so tief unter der Erde liege, daß die Rollen einwandfrei erhalten seien. Normalerweise haben wir nicht so viel Glück.«
»Aber was ist dann mit der Schriftrolle, die wir gesehen haben, als wir in Israel waren …«
»Das Tote Meer ist eine unglaublich trockene Gegend. Daher wurden die Rollen vor der Zerstörung durch Feuchtigkeit bewahrt. Genauso verhält es sich auch mit Papyri aus ägyptischen Gräbern. Aber in Galiläa, wo eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht, ist die Chance, daß so vergängliche Materialien wie Holz und Papier überdauern, praktisch Null. Natürlich vom Standpunkt der Archäologen gesehen.«
»Und doch hat Dr.Weatherby welche gefunden?«
»Ja«, erwiderte Ben, »es sieht ganz so aus.«
Nun begann auch Angie in die Flammen zu starren. Ihre Vorstellungskraft fing Feuer. »Wie alt mögen diese Rollen wohl sein?«
»Wir wissen es noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Das letzte Urteil darüber hängt von mir und zwei anderen Übersetzern aus Detroit und London ab. Durch chemische Analysen konnte Weatherby das Alter der Tongefäße in etwa abschätzen, mit einer möglichen Abweichung von ein oder zwei Jahrhunderten. Der Papyrus und die Tinte wurden ebenfalls analysiert, aber auch hier waren die Ergebnisse nicht restlos überzeugend. Die beiden anderen Übersetzer und ich sollen nun die genauere Eingrenzung vornehmen.«
»Die anderen beiden erhalten ebenfalls Auszüge und arbeiten in der gleichen Weise wie ich. Übersetzer arbeiten gewöhnlich in Teams, aber Weatherby möchte, daß wir getrennt und ohne gegenseitige Hilfe zu Werke gehen. Er glaubt nämlich, daß wir auf diese Weise genauere Übersetzungen liefern werden. Und ich schätze, er wählte uns drei, weil wir ein Geheimnis für uns behalten können.«
»Warum? Was ist denn dabei das Geheimnis?«
»Na ja, das hängt mit unserem Beruf zusammen. Manchmal ist es einfach besser, eine phantastische Entdeckung noch eine Weile für sich zu behalten, bis alles vorbereitet und fertiggestellt ist, um erst dann damit an die Öffentlichkeit zu treten. Die Authentizität eines solchen Fundes könnte in Zweifel gezogen werden, und dann muß man gewappnet sein, um seine Forschungsergebnisse zu verteidigen. In unserem Tätigkeitsfeld gibt es immer kleine Eifersüchteleien.« Ben wollte nicht noch weitergehen. Angie würde es nicht verstehen. Und auch sonst kein Außenstehender, denn es war nicht leicht zu erklären. Man konnte einen makellosen wissenschaftlichen Ruf haben und mit ehrlichen Methoden arbeiten, immer fand sich einer, der alles anfechten würde. Sogar wegen der Qumran-Schriftrollen war seinerzeit weltweit ein Meinungsstreit unter Wissenschaftlern ausgebrochen. Selbst bei naturwissenschaftlichen Entdeckungen war so etwas möglich.
»Du hast mir noch immer nicht verraten, was nun gerade an diesen Rollen so besonders ist.«
»Nun, einerseits sind sie die ersten ihrer Art, die je gefunden wurden. Alle antiken Schriftrollen, die heute auf der ganzen Welt in Museen und Universitäten aufbewahrt werden, haben durchweg einen religiösen oder irgendwie ›offiziellen‹ Inhalt, beispielsweise als Verwaltungs- oder Gesetzesaufzeichnung. Und sie wurden alle von Priestern, Mönchen oder sonstigen Schriftgelehrten verfaßt. Der Durchschnittsmensch, der in diesen Zeiten lebte, schrieb niemals Dinge nieder, wie du und ich es tun. Deshalb ist noch nie zuvor etwas gefunden worden, was sich mit Weatherbys Rollen vergleichen ließe. Verstehst du, ein normaler Bürger, der persönliche Worte niederschreibt.«
»Was für Worte?«
»Es sieht aus wie eine Art Brief oder Tagebuch. Er sagt, er habe eine Beichte abzulegen.«
»Also werden die Rollen dadurch berühmt, weil sie die einzigen ihrer Art sind.«
»Deshalb und dann natürlich«, Ben kniff die Augen zusammen und zeigte ein verschmitztes Lächeln, »wegen des Fluchs.«
»Ein Fluch?«
»Irgendwie ist es ja romantisch, ein Versteck mit alten Schriftrollen zu finden, die mit einem Fluch behaftet sind. Weatherby erzählte mir am Telefon davon. Wie es scheint, war der Jude namens David Ben Jona, der die Rollen schrieb, vermutlich als alter Mann, fest entschlossen, seine kostbaren Handschriften sicher zu bewahren, und griff daher auf einen uralten Fluch zurück. Den Fluch Mose.«
»Den Fluch Mose!«
»Er stammt aus dem Fünften Buch Mose, Kapitel achtundzwanzig. Dort findet sich eine ganze Reihe schrecklicher Flüche. Wie etwa von einer schlimmen Feuersbrunst heimgesucht und auf ewig von Grind und Krätze verfolgt zu werden. Ich denke, David Ben Jona hatte diese Rollen wirklich schützen wollen. Er mußte wohl geglaubt haben, dies sei genug, um jeden Unbefugten in Angst und Schrecken zu versetzen und von den Rollen fernzuhalten.«
»Nun, Weatherby hat es anscheinend nicht abgeschreckt.«
Ben lachte. »Ich bezweifle, ob der Fluch nach zweitausend Jahren noch viel von seiner Kraft hat. Aber wenn Weatherby jetzt plötzlich von Grind und Krätze befallen wird …«
»Hör auf!« Angie rieb sich die Arme. »Brrr. Ich kriege Gänsehaut davon.«
Beide starrten wieder ins Feuer, und Angie, die sich an das verblichene Pergament erinnerte, das sie im »Schrein des Buches« gesehen hatten, fragte: »Warum waren die Rollen von Qumran eine so phantastische Entdeckung?«
»Weil sie den Beweis für die Richtigkeit der Bibel lieferten. Und das ist keine Kleinigkeit.«
»Ist das dann nicht bedeutender als das, was Dr.Weatherbys Rollen zu sagen haben?«
Ben schüttelte den Kopf. »Nicht vom Standpunkt der Geschichtsschreibung. Wir haben genug Bibeltexte, die uns das verraten, was wir über die Entwicklung der Bibel durch die Jahrhunderte hindurch wissen müssen. Was wir nicht besitzen, ist eine hinreichende Kenntnis darüber, wie sich zu jenen Zeiten das tägliche Leben abspielte. Religiöse Schriftrollen wie die vom Toten Meer enthalten beispielsweise Prophezeiungen und Glaubensbekenntnisse, doch sie sagen uns nichts über die Zeit, in der sie geschrieben wurden, oder über die Menschen, die sie verfaßten. Weatherbys Rollen dagegen … Großer Gott!« entfuhr es ihm plötzlich. »Ein persönliches Tagebuch aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert! Denk nur mal an die Wissenslücken, die dadurch geschlossen werden könnten!«
»Was ist, wenn sie älter sind? Vielleicht aus dem ersten Jahrhundert?«
Ben zuckte die Schultern. »Das ist möglich, aber um das sagen zu können, ist es noch zu früh. Weatherby tippt auf das späte zweite Jahrhundert. Die Radiokarbonmethode kann es nicht weiter für uns eingrenzen. Letztendlich hängt es von meiner Analyse des Schreibstils ab. Erst sie wird uns Aufschluß darüber geben, wann David Ben Jona gelebt hat. Dabei ist meine Tätigkeit keine exakte Wissenschaft. Aus dem zu schließen, was ich bislang gelesen habe, könnte der alte David Ben Jona zu jeder x-beliebigen Zeit innerhalb einer Epoche von dreihundert Jahren gelebt haben.«
Ein verträumter Blick zeigte sich auf Angies Gesicht. Es war ihr gerade etwas eingefallen. »Aber das erste Jahrhundert wäre das phantastischste, nicht wahr?«
»Natürlich. Neben den Qumran-Handschriften, den Briefen von Bar Kochba und den Schriftrollen von Masada existiert nach heutiger Kenntnis kein weiteres aramäisches Schriftstück aus der Zeit Christi.«
»Meinst du, er wird darin erwähnt?«
»Wer?«
»Jesus.«
»Oh, na ja, ich glaube nicht …« Ben wandte seinen Blick von ihr ab. Für ihn war die Wendung »aus der Zeit Christi« lediglich ein Instrument zum Festlegen des historischen Maßstabs. Es war einfacher, als zu sagen »vom Jahr vier vor unserer Zeitrechnung bis etwa zum Jahr siebzig nach unserer Zeitrechnung« oder »nach-augustinisch und präflavianisch«. Es war nur ein Kürzel zur Bezeichnung dieser bestimmten Epoche in der Geschichte. Ben besaß seine eigene Theorie über den Mann, den die Leute Christus nannten. Und diese wich von der Norm ab.
»Du wirst also anhand der Schriften herausfinden können, wann es geschrieben wurde?«
»Das will ich hoffen. Die Schreibstile veränderten sich im Laufe der Jahrhunderte. Die Handschrift selbst, das benutzte Alphabet und die Sprache sind meine drei Maßstäbe. Ich werde Weatherbys Rollen mit anderen vergleichen, die wir heute schon besitzen, wie etwa die von Masada, und sehen, inwieweit der Schreibstil übereinstimmt. Nun haben wir nach der chemischen Analyse des Papyrus ein hypothetisches Entstehungsdatum von vierzig C.E. mit einer Spannweite von zweihundert Jahren. Das bedeutet, der Papyrus wurde zwischen hundertsechzig B.C.E. und zweihundertvierzig C.E. hergestellt.«
»Was heißt C.E.?«
»Es steht für Common Era und bedeutet dasselbe wie A.D., ›Anno Domini‹ oder ›Christi Geburt‹, beinhaltet aber keine religiöse Anspielung. Archäologen und Theologen benutzen es. Aber es ist ja auch einerlei, wie man sich bei der Zeitangabe nun ausdrückt. Die Radiokarbonmethode funktioniert prima bei prähistorischen Schädeln, wo ein so großer zeitlicher Spielraum nicht weiter stört. Aber wenn man eine relativ kleine Zeitspanne vor ungefähr zweitausend Jahren eingrenzen will, dann ist ein Spielraum von zweihundert Jahren praktisch überhaupt keine Hilfe. Er bildet lediglich die Grundlage, von der man ausgeht. Dann versuchen wir, anhand der Bodentiefe, in der die Ausgrabung gemacht wurde, ein Datum zu bestimmen. Ältere Schichten liegen darunter, und Lagen aus jüngeren Jahren breiten sich darüber aus. Wie geologische Bodenschichten. Doch nachdem dies alles geschehen ist, müssen wir uns für das endgültige Datum doch wieder der Schrift selbst zuwenden. Und bisher schreibt dieser David Ben Jona in einer Art, die große Ähnlichkeit mit den Handschriften vom Toten Meer aufweist und die man irgendwann zwischen hundert vor Christus und zweihundert nach Christus datieren kann.«
»Vielleicht erwähnt dieser David in seinem Schriftstück etwas, was dir einen genauen Anhaltspunkt geben könnte, einen Namen, ein Ereignis oder sonst etwas.«
Ben, der eben sein Glas zu den Lippen führen wollte, hielt auf halbem Weg inne und starrte Angie an. Darauf war er selbst noch gar nicht gekommen. Und warum sollte es auch nicht möglich sein? Schließlich hatte das erste Bruchstück ja bereits bewiesen, daß diese Migdal-Schriftrollen sich von allen bisherigen unterschieden. Es war möglich. Alles war möglich.
»Ich weiß nicht, Angie«, antwortete er langsam. »Daß er uns ein Datum nennt … auf soviel darf man wohl nicht hoffen.«
Sie zuckte die Achseln. »So wie du redest, könnte man meinen, daß du nicht einmal auf die Rollen selbst hättest hoffen dürfen. Und dennoch sind sie da.«
Ben blickte sie abermals erstaunt an. Angies Fähigkeit, selbst die wunderlichsten Ereignisse ganz beiläufig hinzunehmen, überraschte ihn immer wieder. Und doch, so überlegte er jetzt, während er ihren gleichgültigen Gesichtsausdruck studierte, war es vielleicht nicht so sehr die Gelassenheit, mit der sie gewisse Ereignisse hinnahm, sondern vielmehr die Gelassenheit, mit der sie sie abtat. Sie besaß die Fähigkeit, alles mit der gleichen nüchternen Sachlichkeit aufzunehmen, sei es nun die Tageszeit oder die Nachricht von einer Katastrophe. Angie war keine Frau von heftigen Leidenschaften. Niemals hatte sie etwas an den Tag gelegt, was auch nur annähernd einem Gefühlsausbruch gleichkam. Und sie schien in der Tat stolz darauf zu sein, eine höchst gleichmütige Person zu sein. Selbst in Krisensituationen verlor sie nie die Fassung. Eine beliebte Anekdote, die in ihrem Freundeskreis immer wieder erzählt wurde, handelte von Angies Reaktion auf die Nachricht von der Ermordung John F. Kennedys. Noch keine Stunde, nachdem es geschehen war und die ganze Welt von Entsetzen erfüllt war, hatte ihr einziger Kommentar gelautet: »Tja, das Leben ist gemein.«
»Ja, Schriftrollen wie diese sind mehr, als man sich zu erhoffen wagt. Eigentlich sind sie der Traum eines jeden Archäologen. Allerdings …« Bens Stimme wurde schwächer. Da gab es noch so viele Wenn und Aber. Dr.Weatherby hatte in seinen Briefen nur auf »Schriftrollen« hingewiesen. Doch er hatte nie ihre genaue Anzahl erwähnt. Wie viele von ihnen gab es dort? Wie viele hatte der alte David Ben Jona wohl noch schreiben können, bevor er von »diesem Leben in ein anderes« hinübergegangen war? Und was war es, das er noch so dringend hatte loswerden und zu Papier bringen müssen?
Während er mit Angie vor dem Feuer saß und Wein trank, begann Ben über Fragen nachzudenken, die ihm bis dahin nie in den Sinn gekommen waren.
Ja, in der Tat, was mochte den alten Juden wohl dazu gebracht haben, sein Leben zu Papier zu bringen? Was war so Bedeutendes geschehen, daß er das machte, was so wenige seiner Zeitgenossen taten: die eigenen Gedanken niederzuschreiben? Und was hatte ihn dann veranlaßt, jene Rollen ebenso sorgfältig zu verpacken, wie es die Mönche vom Toten Meer getan hatten – seine Aufzeichnungen als Lektüre für seinen Sohn?
Und dann dieser absonderliche Fluch! Die Rollen mußten etwas Wichtiges enthalten, wenn der alte David so weit gegangen war, um sie zu schützen.
Ben unterbrach seine Spekulationen und konzentrierte seine Gedanken wieder auf den Fund selbst. Er wußte aus Erfahrung, daß es nicht lange dauern würde, bis die Nachricht davon durchsickerte, und war dies einmal geschehen, dann würde die Welt den Atem anhalten. Der Medienrummel wäre schwindelerregend. Sein Name, Dr.Benjamin Messer, würde untrennbar mit der Entdeckung verbunden, und er fände sich plötzlich in dem Rampenlicht wieder, von dem er so oft geträumt hatte. Er würde Bücher veröffentlichen, im Fernsehen interviewt werden und Vortragsreisen durchs ganze Land unternehmen. Er fände Ansehen, Ruhm und Anerkennung und …
Im knisternden Feuer schlugen die Flammen hoch und tauchten das Zimmer für einen Moment in hellen Schein. Irgendwo, ganz nahe, hörte er ein sanftes Atmen. Ben spürte, wie sein Gesicht sich zunehmend erhitzte, sei es nun von dem Feuer im Kamin oder von seiner inneren Erregung. Er wurde langsam müde und dachte an die Briefe, die John Weatherby ihm geschrieben hatte.
Den ersten hatte er vor zehn Wochen erhalten. Darin hatte ihn Weatherby nur kurz von einer »bemerkenswerten Entdeckung« unterrichtet.
Ben erinnerte sich, wie er damals geglaubt hatte, daß Weatherby offenbar eine Synagoge aus dem zweiten Jahrhundert gefunden hatte. Doch dann war dieser Anruf aus Jerusalem gekommen, bei dem John Weatherbys Stimme klang, als hätte er sich einen Eimer über den Kopf gestülpt. Er sprach von einem Versteck mit Schriftrollen, auf das er gestoßen sei, und kündigte an, daß er Ben mit ihrer Übersetzung und zeitlichen Zuordnung betrauen wolle. Das war vor zwei Monaten gewesen.
Die nächste Mitteilung war vier Wochen später in Form eines langen Briefes gekommen. Ein »Ausgrabungsbericht« in zeitlich genauer Abfolge von ihrem Beginn bis zum Fund der Schriftrollen; eine ausführliche Schilderung der Ausgrabungsstätte, insbesondere von Niveau VI; eine Liste von Gegenständen, die man neben den Tonkrügen gefunden hatte – Haushaltsgegenstände, Münzen, Tonscherben – und dann noch eine Beschreibung der Tonkrüge und der Schriftrollen selbst.
Als nächstes war ihm ein dreiseitiger Bericht über den Befund des Instituts für Nuklearforschung an der Universität Chicago zugegangen, die Ergebnisse der Radiokarbontests und eine Festsetzung des Alters der Münzen auf siebzig nach Christus. Doch letztendlich waren die Wissenschaftler lediglich imstande gewesen, auf das breite Spektrum von dreihundert Jahren hinzuweisen, und hatten es auch nicht näher eingrenzen können.
Aus diesem Grund waren die Ablichtungen der Rollen an Ben Messer geschickt worden. Um genauer zu bestimmen, in welchem Jahr sie geschrieben worden waren und was sie aussagten.
»Ben?«
»Hm?« Er öffnete langsam die Augen.
»Schläfst du ein?« Angies Stimme klang sanft und einschmeichelnd.
»Ich denke nur nach …«
»Worüber?«
»Oh …« Ben seufzte. Er spürte ein plötzliches Hochgefühl.
»Mir ist da gerade etwas eingefallen. Etwas, woran ich bisher noch gar nicht gedacht hatte.«
»Was ist es?«
»Daß Davids Vater denselben Namen trug wie mein Vater.«
»Woher willst du das wissen?«
»Das ist in seinem Namen, David Ben Jona, enthalten. ›Ben‹ bedeutet in Aramäisch ›Sohn des‹. Also hieß sein Vater Jona. Und zufälligerweise war Jona auch der Name meines Vaters …«
Allmählich spürte Benjamin Messer die Wirkung des Weines. Aus irgendeinem Grund schienen die Rollen plötzlich noch wichtiger als vorher. Dabei hatte er doch erst damit begonnen, sie zu lesen.
»Meinst du, daß es noch mehr davon gibt?«
»Das hoffe ich. Ich bete zu Gott, daß es so ist.«
Angie sah ihn von der Seite an. »Das wäre mir völlig neu, daß du wüßtest, wie man betet, Ben.«
»Schon gut, das reicht.« Sie hatte ihn oft damit aufgezogen, daß er der frömmste Atheist sei, den sie kenne. Er, Benjamin Messer, der Sohn eines Rabbiners.
Sie schmiegten sich im Halbdunkel des Kaminfeuers aneinander. Angie war emotional vielleicht etwas zurückhaltend, doch ihre sexuellen Wünsche konnte sie durchaus ausdrücken.
»Vergiß die Vergangenheit«, hauchte sie Ben ins Ohr, »komm zurück in die Gegenwart. Komm zurück zu mir.«
Sie machten sich nicht die Mühe, ins Schlafzimmer zu gehen. Der zottelige kleine Teppich vor dem Kamin war bequem genug. Und für eine Weile ließ Angie Ben das Rätsel eines zweitausend Jahre alten Alphabets vergessen.
Später, als sie sich vor dem glimmenden Kaminfeuer anzogen, spürte Ben, wie er rasch wieder nüchtern wurde. Der alexandrinische Kodex, der wohl fälschlich dem Evangelisten Markus zugeschrieben wurde, wartete darauf, übersetzt zu werden. Und dann war da natürlich noch der letzte Teil von Weatherbys Schriftrolle, der gelesen werden mußte. Und morgen gab er Unterricht.
»Bleib heute nacht hier«, drängte Angie sanft.
»Tut mir leid, Liebes, aber weder Regen noch Graupel, noch ein listiges Frauenzimmer sollen den Handschriftenkundler von seinen anstehenden Übersetzungen abhalten. Das ist Herodot.«
»Das ist albern.«
»Ach wirklich? War er Grieche oder Römer, dieser Marcus Tullius Albern?«
Angie schnappte sich seinen Pullover und warf ihn in Bens Richtung.
»Benjamin Messer, mach, daß du rauskommst!«
Er lachte und streckte ihr die Zunge heraus. Angies kastanienbraunes Haar fiel ihr ins Gesicht und verlieh ihr das Aussehen eines kleinen Mädchens, während ihre Augen ihn verführerisch anblitzten. Es machte Spaß, mit ihr zusammenzusein. Zwar wußte sie nichts über alte Geschichte, aber es war immer unterhaltsam mit ihr. Und dafür liebte er sie.
»Ciao, Baby, wie sie im Fernsehen sagen.« Er ging fort und sprang, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunter. Seine unbeschwerte Stimmung verflüchtigte sich jedoch bald in der frostigen Luft, als er den Wilshire Boulevard hinunterfuhr. Ein Radiosender spielte ein Lied von Cat Stevens oder Neil Young. Er konnte nicht genau sagen, von wem.
Ben gehörte dem Schlag unzeitgemäßer Menschen an, die sagen konnten, ihre Lieblingssängerin sei Olivia Elton John, und damit ungestraft davonkamen.
Doch er achtete nicht wirklich auf die Musik, weil das dringende Problem der Schriftrollen ihn wieder zu plagen begann. Wann waren sie denn nun wirklich geschrieben worden? Zweites oder drittes Jahrhundert wäre nicht annähernd so aufregend wie erstes Jahrhundert. Und ebensowenig hätte das späte erste Jahrhundert eine so sensationelle Wirkung wie das frühe erste Jahrhundert.
Gedankenverloren parkte Ben sein Auto in der Tiefgarage seines Apartmenthauses und lief die Treppe zu seiner Wohnung hinauf.
»Was, wenn …? Was, wenn sie tatsächlich im frühen ersten Jahrhundert geschrieben worden wären? Sie könnten sogar irgendeine Erwähnung, einen Anhaltspunkt oder die Spur einer Zeugenaussage enthalten, durch die die Existenz eines Mannes, den man gemeinhin Jesus Christus nannte, entweder bewiesen oder widerlegt würde!
David Ben Jona, dachte Ben, als er mit seinem Wohnungsschlüssel hantierte, zu welcher Zeit hast du gelebt und was hast du mir so Wichtiges zu sagen?
Als er in seiner Wohnung war, machte sich Ben als erstes eine Tasse starken, schwarzen Kaffee, öffnete eine Büchse Katzenfutter für Poppäa und setzte sich dann wieder an seinen Schreibtisch. Der Schein seiner Leselampe erzeugte einen kleinen Lichtkreis, der sich gegen das Dunkel ringsumher abhob. Die übrige Wohnung wirkte wie eine grenzenlose, schwarze Höhle. Nur hin und wieder wurde der Lichtkreis von der neugierigen Poppäa durchbrochen, die über den Schreibtisch lief. Wenn sie dort nichts Interessantes darauf fand, setzte sie ihre nächtlichen Streifzüge durch die anderen Zimmer fort.
Auch an diesem Abend sprang sie, während Ben die Fotografien vor sich ausbreitete, geräuschlos nach oben, stolzierte zwischen Büchern, Aschenbechern und leeren Gläsern umher und schnupperte flüchtig an einem der Fotoabzüge. Dann sprang sie hinunter auf den Fußboden.
Ben war inzwischen wieder völlig nüchtern und vertiefte sich in den dritten Papyrus-Abschnitt. Plötzlich erinnerte er sich an eine Szene, die sich vor sechs Monaten ereignet hatte: Er und Dr.Weatherby waren in dessen Strandhaus am Pazifik gesessen und diskutierten das geplante Projekt Dr.Weatherbys.
Der grauhaarige, robuste Weatherby, der stets so lebendig sprach, hatte Ben schon oft seine Theorie dargelegt, nach der irgendwo in der Nähe von Khirbet Migdal in Israel eine unter der Erde verborgene Synagoge aus dem zweiten Jahrhundert liege. In seinem Wohnzimmer hatte Weatherby ihm an diesem Abend vor sechs Monaten gesagt: »Wie du weißt, führt das offizielle Verzeichnis des israelischen Ministeriums für Altertümer über siebzehnhundertfünfzig historische Stätten innerhalb der Grenzen von vor 1967 auf. 1970 fanden auf Israels achttausend Quadratmeilen mindestens fünfundzwanzig großangelegte Grabungen statt. Und ich beabsichtige, mir ein Stück von diesem Kuchen abzuschneiden. Die Grabungsgenehmigung muß nun bald kommen. Und dann geht’s ab nach Migdal mit meinem Spaten und meinem Eimer, wie ein Kind, das zum Strand läuft.«
Ben starrte lange auf das dritte Foto, auf den formlosen Schreibstil, der dem religiöser Texte so ganz und gar nicht ähnlich war, und er dachte bei sich: So hast du, David Ben Jona, dein kostbares Testament in der Erde von Khirbet Migdal vergraben, und John Weatherby kam daher und grub es aus.
Aber natürlich kanntest du den Ort damals nicht als Migdal. Zu deiner Zeit hieß die Stadt Magdala. Berühmt für ihren Fisch, ihren Zirkus und für eine Frau namens Maria. Maria Magdalena.
Kapitel Zwei
Das dritte Teilstück ließ sich nicht so leicht lesen wie die ersten beiden, denn hier und da waren die Ränder des Papyrus eingerissen, und ganze Sätze wurden mitten im Wort abgebrochen. An mehreren Stellen war die Tinte in die kleinen Zwischenräume der Papyrusfasern gelaufen und hatte die Schrift verwischt. Ein weiterer Grund war, daß dieser Ausschnitt bisher größtenteils aus einem langatmigen Gebet und einem Segensspruch bestand. David Ben Jona war dabei vom Aramäischen zum Hebräischen übergegangen und damit auch zu der gängigen Praxis, Vokale auszulassen. Ben arbeitete die ganze Nacht hindurch, brütete über winzigen Bedeutungsnuancen und versuchte, die unverständlichen Stellen mit Sinn zu füllen.
Ben war ein wenig enttäuscht. Er war es zwar gewohnt, Gebete und religiöse Abhandlungen zu übersetzen – das war ja schließlich sein Beruf –, doch in diesem Fall hatte er gehofft, daß die Magdala-Schriftrollen sich inhaltlich von allen bisher gefundenen unterschieden.
Und jetzt, da der Tagesanbruch nahte, fing Ben allmählich an zu glauben, daß der alte Jude seinem Sohn letzten Endes nichts anderes hinterlassen habe als das übliche hebräische Vermächtnis – heilige Worte.
Auch war Ben über sich selbst enttäuscht, weil er die Zeit der Entstehung von Davids Handschrift nicht genau festlegen konnte. Einige Anhaltspunkte waren offensichtlich: die fehlenden Ligaturen zwischen den Buchstaben (eine Entwicklung, die seit Mitte des ersten Jahrhunderts zu beobachten war), die bekannte rechtwinklige aramäische Handschrift, den hebräischen Buchstaben Alef, der so charakteristisch war, weil er wie ein umgekehrtes N aussah. All diese Hinweise waren vorhanden, reichten aber nicht aus, um sich endgültig auf einen bestimmten Zeitabschnitt festzulegen.
Es gab noch mehr zu übersetzen; ein paar Zeilen waren noch übrig, aber Ben war zu müde, um sie in Angriff zu nehmen. Die Studenten seiner Zehn-Uhr-Vorlesung erwarteten sicher, daß er mit ihnen ihre Arbeiten durchsehen würde, und der Unterricht um zwei Uhr würde eine engagierte Diskussion zum Gegenstand haben. Für beides mußte er vorbereitet sein.
Mit einer Mischung aus Widerstreben und Erleichterung steckte er daher die Fotos in den Umschlag zurück und beschloß, sie bis zum Wochenende warten zu lassen. Bis dahin müßte er mit dem alexandrinischen Kodex fertig sein.
Benjamin Messer war Professor für Orientalistik an der Universität von Kalifornien in Los Angeles und gab drei Unterrichtsfächer: Alt- und Neuhebräisch, die Deutung von hebräischen Manuskripten und altorientalische Sprachen. Wenn er nicht gerade mit der Übersetzung von alten Papyri oder einer antiken Inschrift beschäftigt war, wies er jeden, der sich interessiert zeigte, in die Grundlagen seines Fachgebietes ein.
Nachdem er den Unterricht in der Frühe noch ganz gut bewältigt hatte, begann er während des Nachmittags-Seminars allmählich die Auswirkungen seiner schlaflosen Nacht zu spüren. Es war sein Kurs in Neu- und Althebräisch, den sechzehn fortgeschrittene Studenten belegt hatten, die im Halbkreis um ihn herum saßen und an diesem Dienstagnachmittag nicht umhin konnten, eine gewisse Zerstreuung bei ihrem Professor festzustellen.
»Dr.Messer, sind Sie nicht der Ansicht, daß die Entwicklung der mündlichen Überlieferung sich stärker auf die Sprachentwicklung auswirkte als die schriftliche?« Der Kursteilnehmer, von dem dieser Beitrag kam, blickte Ben hinter seinen dicken Brillengläsern fragend an. Er studierte Sprachwissenschaft als Hauptfach und war ein begeisterter Anhänger von Esperanto.
Ben schaute ihn an, als sähe er ihn zum ersten Mal. Die heutige Diskussion befaßte sich mit der Dynamik der Entwicklung der hebräischen Sprache. Dabei wurde erörtert, welche äußeren Faktoren über die Jahrhunderte hinweg zum Sprachwandel beigetragen hatten. Ben hatte der Frage keine rechte Aufmerksamkeit geschenkt. Er hatte sich mehrmals dabei ertappt, wie er in Gedanken abschweifte und an die Schriftrolle von Magdala dachte.
»Warum sollte das so sein, Glenn? Meinen Sie, die mündliche Überlieferung sei für die Juden bedeutender gewesen als die schriftliche?«
»Ich denke schon. Besonders während der Diaspora. Die mündliche Überlieferung erhielt sie am Leben, als ihre Schriftrollen unerreichbar waren.«
»Dem kann ich nicht zustimmen«, meldete sich eine andere Studentin zu Wort. Sie hieß Judy Golden, eine Studentin der vergleichenden Religionswissenschaft. »Wir leben noch immer in einer Diaspora, und es ist das geschriebene Wort, das uns über die Entfernung hinweg zusammenhält.«
»Eigentlich haben Sie beide recht. Keine dieser Überlieferungen, weder die mündliche noch die schriftliche, kann von der anderen getrennt behandelt werden.« Er warf einen Blick auf die Uhr. Der Unterricht schien sich heute nur so dahinzuschleppen.
»Gut, nun befassen wir uns heute nachmittag ja eigentlich mit den Veränderungen, die im Laufe der Jahrhunderte im geschriebenen und gesprochenen Hebräisch auftraten, und mit den äußeren Faktoren, die diese Veränderungen bewirkten. Möchte sich jemand dazu äußern? Wie steht es mit den Auswirkungen der Diaspora auf das geschriebene Hebräische? Judy?«
Sie bedachte ihn mit einem kurzen Lächeln. »Vor der Entstehung des Talmud mußten sich die Juden auf ihre hebräischen Schriftrollen und auf ihr Gedächtnis verlassen. Doch im Zeitalter des Hellenismus, als die Juden das Hebräische, ihre ›Heilige Sprache‹, mehr und mehr verlernten, konnten sehr viele unter ihnen die Thora nicht mehr lesen. Zu dieser Zeit entstand die Septuaginta, die Fünf Bücher Mose, in griechischer Sprache, so daß dann alle über das Römische Reich verstreut lebenden Juden ihre Heiligen Bücher lesen konnten. Aber ich glaube nicht, daß die Septuaginta das Hebräische damals bloß verändert haben sollte; vielmehr beseitigte sie es ganz und gar.«
Benjamin Messer runzelte für einen Augenblick die Stirn. Judy hatte ein ausgezeichnetes Argument vorgetragen, das er nicht zu hören erwartet hatte. Während sie sprach, versuchte er sich zu erinnern, was er über sie wußte. Judy Golden, von der Universität Berkeley an die hiesige Universität übergewechselt, sechsundzwanzig Jahre alt, studierte im Hauptfach vergleichende Religionswissenschaft. Sie war eine ruhige junge Frau mit ausdrucksvollen braunen Augen und langem schwarzen Haar. Das Symbol des Zionismus, der Davidsstern, hing ihr an einer Kette um den Hals.
»Sie haben vollkommen recht«, meinte Ben, nachdem sie geendet hatte. »Die Septuaginta schaffte in der Tat zwei entgegengesetzte Bedingungen. Einerseits vermittelte sie den Juden, die kein Hebräisch beherrschten, den Inhalt der Heiligen Bücher, doch andererseits entweihte sie das Wort Gottes durch seine Wiedergabe in einer ›heidnischen‹ Sprache. Hier haben wir erneut ein gutes Beispiel dafür, wie untrennbar die hebräische Sprache mit der hebräischen Religion verbunden ist. Um das eine zu studieren, muß man sich auch mit dem anderen befassen.«
Ein weiterer verstohlener Blick auf die Uhr. Konnte er sich daran erinnern, daß eine Unterrichtsstunde sich jemals so in die Länge gezogen hatte? »Gehen wir nun weiter und kommen wir zum nächsten Punkt«, sagte er, während er ein neues Wort an die Tafel schrieb: Massora. Dann folgte ein Datum: Viertes Jahrhundert C.E.
»Wahrscheinlich war der erste Massoret Dosa Ben Eleasar …«
Und während der ganzen Vorlesung mußte er sich dazu zwingen, sich auf das zur Debatte stehende Thema zu konzentrieren. Durch seinen Schlafmangel sickerten immer wieder Gedanken an die magdalenischen Schriftrollen durch.
Er war erleichtert, als er die Vorlesung eine Stunde später wieder für ein paar Tage hinter sich hatte. Als Diskussionsthema für den kommenden Freitag standen die »Entwicklung des Mischna-Hebräischen und Beispiele für Unterschiede zwischen diesem und dem modernen Hebräisch« auf dem Unterrichtsplan. Er kündigte auch an, daß er in den nächsten paar Wochen seine gewöhnlichen Sprechstunden nicht abhalten würde, so daß besondere Terminvereinbarungen getroffen werden müßten.
Die kühle Abendluft, die ihm außerhalb des Gebäudes entgegenströmte, erfrischte ihn nur wenig. Es ging auf fünf Uhr nachmittags zu, und die Sonne war fast untergegangen. Um diese Zeit, zwischen den Tages- und Abendveranstaltungen, war der Campus, das ausgedehnte Unigelände, ruhig und fast menschenleer. Die wenigen Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, als er die Außentreppe des Gebäudes hinunterlief – einen Bericht über seine Handschriften an Randall schicken, Angie vor sechs Uhr anrufen, auf dem Heimweg an der Reinigung vorbeifahren –, wurden von einer Stimme an seiner Seite unterbrochen:
»Dr.Messer? Entschuldigen Sie …«
Er hielt auf der letzten Treppenstufe inne und schaute hin. Judy Golden war fast dreißig Zentimeter kleiner als er, und durch ihre flachen Sandalen wurde dieser Unterschied noch betont. Sie war ein zierliches, hübsches Mädchen. Ihr volles schwarzes Haar wehte im Abendwind. »Entschuldigen Sie, sind Sie in Eile?«
»Nein, überhaupt nicht.« In Wirklichkeit hatte er es natürlich eilig, aber er war auch neugierig, was sie von ihm wollte. Seit Beginn des Semesters hatte sich das stille Mädchen nur selten zu Wort gemeldet.
»Ich wollte Ihnen nur sagen, daß mir Ihr Gebrauch von ›Common Era‹ anstelle von ›Anno Domini‹ gefällt.«
»Wie bitte?«
»Viertes Jahrhundert C.E. Das haben Sie doch an die Tafel geschrieben.«
»Oh, ja, ja …«
»Ich war überrascht, es zu sehen. Besonders, weil es von Ihnen kam. Nun, ich meine … Ich wollte Sie nur wissen lassen, was ich darüber denke. Dieser Linguistik-Hauptfächler Glenn Harris fragte mich auf dem Weg aus dem Seminarraum, was es bedeute …«
Ben runzelte die Stirn. »Was meinen Sie damit, besonders, weil es von mir kam?«
Judy errötete und wich ein paar Schritte zurück. »Es war blöd von mir, das zu sagen. Es tut mir leid, es rutschte mir nur so heraus …«
»Oh, schon in Ordnung.« Er setzte ein Lächeln auf. »Aber was meinten Sie damit?«
Sie wurde noch röter. »Nun, ich meine, jemand erzählte mir, Sie seien Deutscher. Sie seien in Deutschland geboren, sagten sie mir.«
»Oh, das … Ja, das stimmt … aber …« Ben ging seinen Weg in der eingeschlagenen Richtung weiter, und Judy versuchte an seiner Seite mit ihm Schritt zu halten.
»Der Gebrauch von C.E. bedeutet nicht zugleich eine theologische Meinung. Es ist, wie wenn ich sage ›Ms‹. Wenn ich Sie Ms. Golden nennen würde, müßte das nicht unbedingt bedeuten, daß ich ein Anhänger der Frauenemanzipation bin.«
»Trotzdem sieht man C.E. nicht oft.« Sie mußte doppelt so viele Schritte machen, um mit seinem Tempo mitzuhalten.
»Ja, das kann schon sein.« Ben hatte niemals wirklich darüber nachgedacht. Unter jüdischen Historikern und Geisteswissenschaftlern hatte man den Gebrauch von ›A.D.‹ zur Bezeichnung der neuen Zeitrechnung fallenlassen, weil es ein Einverständnis mit der Bedeutung dieses Begriffs mit einschloß. Statt dessen benutzte man jetzt ›C.E.‹, Common Era, eine objektivere Bezeichnung, die aber eigentlich dasselbe aussagte.
»Was hat die Tatsache, daß ich in Deutschland geboren wurde, damit zu tun?«
»Nun, es ist ja eine jüdische Erfindung.«
Für einen Augenblick zeigte sich eine leichte Überraschung auf seinem Gesicht. Dann lachte er kurz auf und meinte: »Oh, ich verstehe. Wissen Sie denn nicht, daß ich auch Jude bin?«
Judy Golden blieb unvermittelt stehen. »Wirklich?«
Er schaute auf ihr Gesicht hinab.
»Was ist denn los? Oh, warten Sie, sagen Sie’s mir nicht. Ich sehe nicht jüdisch aus, ist es das, was Sie denken?«
»Ich befürchte, jetzt bin ich wirklich ins Fettnäpfchen getreten«, erwiderte Judy verlegen. »Genau das habe ich gedacht. Und dabei hasse ich diese Vorurteile selbst.«
Sie liefen in Richtung auf das nächstgelegene Parkhaus weiter.
»Das erklärt es«, sagte sie.
»Erklärt was?«
»Das C.E.«
»Da muß ich Sie leider enttäuschen. Für mich beinhaltet diese Abkürzung keinerlei persönliche Anschauung. Ich benutze sie als objektive Bezeichnung und nicht aufgrund einer Nichtanerkennung des Glaubens, der durch die Worte Anno Domini, im Jahr unseres Herrn, zum Ausdruck kommt. Außerdem wird es in zahlreichen Büchern so gehandhabt, und auch viele meiner Kollegen sind dazu übergegangen, diesen Begriff zu verwenden. Die Juden haben da kein Monopol. Nur weil jemand C.E. sagt anstatt A.D., heißt das noch lange nicht, daß er ein Zionist ist.«
Unwillkürlich faßte sie nach ihrer Kette.
»Wissen Sie«, fuhr Ben fort, als sie sich dem Parkhaus näherten, »Sie sprechen Hebräisch wie eine Muttersprachlerin. Haben Sie Israel je besucht?«
»Nein, aber eines Tages würde ich das gern tun.«
Sie blieben am Eingang stehen. Hinter ihnen ging die Sonne unter und tauchte den Horizont in flammendrotes Licht. Ben wartete höflich darauf, daß die junge Frau noch etwas sagte, obwohl er insgeheim hoffte, daß das Gespräch beendet sei. Schließlich meinte er: »Jemand wie Sie, mit Ihrem Interesse für die Religion, die hebräische Sprache und das jüdische Erbe, sollte eigentlich seinen ganzen Besitz verkaufen und sich ein einfaches Flugticket nach Israel holen.«
»Das habe ich schon mehrmals versucht, aber meine Pläne schlugen immer fehl. Es ist schwer, Geld dafür aufzutreiben. Trotzdem danke, Dr.Messer, daß Sie sich Zeit für mich genommen haben. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen.«
Der Anblick des alexandrinischen Kodex auf seinem Schreibtisch verschaffte Ben gleich wieder ein schlechtes Gewissen, als er sich mit einem Glas Wein und einer noch nicht angezündeten Pfeife darüber beugte. Dr.Joseph Randall hatte ihn in einer Fotokopie vor zwei Wochen zwecks genauerer Übersetzung an Ben geschickt. Er war in einem koptischen Kloster in der Wüste bei Alexandria gefunden worden und befand sich nun im Ägyptischen Museum in Kairo. Es handelte sich um ein Manuskript in griechischer Sprache, das viele Parallelen zum Codex Vaticanus aufwies, einer im vierten Jahrhundert in Ägypten entstandenen Pergamenthandschrift der Bibel. Randalls Papyrus mit dem Titel »Apostelbrief des Markus« enthielt viele Ungenauigkeiten, und obwohl er unwiderlegbar vor vielen hundert Jahren geschrieben worden war, war er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht echt.
Ben legte seine Pfeife zur Seite und trank den Wein aus. Aus der Stereoanlage ertönte leise und unterschwellig Bachs Toccata und Fuge in d-moll. Das half ihm oftmals, sich zu konzentrieren.
Im dritten und vierten Jahrhundert wimmelte es nur so von Fälschungen, von denen man viele für Briefe und Geschichten der Apostel hielt. Die vor ihm liegende Handschrift mußte jahrhundertelang sehr verehrt worden sein, bevor sie beim Auszug der Mönche aus dem Kloster zurückgelassen wurde, denn der Evangelist Markus galt als der Begründer der christlichen Kirche in Ägypten vor neunzehnhundert Jahren. Das war es wenigstens, was die Kopten glaubten.
»Wenn es überhaupt einen heiligen Markus gegeben hat«, murmelte Ben. Es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren.
Auch der Wein hatte nicht geholfen, und Bach ging ihm langsam auf die Nerven. Außerdem hatte er vergessen, auf dem Heimweg an der Reinigung zu halten.
Der Kodex war ein langes Werk und nicht sehr sorgfältig verfaßt. Einige Wörter waren nebulös und machten ganze Sätze unklar und bedeutungslos. Er griff auf mehrere andere Texte zurück, um Vergleiche anzustellen, und spürte, wie er sich selbst zwingen mußte, um beim Thema zu bleiben. Als wenig später Poppäa Sabina heraufsprang, um die Schreibtischplatte zu untersuchen, nahm Ben sie auf den Arm und begann, sie zu streicheln.
»Du hast ganz recht, meine struppige Teufelin. Eine Arbeit, die es wert ist, getan zu werden, ist es wert, gut getan zu werden. Und ich tue sie nicht gut.«
Er hörte das leise Schnurren der Katze an seiner Brust. Dann stand er auf, um es sich in einem der beiden behaglichen Sessel im Wohnzimmer bequemer zu machen. Bens Wohnung lag im Norden des Stadtteils Wilshire, also etwas unterhalb von Hollywood, und war deshalb auch entsprechend teuer, aber dafür hatte er viel Platz und viel Ruhe und konnte ungestört arbeiten. Er hatte die Räume sehr komfortabel eingerichtet. Das Wohnzimmer war sehr bequem mit seinen Teppichen, Kunstgegenständen und einladenden Möbelstücken. Seine vielen Bücherregale hatte er im Arbeitszimmer untergebracht, das ganz in Leder und dunklem Holz gehalten war. Außerdem verfügte er über Schlafzimmer und Küche, mit separatem Eingang und einem Balkon. Ben fühlte sich wohl in seiner Wohnung und nutzte sie häufig als stillen Zufluchtsort.
Trotzdem konnte er sich an diesem Abend nicht so recht entspannen. »Es liegt an diesem alten Juden«, sagte er zu Poppäa, die ihre Nase an seinem Hals rieb. »David Ben Jona ist bei weitem interessanter als dieser gefälschte Markus-Brief.«
Ben stützte seinen Kopf gegen die Sessellehne und starrte an die Decke. Zumindest, dachte er kühl, würde ich eher an die Existenz von David Ben Jona glauben als an einen Heiligen namens Markus, der angeblich das Evangelium niederschrieb. Benjamin Messer räumte ein, daß ein römischer Jude mit Namen Johannes Markus wahrscheinlich im ersten Jahrhundert in Palästina gelebt hatte und vermutlich in die Aktivitäten der Zeloten verstrickt gewesen war. Aber wer war das in Judäa zu jener Zeit nicht? Doch daß er der Autor des früheren und kürzesten Evangeliums sein sollte, war höchst fragwürdig. Immerhin existierte das Markus-Evangelium vor dem vierten Jahrhundert nicht einmal in irgendeiner vollständigen Form. Was, außer dem Glauben daran, konnte beweisen, daß das Markus-Evangelium »echter« war als zum Beispiel der Markus-Brief, der nun auf Bens Schreibtisch lag?
Glaube.
Ben setzte seine Brille ab, die ihm ungewohnt schwer vorkam, und legte sie auf das Seitentischchen neben sich. Was war überhaupt Glaube, und wie konnte man ihn messen? Daß das Neue Testament erst seit ungefähr dem Jahr dreihundert nach Christus in schriftlicher Form nachweisbar war, schien den Glauben so vieler Millionen Christen nicht im geringsten zu beeinträchtigen. Daß die Geschichte von der Unbefleckten Empfängnis, von unzähligen Wundern und von der leibhaftigen Auferstehung nach dem Tod der Menschheit erst Jahrhunderte, nachdem sie sich angeblich zugetragen haben, in Handschriften überliefert worden war und daß ihre Urheberschaft bis heute nicht zweifelsfrei bestimmt werden konnte, hatte keine Auswirkungen auf die Überzeugung von Millionen. Das war Glaube.
Einen flüchtigen Augenblick lang dachte Ben an seine Mutter Rosa Messer, die bereits vor vielen Jahren einen gnädigen Tod gefunden hatte. Und ebenso rasch schob er die Erinnerung daran beiseite. Es tat ihm nicht gut, jetzt an sie zu denken. Ebenso hatte Ben längst den Versuch aufgegeben, die wenigen Erinnerungen an seine Kindheit nach seinem Vater, Rabbi Jona Messer, zu durchforsten. Er war gestorben, als Ben noch ein kleiner Junge war.
Das war in Majdanek gewesen, einem Ort in Polen, an den Juden deportiert worden waren.
Das Telefon klingelte dreimal, bevor Ben aufstand, um den Hörer abzunehmen.
»Wie kommst du voran?« fragte Angie. Sie äußerte stets Interesse an seinem neuesten Übersetzungsvorhaben, und ob es nun echt oder gespielt war, spielte für Ben keine Rolle.
»Langsam«, gab er zurück. »Na ja, eigentlich geht es überhaupt nicht voran.«
»Hast du gegessen?«
»Nein. Hab keinen Hunger.«
»Willst du vorbeikommen?«
Ben zögerte. Gott, es wäre schön, bei Angie abzuschalten. Vor dem Kamin zu sitzen und die alten Manuskripte für eine Weile zu vergessen. Und mit ihr zu schlafen.
»Ich hätte wirklich große Lust dazu, Angie, aber ich habe Randall mein Wort gegeben. Gott, dieses Zeug ist der letzte Mist.«
»Kürzlich nanntest du es noch eine Herausforderung.« Ben lachte. Seine Verlobte hatte eine bemerkenswerte Gabe, jemanden aufzuheitern. »Das ist dasselbe. Ja, es ist eine Herausforderung.« Sein Blick schweifte zurück zum Schreibtisch, blieb aber nicht an der Fotokopie von Randalls Kodex, sondern an dem braunen Umschlag haften, der Weatherbys drei Fotografien enthielt.
Das war es, was ihn wirklich beschäftigte. Nicht der alexandrinische Kodex oder sein Versprechen gegenüber Joe Randall. Es waren die drei Fragmente einer Schriftrolle, die vor kurzem in Khirbet Migdal ausgegraben worden war und deren letzte paar Zeilen noch nicht übersetzt waren.
»Angie, ich werde ein Nickerchen machen, dann aufstehen und die Arbeit in Angriff nehmen. Ich habe Randall versprochen, ich würde ihm in zwei Wochen die beste Übersetzung abliefern. Du verstehst schon.«