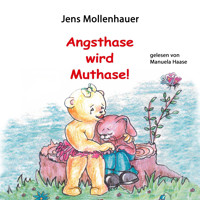9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Für den erfahrenen Jugendschützer Jens Mollenhauer gehören sie zum Alltag: Kinder, die andere verprügeln und ihre Taten mit dem Handy filmen. Teenager, die mehr Akteneinträge als Lebensjahre auf dem Buckel haben. Mollenhauer hat mit zahllosen Betroffenen gesprochen, Tätern wie Opfern, um die Hintergründe zu erfahren und zu zeigen, dass Gewalt keine Lösung ist. Gewalt, die ihren Ursprung fast immer in verletzten Gefühlen, Vernachlässigung und mangelnden Vorbildern hat: «Herzgewalt» eben. Eindrücklich schildert Jens Mollenhauer seine Begegnungen und plädiert für einen anderen Umgang mit unseren Kindern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jens Mollenhauer
Herzgewalt
Warum wir kriminelle Jugendliche nicht alleinlassen dürfen
Über dieses Buch
Wir dürfen gewalttätige Jugendliche nicht alleinlassen!
Kinder, die andere verprügeln und ihre Taten mit dem Handy filmen. Teenager, die mehr Akteneinträge als Lebensjahre auf dem Buckel haben. Sogenannte Systemsprenger, die für keine Hilfsmaßnahmen mehr erreichbar scheinen – für den pensionierten Polizisten Jens Mollenhauer gehörten sie zum Alltag. Was ist mit diesen Jugendlichen los? Wo sind Empathiefähigkeit und Respekt? Welche Verantwortung tragen wir als Gesellschaft, und wie kann man verloren geglaubte Jugendliche wieder zurückholen? Mollenhauer hat als Jugendschützer mit zahllosen Betroffenen aus allen Schichten gesprochen, um die Hintergründe zu erfahren und zu zeigen, dass Gewalt keine Lösung ist. Gewalt, die ihren Ursprung fast immer in verletzten Gefühlen, Vernachlässigung und mangelnden Vorbildern hat: «Herzgewalt» eben. Eindrücklich schildert Jens Mollenhauer seine Begegnungen und plädiert für einen anderen Umgang mit unseren Kindern.
Vita
Jens Mollenhauer arbeitet seit fast vierzig Jahren als Polizist. Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei und als Undercover-Polizist leitet er inzwischen seit einigen Jahren die deutschlandweit einzigartige Jugendschutzeinheit der Hamburger Polizei. Er engagiert sich ehrenamtlich an Schulen und Kindergärten und bietet Workshops für Gewaltprävention und gegen Mobbing an. Er lebt mit seiner Frau und seinen acht Kindern in der Nähe von Hamburg.
Axel Fischer ist TV-Journalist und Kameramann. Er wirkte bei zahlreichen Investigativ-Reportagen u.a. für SPIEGEL TV, das ZDF und ARTE mit. Er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Schleswig-Holstein.
Nicola Fischer ist Journalistin und TV-Produzentin. Sie arbeitet u.a. für TV-Formate der ProSiebenSat.1 Media, RTL, NDR und ZDF. Ihren Themenschwerpunkt hat sie auf sozial- und gesellschaftspolitische Themen im Boulevard gelegt. Die gebürtige Hamburgerin lebt mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn in Schleswig-Holstein.
Impressum
Hinweis: Die Namen der Protagonist:innen sind geändert, persönliche Details und Orte zum Schutze der Personen verfremdet.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Regina Carstensen
Bilder im Tafelteil © Jens Mollenhauer
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung Eva Häberle
ISBN 978-3-644-01823-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1 Die gute Gang
2 Hamburgs Hinterhof
3 Lukas – der Junge vom Balkon
4 Mehr Akteneinträge als Lebensjahre
Marshall B. Rosenberg – der Mann, der mich prägte
5 Abwesende Väter
Die Rolle des Vaters
Die «Onkel» in meiner Familie
Papa-los
6 Du bist ein Mann, du musst dich wehren
7 Prügelei auf Instagram
8 Gewalt kennt kein Geschlecht
Charleen – auf dem Weg zur Freiheitsstrafe
9 Hotspots – wo es eskaliert
Schwieriges Pflaster Jungfernstieg
Selina und ihr Baby
10 Shisha-Bars und Einsätze in Einkaufszentren
Dimi und seine Gang
11 Die Rolle der Schulen
Meine Reise zu den Indigenen in die USA
Finley außer Rand und Band
Fußball ist Männersache
12 Systemsprenger
Jason – Schläger, Tankstellenräuber und Dieb
13 Die Akte Anissa – wohin mit den Hoffnungslosen?
Tod und Hass per Messenger
Wohin mit den Hoffnungslosen?
14 Zu jedem Täter gehört ein Opfer – die andere Seite
Echte Freunde
15 Was man tun kann: Zeit, Zärtlichkeit und Zuneigung
Danke
Tafelteil
Prolog
Plötzlich bekam ich einen heftigen Tritt in den Rücken. Ich schaffte es gerade noch, mich umzudrehen. Prompt kassierte ich einen weiteren Fußtritt, diesmal mitten ins Gesicht. Ich taumelte. Es folgten Faustschläge und Hiebe, ohne Pause. Es waren mehrere Angreifer, einer der Typen tänzelte um mich herum wie ein Profi-Kampfsportler. Trotz einiger Erfahrung mit gewalttätigen Konflikten hatte ich ihm und seinen Kumpels wenig entgegenzusetzen und nahm nur etwas die Arme zur Verteidigung hoch. Noch ein Schlag. Ein schrilles Pfeifen im linken Ohr. Dann ging ich zu Boden – und da lag ich dann auf dem rauen Pflaster des Hamburger Doms, des größten Volksfests der Stadt.
Die Typen ließen nicht von mir ab. Noch mehr Tritte und Schläge folgten, und ich dachte: Die bringen mich um. Scheiße, das war’s. Das ist mein Ende! Aber da war noch ein Gedanke, fast noch schlimmer als der vorherige: Ich bin ein Loser, denn ich habe mich nicht mal gewehrt. Schließlich ein Filmriss. Absolute Schwärze, vor meinem inneren Auge zog nichts vorbei.
Das Nächste, woran ich mich erinnerte, waren die Polizei-Kollegen von der hundert Meter entfernt gelegenen Dom-Wache, die mir zur Hilfe eilten. Ich wurde ins nahe Krankenhaus gebracht, die Diagnose: geprellte Rippen, Gehirnerschütterung und ein Nasenbeinbruch. Körperlich und seelisch war ich ordentlich demoliert.
Das war 1983. Meine wilde, unstete Zeit lag hinter mir. Inzwischen war ich Polizeianwärter, und das war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Als Heranwachsender galt ich nicht gerade als unkompliziert, war wohl eher das, was man heute einen problematischen Jugendlichen nennen würde. Ich beging Diebstähle, Körperverletzung, knackte Automaten und hatte drei Freundinnen gleichzeitig. Ich war alles andere als ein feiner Mensch.
Irgendwann musste ich mich entscheiden, auf welcher Seite ich im Leben stehen wollte. Denn mir wurde klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich wollte auf die gute, die rechtschaffene und ehrliche Seite. Da gehörte ich hin und fand schließlich bei der Polizei meinen Platz. Aber nicht nur meinen beruflichen Platz, sondern auch eine Zugehörigkeit und vielleicht sogar die Ersatzfamilie, nach der ich jahrelang ziellos gesucht hatte.
An besagtem Nachmittag hatten wir uns mit einigen Polizeianwärter-Kollegen vorgenommen, privat auf den Dom zu gehen, wir wollten etwas unternehmen, uns amüsieren. Mit stolzgeschwellter Brust spazierten wir über den Jahrmarkt. Dabei hatte ich gerade mal eine Woche Rechtskunde und die Einkleidung an der Polizeischule hinter mir. Wie junge Erwachsene es gern tun, schauten wir den Mädels nach. Leider hatte ich die Rechnung ohne die «Streetboys» gemacht, eine Gang mit Verbindung zum Kiez und berüchtigt dafür, brutale Schlägereien anzuzetteln. In diesem Fall auch mit mir. Ich zwinkerte auf dem Volksfest dummerweise der falschen Frau zu, denn sie war mit einem der Männer aus der Gang verbandelt.
Ein falscher Blick – und die prügeln mich fast tot? Dieses Ereignis brannte sich bei mir ein wie ein Trauma. Es dauerte nur wenige Sekunden, die sich jedoch anfühlten wie Stunden. Die Tritte und Schläge trafen mich blitzschnell. Keiner in meiner Nähe half mir. Kein Passant, kein Schausteller, niemand, der etwas sagte oder zumindest den Notruf wählte. Meine damaligen Polizeianwärter-Kollegen flüchteten, aus Angst, selbst angegriffen zu werden. Im Grunde unverständlich, wenn man bedenkt, dass Polizisten helfen und eben nicht weglaufen sollen. Besonders einschneidend war für mich, dass ich mich für unverletzbar gehalten hatte, ich davon ausgegangen war, eine tolle Nummer zu sein. Aber ich war nur ein kleines Licht, das Opfer von Gewalt wurde und leidvoll erfahren musste, was fehlende Zivilcourage bedeutete.
Daraus entstand der Wunsch, etwas gegen solche Gewalt zu tun. Ich fragte mich: Warum hörten die Gang-Mitglieder nicht auf, als ich schon auf der Erde lag? Wie konnten Menschen so schnell, geradezu von null auf hundert, derart aggressiv agieren? Und woher rührte diese enthemmte, skrupellose Gewalt? Ich machte mich auf die Suche nach Antworten. Dabei half mir auch die Rückschau auf mein eigenes Leben. Warum driftete ich bereits als Grundschüler ab, rauchte heimlich im Gebüsch und wurde rebellisch? Wie war es dazu gekommen, dass ich als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geriet und selbst Mitglied einer Gang wurde?
Als Teenager erfuhr ich von der Lebenslüge meiner Mutter. Mein Vater, der starb, als ich vier Jahre alt war, war gar nicht mein leiblicher Vater. Trotzdem ließ mich meine Mutter jahrelang weiterhin zu seinem Grab pilgern und Blumen niederlegen. Doch in Wirklichkeit war ich das Ergebnis einer Affäre in Italien mit einem erfolgreichen Komponisten, der dort eine Familie hatte. Mein älterer Bruder, offenbarte sie mir, war auch nicht mein leiblicher Bruder, sondern er wurde von meiner Mutter adoptiert. Sie hatte gedacht, sie könne keine eigenen Kinder bekommen. Die Affäre in Italien hatte das Gegenteil bewiesen.
Mit diesen neuen Erkenntnissen zerbrach für mich als Heranwachsender meine Welt. Von einem Tag auf den anderen hatte ich meinen familiären Halt verloren, mir fehlten Vorbilder, an denen ich mich orientieren konnte. Ziellos begann meine Suche nach Zugehörigkeit, vielleicht sogar Identität. Durch die Lügen war nur noch unbändige Wut in mir, auf alles und jeden. Als junger Erwachsener, mit neunzehn Jahren, suchte ich die Weite. Ich lebte in den USA bei einem indigenen Stamm. Die große Wut in mir nannten die Indigenen «Feuer im Bauch».
Diese Wut ist nun vierzig Jahre her. Aber die Erinnerungen und Empfindungen von damals sind geblieben. Und genau diese Wut sehe ich heute oft bei auffälligen Kids und problematischen Jugendlichen.
Trotz der Gewaltaktion auf dem Hamburger Dom oder gerade deswegen blieb ich weiter auf der Spur. Für Gewaltfreiheit und Jugendschutz, dafür schlug mein Herz, so sehr, dass ich mich 2009 bei einer besonderen Einheit der Hamburger Polizei bewarb, bei der Abteilung Jugendschutz. Seit über zwölf Jahren kümmere ich mich nun um kriminelle Jugendliche und Kids. Als Polizist und als Mensch. Ich höre ihnen zu, spreche mit ihren Eltern oder mit Großeltern, zu denen sie abgeschoben wurden, und weiß oft, was die Kids in ihrem Alltag bewegt. Für viele von ihnen ist Gewalt die einzige Lösung, der einzige Ausweg. Es ist ihre Form der Kommunikation. Ein Auf-sich-aufmerksam-Machen, ein Ventil für ihre stille Wut und das Feuer, das auch ich als Teenager im Bauch hatte.
Mit diesem Buch möchte ich zeigen, dass wir kein Kind und keinen Jugendlichen verloren geben und um jeden und jede kämpfen sollten. Ich möchte Eltern dazu ermutigen, die Entwicklung ihrer Kinder genau zu beobachten und aufmerksam ihr Leben zu verfolgen. Ihnen ein Vorbild zu sein und sie nie aus den Augen zu verlieren, ganz egal, in was für einer Lebensphase sie sich gerade befinden.
In diesem Buch spreche ich über Erlebnisse aus meinem Berufsalltag und zeige Fälle, bei denen Erziehung gescheitert ist und es an Liebe und Zuneigung fehlte. Ich möchte mit diesem Buch keine Ängste schüren, sondern aufklären. Auch rebellische Kids sollten die Chance und das Recht haben, Gehör und Zuwendung zu erfahren. Dafür sind wir als Gesellschaft verantwortlich, und dazu fühle ich mich als Jugendschutz-Polizist verpflichtet.
1Die gute Gang
Als ich auf dem Hamburger Dom zusammengeschlagen wurde, war ich erst wenige Tage Polizeischüler. Damals erfuhr ich, was fehlende Zivilcourage bedeutet. Ich hatte die Hilflosigkeit gespürt, als meine Kollegen die Flucht ergriffen, um ihre eigene Haut zu retten. Obwohl ich in meiner Freizeit geboxt hatte, hatte ich keine Chance gegen die «Streetboys». Bestimmt war ich kein begnadeter Boxer gewesen, aber gut genug, um mich verteidigen zu können – dachte ich. Mein Selbstwert war ganz unten. Meine verwundete Seele brauchte einen Kitt. Ich sehnte mich nach etwas, das mir mein Selbstvertrauen zurückgab. Und so landete ich unmittelbar nach meiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei. Eine Einheit, die perfekt zu mir passte. Denn neben dem Boxsport lief ich Marathon. Ich war Sportler durch und durch. Damit war ich bei der Bereitschaftspolizei in guter Gesellschaft. Sie war die Truppe fürs Grobe. Für Demos, Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Davon gab es 1986 reichlich.
Die Stimmung in der Stadt war spannungsgeladen. Das Kernkraftwerk Brokdorf vor den Toren Hamburgs wurde in Betrieb genommen, trotz massiven Widerstands aus der Bevölkerung. Es war die Zeit, als mehrere Wohngebäude der Hafenstraße von linksautonomen Demonstranten besetzt wurden, ein Konflikt, der immer wieder in heftigen Straßenschlachten gipfelte. Alles Einsatzgebiete für die Bereitschaftspolizei. Unsere Truppe hieß Festnahmezug und bestand nur aus jungen Typen, muskelbepackt, mit Bock auf Action. Alle waren hoch motiviert.
Wir waren eine Einheit, bei der sich der eine auf den anderen verlassen konnte. Mussten wir auch. Denn wenn eine Demo in der Hafenstraße angekündigt war, hatte das mit friedlichen Kundgebungen nichts zu tun. Stattdessen trafen wir auf vermummte Autonome, brennende Barrikaden, fliegende Pflastersteine. Und wir an vorderster Front. Das war Straßenkampf. Bei einem Einsatz wurde ein Kollege von einem Molotowcocktail getroffen und brannte wie eine Fackel. Wir konnten ihn zum Glück schnell löschen. Bei einem anderen Einsatz wurden von fünfundzwanzig Kollegen einundzwanzig verletzt. Die Polizeitaktik bei Demos mit Gewaltpotenzial war damals noch nicht sonderlich ausgereift. Reinlaufen, Draufknüppeln, Rückzug.
Wir hießen zwar Festnahmezug, unser Spitzname war allerdings «Schädelzug», da wir selten jemanden festnahmen, aber immer mit dem Kopf vorangingen. Man musste kein Stratege sein, um zu erkennen, dass am Ende mehr Verletzte als Erfolge zu registrieren waren. Deshalb wurde später die BFE gegründet, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, eine Spezialeinheit, die bis heute Teil der Hamburger Polizei ist. Sie ist für derartige Manöver geschult, denn unser Schädelzug wirkte bei den Demos eher eskalierend als befriedend.
Als ich in die BFE kam, wurde ich undercover bei Demos eingesetzt, zur Observation von Personen. Mit meinen langen schwarzen Haaren – eine Matte wie Thomas Anders von Modern Talking – sah ich einem Autonomen viel ähnlicher als den meisten meiner Kollegen. Die Straftäter bei Demonstrationen konnten so problemlos festgenommen werden, das Demonstrationsrecht wurde auf diese Weise geschützt und Eskalationen wurden vermieden. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Konzept.
Nur wenige Hundert Meter von der Hafenstraße entfernt, auf der Hamburger Reeperbahn, tat sich Ende der Achtzigerjahre/Anfang der Neunzigerjahre ebenfalls etwas. Das Machtmonopol unter den Zuhältern hatte sich verschoben, Albaner gewannen zunehmend an Einfluss und verdrängten die Alteingesessenen. Das Gefüge geriet durcheinander, und die Situation wurde insgesamt unübersichtlich. Die Polizei wusste nicht mehr genau, wer im Prostitutionsgeschäft das Sagen hatte. Parallel liefen Anfang der Neunzigerjahre zahlreiche Verfahren wegen Scheckbetrugs. Das LKA wollte herausfinden, wer dahintersteckte. Und da sie wussten, dass ich undercover agieren konnte, sollte ich als nicht offen ermittelnder Beamter eingesetzt werden, als NoeB. Ich sollte unter falscher Identität den Ort aufsuchen, von dem aus die Albaner operierten: eine kleine Kneipe am Hamburger Berg. Heute eine Partystraße mit zahlreichen Lokalen, damals allenfalls eine heruntergekommene Gasse, in der zwielichtige Kaschemmen sich aneinanderreihten, darunter Zum Goldenen Handschuh, in dem der Serienmörder Fritz Honka seine Opfer kennenlernte, oder der gegenüberliegende Elbschlosskeller, Sammelbecken für alle Gestrandeten von St. Pauli.
Mein Job bestand darin herauszufinden, wer in dem Laden telefonierte. Ich sollte Kontakt zu den entsprechenden Personen herstellen und ihr Vertrauen gewinnen, um am Ende die Hintermänner des groß angelegten Scheckbetrugs ausfindig zu machen.
Also marschierte ich eines lauen Sommerabends im Juni 1994 in die Kneipe hinein und begrüßte die dort anwesenden Personen mit einem fast überschwänglichen «Ciao belli miei». Denn meine Legende wich nur in Teilen von meinem tatsächlichen Lebenslauf ab. Ich war ein boxender Halbitaliener mit Wohnsitz in Lüneburg, der den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hatte, sich nebenbei als Versicherungsmakler verdingte und mehr Geld verdienen wollte, um seine Schulden bezahlen zu können. Aus diesem Grund wollte ich Zuhälter werden, um mir mit Prostituierten ein wenig etwas dazuzuverdienen. Abgesprochen hatte ich diese Legende zu diesem Zeitpunkt mit noch niemandem. Ich erzählte sie einfach, weil sie zumindest in der Familiengeschichte meinem eigenen Leben ähnelte und für mich so jederzeit rekapitulierbar war. Ich setzte mich also an den Tresen und sprach die junge Frau neben mir direkt an.
«Buonasera, darf ich dich zu einem Drink einladen?»
«Gerne, dich habe ich ja noch nie hier gesehen», antwortete sie. Sie war höchstens Mitte zwanzig, hatte rotblondes, schulterlanges Haar, ein puppenhaftes Gesicht mit vollen Lippen. Ein bisschen sah sie aus wie die junge Katja Ebstein.
«Was trinkst du denn?»
«Whiskey Cola.»
«Und wie heißt du?» Ich fiel mit der Tür ins Haus.
«Tanja. Aber jetzt hast du mir immer noch nicht verraten, was so einen schnuckeligen Typen wie dich in dieses Loch hier verschlägt.»
«Ich bin neu in Hamburg. Und ich sag’s dir ganz ehrlich: Ich brauche mehr Kohle. Ich bin hier auf dem Kiez, weil ich Zuhälter werden will. Kein Großer, ein, zwei Frauen würden schon reichen. Vielleicht kannst du mich ja mit Leuten bekannt machen.»
Tanja und ich hatten sofort einen Draht zueinander. Sie kam selbst aus dem Milieu, hatte einen Freund, für den sie «ackerte», wie sie sagte. Sie ging also anschaffen und war mit den Personen aus dem Rotlichtmilieu bestens vernetzt. Als Boxer mit Namen Luigi Esposito hatte ich einen guten Einstieg und war bereits am Ende des Abends mit der Hälfte der Kneipe per Du. Am nächsten Morgen erschien ich auf der Dienststelle, um meinem Vorgesetzten von meinen Erlebnissen zu berichten.
«Jens, du bist wahnsinnig. Wenn wir das wirklich weiterbringen wollen, brauchst du gefälschte Papiere, sonst ist es zu riskant. Du kannst auffliegen. Stell dir vor, die filzen dich und kriegen raus, dass du in Wahrheit Jens Mollenhauer und nicht Luigi heißt.»
Luigi – Gigi – Esposito war der Name meines italienischen Cousins. Den gab es ja wirklich, falls mich jemand überprüfen wollte. Mein Chef besorgte mir einen entsprechenden Personalausweis, und ab dem Moment, in dem ich mich auf der Reeperbahn bewegte, war ich Luigi aus dem Süden Italiens. Und ich wurde Zuhälter. Natürlich kein richtiger, nur nach außen hin. Die Prostituierte, die angeblich für mich arbeitete, war eine V-Frau, eine Vertrauensfrau. V-Leute sind bei der Polizei und beim Verfassungsschutz üblich, um Kenntnisse über ein Umfeld zu erlangen, in dem nur verdeckt ermittelt werden kann. Aktuell werden V-Leute in der rechts- und linksextremen Szene eingesetzt, um an Informationen zu gelangen.
Die V-Frau war Teil meiner Legende, um meine Glaubwürdigkeit gegenüber den wirklichen Zuhältern zu erhöhen. Sie öffnete mir schnell Tür und Tor. In einer Boxkneipe lernte ich Zuhälter kennen, die damals das Geschäft mit der Prostitution auf dem Kiez kontrollierten. Meine Beobachtungen hielt ich minutiös in seitenlangen Berichten fest, die dem LKA als Grundlage für ihre Ermittlungen dienten. Die Luft wurde aber zunehmend dünner für mich, ich musste jederzeit damit rechnen, von Personen aus dem Milieu bespitzelt zu werden. Zu groß war das Misstrauen darüber, dass jemand Geheimnisse ausplauderte, an die die Polizei nicht geraten durfte. Deshalb traf ich mich konspirativ mit einem Mitarbeiter des LKA, der mich führen sollte. Wir tauschten Informationen aus, und ich bekam von ihm Bargeld, damit ich vor den Jungs aus dem Milieu glaubhaft den Luden geben konnte.
Eines Tages allerdings betrat ich mit zwei Albanern einen Waffenladen. Sie brauchten neue Waffen, und ich sollte beim Kauf dabei sein. Zugleich sollte ich herausfinden, welche Waffe für mich geeignet wäre, damit ich mich als Zuhälter behaupten konnte. Das wurde der Einsatzleitung dann zu heiß. Es überstieg meine Qualifikation als NoeB. «Du bekommst Kiezverbot. Du bist nicht führbar!», raunte mir der Einsatzleiter zu. Ein Satz, den ich in meiner weiteren beruflichen Laufbahn noch oft hören sollte. Wie ich vorging, war sicher nicht immer der richtige Weg, aber einer, der mich häufig zum Ziel gebracht hat. Jetzt steckte ich jedoch zu tief im Zuhältersumpf. Ich musste mit einer Legende von der Bildfläche verschwinden.
Zusammen mit einem Kollegen fuhr ich nach Hannover. Das war das letzte Lebenszeichen, das ich auf der Reeperbahn hinterließ. Danach verlor sich meine Spur. Wahrscheinlich hielten mich die meisten für tot. Inoffiziell wurde ich in den Innendienst der Kriminalpolizei versetzt, machte mein Abitur nach und stieg in den gehobenen Dienst der Polizei auf. Von der Arbeit beim Jugendschutz trennten mich damals noch ein paar Jahre.
Rückblickend bin ich froh, diese Zeit irgendwann hinter mir gelassen zu haben. Festnahmezug, Kampfsport, verdeckt ermitteln im Rotlichtmilieu – ich musste einen Gang zurückschalten. Zum Zeitpunkt meines Ausstiegs war ich schließlich bereits dreifacher Familienvater. Ich hatte ein soziales Umfeld, das sich um mich sorgte. Meine Familie, Freunde, Kollegen. Ich hatte meinen Platz im Leben gefunden. Etwas, womit viele «meiner» Jugendlichen hadern.
2Hamburgs Hinterhof
Hamburg ist riesig. Flächenmäßig kaum kleiner als Berlin. 1,8 Millionen Menschen wohnen hier. Hamburg ist das Tor zur Welt, die schönste Stadt der Welt sowieso, Elbphilharmonie, Speicherstadt, der Hafen. Schmuck ist bei uns Hamburgern ein Adjektiv für Schönheit. Und Hamburg sieht schmuck aus, denn der Stadt an der Elbe geht es gut. Die Elbvororte im Westen und die Walddörfer im Norden weisen die höchste Millionärsdichte in Deutschland auf. Hamburg ist nicht so schmutzig wie Berlin, nicht so eng wie München. Eine Stadt der Superlative. Zumindest sieht sich Hamburg selbst so, wenn es darum geht, sich mit anderen Metropolen zu messen.
Die Wahrheit ist nicht ganz so rosig. Hamburg kränkelt, wie viele Großstädte. Soziale Spaltung ist eine seiner Krankheiten. Während es den Menschen rund ums Stadtzentrum besonders gut geht, wächst in der Peripherie die Armut. Gerade im Süden und im Osten der Stadt gibt es jede Menge soziale Brennpunkte, darunter Stadtteile wie Kirchdorf-Süd, Harburg oder Billstedt. Billstedt ist mein Arbeitsplatz. Als «Arbeiterviertel mit internationalem Flair» beschreibe ich es gern. Billstedt hat im Zweiten Weltkrieg viele Bomben abbekommen. Von den begehrten und für Hamburg so charakteristischen Gründerzeitvillen ist hier nicht viel zu sehen. Stattdessen Fünfziger- und Sechzigerjahre-Zweckbauten, wohin man schaut.
Das Straßenbild ist geprägt von Wettbüros, Shisha-Bars, Kulturvereinen und Schawarma-Imbissen. Mehrfamilienhäuser mit rotem Backstein und altem gelblichen Putz wechseln sich ab mit Waschbeton-Blocks, dazwischen hin und wieder ein paar Reihenhäuser. Architektonisch eher fragwürdig. Und immer freitags, rund ums muslimische Freitagsgebet, hat man das Gefühl, in einem anderen Land zu sein. Und das meine ich nicht wertend. Das ist eine besondere Atmosphäre, gerade im Sommer, dann vibriert das Viertel, und die Menschen sind auf den Straßen. Es ist laut, chaotisch und lebendig.
In den Straßen rund ums Billstedt Center, dem größten Einkaufszentrum des Hamburger Südostens, riecht es nach Shisha-Tabak, und auf dem Boden liegen überall die ausgespuckten Hülsen von Sonnenblumenkernen. In einem Reiseführer über Hamburg würde wahrscheinlich stehen: «Billstedt ist ein Stadtteil voller Gegensätze.» In meinen Augen wäre das Schönfärberei. Billstedt ist ambivalent, keine Frage. Graue Architektur auf der einen, grüne Lunge auf der anderen Seite. Parks und Seen wie der Öjendorfer See und die Boberger Dünen sind beliebte Ausflugsziele. Doch zur Wahrheit zählt auch, dass in Billstedt knapp 60 Prozent aller Menschen einen Migrationshintergrund haben. Das sind fast doppelt so viele wie im Durchschnitt in der Hansestadt. Ähnlich sieht es bei der Arbeitslosigkeit aus. Während in Hamburg nur etwa 4,5 Prozent der Menschen ohne Job sind, sind es in Billstedt fast acht Prozent. Die Anzahl der Straftaten von Jugendlichen hat 2022 laut polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) um fast 20 Prozent zugenommen. Eine mögliche Erklärung für diese Zunahme ist die Corona-Pandemie. Schulschließungen und soziale Isolation während des Lockdowns haben bei den Kindern dazu geführt, dass sich ihre Lebensqualität verschlechtert und sich ihr Sozialverhalten negativ entwickelt hat.
Mit Sozialromantik kommt man hier in Billstedt jedenfalls nicht weit. Viele Kulturen, die eher parallel als miteinander leben, mit einem eigenen kulturellen Regelwerk, bestimmen diesen Stadtteil.
Billstedt hat mehrere Hochhaussiedlungen. Mümmelmannsberg, Sonnenland und die Gegend rund um das Billstedt Center sind nur einige davon. Hier hat man in den Sechzigern Straßenzüge voller anonymer Betonburgen errichtet, um für möglichst viele Menschen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wer Geld hat, zieht in die Stadt. Und wie so oft bleiben diejenigen, die sich woanders keine Wohnung leisten können. Hier sind viele meiner Jungs und Mädchen zu Hause. So nenne ich die kriminellen Jugendlichen aus meinem Einsatzgebiet, die ich bei meiner Arbeit fast täglich auf der Straße treffe. In ihrem «Bischded», wie sie es nennen. Billstedt auf «International».
Mittendrin befindet sich das Polizeikommissariat 42, meine Dienststelle, mein Stützpunktrevier. Von hier aus leite ich den Jugendschutz der Polizei Hamburg, Mitte 1 und 2 sowie Bergedorf. Vom Osten der Stadt bis nach St. Pauli erstreckt sich mein Einsatzgebiet. Ein riesiges Areal. Und jeder Stadtteil hat seine Eigenheiten. Wir sind ein fünfzehnköpfiges Team, alles ehemalige Schutzpolizistinnen und Schutzpolizisten, die irgendwann zum Jugendschutz wechselten. Eine eingeschworene Truppe, sehr erfahren, da jeder von uns jahrelang Dienst auf der Straße versehen hat.
Wir betreiben Präventionsarbeit. Unseren Erfolg kann man nicht an Fallzahlen festmachen wie etwa bei der Kripo. Dort werden Ermittlungsresultate in Statistiken erfasst: wie viele Einbrecher gefasst, Gewaltverbrechen aufgeklärt oder Brandstifter festgesetzt wurden. Das gibt es bei uns nicht. Denn Verbrechen, die dank unserer Arbeit gar nicht erst stattfinden, kann man nicht messen.
Der Jugendschutz ist eine Abteilung innerhalb der Polizei, die sich um minderjährige und jugendliche Straftäter kümmert. Oder um solche, bei denen wir befürchten, dass sie es noch werden. Wir besuchen wiederholt straffällig gewordene Jugendliche unangekündigt zu Hause und halten sogenannte Gefährderansprachen. Das sind verbale Warnschüsse, damit die (möglichen) Täter wissen, dass wir sie auf dem Radar haben. Aber wir besuchen auch die Geschädigten, die meist im gleichen Alter sind. In sogenannten Norm- und Hilfegesprächen geben wir den Opfern eine Stimme, hören ihnen zu und schenken ihnen Selbstvertrauen, damit sie möglichst keine Angst mehr vor ihren Peinigern haben.
Aber unser wichtigster Einsatzort ist die Straße. Dort haben wir unsere Ohren. Dort, wo sich die Jugendlichen aufhalten, sind wir. Wir kennen ihre Lieblingsplätze und suchen sie dort auf. Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir sind in Zivil unterwegs, sind aber keine Zivilfahnder, auch wenn uns die Kids gerne als «Zivis» betiteln. Wir fahnden allerdings nicht. Als uniformierter Polizist müsste ich die Kids erst überzeugen, dass vor ihnen nicht nur ein Polizist steht, der den Staat, das Gesetz repräsentiert, sondern auch ein Mensch. In Zivil verschwimmt nach einer Doppelsekunde der Eindruck, wir seien «der Staat». Doch wir halten mit unserer Zugehörigkeit zur Polizei nicht hinterm Berg. Ich trage meinen Ausweis gut sichtbar um meinen Hals. So kann jeder Jugendliche sofort sehen, dass ihm ein Polizist gegenübersteht. Ein Zivilfahnder tut das nicht. Ich will als Polizist erkannt und wahrgenommen werden, ich will mich nicht verstecken oder den Eindruck erwecken, undercover unterwegs zu sein. Diese direkte Art schafft Vertrauen. Die Kids erkennen mich. Sie merken, dass ich nichts Böses von ihnen will. Ich will nur reden. Will erfahren, was sie umtreibt, welcher von ihren Kumpels wieder Mist gebaut und bei wem die Kripo gerade vor der Tür gestanden hat.
Das klingt so einfach: hingehen und mit ihnen reden. Aber es ist das Ergebnis wochen- und monatelanger Arbeit. Der Versuch, eine emotionale Bindung aufzubauen. Und genau das unterscheidet uns vom Rest unserer Kollegen. Wir tun etwas, das die Jugendlichen nicht kennen: Wir nehmen uns Zeit, und wir hören ihnen zu. Tauchen in ihre Welt ein, lernen ihre Freunde, ihre Opfer, ihre Familien kennen. Immer und immer wieder. Das hat viele Vorteile. Denn wenn es Stress gibt, rufen uns die Streifenpolizisten, und wir können deeskalieren. Bei Straftaten zieht uns die Kripo hinzu, denn wir kennen unsere «Pappenheimer» meist schon lange, bevor sie den ersten Akteneintrag haben.
Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich bin und bleibe Polizist. Ich bin kein Sozialarbeiter. Ich habe eine Strafverfolgungspflicht. Beschuldigt ein Jugendlicher sich selbst oder einen seiner Kumpel einer Straftat, muss ich dem nachgehen, ohne Ausnahme. Ich würde mich auch niemals mit einem minderjährigen Jugendlichen hinstellen und eine Zigarette rauchen. Ich lebe Vorbildverhalten nach Gesetzeslage vor. Klingt steif, hilft aber. Ich verbrüdere mich nicht. Mein Auftreten muss im Einklang mit der Arbeit der Polizei stehen. Grenzsetzung gehört dazu. Ich säusele nicht nur oder rede weichgespült. Das ist nicht die Sprache, die die Kids verstehen. Ich erteile Platzverweise, unterbinde Spaßkämpfe und bringe Straftaten zur Anzeige. Ich drücke kein Auge zu. Ich wähle aus, welche Kommunikation wann die beste ist. Ich spreche die Sprache der Jugendlichen und passe mich meinen Adressaten an, damit sie mich verstehen. Manchmal autoritär, mit Du-Botschaften, hart und direkt, dann kommt der Polizist raus. Manchmal aber auch defensiv. Dabei hilft mir mein Urteilsvermögen und meine jahrelange Erfahrung auf der Straße.
Als Polizist denke ich nicht völlig vorurteilsfrei. Ich packe Menschen in Schubladen, scanne sie. Das hilft mir einzuschätzen, wie mein Gegenüber eingestellt ist. Ist er aggressiv, fährt er gerade innerlich hoch? Ist er unsicher, oder versucht er, eine bestimmte Sache zu überspielen? Wühlt ihn etwas auf, oder befindet er sich in einem psychischen Ausnahmezustand? Mich interessiert das Verhalten, das ich in dem Moment beobachte. Den anderen im Blick zu haben und ihn aufmerksam zu checken, dient zugleich der Eigensicherung. Das hat uns Menschen schon vor Zehntausenden Jahren geholfen, Gefahren zu erkennen und besser einzuschätzen.
Wir Jugendschützer sind auch nie allein unterwegs, sondern gehen immer zu zweit auf die Straße. Immer wieder spielen wir das Spiel «Good Cop – Bad Cop». Es ist ein psychologischer Trick, eine Taktik, um zwischen Sympathie und Provokation sowie Einschüchterung abzuwechseln: Der Grat zwischen guter Bulle und Verräter ist sehr schmal. Doch ich selbst verstehe mich als fairer Polizist. Sobald sich ein Jugendlicher in Schwierigkeiten manövriert, weise ich ihn auf die rechtlichen Konsequenzen hin. Das wissen die Jungs zu schätzen und merken es sich. Im Gegensatz zum Sozialarbeiter haben wir aber einen anderen Stellenwert bei ihnen, weil sie wissen, dass wir Polizisten sind. Der Respekt ist ein anderer, denn zwischen den Jugendlichen und mir besteht immer eine natürliche Distanz. Wir sind Polizisten, wir sind bewaffnet, wir dürfen festnehmen, wenn es notwendig ist.
«’nen Bullen wie dich hab ich noch nie getroffen», höre ich oft von den Kids. Sie können mich und meine Arbeit nicht einordnen und entscheiden am Ende aus dem Bauch heraus, ob ich für sie Freund oder Feind bin. Meistens bin ich Freund. Dadurch wenden sie sich an uns, gerade wenn es einen Konflikt gibt, dann erinnern sie sich an mich, erkennen mich wieder. Viele von ihnen haben auch meine Telefonnummer. Denn bei Gesprächen mit den Kids lasse ich meine Visitenkarte mit meiner Diensthandynummer bei ihnen. Dadurch bin ich oft die erste Anlaufstelle, wenn sie Probleme haben. Das ist das Besondere an unserer Arbeit, und deswegen erfahre ich wenig Widerstände.
Nochmals, ich bin Polizist, insofern ist auch meine Ausrüstung die eines Polizisten: Teleskopschlagstock, Reizstoffsprühgerät (RSG), eine schusssichere Weste und natürlich meine Dienstwaffe. Damit geschossen habe ich in meiner gesamten Zeit als Polizist aber nie. Meine Waffe ist das Wort. Wenn das nicht ausreicht, habe ich als Jugendschützer versagt. Und wird es doch mal brenzlig, hole ich Verstärkung und gehe nicht allein in die Konfrontation. Das aber passiert äußerst selten.
Als Leiter unserer Einheit entscheide ich, wer ein Team bildet. Auch hier ist Vertrauen wichtig. Denn wer als Team funktioniert, kann in kritischen Situationen auf den anderen aufpassen. Das ist notwendig, denn die Kids haben trotz ihres oft noch sehr jungen Alters vielfach eine beachtliche Strafakte, nicht selten mehr Akteneinträge als Lebensjahre. Mein Kollege Helge Westphal kennt den Jugendschutz wie kaum ein anderer. Eigentlich bin ich derjenige, der in Bildern spricht. Aber diese sehr passende Metapher kommt von Helge. Er sagt über die gewalttätigen Kids: «Leider ist es so, dass viele der Jugendlichen frühkindliche Gewalt erlebt haben. Und das prägt. Das ist in etwa so, als hätte man dunkle Flüssigkeit in ein Gefäß geschüttet und darauf klare. Das Klare steht für das Gute im Kind, im Menschen. Aber die dunkle Flüssigkeit ist da, und je nachdem, in welche Richtung sich ein Leben bewegt, kann die dunkle Flüssigkeit im Gefäß wieder hochkommen. Man wird sie nicht los.»
Viele stellen sich die Partner-Situation bei der Polizei sicherlich so vor, wie sie in Fernsehkrimis gezeigt wird. Zwei ermittelnde Polizeibeamte, Seite an Seite, die Akten wälzen, im Dienstwagen Unmengen von Kaffee trinken, Wohnungen observieren und bis ins Morgengrauen hinein den Bösewicht jagen, um einen Fall zu lösen. Anschließend gehen sie in eine Kneipe und trinken ein Bier. So ist es aber nicht, die Realität ist eine andere. Allein schon deshalb, weil wir beim Jugendschutz keine Ermittlungsarbeit machen. Und nach Feierabend gehen Helge und ich nach Hause zu unseren Familien, denn wir sind nicht nur Polizisten, sondern auch Väter, und unsere Kolleginnen sind Mütter. Außerdem sind unsere Dienste häufig lang und können sich bis weit nach Mitternacht ziehen.
Was aber tatsächlich zutrifft, ist die Vorstellung von dem besonderen Band, das Kollegen zusammenschweißt. So ist es jedenfalls bei Helge und mir. Seit 2003 ist Helge beim Jugendschutz der Hamburger Polizei und damit der Kollege, der den Job am längsten von uns macht. Seine Perspektive auf die Straße ist ziemlich einzigartig. Er kennt fast jeden Jugendlichen, und die Jugendlichen kennen ihn. Sie haben ihm den Spitznamen «Franzose» gegeben, weil er immer ein Barett aufhat. Helge wollte unbedingt eine Kopfbedeckung tragen, hatte aber das Gefühl, dass ihm keine Mütze wirklich gut steht. Er probierte einige Modelle und Caps durch, bis er schließlich beim Barett landete. Danach trug er es konsequent bei jedem Dienst, und es wurde zu seinem Markenzeichen. Zeitweise trug er die Haare zum Pferdeschwanz mit einem Undercut. Ziemlich cool. Die Jugendlichen sollen uns ja auch erkennen, daher war dieses besondere Accessoire ein klarer Vorteil.