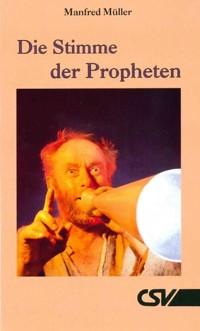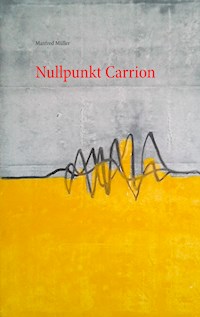Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hugo, genannt Luc, ein junger, vielversprechender Maler, lebt in der Zukunft. Eine spektakuläre Ausstellung wird ihm versprochen; dafür muss er sich aufgeben. Barbara, genannt Inanna, Altorientalistin und renommierte Expertin für die Keilschrift der Sumerer, versteckt sich in die Vergangenheit ihrer Arbeit und ihrer Erinnerungen. Die Gegenwart macht ihr Angst. Beide leben in zwei verschiedenen Städten und in zwei verschiedenen Welten. Aus diesen Zwängen versuchen sie, sich zu befreien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heute kann die Dachlandschaft ihn mal…! Auch das verquälte van Dyck Braun (Farbgemisch aus Ziegelrot, Ruß, Staub, Moos und Jahren der Verwitterung) legt sich heute nicht auf seine Stimmung. Keinen Blick wird er hinwerfen. auch nicht hinunter in die Gassenschlucht, die zwischen den Dachtraufen gähnt. Jedes Mal zieht ihn das alte Gemäuer herunter, sobald er es vor Augen hat. Hier mag sich Carl Spitzweg heimisch gefühlt haben. Er ist für andere Zeiten bestimmt. Er muss von hier weg. Er muss in ein Stadtviertel ziehen, das ihm Anregung gibt, mit neuen Formen und Farben seine Zukunftsbilder zu malen. Eine neue Ausstellung wird er in Angriff nehmen. Sie wird sein Durchbruch werden. Sie wird ihm Anerkennung und Geld verschaffen für eine zukunftsträchtige Wohnung: „zukunftsträchtig“ sein Lieblingswort!
So steht er auf dem Balkon, sieht über das alles hinweg, sieht über sich den Himmel, sieht ein klares, zartes Hellblau. Es wird gutes Wetter geben: ein Frühsommertag im Mai! Er schaut zum Horizont, hin zu einem Streifen aus dunstigem Violett vom Sonnenaufgang, darüber sich ein lichtes, kühles Gelb ausbreitet, das sich nach oben ins Himmelblaue mischt. Solche Ausblicke weisen ihn in die Zukunft, lassen ihn seine Bilder malen, nicht mit dem Kopf, sondern mit Sehnsucht, einer unbeschreiblichen, einer farbintensiven. Er beobachtet den pfeilschnellen Flug der Schwalben. Sie zerschneiden den Himmel, kreuz und quer, aufgeregt ihr Frühstück einfangend.
„Seht die Vögel unter dem Himmel: Sie sähen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?
Wer ist unter euch, der seiner Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.
Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen?“
Für seine Ausstellung wird er eine Serie fertigen, Arbeitstitel: Zukunftsbilder oder besser Sehnsuchtsbilder oder noch besser XYZ1-x, denn das, was in ihm ist und herausmuss, hat keinen Namen. Nur noch das Tafelbild, die Auftragsarbeit, die quälende, dann beginnt mit der Serie, wenn ihn nicht vorher dieser mürbe Balkon in die Tiefe reißt. Jedes Mal überfällt ihn das Gefühl, wieder einmal davongekommen zu sein, wenn er ins Zimmer zurückgeht wie jetzt. Warum setzt er sich diesem Schauder aus? Ganz einfach: Ihm kann nichts passieren. Eine große Zukunft ist ihm vorausbestimmt. Er schaut nur in die Ferne!
Im Zimmer schaltet er das Radio ein. Der Deutschland Funk berichtet über den Drohnenangriff auf Moskau. Die Geschichte kennt er von gestern aus Radio und Fernsehen! Heute wird sie breitgetreten. Er schaltet ab. Er muss nach vorne schauen. Er macht sich daran, ein Frühstück zu richten. Er öffnet den Kühlschrank und verliert seine Lust beim Anblick der kläglichen Sachen, die in der trüben Innenbeleuchtung kauern. Seine Rituale und Gewohnheiten muss er ablegen. Sie halten ihn in der Vergangenheit fest. Er wird ins Café gehen. Eine Tasse Kaffee, ein Croissant sollen heute genug sein.
An das Ächzen und Knarren der Holzstufen unter seinen Tritten wird er sich nie gewöhnen. Die Geräusche im Treppenhaus fahren ihm in die Beine und durch den Körper und werden ihn noch krumm und alt machen, wie vor ihm Generationen von Mietern, wenn er nicht endlich von hier verschwindet. Die Gasse, die er von oben nicht sehen wollte, rächt sich an seiner Missachtung. Missmutig öffnet sie sich ihm im trüben Mäusegrau. Das Kopfsteinpflaster unter seinen Schuhen ist schmierig vom Tau. Feuchtigkeit und Moder hängen in der Luft. Himmelslicht fällt müde bis zum Boden. Die Geräusche der Ladeninhaber hallen kläglich. Sie bugsieren ihre Sachen vor die Läden. An den hohen Hauswänden steigt das Scheppernd und Quietschen nach oben. Sein Blick folgt ihnen. Dort ist der Himmel ein schmaler Lichtschacht. Er senkt seinen Kopf auf das glitschige Pflaster, biegt dann nach rechts in die Korngasse, hastet durch eine verpisste Hauspassage, gelangt in die Sternthaler Allee, hier: lichtes Grün, Sonnenstrahlen, hastende Passanten, Autos, Vogelzwitschern in den Platanen, die stolz ihre frischen Blätter ausbreiten. Da atmet er auf. Im Café will er sich ein Programm für den Tag ausdenken; ins Blaue hinein lebt er nicht. Die Eingangstür zum Bistro steht weit geöffnet, Mief der Nacht weht heraus. Er tritt ins Innere. „Die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung…aufleben.“ Auch die Flügel der hohen Fenster hängen weitgeöffnet in den Raum. Geräusche der Straße und Licht, gefiltert vom Blattgrün der Alleebäume, kommen herein. Auch hier ist der Boden - dunkle, schrundige Holzdielen - feucht wahrscheinlich vom Frühputz. Er geht zum Tresen. Die Moni schaut ihm lächelnd und erwartungsvoll entgegen. Das Läuten seines Handys hindert ihn daran, seine Bestellung aufzugeben:
„Hallo!“
„Habe ich dich aufgeweckt?“
„Hallo, Theresa! Von wegen, ich hab schon einen halben Tagesmarsch hinter mir.“
„Dann bist du wahrscheinlich zu müde, um zu mir zu kommen? Ich habe eine tolle Neuigkeit für dich.“
„Sag, was!“
„Überraschung! Wann kannst du?“
„Ich hab meinen Terminkalender nicht bei mir. Schlags du vor.“
„Jetzt!“
„Für dich lasse ich alles liegen und stehen. Bis gleich!“ Was er ihr gesagt hat, macht er nicht: Er läuft den Frauen nicht nach! In Ruhe wird er frühstücken. Wenn sie „Jetzt“ gesagt hat, wird sie ihn im Bett erwarten. Unsinn! Das hat sie noch nie getan, wird es nie tun, hoffentlich. Mit solchen Geschichten wird er seinen Blick in die Zukunft nicht verstellen.
Das Radio jagt ihr Angst ein. Ihr Herz klopft fühlbar:
„Barbara, reiß dich zusammen“, herrscht sie sich an. Drohnen haben die Kuppel des Kremls bombardiert. Der Krieg weitet sich aus, befürchtet sie. Schon die Römer haben es verstanden, den Krieg ins feindliche Land zu tragen. Auch Sargon von Akkad war Meister in dieser Taktik. Plötzlich fallen ihr diese Vergleiche ein und zeigen ihr deutlich die Tragik des Ereignisses. Das Bündnis wird mit hineingezogen werden. Die Gefahr eines dritten Weltkriegs rückt immer näher. Die Freude und Leichtigkeit, mit der sie ein Frühstück auf der Terrasse und in der Sonne vorbereitete, sind ihr vergangen. Der blaue, duftige Morgen gaukelte ihr eine heile Welt vor. Da hat sie sich vorgenommen, den herrlichen Frühsommertag zu genießen, ihre Arbeit liegenzulassen, einen langen Spaziergang zu machen, vielleicht in die Stadt zu gehen, vielleicht sogar zum Essen. „Barbara, wenn du einmal Pläne machst“, spricht sie laut zu sich. Sie weiß schon, warum sie nie gern vorausdenkt. Oft überlegt sie erst mittags, was sie nachmittags tun wird, wenn sie nicht den ganzen Tag in Arbeit versinkt. Niemand schreibt ihr etwas vor, niemand wartet auf sie.
So nimmt sie die Kanne, das Geschirr, Brot, Marmelade, Käse vom Gartentisch, stellt alles auf das Tablett, trägt es zurück ins Haus, in die Küche, geht wieder zurück, schließt die Terrassentür und weiß in diesem Moment nicht weiter. Sie schaut auf das helle Viereck, das die Sonne zu ihren Füßen auf den rosafarbigen Teppich gelegt hat. Sein Rosa strahlt bis zur Zimmerdecke hoch. Der Raum wirkt duftig und federleicht. Soll das ihre Stimmung heben? Auch die Inanna auf der Anrichte schaut ratlos zu ihr herüber, oder mahnt sie zur Fortführung ihrer Arbeit? Aber sie wollte doch eine Arbeitspause machen, frühstücken in der Sonne, durch den leichten Morgen spazieren! Vielleicht würde ihr auf dem Weg eine Lösung einfallen? Diese verwitterte Keilschrifttafel fordert sie heraus. Sie hätte sie nicht annehmen sollen. Sie hat sich breitschlagen lassen, gebauchpinselt vom Gesülze des Hochwohlgeborenen: „Wenn nicht Sie, wer in aller Welt sollte das entziffern können? Ein Jahrhundert Fund, unschätzbar“. Widerwillig geht sie ins Arbeitszimmer, setzt sich an den Schreibtisch. Der große, schwarzweiße Fotobogen der Schriftkopie liegt ausgebreitet vor ihr und starrt sie an wie die Inanna auf der Anrichte. Nein! Bei aller Liebe, sie muss ins Freie!
Schon die ersten Schritte durch den Vorgarten mit seinem saftigen Grün, den gelben, weißen, roten Farbtupfern im Spalier, dem flirrenden Himmelblau, das bis in die Schatten der Bäume und Büsche dringt, lassen ihre Unlust, den Druck und die Hilflosigkeit schwinden. Sie könnte auch im Garten umherspazieren und sich den Weg nach draußen ersparen. Nun hat sie sich mal zu einem Spaziergang entschlossen und sollte ihn auch wagen. Eine weite Entfernung vom Schreibtisch wird ihr guttun. Ihren Weg plant sie nicht. Sie wird einfach vor sich hingehen. Ob sie dann in die Stadt geht, wird sich noch zeigen.
Er muss sich umziehen. Für den Weg von der Wohnung zum Café hat er seine alten Klamotten anbehalten. Bei Theresa spielt er die Rolle des Futurologen. Gestylt für die Zukunft wird er wieder auftreten! Er eilt vom Café aus ins Atelier. Dort nimmt er seine Kostüme aus dem Schrank: Ein hautenges Sweatshirt, anthrazit, und die weite, naturfarbene Leinenhose, silberfarbene Sneakers, silbriges Basecap. Nein! Ein Blick in den Spiegel überzeugt ihn: Muskeln braucht er sich keine zulegen. Seine asketische Gestalt passt zu seinem Handwerk und zu seinem Ziel: die Zukunft. Etwas Gymnastik sollte er trotzdem machen. Er muss fit bleiben. Zukunft ist immer anstrengend!
Das Eisentor des Ateliers klemmt beim Schließen wie immer. Er quält sich ab, bis es einrastet. Wie oft muss er den Hausmeister noch ansprechen? Der nennt sich jetzt Facility Manager und gibt sich noch weniger mit einfachen Arbeiten ab. Er blickt sich im Hinterhof um. Er hat keine Zeit, den Mann zu suchen. Die Theresa wird ungeduldig auf ihn warten. Er eilt zur U-Bahnstation. In ein paar Minuten wechselt er von seiner Welt des Biedermeiers, die Rolltreppe hinunter, in die neue Welt der zukunftsträchtigen Technologie.
Auch die Wiese vorm Haus strahlt im frischen Grün. Ihre Augen, ihr Kopf erholen sich zusehends vom wirren Schwarzweiß auf dem Schreibtisch. An den Rainen und am Waldrand, dort wo der Kunstdünger nicht hinreichte, entdeckt sie zwischen hohen Grashalmen ein buntes Blühen. Die Namen der Wildblumen kennt sie nicht oder hat sie vergessen. Als Wissenschaftlerin schämt sie sich über ihre Unkenntnis in der Botanik. Einspurig darf sie nicht werden. Wie schön muss die Welt gewesen sein ohne die Chemie in der Natur. Die Beschäftigung mit dem Bewässerungssystem im Zweistromland hat ihr eine überquellende Naturschönheit vor Augen geführt. Was für eine heitere Arbeit das war, die Gesänge der Sumerer über diese himmlische Pracht zu übersetzt. Das war eine Freude, mit Leichtigkeit Zeile um Zeile zu übertragen nicht so, wie dieser vertrackte Jahrhundertfund auf dem Schreibtisch, der bis jetzt weder Hand noch Fuß zeigt.
Nein, auf dem Rückweg wird sie nicht durch die Stadt spazieren. Der Rathausplatz wird von Menschen überquellen, die bei diesem Wetter von allen Seiten ins Zentrum strömen, laut und aufgeregt: Sehen und gesehen werden! Sie wagt den Feldweg weiter durch die Wiese, auch wenn sie sich dadurch noch weiter vom Haus entfernt. Ein leichter, warmer Windhauch streicht über die Gräser und über sie hinweg. Der Sommer naht! Dieser Gedanke überfällt sie und beunruhigt. Die Umstellung fällt ihr immer schwer. Nach der Stille des Winters, der frühen Dunkelheit, dem Verkriechen im Haus, in sich selbst, sich jetzt öffnen müssen für die Helligkeit, das Leben im Freien, die Menschen mit ihrer Umtriebigkeit, immer gewärtigt sein, ihr Alleinsein und ihre Abgeschiedenheit werden gestört von einem Besuch, von einem Nachbarn, einem Anruf, einer Erwartung. Sieh schaut ins Grüne. Der Weg führt sie am Waldrand entlang, dann biegt er ins Innere ein, wo er zwischen mächtigen Baumstämmen verschwindet. Wann ist sie das letzte Mal hier gewesen? War das in der Zeit mit Max? Nie sind ihr die hohen Kiefern aufgefallen. Ihre Kronen ragen weit in das Blau und beugen sich mit ihren Wipfeln, als wären sie da oben verwelkt. Sind das die Anzeichen der Umweltzerstörung, schon so nahe ihrem Haus? Alles kommt ihr unbekannt, neu vor. Ein Gefühl von Unsicherheit, ja Bedrohung steigt in ihr auf. Alte, vertraute Pfade kann sie wohl nicht verlassen, nicht nur in der Natur, auch in ihrem Leben nicht? Geht sie nicht immer die gleichen Wege ängstlich bedacht, Veränderungen zu vermeiden? Sie sollte umkehren, aber bitte auf dem Weg, den sie nun kennt.
Als sie die Haustür aufschließt, fühlt sie, der Ausflug hat ihr gutgetan, auch wenn sie zum Ende etwas außer sich geraten ist. Aber nun wird sie sich wieder einwickeln in ihre Häuslichkeit, in ihren Kokon und bereitwillig zu ihren Sumerern zurückkehren. Es wäre gelacht, wenn sie die Tafel nicht in den Griff bekäme: „Wer sonst“, wie er gesagt hat!
Er liebt diese Kunstwelt. Er mag die blitzenden Rolltreppen, die Leuchttafeln, die Bildschirme, die von Nachrichten zu Werbung hin und her wechseln: ein zerbombtes Stadtviertel, ein Mannequin in Dessous, Tote verstreut auf der Straße, ein Südseestrand. Er mag diese unterirdischen Stadtviertel. Er mag den Anblick der Menschen auf den Bahnsteigen, die zu einem Teil der Technik geworden sind, während sie warten. Sie erstarren, beamen sich in eine andere Welt, in die Welt der Bildschirme, die ihnen gegenüber an der Wand hängen. Er denkt: Wir nehmen uns keine Zeit mehr fürs Warten: Alles muss ruckzuck gehen. Haben wir Angst vorm Nachdenken?
„Meine Tage sind wie Rauch geschwunden, meine Glieder wie von Feuer verbrannt. Versenkt wie Gras und verdorrt ist mein Herz, so dass ich vergessen habe, mein Brot zu essen. Vor lauter Stöhnen und Schreien bin ich nur noch Haut und Knochen. Ich bin eine Dohle in der Wüste, wie eine Eule in öden Ruinen.“
Nach vier Stationen rollt er zur Oberwelt. Er wechselt von der Kunstluft und dem Kunstlicht in die Sonnenstrahlen und in den Sauerstoff und Duft, der vom Park auf der anderen Straßenseite herüberweht. Er ahnt, was noch entwickelt werden muss, bis diese Unterwelt für den Menschen überlebensfähig wird. Er ist überzeugt, ein Leben in der Unterwelt ist die ferne Zukunft: Die Erde ist verbrannt und vergiftet. Die Sonne glüht erbarmungslos. Zur Theresa sind es ein paar Minuten, die er auf der quirligen Geschäftsstraße zurücklegt. Die Glasschiebetür der Galerie ist geöffnet. Er tritt in den Ausstellungssaal und auf den glänzenden Parkettbelag. Im Hintergrund sieht er die Chefin am Tisch sitzen. Sie erhebt sich und schreitet ihm entgegen im Catwalk, ihrer hohen Figur bewusst: Küsschen rechts, Küsschen links.
„Ich habe auf dich im Bett gewartet, auf ein Frühstück, mit dem du mich überraschst.“
Ihr Gesichtsausdruck sagt ihm, das soll ein Witz sein.
„Du weißt, ich lese dir deine Wünsche von den Augen ab, aber durchs Handy konnte ich sie leider nicht sehen.“ Sie nimmt seine Hand und zieht ihn zum Schreibtisch.
„Das nächste Mal! Jetzt habe ich eine Überraschung für dich, was sage ich, einen Glückstreffer, ein Himmelsgeschenk, einen Hauptgewinn. Du kannst dich glücklich schätzen mit mir. Du weißt, dass die Kuratorin der Arthall eine gute Freundin von mir ist. Zufällig, was sage ich, es musste so sein, dass ich sie gestern getroffen habe. Sie hat mir erzählt, in sechs Wochen wollte sie ihre große Ausstellung „Blick in die Zukunft“ eröffnen. Alles sei fertig, nur einer der drei Künstler ist soeben ausgefallen, der Henrik Maartens. Ich habe den Verdacht, ein Streit oder so. Du kennst ihn, glaube ich, von einer Vernissage, wo er sich so benommen hat. Weißt du noch? Das ist ein schräger Typ, unberechenbar und querköpfig. Also sie sagte mir im Vertrauen, sie suche dringend einen Ersatz. Das war meine Stunde! Da habe ich dich ins Gespräch gebracht, dass du zurzeit an großen Tafeln arbeitest, genau zu diesem Thema, dass überhaupt die Zukunft dein Grundelement ist und so. Ich habe sie heiß gemacht und, was sagst du, sie wartet auf dich. Was sagst du jetzt dazu? Ruf sie gleich an!“
„Eine interessante Sache! Wie viele Bilder braucht sie? Ein paar habe ich zum Thema fertig.“
„Das musst du alles selbst mit ihr besprechen. Ruf sie gleich an oder besser, ich rufe sie an und gebe sie dir.“
Natürlich, sie will ihr Honorar rechtfertigen! Die zwei Frauen plaudern miteinander. Derweil schlendert er durch die Verkaufsausstellung, die er schon kennt. Drei Arbeiten von ihm sieht er an einem guten Platz hängen. Wieder stellt er fest: Sie sind besser als die anderen. Er hat sie mit Feuer gemalt. Dann reicht die Theresa ihm das Handy. Die Frau am anderen Ende hat eine helle, etwas scharfe Stimme. Sie vereinbaren ein Treffen, zu dem er seine Arbeiten mitbringen soll, das heißt, sie schickt ein Auto für den Transport, unverbindlich sagt sie mit strengem Ton. Er geht dann weg von der Theresa, da legt sich seine Anspannung. Ein warmer Schwall überströmt ihn und lässt ihn einen Schrei ausstoßen: Juhu! So bald, in solch einem Haus der Arthall, genau zu seinem Thema, sein Werk, ein Glücksfall, eine Fügung des Himmels! Das wird sein Durchbruch werden! Er hastet zurück ins Atelier, die angebotenen Arbeiten zu sichten.
Der Sinn des Satzes erschließt sich ihr nicht, auch nicht nach langem Sinnen. Die Verwitterung lässt - wie an anderen Stellen auch - mehrere Aussagen zu. Wieder verknotet sich ihr Kopf wie vor ihrem Spaziergang. Aber jetzt wirft sie nicht alles wieder hin, sondern fasst Mut, zusammenzupacken und zum Hochwohlgeborenen zu fahren. Sie ist nur Expertin für die Schrift, dagegen hat er den tiefen geschichtlichen Durchblick. Sie kennt sich: Den einmal spontan gefassten Entschluss muss sie sofort umsetzen, sonst quält sie sich danach mit Zweifeln und Umstandskrämerei, die sie schlussendlich untätig werden lassen. Sie nimmt sich einen gewaltigen Schritt vor, heraus aus ihrem geborgenen Reich und ins Getriebe: Bahnreise, Hotelübernachtung, fremde Menschen, fremde Welten!
Also schreibt sie eine E-Mail an den Herrn Prof. Dr. Maximilian Bolst, schildert ihre bisherigen Ergebnisse und Fragen und bittet um einen Besuchstermin in möglichster Kürze. Bis er antwortet, wird sie weiterarbeiten und wo nötig, Lücken lassen. Das Sonnenlicht schleicht sich nun auf ihre Schreibtischplatte und blendet sie. Sie steht auf und zieht die Vorhänge zu. Das Arbeitszimmer wird in ein rosa Licht getaucht: Eine traumhafte Atmosphäre breitet sich aus, als säße sie in einem Separee, in einer Bar? Wann ist sie das letzte Mal ausgegangen? War das dieser Abend mit der Martha und Freund und dessen Freund, der sich um sie kümmern sollte, hier im Ort in dieser schwulen Bar? Nein, schwul war sie nicht, aber irgendwie schummrig, schmuddelig. Sie müsste mal ausgehen, was erleben, hatte die Martha damals zu ihr gesagt. Zum Glück konnte sie sich bald absetzen. Das ist nicht ihre Welt, aber dieser rosa Firlefanz jetzt um sie herum auch nicht! Woher kommt das Sonnenlicht? Noch nie schien die Sonne so kräftig ins Arbeitszimmer. Manchmal erscheint ihr das Jetzt traumhaft und der Traum Wirklichkeit. Ach ja, der Ahorn ist weg! Er hat ihr im Sommer die Sonnenstrahlen abgehalten. Was hat ihr das weh getan, den mächtigen Baum, der krank war, fällen zu lassen! Sie musste das Haus verlassen, als die Gärtner angerückten. Schon als Kind ist sie in ihm herumgeklettert. Sie erinnert sich: Die Mutter scheucht sie so lange, bis sie sieht, sie kann sich sicher und geschickt in ihm auf und ab bewegen. Unter ihm an seinen Stamm angelehnt, schlafen sie bei der Hitze ein oder sie machen Picknick in seinem Schatten mit der Mutter oder mit den Freundinnen, oder die Sache mit Max oder das mit dem Vater! Das mit dem Vater: ein heißer Sommertag. Sie ist noch klein. Es ist so heiß außerhalb des Baumschattens. Sie liegt auf der Decke, die Mutter kommt zu ihr, sie weint. Nein! Nur ihr Gesicht ist ganz nass und die Augen sind gerötet. Sie sagt, sie müssten jetzt beide sehr stark sein und fest zusammenhalten. Der Vater ist jetzt nicht mehr bei ihnen. Er ist jetzt in den Himmel gegangen. Sie werden ihn nicht mehr sehen, aber es ginge ihm dort gut. Im letzten Herbst verlor er viel zu früh die Blätter und im Frühjahr kam kein neues Blatt mehr, da wollte sie nicht glauben, dass er tot war, der Baum. Nicht einmal das Holz wollte sie behalten für den Kachelofen, doch die Gärtner nahmen es einfach mit ohne Vergütung, wo sie doch als selbstverständlich erwartet hatte, sie würden den Holzpreis in der Rechnung abziehen, aber sie sagte nichts zu ihnen. Die Sache wollte sie schnell hinter sich bringen. Jetzt muss sie sich mit dem aufziehenden Sommer umstellen, auf das neue Licht im Arbeitszimmer einstellen: Veränderungen fallen ihr immer so schwer! Da muss sie sich mit dem Gegenwärtigen abgeben, wozu sie immer wenig Lust hat.
Während sie am Schreibtisch sitzt, ihre Blicke unsicher durch das Zimmer schweifen lässt, haltsuchend, kündigt der Laptop eine Nachricht an. Sie atmet auf: Bolst antwortet: Er erwarte sie gerne nach Rückkehr von seiner Reise Ende Juni. Da könnten sie dann kurzfristig einen Termin ausmachen, das enttäuscht sie, hat sie doch schon in Gedanken den Koffer gepackt. Soll sie über einen Monat warten, bis sie ihre Arbeit weitermachen kann? Lächerlich! Die Tafel lag über dreitausend Jahre im Boden. Nun kann es auf ein paar Wochen nicht ankommen! Sie überstürzt alles gern. Was sie sich in den Kopf gesetzt hat, muss immer sofort getan werden, weil sie an Morgen nicht denken mag. Sie könnte weitermachen, Lücken lassen, aber dann läuft sie Gefahr, den Überblick und das System zu verlieren.
Ja, das ist eine gute Idee, wirklich eine Fügung: Sie macht Ferien, Sommerferien, aber hier zuhause: lang schlafen, gemütlich frühstücken auch im Rathauscafé, gärteln, was Gutes kochen, lesen, keine Fachliteratur, nicht einmal das Gilgamesch Epos, was sie lange wieder lesen wollte, und spazieren gehen, wandern ohne Angst. Wenn sie den Waldweg öfter geht, wird er ihr vertraut werden. Dann kann sie sich von da aus weiter ins Landesinnere vorwagen. Nein, nicht schon wieder Pläne für die Zukunft! Sie macht einfach Urlaub und lebt in den Tag hinein. Schwungvoll steht sie auf, schiebt die Vorhänge zurück und damit die Traumwelt, schließt die Augen und lässt sich von der Sonne bestrahlen. So findet sie innerliche Ruhe.
Das Ordnungssystem in den Regalen weiß er noch. Zielsicher greift er die Tafeln heraus, die er für die Ausstellung vorsieht. Sie sind größer und wuchtiger als er erwartet hatte. Nachdem er sie längere Zeit nicht gesehen hat, ist sein Blick ungetrübt: Sie gefallen ihm, was nicht selbstverständlich ist. Die schweren Farben leuchten geheimnisvoll. Aufs Neue freut ihn seine Erfindung, die das satte Karminrot und das Kobaltblau und Smaragdgrün wie Emaille fluoreszieren lässt. Die goldenen und schwarzen Flächen dazwischen, die ihm zum Schluss noch einfielen, erzeugen eine traumhafte Wirkung. Seine Menschen, so zart und schlank, kuscheln sich in die Farben oder werden von ihnen erdrückt oder gar zerfressen, je nachdem, was er zum Ausdruck bringen wollte. Die Arbeiten kann er mit gutem Gewissen anbieten. Er lehnt sie aneinander gereiht an die freie weiße Wand und verlässt das Atelier zufrieden, als habe er gerade Großes geleistet. Selbst das widerspenstige Eisentor kann seine Hochstimmung nicht dämpfen.
Auch am nächsten Morgen verzichtet er auf ein Frühstück: Er ist unruhig. Nicht alle Tage tanzt er bei der Kuratorin einer großen Kunsthalle an. Sein futuristisches Kostüm von Gestern dient ihm zu seinem großen Auftritt. Nervös wartet er auf das Lieferauto, das sie schicken will. Endlich schnarrt die Türglocke. Ein Mann im Overall steht davor und sagt, er solle Bilder abholen, ob er hier richtig sei. Abschätzig blickt er um sich, wohl feudalere Umgebungen bei seiner Arbeit gewohnt. Nach längeren Erklärungen - weil er keinen Auftrag habe ihn zu fahren und die Ware irgendwo zu suchen - und nach einer Drohung, die Kuratorin höchstpersönlich einzuschalten, willigt der Fahrer ein, mit ihm ins Atelier zu fahren, die Ware einzuladen und alles zusammen in die Arthall, genauer gesagt, in deren Lagerhalle zu verfrachten. Wenn die alle so bürokratisch agieren, wird er keinen leichten Stand haben, denkt er. Er fühlt sich im wahrsten Sinn als freischaffender Künstler, der sich weder um Formalitäten noch um Normen schert, nicht einmal um bürgerliche Umgangsformen. Ob er sich ändern muss, wenn er in diesen elitären Kunstkreis aufgenommen wird?
Die Frau, vor der er dann steht, heißt Siglinde Zwängler und sieht auch so aus. Sie hat den durchdringenden Blick seiner Putzfrau, die überall nach Staub sucht. Nachdem sie sich angeblich sehr freut, ihn zu sehen, wendet sie sich seinen Arbeiten zu, die an der Wand aufgereiht lehnen. Still verrinnt die Zeit. Er fühlt Schweiß in den Achselhöhlen quellen. Sie fragt, was das für eine Farbe sei. Er erklärt die Zusammensetzung und das Anreiben.
„Wie! Sie reiben Ihre Farben selbst an wie die alten Meister?“
„Auch wenn ich Zukunftswege gehe, fühle ich mich den Alten verpflichtet. Ich bin mit ihnen aufgewachsen und habe sie studiert.“
„Hm, hm, hm!“
Wieder geht sie stumm von Bild zu Bild. In seinen Achselhöhlen rinnt der Schweiß.
„Wie interpretieren Sie das Thema?“
„Sie sehen, die Figuren sind nicht auf der Erde, nicht in der Natur, nicht in einem Zimmer; sie sind unter der Erde. Gold schimmert, kaum Licht. Sie leben in einer Unterwelt. Die Oberwelt ist unbewohnbar geworden. Meine Zukunftsvision habe ich mal in einer Ausstellung so veröffentlicht: Wir haben uns entfernt von unseren Ursprüngen, wir haben uns entfernt von uns selbst. Dank Naturferne, Konsumwahn, Psychowerbung und chronischem Narzissmus wissen wir nicht mehr, wo wir sind. Wie Eingeschlossene sind wir in einem goldenen Käfig.“
„Wie ein Gedicht sagen Sie das. Warum sind die alle nackt und das viele Gold ringsum?“
„Die Szene geht auf und unter die Haut. Wir versumpfen in Luxus und Gier. Die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Wir bauen uns unterirdische Städte, wie jetzt schon im Kleinen am Stachus zum Beispiel.
„Eine schaurige Vision! Aber die Arbeiten gefallen mir. Ich nehme sie.“
Er würde sie umarmen, wenn sie nicht so unnahbar wäre, so autoritär und dünn. Zusammen gehen sie in ein Büro und bereden die Einzelheiten der Ausstellung: Es wird eine Verkaufsausstellung werden. So biete sich ihm die Chance, reich zu werden, sagt sie, wobei sie zum ersten Mal lächelt, und ihn anschaut ohne Staubsaugerblick. Der Künstler verpflichte sich, während der Dauer dreimal anwesend zu sein. Dazu empfiehlt sie, nicht als Mister Spock von Star Trek aufzutreten. Sie verlässt ihren geschäftlichen Tonfall und lacht kräftig, ein helles, reines Lachen. Seine Kurzvita und ein Exposee seines Werks werden sie in den nächsten Tagen gemeinsam verfassen; er solle einen Entwurf mitbringen. So werden sie sich wiedertreffen und das freue sie. Sie blättert in einem Terminkalender. Sie vereinbaren einen Termin. Er geht, nein schwebt davon.
Seine überquellende Freude will er mit jemandem teilen. So sucht er seine Galeristin auf. Auch sie sagt, sie freue sich ihn zu sehen. Er ist ein Glückskind, alle Welt freut sich ihn zu sehen! Allerdings habe sie keine Zeit, ein Kaufinteressent sei bei ihr; das könnte sich hinziehen. Er solle sich melden in den nächsten Tagen. Alleingelassen mit seiner Freude, fällt ihm Jahn ein, den er schon lange nicht mehr gesprochen hat, mit ihm könnte er sich treffen und anstoßen. Seine Telefonnummer hat er noch gespeichert, aber der meldet sich nicht; dann halt die Jolanda auch lange nicht gesehen. Sie meldet sich tatsächlich und freut sich auch über seinen Anruf, hat aber keine Zeit. Das hat er davon: Er pflegt seine Einsamkeit, keine Freundschaft, keine Beziehung. Wenn er mal jemanden braucht, ist keiner da! Da bleibt ihm nur die Moni vom Café. Auch wenn sie keine fünf Minuten bei ihm stehen wird, so beschäftig wie sie immer ist, hat er jemanden in der Nähe, dem er ab und zu einen Blick und einen Satz zuwerfen kann. Also wendet er sich in Richtung des Cafés. Auf dem Weg stellte er sich die Szene vor: Er steht am Tresen und weiß nicht, was er trinken soll. Die Moni fragt ihn zum x-ten Mal nach seinem Wunsch, hastet dazwischen immer wieder weg: Bier, Wein, Schnaps danach ist ihm nicht. Er sieht sich, wie er so steht, den anderen zuschaut, wie sie sich miteinander vergnügen an den runden Tischchen im Raum und draußen auf dem Gehsteig, Pärchen, die vor kurzem aus dem Bett gestiegen sind und die, die kurz davor sind ins Bett zu hüpfen. Nein! Seine Einsamkeit muss er nicht füttern. Kurz entschlossen kauft er Gebäck und geht damit zum Atelier. Als habe sein leerer Magen seinen Geist beflügelt - er hat nichts gegessen, seit er sich für die Kuratorin gerichtet hatte – drängt es ihn, sofort mit der Serie zu beginnen, die ihm heute Morgen in den Sinn kam über diese seine Zukunft, die ihm nun so rosig entgegenleuchtet.
Das verklemmte Werkstatttor lässt ihn dieses Mal kalt. Geduldig manipuliert er am Schloss. Schließlich gelangt er in den Saal, riecht Öl, Terpentin, Farben - was inspiriert - und macht sich ohne Zeremonie an die Arbeit. Eine große, neubespannte Tafel stellt er auf die Staffelei. Jetzt hat er gedämpftes Licht an seinem Standplatz. Die Sonne scheint nur morgens durch die Glasfront herein. Den Innenhof sieht er, durch die Scheibe, im Schatten träumen. Er sieht eine große Zukunft vor sich: rosig also, in heiteren, leichten und bunten Farben, klare Formen, geometrisch geordnet, ganz im Hintergrund strahlendes Licht, keine Unterweltvision wie die Bilder, die er der Kuratorin vorgestellt hat. So macht er sich ans Werk. Erst am Abend legt er sein Werkzeug auf die Seite, reinigt die Pinsel und Bürsten. Die Restfarben lässt er auf der Steinplatte ruhen und deckt sie ab. „Bis morgen“, sagt er zu ihnen.
Die Sonne vorm Fenster lockt sie in den Garten. Sie zieht ihre Hauskleidung aus, schlüpft in den Bikini, den winzigen, holt den Liegestuhl aus der Garage, wo er überwintert hat, stellt ihn auf die Wiese an einen Platz, wo fremde Augen sie nicht erspähen können, und gibt sich mit einem befreienden Stöhnen den heißen Strahlen hin. Der Ahorn, der abgesägte, hätte ihr Schatten gemacht. Es gefällt ihr, sich immer wieder zu erinnern, wie sie hier unter seinem Schatten, auf der Decke liegt. Klein ist sie, 6 Jahre alt. Wieso weiß sie das genau? Einschulung im Herbst davor. Sie liegt auf dem Bauch, beobachtet eine Hummel auf einer Blume im Gras. Da kommt die Mutter zu ihr, lässt sich nieder auf den Deckenrand. Sie sieht in ihr Gesicht, sie weint, nein, ihr Gesicht ist nass und die Augen sind gerötet. Sie sagt, sie flüstert: „Wir müssen jetzt ganz stark sein. Vati ist nicht mehr bei uns. Er ist jetzt in den Himmel gegangen. Wir können ihn nicht mehr sehen, aber es geht ihm dort gut, und er schaut auf uns, damit uns nichts passiert“.
Sie schließt die Augen, hört die Stimme der Mutter, riecht ihren Körper. Er riecht nach Krankenhaus. Sie beschäftigt sich viel und gern mit ihren Erinnerungen. Diese vom Vater wiederholt sich immer wieder. Die Szene hat sich ihr eingebrannt. Schnell wird sie immer lebendig beim kleinsten Anlass. Vieles danach ist gelöscht. Das heißt, im Gedächtnis ist nie was gelöscht, nur verschoben in eine versteckte Datei, von der es - oft unter scheinbar zusammenhanglosen Anlässen - heruntergeladen wird, wie soeben: Was hat der Tod des Vaters mit ihrem lustvollen Sonnen zu tun? Aber diese Erinnerung stört sie nicht. Das ist schon lange her. Die Trauer bleibt zwar, aber sie hat sich daran gewöhnt. Der Vater war ein lustiger Mann. Die ersten Kletterversuche hat sie mit ihm gemacht. Da musste er sie noch zum untersten Ast hochheben. Sie muss lächeln, wenn sie an ihn denkt. Aber wie er ausgeschaut hat, weiß sie nur von den blassen Fotos auf der Anrichte und in den Alben. Ob er noch immer vom Himmel aus auf sie schaut? Für die Toten gibt es keine Zeit. Vergangenheit und Zukunft sind ihnen fremd. So sind sie nur im Jetzt. Das Jetzt ist ihre Ewigkeit. „Wen wir lieben, der ist nie fort. Liebe ist ewige Gegenwart.“ Manches Mal, wenn´s ihr ganz eng wird, betet sie zu ihm. Mit der Mutter haben sie jeden Tag zusammen gebetet. Sie wusste, sie kann nie vom Baum fallen, denn er würde sich nicht schuldig machen, weil er ihr ja das Klettern beigebracht hat. Dem Max hatte sie das einmal erzählt, sonst niemandem; der hat sie ausgelacht. Danach wollte sie ihn nicht mehr sehen, so oft er auch angetanzt kam. Sie hat ihn aus den Augen verloren. Viele waren es nicht, mit denen sie zutun gehabt hat. Sie hat sie alle aus den Augen verloren. Bis heute fühlt sie sich unfähig oder unwillig Beziehungen zu pflegen. Sie laufen ihr alle nach kurzer Zeit weg. Nein, sie läuft weg. Die Mutter war eigentlich ihre einzige Freundin. Wahrscheinlich war sie eifersüchtig auf ihre Bekanntschaften, ob Männer oder Frauen. Nein, sie darf ihr nicht die Schuld geben, dass sie allein ist! Sie müsste ihr sogar dankbar sein, wenn sie einen Anteil an ihrem Alleinsein hätte. Ist´s nicht schön, wie sie jetzt lebt? Sie kann machen, was sie will, braucht keinen fragen, sich nach keinem oder keiner richten. Sie kann tun und lassen, was sie will. Sogar ihre Arbeit kann sie einteilen nach ihrem Ermessen. Die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut! Sie zieht ihren Bikini aus: Niemand kann sie sehen.
Das Morgenlicht kann er kaum erwarten. Die Sonne schaut noch nicht über die Ziegeldächer in sein Zimmer, da steht er auf. Er wird unterwegs einen Kaffee bei der Moni trinken. „Bei der Moni“, sagt er, auch wenn er nicht weiß, ob sie da ist. Er denkt an das Bild: Ungeduldig und wild entschlossen will er rasch weiterarbeiten. Es hat ihn gepackt! Das Bild verselbstständigt sich. Eine Vision aus Farben und Formen ist in ihm. Sie wirft seine anfängliche Vorstellung über den Haufen. Er weiß, mit jedem Farbauftrag werden sich wieder ungeahnte Ideen auftun. Es ist wie auf einem Weg, der immer tiefer ins Unbekannte führt und immer neue Ausblicke bietet. Am Ende steht er vor einer fertigen Arbeit und schaut und staunt und meint, das habe er nicht gemacht. So etwas Schönes kann er nicht. Dann schaut er nach oben in den Himmel und bedankt sich. Er ahnt, mit dieser Arbeit werde es ihm auch so ergehen.
„Du, Herr gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher; du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt mir.“
So macht er sich auf den Weg. Er verzichtet dann aufs Café bei der Moni. Im Atelier kann er sich Wasser kochen, das reicht ihm. Das verdammte Eisentor will ihn daran hintern, rasch zu seiner Arbeit zu gelangen. Es fordert ihn immer zu einem Test seiner Stimmung heraus. Heute gelingt ihm die Öffnung mit Gelassenheit. Erbärmlich quietscht es auf, weil es verloren hat. Die Sonne wirft auf den Atelierboden einen grellen Strahl, der bis zur hohen Decke reflektiert. Die neue Tafel steht im hellen Licht. Er vertieft sich in die gestrigen Anfänge und plant seine nächsten Arbeitsschritte: Nein, nicht planen, nicht den Kopf einschalten, die Seele: Seine Zukunft ist rosig, seine Zukunft ist groß, seine Zukunft ist federleicht…
Das Handy meldet den Eingang einer Nachricht. Nicht jetzt! In einer Pause wird er sie lesen. Dann schaut er auf die Wanduhr, wieder einmal hat er Raum und Zeit beim Arbeiten vergessen: Nach Mittag schon! Er geht zum Sushi Laden. Auf dem Rückweg beginnt er, aus der Schachtel zu essen. Den Rest isst er im Stehen vor der Staffelei und studiert dabei den Farbauftrag und die Formen. Er wird sich selbst hineinmalen: Wie, wo, das wird während des Malens von selbst ergeben; auf jeden Fall rosig. Schnell liest er die Nachricht:
„Lieber Luc Landing!
Leider habe ich keine erfreuliche Nachricht. Der Aussteller, für den Sie so großzügig und bereitwillig eingesprungen sind, hat sich zurückgemeldet. Da ich mit ihm noch unter Vertrag stehe, bin ich gezwungen, ihn zu berücksichtigen, sodass unsere Absicht, die wir nicht schriftlich fixiert haben, gegenstandslos geworden ist.
Mir haben ihre Arbeiten so sehr zugesagt, dass ich Sie bei Gelegenheit wieder ansprechen möchte.
Inzwischen…“
Er liest noch ein paar Mal: Das gibt es nicht, das kann er nicht glauben! Er leitet die Mail weiter zur Theresa. Er setzt sich auf seinen Malschemel unters offene Ateliertor in die Sonne.
Ihr zweiter Urlaubstag, stellt sie fest. Zeit ist inzwischen ein Fremdwort geworden: Frühstück auf der Terrasse, Liegestuhl auf der Wiese. Die Morgensonne strahlt warm. Die unruhige Nacht kann sie herrlich ausgleichen. Im Halbschlaf dämmert sie dahin. Der Gedanke, sie hat vergessen sich einzucremen, schreckt sie auf. Ihr ist so heiß und wohlig schlaff zumute, dass nichts und niemand sie zum Aufstehen bewegen könnte. Sie hört den Martin im Haus. Sie ruft ihn, er soll ihr die Sonnenschutzcreme bringt und sie eincremen, so hingebungsvoll wie immer. Unsinn! Das ist schon lang her! Manchmal weiß sie nicht, ob sie gestern oder heute lebt. Ihre Erinnerungen überdecken oft den Augenblick und sie verliert sich in der Zeit. Das mit dem Martin war vor langem und kurz: ein Sommer lang, ein heißer, nicht allein das Wetter. Sie waren oft nackt zusammen im Garten. Im Urlaub wohnte er hier. Er las ihr die Wünsche von den Augen ab, bediente sie, verwöhnte sie. Er fuhr sofort in die Stadt, um ihr die verrücktesten Wünsche zu erfüllen. Er nistete sich hier ein, dann wurde er ihr zu viel. Er war wie ein Butler, immer sprungbereit ohne eigene Ideen. Wie kam sie auf die Idee: Sie sagte eines Morgens beim Frühstück zu ihm, sie brauche ihre letzten Urlaubstage für sich allein, um ihre Reise nach Uruk vorzubereiten. Das war eine Ausrede, viel vorzubereiten gab es nicht. Sie war aufgeregt, eine hohe Auszeichnung war das. Das war damals die Ausgrabung im alten Uruk, zu der sie als Expertin für die Keilschrift eingeladen wurde, von höchster Stelle, vom Bolst selbst. Sie sieht ihn erstarren, den Martin. Sein Gesicht ist blutleer. Er geht weg ohne viel Worte. Sie verreiste dann und verlor ihn, wie alle anderen auch, aus den Augen. Er war der Einzige, der bisher bei ihr gewohnt hat. Sie kann sich nicht vorstellen - während sie überlegt, ob sie wegen der Creme aufstehen oder liegenbleiben soll - dass hier noch mal ein Mann herumtanzt. Sie genießt ihr Alleinsein im großen Haus, seit die Mutter tot ist. Die erste Zeit nach Mutters Tod ist hart gewesen. Sie ist entsetzlich allein, empfindet wieder diese Leere im Haus von damals bedrückend, beängstigend, bedrohlich sogar. Sie kann nicht im Haus schlafen. Sie schläft im Garten unter dem Ahorn, in der Ecke bei der Ligusterhecke. Es sind warme Nächte zum Glück! Übernächtigt schleicht sie im Morgengrauen in ihr Zimmer, legt sich halb bewusstlos aufs Bett, träumt Schreckliches. Immer wieder tauchte die tote Mutter auf, mal selig lächelnd, mal entstellt. Dann die kühleren Tage und Nächte! Notgedrungen musste sie im Haus ausharren und fand das eines Tages angenehm. Sie vergrub sich auf dem Sessel im Wohnzimmer oder auf dem Sofa und vor allem in ihre Erinnerungen, nur in die schönen; sie hat sehr viele schöne Erinnerungen. Die schönsten kramt sie hervor, wenn es ihr mal nicht so gut geht. Warum denkt sie plötzlich daran? Es geht ihr gut, sehr gut sogar, nur ein bisschen unsicher ist sie mit ihrer neuen Lage, dem Urlaub. Sie ist immer unsicher. Der Hugo hatte sie immer über alle Hürden gebracht. Sie muss lachen, denn er schämte sich für seinen Namen, deshalb nannte sie ihn immer mit vollem Namen, Hugo Huber, lieber Hugo Huber! Er war der liebste, herzlichste, klügste, unternehmungslustigste, empfindsamste Mann, den sie sich vorstellen kann; vielleicht, weil er ihre erste Liebe war. Oder war er ihre erste Liebe, weil er so war? Sie sieht ihn, wie sie sich zum ersten Mal begegnen bei einer Hausparty. Sie sieht ihn, wie sie zum ersten Mal in dem Café sitzen und dann tanzen. Sie sieht ihn, wie sie ihn in seinem kleinen Zimmer besucht und was dann passiert, aber Einzelheiten blendet sie schnell aus, das würde sie nervös machen. Was arbeitete er damals? Er arbeitete viel und alles Mögliche. Einen richtigen Beruf wollte er nicht erlernen. Sie war damals im zweiten Semester; da war sie sehr beschäftigt: Altertumswissenschaften! Wie kam sie nur auf diese Idee? Am Anfang zweifelte sie, aber heute geht sie in ihrer Arbeit auf und ist glücklich über ihre Entscheidung. Sie hilft ihr, der Gegenwart zu entkommen, so wie auch die Beschäftigung mit ihren schönen Erinnerungen. Die Gegenwart mag sie nicht. Sie ist ihr unsicher und suspekt.
Sie fühlt, ihre Haut beginnt an manchen Stellen zu brennen. Sie wird später weiter an Hugo Huber denken. Sie hat vergessen, dass sie in der Sonne liegt, schon viel zu lang, das heißt, die Hitze hat sie genossen, aber nicht die Folgen bedacht. Sie wundert sich über ihren Bikini; den hatte sie doch ausgezogen! Jetzt hat sie ihn an. Der Martin hat sie eingecremt ohne Bikini. Er cremt sie immer ein da, wo er nicht soll. Wahrscheinlich hat sie den Bikini deshalb vorher schnell angezogen. Irgendwas stimmt da nicht! Der Martin ist lange nicht mehr hier. Sie stemmt sich aus dem Liegestuhl, ein bisschen versteift und benommen und geht ins Badezimmer. Jetzt im Urlaub könnte sie auch etwas Sport machen! Ihre Haut ist heiß und trocken. Ach, das mit dem Bikini war Gestern; da lag sie ohne! Wie leicht sich bei ihr Gestern und Heute verschmelzen. Ach, wenn sie doch nur gestern leben würde! Sie cremt sich ein. Wegen ihres Körpers bräuchte sie keinen Sport treiben. Sie sieht sich im Spiegel schlank, keine Fettpolster. Ihr Fleisch, das sie kraftvoll mit der Creme bearbeitet, ist fest, glatt die Haut. Aber sie rostet schnell ein beim Ruhen; dann spürt sie ihre Gelenke bei den ersten Bewegungen, weshalb ihr Sport einfiel. Jetzt, wo sie Ruhe hat oder sich zur Ruhe zwingt, kann sie solche Gedanken spinnen. Das findet sie gut. Sie wird in die Stadt gehen. Dort gibt es zwei oder drei Fitnessstudios. Die wird sie sich anschauen und mit den Leuten reden. Unterwegs kann sie an Hugo Huber denken. Sie hat große Lust dazu.
Das Hany schreckt ihn hoch vom Malschemel. Die Theresa antwortet mit einer Nachricht:
„Lieber Luc, es tut mir leid, aber sei froh: Die Ausstellung auf diesem Niveau, ehrlich gesagt, wäre zu früh gekommen. Du musst reifen. Nimm dir Zeit. Dir läuft nichts davon. Die Zukunft wartet auf dich. Allein die Nominierung für die renommierte Arthall ist eine hervorragende Werbung, verwende sie für deine Werbeaktionen; da machst du nichts. Wir sollten uns mal zusammensetzen und das besprechen. Weiterhin frohes Schaffen!“
Wozu hat er eine Galeristin, wenn er seine Zeit mit diesem mühsamen Werbegetue verschwenden soll: Webseite bedienen, chatten mit Followern, Sozialportale füllen, Medienagenturen hofieren! Er ging davon aus, all das erledigt sie für ihn. Sie will doch Geld an ihm verdienen. Warum jetzt dieser Rückzieher? Und er, was will er eigentlich: Reich werden, ein Star werden? Nein, für Grundsatzfragen ist jetzt nicht der Moment. Er muss malen, sonst nichts! „Du, felix Austria nupe! Du, Unseliger male!“ Ganz krumm ist er vom Sitzen geworden. Steif erhebt er sich und geht zur Staffelei. Als würde er das halbfertige Bild seiner rosigen Zukunft - noch vor kurzem - zum ersten Mal sehen. Es ist ihm fremd: eine Vision von früher in leuchtenden Farben und heiteren Formen, am Rand schummrig, in der Mitte hell: die Vorstellung von seiner Zukunft vor der Nachricht. Und jetzt? Wechselt er seine Zukunftsideen je nach Stimmung? Die Galeristin hat Recht: Er ist unreif. Also rann ans Werk, um zu reifen! Unverdrossen beginnt er, die Figur - er selbst - zwischen die Farben zu skizzieren. Doch dann sagt er sich: Das Allerwichtigste beim Malen ist Ehrlichkeit. Er darf sich nicht irgendwie hier unterbringen. Er muss sich erst wohl oder übel der Frage stellen: Wie sieht er sich in der Zukunft? Er wird überrannt von den Ereignissen. Jetzt kann er solche Überlegungen nicht anstellen. Er braucht Abstand. Er legt sein Werkzeug auf die Seite, hängt die Tafel zu, verlässt eilig die Stätte und den schrillen Aufschrei des Ateliertors, oder ist es ein höhnisches Gelächter über ihn - der Fantast, der Utopist, der Witzbold? Er wird nicht die S-Bahn nehmen. Er wird nach Hause laufen. Auf dem Weg wird er seinen Kopf freibekommen: zukunftsausgerichtet muss er denken und handeln. Was passiert ist, ist passiert, passé! Die Vergangenheit ist Sache der Totengräber! Das sagt er sich immer wieder, während er mit schweren Schritten zu seiner Wohnung geht.
Der Hugo Huber hätte ihr jetzt gesagt, was zu tun ist, was ansteht, was als Erstes erledigt werden muss. Sie hat sich an seiner Seite so sicher gefühlt. Er war so ganz da. Sie konnte sich ihm überlassen. Auch wenn sie bei ihm in seinem Zimmer war, überließ sie sich ihm ganz. Sie ließ sich bei ihm ins Jetzt fallen; hing sie doch immer gern in der Vergangenheit herum. Er holte sie da heraus. Sie sei eine Traumtänzerin. Sie sei nie richtig da, sagte er immer.
Aus dem Haus gehen, die Tür abschließen, als schlösse sie sich selbst ab, in die Stadt gehen: das Gerenne, das Getue, das Ungewisse, das sie erwartet! Es sind immer große Schritte, sich aus ihrem Kuscheldasein zu lösen. Eigentlich müsste sie sagen aus ihrem Kuschelwegsein, denn das Dasein betreibt sie selten.
Erstaunt blickt sie um sich. Da hat sie ein Beispiel für ihre Abwesenheit vor Augen: Sie sieht den schönen Spazierweg neu geschottert, eine Parkbank im Schatten der Alleebäume, am Horizont die ersten Stadthäuser. Das hat sie noch nie gesehen. Das nimmt sie jetzt erst wahr. Mit ihrem Körper ist sie da, mit ihrem Kopf woanders. Sie läuft durchs Leben und merkt es nicht. Der Hugo hat sie Traumtänzerin genannte, nicht nur, weil sie so traumhaft mit ihm tanzte, sondern weil er zu ihr sagte, sie wäre nie richtig da.
Sie setzt sich auf die Bank. Jetzt ist sie da! Zwischen zwei Baumstämmen hat sie einen Ausblick in die vom Sonnenlicht durchflutete Natur, in das weite Hügelland. Die Rapsfelder in der Ferne leuchten gelb. Ihre stehende Redensart: Auch ihn, den Hugo, hat sie aus den Augen verloren. Es zieht sich etwas in ihrer Brust zusammen. Sie spürt es jedes Mal: Sie hat geweint, als er in den Zug stieg. Er hatte auch seltsam dreingeschaut. Aber was sollten sie machen? Er fand keine neue Arbeit in der Stadt, nur hoch im Norden. Die Entfernung war zu groß, um sich zu treffen, und das Geld zu klein für eine Reise. Sie schrieben sich wie aus zwei Welten. Ihre Nachricht begann mit „Weißt du noch…“, und er erzählte, was er machen will und werde. Dann berichtete er von seiner Absicht einen Europatrip zu machen und unterwegs zu arbeiten, wo sich was böte. Ihr Studium beschäftigte sie zu sehr, um bei der Sache zu bleiben. So schlief ihre Post ein, und ihre Erinnerungen wurden lebendig.
Sie atmet ein paar Mal tief durch. Ihre Brustenge löst sich. Nun hat sie keine Lust mehr, in die Stadt zu gehen, sich dort all dem Neuen zu stellen, in das Getriebe und Gerenne einzutauchen. Sie geht den Weg zurück zum Haus. Am Hauseingang steht ein Mann und schaut ihr entgegen:
„Entschuldigen Sie! Sind Sie Frau Doktor Inanna Schuck?“
Sie kennt den Mann nicht. Er macht keinen gefährlichen Eindruck. Er lässt ihr keine Zeit, ihn genauer zu studieren. Sie nickt, er reicht er ihr ein Päckchen.
„Das habe ich für Sie vom Postboten angenommen. Wir wohnen seit kurzem dort drüben. So können wir uns noch nicht kennen.“
Er deutet zum Wäldchen. Sie weiß, dahinter ist eine kleine Siedlung, Einfamilienhäuser, nicht weit entfernt.
„Entschuldigen Sie meine Neugierde: „Inanna“ ist eine Göttin. Nicht wahr? Ein ungewöhnlicher Name bei uns.“
„Das stimmt, aber es ist auch ungewöhnlich, dass das jemand weiß.“
„Vom Kreuzworträtsel: Sumerische Göttin, sechs Buchstaben. Stimmts?“
„Ja! Mehr wissen Sie nicht?“
„Göttin der Sexbegierde und des Krieges.“
„Das ist nur ein Teil von ihr. Sie ist auch für den Morgenstern und Abendstern zuständig und für die Häuslichkeit und vieles mehr.“
„Ich sehe, Sie kennen sich aus. Sind Sie vom Fach?“
„Ich bin Sumerologin.“
„Das ist ja hochinteressant! Vielleicht dürfen wir Sie mal einladen, dann könnten wir das vertiefen. Es interessiert mich sehr. Mein Name ist Balling, Horst Balling.“ Einladung! Alles, nur das nicht, schießt es ihr durch den Kopf.
„Ja, gerne einmal“, antwortet sie kühl. Er macht keine Anstalten zu gehen. Sie geht zur Tür, steckt den Schlüssel ins Schloss:
„Bin leider etwas in Eile, danke ihnen für Ihre Mühe. Sehr freundlich.“
Dann geht sie ins Haus. Sie kennt die Nachbarn nur vom Vorbeigehen und Grüßen und hat kein Verlangen nach mehr. Schon gar nicht nach dem Herrn Balling, der sie so anzüglich angeschaut hat, als er „Sexbegierde“ sagte. Sie ist es gewohnt, auf ihren Namen angesprochen zu werden. Manchmal ist sie selbst überrascht, denn sie heißt eigentlich, oder besser, sie hieß Barbara. Inanna nennt sie sich seit der Promotion aus Verehrung für diese wunderbare Göttin, aber mit Sex will sie nicht in Verbindung gebracht werden; so anzüglich gesagt, trifft es auch nicht für Inanna zu, deren Scham heilig ist. Eine Heilige Hochzeit feierten die Sumerer mit ihr und dem Dumuzin, dem Hirtengott. Sie war nicht wie die archaischen Urgöttinnen dick, erdrückend mütterlich, sondern schlank, attraktiv, eine Vorgängerin der Aphrodite, der Venus. Aber sie war auch mutig, hart und brutal: Göttin des Kriegs und der Liebe. Sie ging für die Menschen in die Unterwelt, starb und stieg auf nach drei Tagen. Das alles hätte sie diesem Balling erzählen sollen, aber irgendetwas hielt sie ab, sich mit ihm länger abzugeben.