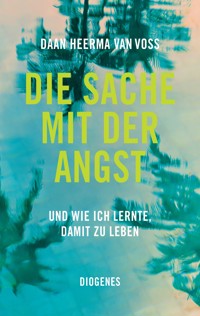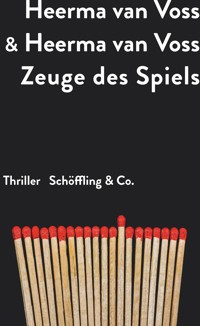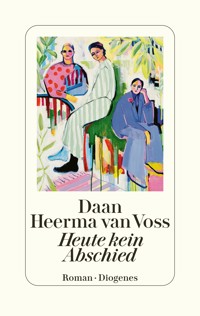
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der plötzliche Tod von Oskar stellt das Leben seiner drei Kinder auf den Kopf. Eigentlich müssen sie sich von ihrem Vater verabschieden, doch allmählich stellen sie fest, dass sie ihm vielleicht zum ersten Mal begegnen. Ein großer Familienroman über das Abschiednehmen und das Willkommenheißen, über eine zersplitterte Familie, die vor weitreichenden Entscheidungen steht, die viel zu lange aufgeschoben wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Daan Heerma van Voss
Heute kein Abschied
Roman
Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Diogenes
Für meinen Vater, den ich so lange wie möglich vermissen will.
TEIL ILiebe und Leid
Sein Name war
Diese Bekanntschaft wird kurz sein. Kurz, aber notwendig, so wie das nun mal ist mit Warnungen. In diesem Kapitel stirbt bereits jemand. Und dieses endgültige Verstummen wird mehrere Leben in eine Stromschnelle geraten lassen. Der Mann, um den es geht, wird nach der nächsten Leerzeile seine Aufwartung machen. Einen Moment Geduld noch.
Hiermit verspreche ich, dass ich mich nicht aufdrängen werde. Hier und da werde ich mich vernehmen lassen. Bin ich persönlich von dieser Geschichte betroffen? Auf jeden Fall, nie war ich es mehr als hier und jetzt, gerade aufgrund meiner Rolle als Erzähler. Zum Glück für uns beide halten mich mein guter Geschmack und eine Abneigung gegen Sentimentalitäten davon ab, diese Betroffenheit genau zu benennen oder damit zu hausieren. Du wirst mir schon glauben müssen: Diese Geschichte ist wichtig.
Da ist er. Dort, in dem Labyrinth, das wir Schiphol nennen. Sein Koffer ist eingecheckt, und nun schlendert er von Terminal zu Terminal und von Halle zu Halle. Es ist Jahre her, dass er zuletzt auf dem Amsterdamer Flughafen war, er hatte vergessen, wie viel Stress dieser Ort ihm bereitet. Was er aber sehr wohl weiß: Wie schlecht Stress für sein Herz ist. Ihm wurden Tabletten deswegen verschrieben. Tabletten, die er gleich nicht mehr brauchen wird.
Es ist Sonntag, sechs Uhr abends, und für sein Gefühl geht heute alles zu schnell. Die gelben Bildschirme sind zu grell, die Menschen reden zu laut, sie achten nicht darauf, was links und rechts passiert. Er bestellt einen Kaffee – »einen normalen, schwarzen Kaffee in einer üblichen Größe« – und sinkt in einen Schalensessel, der nicht gerade angenehm für seinen Rücken ist. Dieses Niedersinken vollzieht er mit so viel Selbstsicherheit, dass seine Nachbarn von alleine zur Seite rücken, als trauten sie dem Ganzen nicht recht, als hätten sie es mit einer anderen Tierart zu tun.
Doch was wissen sie schon? Sie haben ihn nicht als Dreikäsehoch gekannt, als er mit seinen langen, wollenen Kratzstrümpfen durch die trüben Brabanter Dorfstraßen lief, im Hinkeschritt springend oder Kiesel wegkickend, Autos gab es kaum, vorbei an der Mühle, vorbei an der Sankt Albertuskirche. Sie wissen nicht, wie er als Schüler bereits davon träumte, den Zug zu nehmen, weg, weg. Über die Welt da draußen, die weite Welt da draußen, eingeteilt in dreizeilige Lemmata, las er täglich in der Enzyklopädie für jedermann, still für sich, in seinem ungeheizten Zimmer, eine Pferdedecke um die Schultern gelegt, während der Geruch von Muttis Kartoffels durch die Fußbodenspalten drang. Sie wissen nicht, wie sein Schweiß roch, als er in der großen Stadt zum ersten Mal verliebt war, wie überglücklich er sich fühlte, als die Krankenschwester sagte: Sie sind Vater geworden.
Noch ehe er den dritten Schluck von seinem Kaffee getrunken hat, wird sein Flug aufgerufen, eine betuliche Blechstimme aus allen Ecken jeder Halle, jedes Shops, jeden WCs. Dann erklingt sein Name. Er solle sich bitte am Gate melden. Hat er nicht auf die Zeit geachtet? Hat er sich vertan? Er weiß es nicht. Er lässt den Kaffee stehen und macht sich auf den Weg und denkt, während er geht, an seinen Sitz in der Maschine, 17F, an das KLM-Menü, das ihn erwartet, an die extra Minibrezel, auf die er, in Anbetracht seiner Familiengeschichte, ein Recht haben müsste. Doch seine Schritte verlangsamen sich, die Füße schleifen über den Boden, er kommt kaum vorwärts. Hinter den großen Fenstern steigen die Flugzeuge auf, ein donnerndes Dröhnen, einigermaßen gedämpft durch die gutgelaunte Klaviermusik, die Schritte der Menschen um ihn herum, das liebliche Stimmengewirr. In den nach Fußbodenreiniger riechenden Grotten Schiphols, in dem Streifen Niemandsland zwischen Gate D12 und D14, bricht er zusammen. Wie eine Marionette, deren Fäden durchgeschnitten werden, und mit jedem Schnitt ist er weniger er selbst. Er versucht aufzustehen, was ihm nur halb gelingt. Er schwankt weiter. Ungläubig schaut er auf seine Hände, Füße. Dies ist sein Körper, dies ist ein Tag wie jeder andere, eingeklemmt zwischen gestern und morgen, alles in Ordnung. Dies denkt er, und folglich gibt es ihn noch, und folglich ist alles in Ordnung. Sein Name wurde noch mal aufgerufen, er hörte es schon nicht mehr.
Wer ist der Mann, der auf diesen Namen hört? Eine anerkannt schwierige Frage, die umso komplexer wird, je besser man ihn kennt. Wie kann man überhaupt jemanden kurz charakterisieren, wie fasst man die Unendlichkeit eines Menschenlebens in einen einfachen, eindeutigen Satz zusammen, der beginnt mit: Er oder sie ist.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Mann, um den es geht, notorisch schlecht einzuordnen ist. Mindestens fünf Menschen in der Trauerhalle, in der ihm in acht Tagen die letzte Ehre erwiesen wird, werden irgendwann denken: Wenn man mich fragt, dann habe ich den guten Mann eigentlich kaum gekannt. Ich will dennoch den Versuch unternehmen, ein Bild von ihm zu geben, auch wenn dieses Bild vermutlich mehr einem Schatten als einem Foto ähnelt.
Zunächst die Fakten: Er ist ein Sohn, ein Ex-Ehemann, und er ist Vater von drei erwachsenen Kindern, in chronologischer Reihenfolge: Tessel (1981), Moor (1985) und Cat (1989). Zu ihrer Mutter, Elise, hat er schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Dass er noch nahezu jeden Tag an sie denkt, weiß niemand. Vielleicht ist das besser so.
Nie hat ein Porträt von ihm in der Zeitung gestanden, und es wurde auch nur ein einziges Mal ein Interview mit ihm veröffentlicht, in einer Studentenzeitschrift, über die Stadtfotos, die er im Laufe der Jahre gemacht hat. Vielleicht wird ihm ein Themennachmittag gewidmet, von einem Connaisseur, in einem kleinen Programmkino, in dem das Flurlicht kaputt ist. Lange war er ein zäher Soloselbstständiger in der immer jungen Filmwelt, und manchmal hatte er sogar »Erfolg«. Doch in letzter Zeit fragte er sich immer häufiger, ob er die geringe Zahl von Jobs, die ihm angeboten wurden, nicht in Verbindung mit dem verhassten Urteil Rente bringen musste. Vor zwei Wochen, an einem regnerischen Dienstagabend, kam ihm im Fernsehen eine zuckersüße niederländische Rom Com unter. Nicht einen Schauspieler hätte er beim Namen nennen können. Er erinnerte sich an das, was Gene Grift, sein alter Hollywood-Kumpel, einst zu ihm gesagt hatte: Dass etwas, ein Job, eine Welt, sich ganz selbstverständlich anfühlt, solange man dazugehört, jedoch vollkommen lächerlich wird, sobald dies nicht mehr der Fall ist. Dort, vor dem Fernseher, wurde ihm bewusst, dass er ein Außenstehender geworden war, und vielleicht war er das schon seit Langem – möglicherweise machte man sich schon seit Jahren lustig über ihn: Wer ist der alte Kerl da hinten auf dem Set?
Er öffnete eine Suchmaske auf seinem Laptop und fand einen billigen Flug, nach Porto. Heute Morgen noch schaute er in den Spiegel und dachte an seinen bevorstehenden Urlaub, den ersten seit Jahren, den er heute Abend mit einem dunkelroten Glas Tawny vor einem der alten, dicht an dicht gebauten Portlokalen am Hafen einläuten würde.
Wie klingt er, wie sieht er aus?
Seine Stimme ist altertümlich, tief und ernst, als wäre sie dazu gemacht, Unglücksnachrichten zu verkünden. Wenn er überwältigt wird, von Wut, von Rührung, von allem, was größer und stärker ist als er, verliert er sich in Gestotter. Er hat eine Radiostimme, die zu seinem Radiogesicht passt. Eine Haut wie Borke – rau, voller Flecken und Grübchen – mit lila Kratzern auf den Nasenflügeln. Eine durchfurchte Stirn, Falten, die durch Nachdenken, schaurige Träume und die Neigung, bei unzureichendem Licht zu lesen, verursacht wurden. Nicht hässlich, eher unfertig. Ein Maler würde sagen, ein mittelalterliches Gesicht aus der Zeit, kurz bevor die Gesichter detailgenau und subtil wurden. Geburtsort: Oosterhout. Geburtsjahr: 1946. Größe: 1,78. Todestag: heute.
Das Zusammenbrechen zwischen zwei Gates, die Marionettenfäden, die durchgeschnitten werden, das Schwanken, es ist ein primitives Bild. Es ist tierisch, roh. Umstehende erschrecken, aber sehen nicht weg. Sie vergessen zu atmen, ihre Pupillen erweitern sich, sie rufen nach einem Arzt. Aber die Rufe dringen nicht zu ihm durch, höchstens als ferne Schwingungen. Seine Wangen glühen, warum ist es nur so warm?
Die Umstehenden, schauen sie auf einen guten oder schlechten Menschen? Was würden seine Freunde dazu sagen, oder seine Kinder?
Er liebt seine Kinder, gewiss, auf seine Weise. Auf ein Schulterklopfen brauchen sie sich keine Hoffnung zu machen. Liebe strömt stets auf einem Umweg. Am Königinnentag zog er früh los, um auf dem allgegenwärtigen, traditionellen Flohmarkt die besten Spielsachen für sie zu finden. In der klammen Morgendämmerung streunte er die Amsterdamer Apollolaan entlang, die Hände tief in den Taschen seiner bretonischen Fischerjoppe, auf der Suche nach Stormtroopern, Ewoks oder Comics für Moor, Buntstiften und Bleistiften für Tessel, Puppen für Cat. Die Beute wartete auf sie, wenn sie, noch benommen vom Schlaf, schlurfend die Treppe runterkamen. Wenn Tessel mit ihrer Familie in Urlaub fährt, stets nach Frankreich, faltet er zu Hause an seinem Schreibtisch die alte Straßenkarte auseinander und steckt Heftzwecke in die Städtchen, wo sie übernachten, um so doch ein wenig mit ihnen zu verreisen. In einstmals aktuellen Reiseführern sucht er dann nach netten Cafés, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, gut gemeinten Provinzmuseen. Er ruft sie an, erreicht sie aber nicht. Große Aufmerksamkeit für kleine Dinge.
Für andere Seiten seines Charakters lassen sich nicht so leicht gute Worte finden. Er hat ein aufbrausendes Temperament, auch wenn er das selbst abstreiten würde. Er war kein prinzipieller Gegner von väterlichen Klapsen, wenn ein Kind (der Sohn, Moor) nicht auf ihn hörte. Er hupt Fahrradfahrer ohne Licht an, die sich dann zu Tode erschrecken. Recht so. Wenn jemand im Fernsehen sagt, er oder sie sei traumatisiert, verspürt er Lust, etwas kaputtzumachen. Und ja, er hat Fehler gemacht, genug Fehler. Reden wir später drüber, im Augenblick scheint mir das wenig passend.
Guter Mensch, schlechter Mensch, welche Rolle spielen moralische Klischees denn noch, er hat sowieso nicht mehr lange, und wer hat die Autorität, darüber zu entscheiden?
Es geht schnell jetzt. Seine Gedanken an den Sitzplatz, die Flugzeugmahlzeit und das Brezeltütchen, auf das er ein Recht zu haben meint, sind vollkommen verschwunden. Gedankengänge hat er überhaupt nicht mehr, sein Leben läuft vor ihm ab, jedoch auf eine diffuse, komplexe Art, die nur er erklären könnte, wenn er sich nicht in diesem wortlosen, entschwindenden Zustand befände. Ihn beschäftigen Schimmer und Blitze, fragmentierte, eingedickte Erinnerungen und Erlebnisse, die sich aus der Chronologie, die sie an ihrem Platz hielt, gelöst haben. Alles geschieht in ein und derselben Sekunde. Wie das bleiverglaste Kirchenfenster das graue, magere Gesicht von Ehrwürden Doomernik färbte, während er näher kam, immer näher kam, und ihm zublinzelte, wie ein Zyklop. Die erste Nikon F, die er je sah, in Amsterdam, wie es sich anfühlte, sie in die Hand zu nehmen, die Welt durch ein Objektiv zu betrachten, aus der Distanz und dennoch dazugehörig. Der Schlafzimmerblick seiner Ex, Elise, in den ersten gemeinsamen Jahren, die kleinen, hoffnungsvollen Augen, so unverschämt froh, neben ihm aufzuwachen. Die kühlen Luftströme, die durch das offene Fenster seines gemieteten Cadillacs ins Innere strömten, wenn er durch Hollywood cruiste. Der warme Babygeruch seiner Kinder, als sie ihn noch an sich schnuppern ließen. So viele Leben, vereint in dem einen. Umgeben von den Lampen und flackernden Bildschirmen des Flughafens, sieht er Glühwürmchen, die ersten des Jahres, sie leuchten in Form von kleinen, geschmeidigen, Halogenachten im Dunkel, das sein Elternhaus in der Pastoriestraat in Oosterhout umgibt. Doch als er die Arme ausstreckt, sind sie weg. Er wird abgeschält. Alles, was selbstverständlich war, verschwindet immer mehr. Alles, was einst zufällig war, erscheint jetzt schicksalhaft. Und umgekehrt.
Alles in einer einzigen Sekunde.
Danach verblassen die Blitze, und es bleibt nur ein Nebel aus Eindrücken und Gefühlen, die er einst gehabt oder empfunden hat, und die nun, abgeschnitten von den konkreten Erinnerungen, zu denen sie ursprünglich gehörten, in ihm umherschweben und sich nie wieder setzen werden. Sie entspringen aus ihm, doch sie sind kein Teil mehr von ihm. Als er mit ausgestreckten Armen niedersinkt, reißt er, statt Glühwürmchen, eine Packung Kaubonbons aus dem Verkaufsständer eines kleinen Kiosks. Ein Kind, das exakt diese Tüte haben wollte, zeigt neidisch auf ihn, eine Mutter legt ihre Hand an den Mund, ein Mann, der fünf gebügelte Sakkos in der Hand trägt, lässt sie alle fallen. Doch das Unvermeidliche hat bereits begonnen. Die Umherstehenden sind Zeugen eines ebenso feierlichen wie brutalen Ereignisses: Ein Mitmensch verliert sein Leben.
Die Vielfältigkeit eines Menschenlebens, die Charakterzüge, die niemand anders als der Sterbende jemals an den Tag legen wird, die Gedanken, die kein anderer genau so haben wird, der Besitz, die Gegenstände, die Kindersocken, die Oberhemden, die Turnschuhe, die Entscheidungen, die das Leben zu seinem machten, die Verwünschungen und Versprechen und Verliebtheiten, die Lieder, die er mochte, die Fotos, auf denen er abgebildet ist, der Körper, der blühte, erwachsen wurde und dann allerlei Wehwehchen aufzuweisen begann, und zentral darin das eine Organ, von dem alles abhängt, das allmählich immer langsamer schlägt, langsamer, noch langsamer. So lange dauert das Leben, so viel länger noch dauert der Tod, und so blitzschnell verwandelt sich das eine in das andere.
Niemand ist in der Nähe, um Abschied zu nehmen. Doch dass er allein ist, macht ihm, vielleicht zum ersten Mal nach langer Zeit, überhaupt nichts aus. Es ist eine reine, konzentrierte Einsamkeit, die er empfindet, die eines Sterns oder eines Steins, der von einer Klippe fällt.
Es ist offensichtlich, welches Ereignis sich vor ihm erstreckt. Das spürt er. Obwohl keiner von uns jemals zuvor gestorben ist, wissen wir im entsprechenden Moment, dass es geschieht, dass es begonnen hat. Es wird schnell passieren, fühlt er, ohne sich zu wundern, möglicherweise sogar mit einem Hauch von Ehrfurcht. Er hatte immer Angst vor dem Tod, vor dem Sterben. Als gäbe es die Möglichkeit, dass er es nicht könnte, ohne dabei seine Würde zu verlieren, dass er bei dieser Prüfung durchfallen könnte. Aber er kann es sehr wohl. Er ist dabei. Ein »Bestanden« winkt.
Er gibt nach. Ein sanftes, warmes Gefühl durchzieht unerwartet seinen ganzen Körper – nie wieder wird ihm jemand Schmerzen zufügen, nie wieder wird er seinen Schmerz an einem anderen rächen müssen. Doch äußert sich dieses Gefühl nicht in einem Lächeln, seine Gesichtsmuskeln erstarren; das Gefühl bleibt ohne sichtbaren Beweis, als hätte es nie existiert. Seine Lungen nehmen nichts mehr auf und stoßen nur noch ein bisschen, bis-sch-en aus.
Es geschah gerade, es geschah, es war geschehen.
Ach ja. Sein Name war Oskar.
Sans rancune
Von den Ereignissen auf Schiphol weiß Tessel noch nichts, als sie in Amsterdam in den Bibliothekssaal kommt, wo sie eine Lesung halten soll; als sie den freundlichen, schnurrbärtigen Veranstalter begrüßt; als sie den fensterlosen Personalraum betritt; als sie ihre Jacke an einen Haken neben dem verdatterten Porträt des Königs aufhängt; als sie an das Pult tritt; als ihr Telefon in der zurückgelassenen Jacke vibriert. Es sind Tessels letzte unwissende Momente, die sie später, wie das so ist, für unverzeihlich arglos halten wird. Derjenige, der sie anruft, ist ihr jüngerer Bruder Moor. Er versucht es weiter – eine Neigung, die Überbringern von schlechten Nachrichten eigen ist.
Doch gerade sind Tessels Gedanken noch beim Pult, beim Publikum und bei dem Thema ihres Vortrags: der allwissende Erzähler. Dem Publikum wäre es lieber, wenn sie aus früheren Werken vorläse, anstatt eine Abhandlung über ein literaturwissenschaftliches Problem wie dieses verdauen zu müssen, das weiß sie, und der schnurrbärtige Veranstalter hat sogar extra um einen Vorleseabend gebeten. Doch Tessel denkt lieber an neue Arbeiten, an die Suche nach dem Neuen – es ist doch schön, die Zuhörer erleben zu lassen, wie eine solche Suche aussieht, sie daran teilhaben zu lassen, ihnen etwas zum Nachdenken zu geben, anstatt sie mit einer Passage geronnenen Textes, den sie bereits kennen, abzufertigen. Außerdem ist das Problem des allwissenden Erzählers für sie viel mehr als ein verstaubtes Literaturproblem – möglicherweise berührt es ja den Kern dessen, wie wir unser Leben führen.
Während der vergangenen Wochen hat Tessel Gedanken gesammelt, ganz nebenbei. Manchmal ist sie vom Haushalt so erschöpft – weniger von der Erledigung der Arbeiten als vielmehr von deren Organisation –, dass ihr die Energie fehlt, ihre Ideen weiter auszuarbeiten. Sie hofft, aus ihren Notizen werde von selbst etwas erwachsen, doch so funktioniert das nicht, oder nicht mehr. Sie verspürt jetzt bereits Lust, heute Abend zu Clios Zimmer zu gehen, die Tür leise zu öffnen und ihre Tochter zu riechen, das sanfte Auf und Ab ihrer Brust zu beobachten. Warum, weiß sie nicht, aber sie muss an einen Sankt-Martinsabend denken, vor langer Zeit, an dem Moor und sie sich mit verwaschenen Handtüchern, Metalldraht und Bergen von Klopapier als Blumenkohle verkleidet hatten und zusammen durch die dunklen Straßen gegangen waren, mit ihren schaukelnden Laternen, die leuchteten, bis die Lämpchen den Geist aufgaben.
Der Saal ist mehr oder weniger gefüllt, etwa vierzig Zuhörer, nur in der letzten Reihe sind noch ein paar Plätze frei. Sie entfaltet ihr Manuskript. Die gefundenen Gedanken bilden noch weniger ein Ganzes, als sie gedacht hat. Zunächst stehen dort ein paar lose Ideen über die innige Verbindung zwischen dem allwissenden Erzähler und Gott, die Instanz, die nicht nur allmächtig, sondern auch allwissend ist. Ohne allwissenden Gott keine Religion, ohne Gott kein allwissender Erzähler. In den darauffolgenden Absätzen schlägt sie den Bogen zur klassischen Literatur. Homer und später Dickens, Émile Zola. Erst im letzten Jahrhundert sei der allwissende Erzähler außer Mode gekommen und sogar in Misskredit geraten, die Vorstellung habe man archaisch, lächerlich gefunden. Tessel blättert um, wobei sie sich am Papier einen Schnitt im rechten Zeigefinger zufügt, ein winziger Streifen Blut. Gegenwärtig glaubten die meisten an die postmoderne Theorie, liest sie weiter, dass es Milliarden einzelne Erzähler mit einem eigenen Leben und einer eigenen Geschichte gebe, ohne sich dabei auf etwas oder jemanden stützen zu können, der den wechselseitigen Zusammenhang zwischen all diesen Leben im Blick habe. »Wir sind zu Schauspielern ohne Regisseur geworden, im Zweifel über unseren Text«, sieht sie auf dem Papier. »Wir sind uninspiriert geworden, vielleicht schauen wir sogar auf unser eigenes Leben herab.« Sie hatte gehofft, auf der Basis dieser Punkte improvisieren und extemporieren zu können. Doch an diesem Abend fehlt ihr dazu die Kraft. Eine Schlussfolgerung hat sie noch nicht. Was sie hat, sind zwei Fragen, die sie schon seit Monaten beschäftigen und die sie ihren Zuhörern stellen wollte, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Doch dies ist nicht der Abend dafür. Die beiden Fragen: Könnte es sein, dass es doch eine Instanz gibt, ein etwas oder einen jemand, der alles über uns weiß? Und wenn ja, würden wir dann hören wollen, was diese Instanz zu erzählen hat?
»Der allwissende Erzähler …«, sagt Tessel nach einer viel zu langen Stille mit ihrer ausgefeilten Vorlesestimme, die viel affektierter klingt, als sie denkt.
Ein »Ksss« im Saal, das sie als Aufmunterung versteht. Ein leises Murmeln in den Zuschauerreihen. Sie macht eine kurze Pause, um einen Schluck Wasser zu trinken. Sie schaut ins Publikum. Nette Leute, grau und höflich, die sieben Euro bezahlt haben, um an diesem Sonntagabend hier sein zu dürfen, in diesem Bibliothekssaal mit abgehängter Decke, um ihr zuzuhören, in der Hoffnung, etwas zu hören, was sie bereits kennen. Sie blinzelt hinauf zu den grellen Deckenlampen. Das Ksss vorhin, vielleicht hat sie es sich nur eingebildet. Oder war es ein Zeichen der Verärgerung? Undeutlich und aus der Ferne erklingt das Dröhnen eines Flugzeugs; sie hofft, dass ihr Vater einen guten Flug gehabt hat, und nimmt sich vor, ihm eine Nachricht zu schicken. Ach, vielleicht kann sie ihn besser später anrufen. Wenn sie es nicht tut, wer sollte es dann tun?
Eine der Frauen in der mittleren Reihe trägt einen Hut, einen wollenen Cloche; ein Stich in Tessels Unterleib, solch einen Hut würde sie nie zu tragen wagen. Zu viel Angst vor Spießigkeit. Vor Ältlichkeit, vielleicht ja. Solange sie sich erinnern kann, finden die Leute sie bereits »alt« für ihr Alter. Doch in den letzten Jahren scheint sich das Altern zu beschleunigen. Seit sie die Vierzig überschritten hat, kommt sie sich vor wie eine Fünfzigerin. Sie ist jemand geworden, die einen kleinen Regenschirm in ihrer Handtasche hat, denn man weiß ja nie. Jemand, die sich über Kellner ärgert, die eine Bestellung unbedingt im Kopf behalten wollen und dann mit Block und Stift wiederkommen. Jemand, die ja sagt, während sie einatmet. Die sich, bevor sie in Urlaub fährt, vor Verstopfungen fürchtet und zu lange nach den besten Mitteln dagegen googelt. Was haben diese kleinen Veränderungen zu bedeuten? Alles? Nichts? Sie ist jemand geworden, die sich angesichts all ihrer neuen Angewohnheiten fragt: Ist dies endlich der unumstößliche Beweis dafür, dass ich mich verändert habe?
Wenn sie sich nicht verändert hat, warum gelingt es ihr dann seit nahezu sechs Jahren nicht mehr, um genau zu sein, seit der Veröffentlichung von Der Uhrmacher, die als enttäuschend oder sogar elitär-irritierend empfundene Fortsetzung ihres ziemlich erfolgreichen Romans Sans rancune, etwas Substanzielles zu schreiben? Sie kann doch schreiben, im Prinzip? Nein, daran zweifelt sie nicht, nicht wirklich. Ihre Zweifel sind abstrakter und liegen tiefer als die Dimension des handwerklichen »Könnens«: Sie fragt sich, ob sie überhaupt eine Schriftstellerin ist, jemand, der das gelebte Leben dem geschriebenen unterordnet. Verfügt sie über die Unbarmherzigkeit, die Wirklichkeit vor allem oder sogar ausschließlich als Material zu betrachten? Eine schreckliche Frage mit lauter schmerzhaften Antworten. Daher verwendet sie nun den Großteil ihrer Zeit darauf, Gutachten für Verlage zu schreiben, in Stiftungskommissionen zu sitzen, die Stipendien an Autoren vergeben, die mehr Mut als sie haben, und Lesungen zu halten. Einmal im Monat googelt sie sich selbst. Wenig neue Treffer. Ihr Wikipediaeintrag wurde seit anderthalb Jahren nicht aktualisiert; manchmal ist sie versucht, es selbst zu tun. Doch welche Neuigkeiten könnte sie hinzufügen? Sie meidet Buchpräsentationen von Kolleginnen und Verlagsempfänge. Aus Selbstschutz. Noch eine solche Zusammenkunft von talentierten, bewunderungswürdigen und beliebten Schriftstellern, die, anstatt ihre Liebe für diese rätselhafte Kraft, die sie verbindet, die Literatur, das Buch, zu erklären und diese Liebe gemeinsam zu erforschen und zu vertiefen, es vorziehen, wie eine Trauergemeinde dazusitzen, Erdnüsse zu knabbern und über das Aussterben des Lesers, des guten Lesers, des wahren Lesers zu jammern. Noch eine einzige solche Zusammenkunft, und die Mutlosigkeit würde möglicherweise endgültig siegen. Tessel schaut noch einmal in den Saal. Keine Anmerkungen, keine Fragen. Sie weiß, was sie zu tun hat. Sie verlässt das Pult und kehrt mit einer alten Taschenbuchausgabe von Sans rancune zurück. Sie spricht Sätze, die sie bereits Hunderte Male gesprochen hat, und sie fragt sich, ob es nicht inzwischen der Text von jemand anderem ist, den sie vorliest.
In der zweiten Fragerunde hebt nur die Frau mit dem Cloche ihre Hand. »Also«, setzt sie an, als ihr ein Mikrofon unter die Nase gehalten wird; ihre Stimme klingt hoheitsvoll, jedoch nicht unangenehm; wie die einer Königin mit guten Nachrichten, »erst einmal vielen Dank für Ihre Lesung. Ich fand Sans rancune übrigens wundervoll. Es ist schon eine Weile her, aber … Das will ich auch kurz sagen. Nicht, dass Sie denken … Nun ja, gut, ich setz mich dann mal wieder.«
»Was genau wollten Sie fragen?« Tessel wird erst jetzt bewusst, dass man ihr soeben ein Kompliment gemacht hat. Zu spät, um darauf zu reagieren.
»Ach, ja, natürlich.« Sie steht wieder auf. »Ich fragte mich, ob wir bald vielleicht ein neues Buch aus Ihrer Feder erwarten dürfen? Das wäre … Das fragte ich mich.«
»Das neue Buch wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Leider.« Genau genommen steht davon eine halbe Seite auf ihrem Laptop, eine bizarre, ausführliche Beschreibung einer kahlen Zypresse. Den Rest hat sie gelöscht. Sie hat sehr wohl eine Idee für ihren nächsten Roman, eine gute Idee, doch die muss sie mit aller Vorsicht behandeln. Wenn sie sich zu früh an die Arbeit macht, verdirbt sie möglicherweise alles.
Ganz selten einmal fantasiert sie über die einzige wirkliche Alternative zum Stillstand: aufhören zu schreiben, von heute auf morgen, etwas ganz anderes machen, einen Job suchen, jeden Monat an einem bestimmten Tag einen festen Betrag auf dem Konto. »Ein allwissender Erzähler wüsste, wann es so weit ist.« Sie lächelt, in der Hoffnung, damit für das Publikum etwas gutzumachen. Nach einem zögerlichen Applaus nimmt Tessel Blumen in Empfang, die sie bald darauf, im Tausch gegen Nachrichten aus der wirklichen Welt, dem Taxifahrer schenken wird. Sie verbeugt sich kurz und geht dann in den Personalraum, wo sie ihr Smartphone aus der Tasche nimmt und die Nachricht ihres Bruders abhört.
Etwas, das Schmerz ähnelt
Da ist Tessel, seine große Schwester, an diesem ersten Morgen ohne Vater, am Beginn des gewundenen Pfads, der von der Straße zum Lommerhorst führt. Moor sitzt in der Tür seines umgebauten VW-Busses, das linke Bein gestreckt, um einen Spliff darauf zu drehen. Er konnte sie schon in jungen Jahren in allen Varianten bauen, die Tüte, den Sticky, den Fatty, er war der Beste der ganzen Schule, der Reichsbaumeister, nur leider gab es dafür keine Note auf dem Zeugnis und auch keine Auszeichnung. Bedächtig gehend, hin und wieder einem Zweig ausweichend, kommt seine Schwester näher.
Es ist ein schöner Tag. Im sanften, schräg einfallenden Sonnenlicht scheint die Eiche zu glühen. Der Baum stand schon dort, als vor siebzig Jahren die ersten Bewohner mit ihren vagen Wunschträumen von Kommunen und Kibbuzen hier ankamen, Wunschträume, die schon sehr bald verflogen, als sich zeigte, dass es in der Regel keine geborenen Arbeiter waren, die sich der frisch gegründeten Gemeinschaft anschlossen. In der Eiche hat er, zusammen mit Joren und Sjors, Debbies Söhnen, vor zwei Sommern ein Baumhaus gebaut, aus unbrauchbarem Ulmenholz aus dem Sägewerk in Lisse. Manchmal, wenn keiner guckt, klettert Moor allein hinauf, um, der Länge nach hingestreckt, die Blakeund Mortimer-Comics zu lesen, die sein Vater einst am Königinnentag ergattert hat. Während er die speckigen, abgegriffenen Seiten durchblättert, stellt er sich vor, ein Kind vom Lande gewesen zu sein, aufgewachsen mit unendlich viel Zeit, von Wolken und Bäumen beschützt. Wirklich lesen tut er die Hefte nicht.
Als Tessel das schlammige Mittelstück erreicht hat, sieht er, wie ihre Absätze, vermutlich mit einem blubbernd saugenden Geräusch, im Schlamm versinken, Spritzer, Fluchen, teure Reinigung. Sie geht weiter und passiert das letzte »Umkehren!«-Schild. Er rollt nun schneller, er will seinen Spliff fertig haben, wenn sie bei ihm ankommt, das Ding muss angezündet in seinem Mundwinkel hängen, sodass sie in einen Marihuananebel tritt, über den sie sich keinen Kommentar erlauben darf. Sein Revier, seine Regeln. Er winkt kurz.
Es wird sie gewurmt haben, dass er die Nachricht eher erhalten hat als sie. Eine Art Kollege/Freund, der eine sehr geschätzte Reinigung in der Gegend von Schiphol hat, war auf dem Flughafen unterwegs, allwöchentlich liefert er dort gereinigte Jacketts für seine besten Kunden hin. Er sah, wie es passierte. Moor briet gerade Fischstäbchen bei Henk the Tank, der dank ihm auf dem Grundstück wohnen durfte. Bald begann die Sportschau. Henk hatte drei Kisten Hertog-Jan-Bier besorgt. Moors Handy, ein knallgelbes altes Nokia mit Schiebeklappe – von Freund und Feind liebevoll die Banane genannt – lag neben der Kochplatte, und er sah den Namen im Display erscheinen. Nie zuvor hatte er diesen Mann, der eine Art Kollege war, mit dem er aber seit einem aus dem Ruder gelaufenen Doppelkopfabend kaum noch Kontakt hatte, den Namen seines Vaters aussprechen hören: Oskar J.R. van Bohemen,, war das nicht der Name seines … »Das isser«, unterbrach Moor ihn mit heiserer Stimme, während zugleich ein verbrannter Geruch aus der Pfanne aufstieg. »Das ist mein Alter.« Eine genauere Identifikation sei nicht nötig gewesen, berichtete sein Freund, Oskar J.R. van Bohemen, hatte seinen Pass in der Innentasche, und so habe man sogleich feststellen können, dass er kein Organspender war. Das hätte Moor ihnen auch sagen können, den Bettlern in seinem Viertel gab der Alte auch keinen Cent, und jetzt sollte er einem Wildfremden seine Lunge spenden? Henk und er verzichteten auf Fischstäbchen und Fußball und becherten tapfer drauflos. Nach Ansicht von Henk war Oskars Tod alles andere als merkwürdig, die Chancen standen fifty-fifty, so wie bei allem: Es passierte, oder es passierte nicht. Fifty-fifty. Vier Bier später griff Moor zu seinem Telefon, rief Tessel an und hinterließ mit rauer Stimme in ihrer Sprachbox die Nachricht, dass ihr Vater, der Alte, über den Jordan gegangen war.
Da ist sie, seine Schwester, fast ist sie bei ihm. Sie haben einander ein halbes Jahr nicht gesehen, seit der Verabredung zum Kaffee in der Stadt, um die sie ihn gebeten hatte. Sie fand, er könne sich mehr Mühe geben, könne Oskar öfter anrufen, ihn besuchen, seine Schwester war äußerst belehrend gewesen. Moor hatte währenddessen aus dem Fenster gestarrt, auf die Grachten, die Pendler, die Tagestouristen, die miteinander verhandelnden Familien, Museum oder Eis, und sagte, er würde gerne nach Hause gehen. Und das hatte er dann auch ziemlich abrupt getan. Noch ehe sie ihren Bruder umarmt, streckt Tessel eine Hand aus und signalisiert, dass sie auch einen Zug nehmen möchte. Sie raucht, als handele es sich um eine Zigarre, ohne zu inhalieren. Er lächelt. Ein paar Minuten sagt keiner der beiden ein Wort. »Hier wohnst du also?«, unterbricht sie die Stille.
Sie verwendet dasselbe süßliche, blumige Waschmittel wie ihre Mutter früher, denkt er einen Moment lang, eine dünne Duftspur in eine ferne Vergangenheit. »Fast keine Miete, noch nicht gentrifuckt, alles cool. Ja, ja, drinnen schlägst du bestimmt die Füße über dem Kopf zusammen. Schrecklich viel aufzuräumen. Dir kommen vermutlich sofort Besen und Harke in den Sinn, aber das Chaos befindet sich in einem perfekten Gleichgewicht, kein Grund zur Sorge. Alles steht so schief, dass nichts umfallen kann.« Fast keine Miete stimmt nicht. Mehr noch, Moor hat mehrere Monate Mietrückstand. Er hat vor kurzem ausgerechnet, dass er dreißig Jacketts, fünf Anzüge und zwanzig Krawatten verkaufen muss, um seine Schulden zu begleichen, und das kostet ihn Monate, in denen wieder neue Rechnungen dazukommen, möglicherweise mit Verzugszinsen und Inkassogebühren. Ab und zu liegt ein Brief mit bedrohlichem Inhalt auf seiner Fußbodenmatte: Wenn du nicht bald bezahlst, endet die Gastfreundschaft. Dann sei es auch keine Gastfreundschaft, meinte Moor. Er nimmt einen letzten Zug und wirft den Joint weg. »Eine Runde spazieren?«
Sie gehen an dem zweiten Lieferwagen vorbei, der voller Zegna, Armani und Corneliani hängt, sein erfolgreichstes Geschäft seit Jahren, dann am Teich entlang, türkis vor lauter Algen.
»Wir werden jetzt noch nicht darüber reden?«, fragt sie.
Sie stellte die erste Frage. Sie hat den ersten Spielzug gemacht, auch wenn er noch nicht weiß, um welches Brettspiel es sich handelt. »Schreibst du wieder?«, ist seine Gegenfrage. Keine direkte Antwort, also vermutlich nicht. »Da war doch irgendwas mit einem Lektor, nein, mit einem Rezensenten. Bin ich nah dran?« Tage- oder wochenlang kann er friedfertig und großzügig sein, doch wenn seine Schwester in der Nähe ist, übermannt ihn das Gift.
»Du bist eiskalt.« Sie fragt ihn, ob er viel an Papa gedacht hat in letzter Zeit. Bevor das alles passiert ist.
»Ich denke schon seit Jahren nicht mehr an ihn als Papa.«
»Der Vornamen-Komplex.«
»Er heißt Oskar, also nenne ich ihn so.«
»Keine Bilder, keine Erinnerungen?«, fragt Tessel. »Echt nicht? Für mich ist es tatsächlich so, als seien seit gestern die Tore in die Vergangenheit geöffnet. Gerüche von früher kommen mir in die Nase, Düfte von einst. Das brodelnde, mit Curry gewürzte Fett, in dem er seine Pommes frittiert hat. Der starke Douwe-Egberts-Filterkaffee, die Kanne, in der der Kaffee immer lauer, aber nie kalt wurde. Ich sehe ihn im Garten stehen, in seinem rot-blauen Morgenmantel, die erste Dunhill des Tages rauchend. Geräusche. Mamas leichte Schritte auf der Treppe, seine schweren. Geklapper. Er räumt die Schränke aus, auf der Suche nach einer Bratpfanne, von der er ganz genau weiß, dass es sie gibt, sie hat das Ding doch nicht etwa weggeschmissen? Die typische Stille zwischen den beiden. Bestimmt schließen sie sich wieder, die Tore. Wenn das alles vorbei ist. Doch jetzt stehen sie offen, sperrangelweit.«
An die Stille erinnert Moor sich auch noch, ja. Die Stille vor einem Streit, wie ein einbehaltener Atemzug. »Wenn was vorbei ist?«
»Das, jetzt. Der Schock. Er ist nun wirklich weg. Ganz und gar weg. Sehr seltsam.«
Er ist nicht weg, denkt Moor. Noch lange nicht. »Die Tore in die Vergangenheit«, wiederholt er in neutralem Ton. »Ich verstehe das Bedürfnis nach diesem Gerede nicht. Über Erinnerungen und Gefühle. Welchen Sinn hat das? Man erlebt Erinnerungen, man erlebt Gefühle, und das war es dann. Wenn man anschließend auch noch redet über das, was man fühlt, um danach über das zu reden, was man beim Reden darüber fühlt … so kommt man nie an ein Ende, es sind nur Worte. Mama wollte früher auch immer reden.« Sie redete vor allem mit Tessel, sie war die Auserkorene, die Vertraute. »Genug geredet. Es ist passiert, und jetzt geht es weiter.« Keine Erwiderung seiner Schwester. »Ein Herzinfarkt, also?«, sagt er kurze Zeit später.
»Ja.« Sie zögert, scheint vor irgendwas auszuweichen. »Zum Glück hat er nicht gelitten.«
»Und ausgerechnet auf dem Flughafen. Das ist doch der Gipfel der Ironie.« Diese gewissenlose Bemerkung versetzt ihm einen Stich, was bei näherer Betrachtung möglicherweise auch Sinn der Sache war: Ob er beim Gedanken an die letzten Minuten seines Vaters doch noch etwas empfinden kann, das Schmerz ähnelt. »Wohin ging es eigentlich?«
»Ich finde den Tod unseres Vaters überhaupt nicht ironisch«, sagt Tessel. »Porto. Urlaub.«
»Warum bist du gestern nicht ans Telefon gegangen?«
»Eine Lesung«, antwortet sie. »Eine kleine Lesung. Wie geht es dir?«
»Abgesehen hiervon?« Er atmet tief ein, seine Stimme festigt sich. »Ich habe in letzter Zeit Probleme mit den Knien. Wir sind eben keine dreißig mehr.«
»Wie kannst du das bloß sagen, ironisch? Dass es ironisch ist, dass er dort … ging?«
Sie gehen weiter über das Gelände, das er nun bereits seit vier Jahren sein Zuhause nennt, diesen Flecken pure Freiheit, der von Zäunen und Warnschildern umgeben ist.
»Du weißt, ich habe andere Erinnerungen als du«, bemerkt er. Oskars Hand, die Moors Kopf unter den Wasserhahn drückt, um ihn »abzukühlen«. Was von allem am meisten schmerzte, war, dass es Moor nicht gelang, seinen Vater zu hassen. Dafür war die Sohnesliebe, von der Biologie auferlegt, einfach zu stark. Die »Abkühlungsmaßnahmen« endeten erst, als Moor vierzehn war und er seinem Vater im Wohnzimmer gegenüberstand und sagte: Bald bin ich stärker als du, und dann wirst du für jeden Schlag, den du mir verpasst, zwei zurückbekommen. Zu Moors Erstaunen war sein Vater, den er angefangen hatte, Oskar zu nennen, einfach aus dem Zimmer gegangen. Sie hatten nie wieder darüber gesprochen. Aber es musste seinem Vater aufgefallen sein, dass sein Sohn ihn genau so ansprach, wie Kollegen, Freunde oder Bekannte, mit dem Vornamen. Jeder konnte ihn Oskar nennen. Nur drei Menschen hatten das Recht, Papa zu sagen. Davon waren, seit Moor seinen neuen Kurs eingeschlagen hatte, nur noch zwei übrig. Vielleicht hat es ihm ja doch etwas ausgemacht, denkt Moor jetzt, vielleicht war ich ja doch in der Lage, ihn zu verletzen. Moor sieht nicht, was manche anderen sehen: Dass er sehr hartnäckig an Erinnerungen festhält, die andere lieber vergessen würden. Er denkt nicht, was manche anderen denken: Dass gerade Schmerz einen mitunter an den anderen bindet, dass er eine Art Klammer sein kann. Die einzige Gelegenheit, bei der Moor schon mal erwägt, von seinem Vater zu sprechen, sind die Männertreffen, an denen er am Wochenende teilnimmt, wenn sein Portemonnaie es zulässt. Doch die Praxis hat gezeigt, dass er in Gesellschaft von Männern lieber das Gegenteil tut und ganze Vorträge über die Bedeutung des Weiblichen im Männlichen hält, Vorträge, denen er selbst mal mehr, mal weniger Glauben schenkt. Andere Erinnerungen also, und aus anderen Erinnerungen ergeben sich andere Muster, und wenn man diese anderen Muster zusammenzählt, dann erhält man ein anderes Leben, das ist Moor sehr klar. »War es denn wirklich zu viel von ihm verlangt, mich hier einmal zu besuchen? Ein einziges Mal nur? Sorry, aber so denke ich darüber.« Ein paar Wochen bevor seine Beziehung mit Yvonne in die Brüche gehen würde und er, um dem Elend zu entkommen, hierhin gezogen war, hatte er Oskar angerufen und um Rat gebeten. Oskar hörte sich an, was sein in der Klemme steckender Sohn zu sagen hatte, und erwiderte: Mir ist es nicht gelungen, den Laden beisammen zu halten, warum sollte es dir also gelingen? Weil Söhne es manchmal besser hinkriegen als ihre Väter, hatte Moor antworten wollen. Doch er schwieg. Er hatte seinen Vater nie eingeladen, und sein Vater hatte nie gefragt, ob er willkommen sei.
»Ich kann nicht erkennen, wie diese beiden Dinge zusammenhängen, andere Erinnerungen und ob er dich besucht hat oder nicht.«
»Hat er nicht, nicht ein einziges Mal.« Die gewaltige Bestimmtheit, die Autorität, die Moors Vater sich angemaßt hatte, all die sogenannte Macht … und nun war er gefällt worden, wie irgendein dahergelaufenes Tier. Es war unmöglich, darin keine Niederlage zu erblicken; was sonst bedeutet verlieren, wenn nicht zu Boden zu gehen und nicht wieder aufzustehen? Hätte Moor doch irgendwann nur verstanden, irgendwann nur erkannt, dass sein Vater eines Tages niedergestreckt werden und zweifelsfrei verlieren würde, dann hätte er sich als Sohn möglicherweise anders verhalten, dann wäre er vielleicht stärker gewesen.
Tessel und Moor erreichen die Apfelbaumreihe, die das Gelände, auf dem die Wohnwagen stehen, von den zu Wohnhäusern umgebauten Bauernhöfen mit ihren Gärten trennt, dem Areal, wo die reichen Leute wohnen, die sich über seinen Pachtzins beschweren. Die beiden machen rechtsum kehrt. »Hast du mit Mama gesprochen?« Er hätte sie auch anrufen können. Doch was, wenn sie noch weniger Trauer empfand als er? Diese Tragik, die war ihm in der jetzigen Situation einfach zu viel. Und außerdem war Tessel die Älteste. Als ihre Eltern sich scheiden ließen, war sie bereits ausgezogen. Dieser Vorgang lag auf ihrem Schreibtisch.
»Gestern Abend. Sie ist für eine Woche in Ägypten. Sie kommt zurück, sobald sie einen Flug gebucht hat. Wenn du mich fragst, ist sie unsicher, was ihre Rolle angeht. Kann ich verstehen. Mutter seiner Kinder, aber auch: Ex. Die Ex.«
»Ägypten? Bestimmt mit dem Suppenkasper?«
»Sag jetzt bitte nichts Abfälliges über Cas.«
»Auch nicht als Ode an Oskar?« Moor erinnert sich an die entsetzlich langweiligen Essen in Broek in Waterland, bei Elise und Cas, die alte neue Liebe ihrer Mutter. Dann bestrich Cas sich wieder einen Toast mit Quittengelee und erinnerte sich an einen anderen Teil seiner Konditionierung; ob jemand noch ein Gläschen Chardonnay wolle, ein leckerer aus Chile! Und, Gott, als er damals irgendwas von einem C-Level quatschte und Moor einen Moment lang dachte, nun hätten sie endlich ein gemeinsames Thema, Sorgen wegen des Klimas und des Meeresspiegels, doch nein, Cas sprach natürlich von einem Freund, der Chief Financial Officer geworden war, was einem C-Level-Executive entsprach.
»Wir sollten uns an die guten Dinge erinnern.«
»Ja, wir sollten ihn so schnell wie möglich heiligsprechen lassen, dann haben wir das hinter uns.«
»Wir müssen zusammenhalten. Zumindest ein wenig. Sonst kommen wir … Sonst klappt das hier nicht.«
Stille senkt sich auf Bruder und Schwester, sie gehen spazieren, so wie sie unzählbare Stunden zusammen spazieren gegangen sind, in den Wäldern bei Castricum, wo ihre Mutter von Opas Erbe ein Häuschen gekauft hatte. Oder im Bois de Boulogne, in Paris, Elises Stadt, wo die Familie gelegentlich Ausflüge unternahm. »Du hast es gut hier, nicht?«, fragte sie.
»Es ist nie zu spät für eine glückliche Jugend.«
»Hast du noch Kontakt zu Yvonne? Sollte sie das mit Papa nicht vielleicht wissen?«
»Ich habe gehört, sie sei mit irgend so einem politisch-korrekten Typen zusammen. Noch keine dreißig. Bauchmuskeln, markantes Gesicht, fettes Gehalt, garantiert eins a Bananensaft. Neulich erst meinte ich sie zu sehen. Die blonden Locken. In Lisse. War aber ein Kerl mit weißem Haar, ein alter Hardrocker oder so. Da sieht man mal wieder.«
»Da sieht man mal wieder was?«
»Wie es laufen kann. Sie mochten einander nicht mal, Oskar und Y. Denk nicht, dass sich das plötzlich ändert, nur weil er tot ist. Und wie ist es so in deinem großen, leeren Haus?«
Langes Schweigen. »Weniger leer. Henk-Maarten und ich versuchen es wieder miteinander. Das Ganze ist noch sehr frisch. Guck nicht so!«
»Dieser HM. Hochwürdige Majestät, das comeback kid.«
»Würdest du ihn bitte nicht so nennen?«
»HM?«
»Hochwürdige Majestät. Es ist anders jetzt. Besser. Ich muss nicht mehr so tun, als sei ich wahnsinnig glücklich. Zu anstrengend. Und du?«
»Ich habe Deb.«
»Kenne ich sie?«, fragt Tessel.
»He, du weißt schon. Debbie.«
»O ja, entschuldige. Debbie, natürlich.«
Sie hat keine Ahnung. Moor ist sich sicher. »Wir schlafen hin und wieder zusammen. Ich meine damit schlafen, keinen Sex. Herrlich. Mit Beziehungen habe ich endgültig abgeschlossen.«
»Warum musst du alles immer gleich zu einem Dogma machen? Erinnerst du dich noch an den Sommer vor zehn Jahren oder so, als du für eine Woche in Neapel warst und du mit einem Mal erklärtest, du seist durch und durch Neapolitaner. Damals hast du wochenlang, heftig gestikulierend, Niederländisch mit italienischem Akzent gesprochen, mit dem Ergebnis, dass du in beiden Sprachen nicht zu verstehen warst. Bei dir muss immer alles so absolut sein.«
Er zuckt die Achseln, murmelt, er glaube nicht an Dogmen.
»Ich habe Catje ein paar Mal angerufen, aber ihr Telefon ist ausgeschaltet. Auf meine Mails reagiert sie auch nicht. Soll ich es weiter versuchen, oder übernimmst du?«
»Ich kann so was nicht gut.«
»Woher willst du wissen, dass du so etwas nicht kannst? Wie oft ist unser Vater schon gestorben?«
Oft, denkt Moor. Oft, in seinen Gedanken. »Ich habe immer das Gefühl, dass Cat mit schlechten Nachrichten nicht gut umgehen kann. Dass ihre sichere, privilegierte Blase platzen wird. Ich möchte nicht dabei sein, wenn ihr bewusst wird, dass sie einfach eine Frau in den Dreißigern ist.«
»Okay, ich mach’s. Ich besorge auch gleich ein Flugticket. Dann wissen wir zumindest, dass sie kommt. Wir müssen natürlich das ein oder andere organisieren. Oder willst du damit warten, bis Mama und sie hier sind, und wir erledigen alles gemeinsam?«
»Warten, würde ich sagen. Alle gemeinsam.« Es ist Jahre her, dass sie alle irgendwas zusammen gemacht haben. »Heute Morgen hat mich Schiphol angerufen. Dort liegt er wohl noch. Der Leichnam, meine ich.«
»Was haben sie gesagt?«
»O, ich bin nicht rangegangen. Ich gebe dir die Nummer. Besser, wenn du anrufst. Ich und der Kundendienst, kannst du dir das vorstellen? Soll ich mich um die Kleidung kümmern? Was wir ihm anziehen, meine ich. Er sollte doch einigermaßen ordentlich aussehen, wenn er da oben ankommt. Oder da unten, je nachdem.« Tessel reagiert nicht darauf. »Vielleicht sollten wir auch über unsere eigene Kleidung nachdenken. Für die Bestattung. Ich habe ein schönes schwarzes Kleid für dich, von Wang. Kaum getragen.«
»Daran kann ich jetzt noch nicht denken.« Sie starrt in den Himmel, er folgt ihrem Blick – wirre, irrende Wolken. Sie schließt die Augen, öffnet sie wieder. »Wo kriegst du die denn her? Die Kleider? Ich will keine Scherereien.«
»Alles legal, du, keine Sorge.« Es ist ein ebenso simples wie lukratives Geschäft, das er da betreibt, zu harmlos, um wirklich als illegal bezeichnet zu werden. Er steht in Verbindung mit einundzwanzig Reinigungen, die ihn anrufen, wenn Teile von bekannten Couturiers nicht abgeholt werden. Er übernimmt sie für einen kleinen Betrag und verkauft sie online für ein Vielfaches dessen, aber immer noch günstig! Ganz selten gelingt es ihm sogar zu deadstocken. Bei Kleidungsstücken ohne Gebrauchsspuren besorgt er sich im Internet das originale Label, bearbeitet es mit Photoshop und druckt es dann auf den richtigen Karton.
»Okay, du kümmerst dich also um die Kleidung«, sagt sie. »Und ich rufe an. Was soll ich sagen?«
»Dass sie ihn dabehalten sollen, bis wir wissen, was wir tun.«
»Und der Notar? Soweit ich weiß, hatte er einen Notar. Oder denke ich mir das aus?«
Ohne es zu bemerken, sind sie wieder bei Moors umgebauten Bully angekommen. »Denkst du …«, hebt er an, suchend, »… denkst du manchmal auch, dass wir mit anderen Eltern weniger gearscht gewesen wären?« Um nicht einfach nur dazustehen, nimmt er die Banane aus der Tasche und kritzelt die Flughafennummer auf eine herumliegende Serviette.
»Definiere gearscht.«
Nein. Das tut er nicht. Die Welt erstickt an Definitionen. »Fährst du jetzt gleich zurück in die Stadt? Es gibt schöne Obstgärten hier in der Nähe. Oder willst du noch einen Kaffee trinken? Schmeckt ein wenig nach Zigaretten. Magst du Zigaretten?«
»Ich fahre lieber. Keine Lust, in den Berufsverkehr zu geraten.«
Mit einem Mal sieht sie müde aus, todmüde. Eine einträchtige Umarmung folgt. Dann klammern sie sich etwas kräftiger aneinander, ein paar Sekunden lang. Sie lassen los. »Bestellst du Clio liebe Grüße? Nettes Kind, das du da hast. Tschö mit ö.«
Und da geht sie wieder, auf dem sich windenden Pfad, Blick voraus. Wie groß mag wohl die Chance sein, dass sie sich noch einmal umdreht, ihm noch einen Blick zuwirft? Fifty-fifty, sagt er zu sich selbst, so groß wie die Chance bei allem ist. Tu es, schau zurück, bitte.
Sie ist verschwunden.
Moor macht sich daran, einen neuen Joint zu bauen, ihm gelingt nur eine amateurhafte Tüte, die er mit frustrierten Zügen rauchen wird. Er schließt seinen Wagen, um Debbie zu besuchen, vier Minuten Fußweg, geballte Fäuste. Plötzliche Geräusche veranlassen ihn, sich umzusehen, nach links, nach rechts. Rascheln, ein knackender Zweig. Er wirft einen Blick auf die Banane: Fünf Uhr, wie spät ist es dann gleich wieder an der East Coast, in New York? Zu welcher Zeit wird Cat es erfahren, und wird ihre Reaktion der seinen ähneln?
Tausend andere
»Wanna order up some coffee?« Aidins verschlafene, krächzende Morgenstimme, die sich in ihren Ohren nie vollkommen echt anhört, so als handele es sich um die Parodie einer verschlafenen, krächzenden Morgenstimme. Eine gelungene Parodie, das allerdings.
Auf dem WC sitzend, die Unterhose zwischen den Knöcheln und die Badezimmertür halb offen, antwortet Cat zustimmend: gerne, mit Hafermilch, just a splash. Sie tupft sich mit WC-Papier trocken, steht auf und spült ab. Aidin hat drei Sorten Handseife, sie wählt das klassisch-runde, grüne Stück Seife. Der Spiegel über dem Waschbecken zeigt dünne Lippen, eine kräftige Nase, eine Narbe auf der Wange vom Rangeln mit Moor. Sie öffnet die Spiegeltür: Aidins Sporttabletten, seine Fatburner, sein Magnesium, sein Kreatin. Sie nimmt zwei Advils. Doch zu viel getrunken gestern, und sie muss nachher ins Institut, eine Verabredung im Lesesaal, dem sancta sanctorum.
»Your phone or mine?«, fragt Aidin der Form halber, als sie wieder im Schlafzimmer ist. Er sitzt in HH-Boxershorts auf seinem großen Himmelbett mit Bronzesäulen, das vor dem Fenster steht, welches die gesamte Ostseite seines Apartments einnimmt. Er greift nach seinem Smartphone, bedient die dunkelbraunen Vorhänge, die sich nun öffnen und das Sonnenlicht ins Zimmer strömen lassen. Das Licht ist anders als in den Niederlanden, kräftiger, heller, weniger gestreut.
»Mein Akku ist leer«, schwindelt sie. Ihr Telefon ist meistens ausgeschaltet, auch jetzt. Sie nimmt die zwei Flaschen, die sie gestern getrunken haben, vom Tisch, Barolos mit barocken Etiketten, und stellt sie an die Wohnungstür. Er deutet in Richtung der bare brick wall, auf den großen Tisch im industrial style, auf dem mindestens vier Ladegeräte liegen, sowohl für Android als auch für iPhone, nie muss jemand ohne sein.
»Nein, nicht nötig.« Es ist acht Uhr. Der Bürgersteig, soeben mit Seifenlauge aus Eimern gespült, dampft noch. Durchs Fenster sieht sie, wie die Upper West Side zum Leben erwacht, das Lincoln-Center-Viertel, wo man an stillen Tagen, wenn man an der Juilliard vorbeigeht, Fetzen von Vivaldi aufschnappen kann, flüchtige Ballettsilhouetten springen an den Fenstern entlang. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite leuchten im Treppenhaus die Lampen auf, Leute hocken sich hin für ihr morning yoga, die ersten Uber des Tages fahren vor, Reinigungspersonal schließt die großen Glastüren der Weinhandlungen und Kleiderboutiquen auf. Rechts schimmert die grüne Glut des Central Parks, wo Aidin und sie manchmal am Wochenende spazieren gehen, auf Eichhörnchen zeigen und Modellsegelboote beobachten, die über den Weiher gleiten, wenn Wind aufkommt. Erinnerungen, die sie sich gerne ins Gedächtnis ruft, vorzugsweise nur für sich allein, ohne ihn daran teilhaben zu lassen. Ehe man es sich versieht, fängt er an, diese Aktivitäten als »Gewohnheiten« oder schlimmer noch als »Traditionen« zu betrachten. Worte, die für sie die gleiche Bedeutung haben wie »Erwartungen« und »Verpflichtungen«.
Kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag ist sie nach New York gekommen, sie hat diesen Schritt allein gemacht, ohne ihre Familie. Obwohl sie nun schon seit drei Jahren hier wohnt, ist New York für sie immer noch die Stadt, die Anonymität erzwingt. Man kann dort leben, die Parks, die Geschäfte und Theater besuchen, aber man wird sich niemals ganz gesehen fühlen. Es ist gerade diese Nicht-Wechselseitigkeit, die sie immer angesprochen hat, dieses Gnadenlose. An einem ihrer ersten Tage in der Stadt notierte sie drei Ziele: 1) Lernen, Tequila zu trinken. 2) Nicht mehr mit Büchern angeben, die ich nicht gelesen habe. 3) Etwas finden, worin ich so aufgehe, dass es sich anfühlt, als würde ich nicht mehr existieren.
Weil er sie darum bittet, kuschelt sie sich wieder zu ihm unter die Laken, die von ihren Körpern noch warm sind. Sie schlafen mit einander zugekehrten Rücken, sodass ihr Blickfeld nicht verdeckt ist und sie ihre Gedanken schweifen lassen kann. In den wenigen Minuten, bevor sie einschläft, hat sie immer das Gefühl zu zerfallen, in Gedanken und Halbschlafträumen, als würde sie unstofflich werden.
»Das könnte ich nie«, sagt Aidin, »so selten auf mein Smartphone schauen.« Er öffnet seine neueste Kaffee-App.
»Ich würde nur Spiele machen, in denen es darum geht, welcher Käse ich bin.« Das wäre übrigens Comté, meint sie selbst, augenscheinlich neutral, aber manchmal ziemlich scharf und hart – natürlich Comté.
»Du bist Ghoeda. My own slice of Ghoeda cheese.« Mit ernster Miene: »Ich muss mein Telefon immer bei mir haben, aufgeladen und einsatzbereit.«
»Was bedeutet müssen denn?«, fragt sie. »Und man spricht das Wort Gouda. Ggg. Ein hartes, kehliges G.«
»Du mit deinen schwierigen Fragen.« Er wagt sich an ein im Rachen gekratztes G, fängt an zu husten und schüttelt den Kopf: lächerliche Sprache, nette Menschen.
»Hast du nichts im Haus?«, fragt sie mit ihrem breiten amerikanischen Akzent, der in ihren Ohren wie original New Yorker Idiom klingt, bei dem jedoch eingeborene New Yorker, vor allem wegen des zungenbetonten L, das sie hat, denken: Das ist eine, die kommt aus Wisconsin, dem Cheese State. »Soll ich vielleicht Kaffee machen?« Mehr noch als den Geschmack von Kaffee liebt sie dessen Duft; die bitteren Röstaromen, die ihr überall auf der Welt beim Aufwachen in die Nase steigen, die Vertreibung der Nacht zum Nutzen des Tages. »Es muss nicht der beste Kaffee der Stadt sein.«
Gesicht wieder zu seinem Telefon gewandt. »Du solltest nicht schon morgens mit Kompromissen beginnen.«
Sie betrachtet Aidin, kühl, wie eine Außenstehende. Es gefällt ihr, dass er drei Jahre älter ist als sie, so bleibt sie alterslos. Für ihn schwebt sie in der ewigen Alterskategorie »jünger als ich«. Kräftige Kiefer, Rudererschultern und eine schöne, sanfte Haut. Wenn sie ins Restaurant gehen, fängt er mehr Blicke als sie. Sie weiß, dass sie in diese Blicke verliebter ist als in ihn. Er ist der erste Mann, mit dem sie zusammen ist, dem sie ohne Widerwillen einen bläst. Der erste Mann auch, von dem sie sich unter gar keinen Umständen lecken lässt. Tatsachen, die viel oder überhaupt nichts sagen. Sie hat immer schon ein schwieriges, ambivalentes Verhältnis zu Sex gehabt. Sie kommt nur dann zum Orgasmus, wenn sie sich einen anderen Geliebten an ihrer Seite oder in sich vorstellt, einen anderen Körper, nicht unbedingt hübscher oder besser, nur anders. Am liebsten bedient sie sich dabei aus Erinnerungen, die schon ein paar Jahre alt sind und sich bereits ein wenig mit der Fantasie vermischt haben. Manchmal denkt sie: Ich bin routiniert beim Sex. Und manchmal denkt sie: Eigentlich bin ich noch nie wirklich mit jemandem im Bett gewesen.
»Ist was?«
»Nein, alles gut«, erwidert sie.
»So, bestellt. Zehn Minuten. Fucking leckere neue Bohnen bei Gregorys. Aus Südkolumbien. Crazy.« Mit dem flaumig behaarten Rücken seiner Hand streichelt er ihre Wange.
Sie windet sich aus seiner Umarmung und sucht ihre Kleider beisammen. »Nein, jetzt nicht. Kaffee trinke ich ein anderes Mal. Ich muss noch in meine Wohnung, ein paar Sachen holen.«
»Lässt du mich allein?« Er nimmt einen schneeweißen Pullover vom Boden, auf der Brust ein viereckiger Rahmen mit Notorius BIG darin, der eine dicke Zigarre raucht. Den Pullover fand sie bereits am Vortag nicht besonders toll.
»Wie sollte ich ohne meine Bücher und Legal Pads arbeiten können? Der Essay, du erinnerst dich? Wenn daraus nichts wird, habe ich das ganze Jahr verschwendet.« Eine plumpe Ausrede, aber er nimmt sie ihr ab. Es handelt sich um eine sehr ambitionierte Abschlussarbeit über »die freudsche Sichtweise auf den Zerfall der nuclear family«, der standardisierten Kernfamilie, die sie schreiben muss, wenn sie im Januar wieder an die Uni zurückkehren will. Mit diesem Thema konnte sie ihren Dozenten an der NYU (mit der allergrößten Mühe) vom Nutzen des Minor überzeugen, den sie unbedingt absolvieren wollte: zwei Semester am New York Psychoanalytic Society & Institute, unter der Leitung des hochangesehenen Professor Goldblum. Cat hat sich immer schon für erfolgreiche Familien, für Scheidungen und dafür, warum die eine Familie zerbricht und die andere nicht, interessiert, und das war ihre Chance. Für den Freud-Essay, fünftausend Wörter mit allem Drum und Dran, benötigt sie vermutlich sieben Arbeitstage à zehn Stunden, inklusive Pausen von fünfzehn bis dreißig Minuten, Kurzspaziergängen und kalten Duschen. Sie weiß intuitiv, wie lange sie für eine Arbeit braucht, ihre Schätzung stimmt immer, sie hat noch nie einen Abgabetermin verpasst. Die Erfahrung hat sie gelehrt, dass sie die Arbeit am besten auf drei Orte verteilt: zu Hause (wenn sie sich nicht recht wohl fühlt), im Institut (wenn sie Bedarf an strengen Blicken hat) und in einem Diner (wenn sie endlose coffee-refills benötigt). Doch diesmal gibt es zwei miteinander zusammenhängende Faktoren, die das Ganze verkomplizieren.
Zum einen hat Freud in seiner gesamten Metapsychologie kaum etwas direkt über die Kernfamilie gesagt. Ja, er hatte den Nucleus Familie einmal wohlwollend als den ewigen Hintergrund bezeichnet, vor dem sich alle Veränderungen in der Familie vollzögen, hatte aber auch später in seiner Laufbahn die Ansicht vertreten, die klassische Familienstruktur sei die Ursache von allerlei Neurosen. Und der Ausdruck »nuclear family« war eine spätere Erfindung von Soziologen, und ihren gesellschaftlichen Zusammenbruch hatte er nicht mehr erlebt.
Dies führte zum zweiten Problem: Cat hat keinen eigenen Standpunkt, keine originelle Idee, keine Meinung, um die sie ihren Essay herumkonstruieren kann. Goldblum hatte sie auf die möglichen praktischen Probleme hingewiesen, die sie sich mit diesem Thema aufhalsen würde, doch Cat fasste diese Warnung als Ermunterung auf, als hätte der Professor eigentlich gesagt: Dies Thema ist dein Prüfstein, dies ist die Lackmusprobe.
Also kämpft Cat sich durch zahllose Texte von Freud und sucht nach Passagen, die man als Vorausdeutungen oder Vorhersagen über das Schicksal der Kernfamilie interpretieren könnte. Sie kämpft, kommt aber vorerst nicht weiter. Der Abgabetermin ist in drei Wochen, und von der Arbeit hängt mehr ab, als sie sich eingesteht. Wenn sie ihr Minor nicht erfolgreich abschließt, erfüllt sie offiziell nicht mehr die Bedingungen für ihr F-Visum und kann kurzerhand aus den Staaten ausgewiesen werden. Gegen die Rigidität der Einwanderungsbehörde kann keine Universität etwas ausrichten. Doch an eine solche Kaskade von katastrophalen Folgen will sie lieber erst gar nicht denken. Sie schafft das schon.
»Freud, Freud, Freud«, sagt Aidin. »Weißt du, wie ich über Freud denke?«
»Dass er ein schmieriger, alter Mann war, der es liebte, sich vorzustellen, dass alle Töchter mit ihrem Vater ficken wollen, und der sich dazu eine komplette Theorie ausgedacht hat.«
»Woher weißt du das?«
»Weil ich eine enorm große Auffassungsgabe habe. Du hast es mindestens sieben Mal dargelegt, einmal sogar zwei Mal am selben Abend. Sei froh, dass ich dich nicht ernst nehme, denn dann müsste ich dir sagen, dass du von vorne bis hinten nichts kapiert hast.«
Er sieht sie forschend an. »Sehen wir uns heute Abend? Ziehst du deine schönsten Sachen an?«
»Ich tu alles für den richtigen Cocktail«, antwortet sie mit einem Lächeln, das nahezu jeder andere als falsch erkennen würde, nicht aber Aidin. »The Smith?« Er wird sie einladen. Solange er bezahlt, können ihre Kreditkarten nie ihren Dienst verweigern, und die Studienschulden haben keine Macht über sie. Eine Viertelstunde später geht sie durch die Eingangshalle, nickt dem Pförtner zu und tritt in den New Yorker Montagmorgen.
Gibt es etwas Auffälliges an diesem Morgen, dem ersten vaterlosen in ihrem Leben? Hat sie ein seltsames, unheimliches Vorgefühl? Wird sie sich in irgendeinem Moment einer Abwesenheit bewusst? Ist da eine diffuse Stimmung, auf die ihr Ego projektieren kann, dass sie etwas geahnt hat? Nein, nein, nein und nein. In dem Augenblick, als sie den Park auf ihrer Seite verlässt, denkt sie sogar: Vielleicht sollte ich Papa mal wieder anrufen. Aber sie tut es nicht. Sie wird es nun für immer nicht getan haben.
Intermezzo
Wieso sollte es übrigens »ironisch« sein, dass Oskar den Herzinfarkt auf dem Flughafen hatte, wie Moor während des Spaziergangs mit seiner Schwester Tessel meinte? Was war das denn für eine Bemerkung?
Ich, der Erzähler, bin der Ansicht, dass man Moors Aussage nicht losgelöst von dem starken, sehr stressigen Gefühl betrachten kann, das Oskar stets überkam, sobald er Schiphol betrat. Nämlich dass all die vielen Tausend Piloten, Stewardessen und Passagiere, die dort herumgingen, seiner Familie etwas schuldig waren, vielleicht einen Sitz mit zusätzlicher Beinfreiheit, eine kostenlose Tasse Kaffee oder möglicherweise auch eine kleine Tüte Minibrezel. Und um dieses Gefühl einigermaßen verstehen zu können, ist Oskars Urgroßvater (der folglich der Ururgroßvater von Tessel, Moor und Cat ist) von Bedeutung, ein gewisser Großindustrieller namens Sywert Berend van Bohemen,. Man kann die Gegenwart nun einmal nicht ohne die Vergangenheit verstehen, und die Vergangenheit kann man nicht verstehen, ohne auf eine noch weiter zurückliegende Vergangenheit zurückzugreifen (auch wenn diese außerhalb unseres Blickfeldes liegt), auf nicht wahrgenommene Auftakte, die damals niemand als solche empfand, weil der Rest der Geschichte noch nicht stattgefunden hatte.
Am 9. Mai 1909 bestellte dieser Sywert Berend – ein Patriarch vom alten Schlag mit einer markanten Nase, einem schneeweißen Bart und einem großen, schwarzen Rubenshut, den er, wie man hört, auch im Bett aufbehielt – seine zwei Töchter und seinen Sohn in sein Landhaus. Neununddreißig Jahre zuvor, im Jahr 1870 also, hatte Sywert Berend sich als beginnender Zuckerfabrikant im Nordbrabanter Straßendorf Leur niedergelassen. Dort lagen die Zuckerrüben in gigantischen Haufen auf den Feldern, mit Körben wurden sie ins Lager gebracht, wo sie von den Blättern befreit, gewaschen und zu einem Brei aus Fasern und Saft geraspelt wurden, dessen beißender Geruch durch die ganze Gegend waberte. Und aus dem Zucker war ein Vermögen erwachsen, das Sywert Berend um die Jahrhundertwende in die Lage versetzte, als er als Erster in den Niederlanden ein Telefon haben wollte, ein Postamt zu bauen, um so dessen Installation zu beschleunigen. Er investierte weiter in der Region, ließ verwinkelte Häuschen für die Arbeiter bauen und bezahlte die Restauratoren, die sich der Albertuskirche in Oosterhout erbarmten, das Gotteshaus, das seine Nachkommen, Oskar und seine Eltern, um genau zu sein, später allwöchentlich besuchen sollten, wie sich später noch zeigen wird.
Bei dem Gespräch im herrschaftlichen, mit Eichenholz getäfelten Salon teilte Sywert Berend seinen Töchtern und seinem Sohn und Erben Hendrikus Jan mit, dass er, anlässlich des vierzigjährigen Bestehens seines Unternehmens, der Bevölkerung von Leur »etwas Besonderes« bieten wolle. In den Jahren davor hatte er bei dem Versuch zu beweisen, dass seine Familie adliger Herkunft war, weder Kosten noch Mühen gescheut. Er hatte einen lokalen Hobbyhistoriker gefunden, der nichts lieber tat, als bei Kerzenlicht vergilbte, kaum entzifferbare und von allen für vollkommen unbedeutend erachtete Stammbäume zu studieren, und der bereit war zu erklären, dass Sywert Berend von Karl dem Großen abstammte. Für diese großartige Entdeckung erhielt der Historiker natürlich eine großzügige Belohnung. Nun will es der Zufall, dass der Hobbyhistoriker neben seiner Leidenschaft, bei Kerzenlicht vergilbte, kaum entzifferbare und von allen für vollkommen unbedeutend erachtete Stammbäume zu studieren, auch eine zweite hatte: sich im Gasthaus De Bosaap