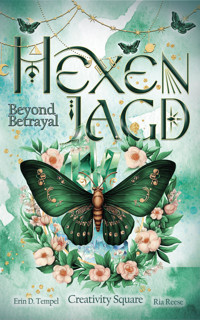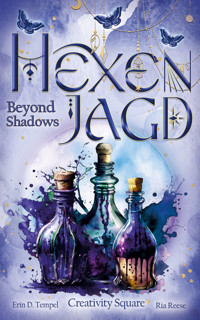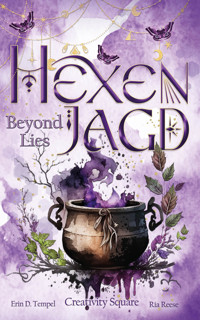
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: im Selbstverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wenn die Ältesten sie loswerden wollen, hätten sie sie auch gleich umbringen können. Aber dann hätten sie weniger zu lachen. Jamie ist so gut wie tot. Sie soll sich an den schwulen Medizinstudenten Jay heranmachen, denn dieser ist für ihren grausamen Zirkel von unfassbarem Wert – ist sein Herz erst einmal gebrochen. Ein aussichtsloser Auftrag. Nicht nur, dass ihre plumpen Flirtversuche wie erwartet an Jay abprallen, bald kann sie sich nicht mehr vor dessen charmanten Bruder Mikael retten. Die wachsenden Gefühle für Mika werfen sie völlig aus der Bahn und die Schuldgefühle gegenüber Jay lassen sie an allem zweifeln, was sie je gelernt hat. Der Auftrag droht im Chaos zu versinken, doch Jamie muss einen Weg finden ihn zu erfüllen, wenn sie keine Holzkiste beziehen will. Wen will sie retten? Jay oder sich selbst? Der spannende Auftakt der Hexenjagd-Serie Ein Muss für jeden der Magie, Slowburn und Found Family liebt! . Hexenjagd ist eine humorvolle Geschichte, die sehr viel Wert auf die Entwicklung ihrer Charaktere legt. Außerdem ist sie queer und hat einen neurodiversen Hauptcharakter. - Eine etwas andere Romantasy. . Lass dich entführen in ein magisches London!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Creativity Square /
Erin D. Tempel & Ria Reese
Hexenjagd Band I - Beyond Lies
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe Oktober 2023
©Creativity Square GbR / Erin D. Tempel & Ria Reese
Umschlaggestaltung: Erin D. Tempel
Satz: Ria Reese
Lektorat: Merle Föhr
Korrektorat: Aurora Flemming
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. Dies ist eine fiktive Geschichte. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen, Orten und sonstigen Begebenheiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Impressum
Creativity Square GbR
Erin D. Tempel & Ria Reese
Stuttgarter Straße 106
70736 Fellbach
Independently Published
E-Mail: [email protected]
Web: creativitysquarenovels.com
Für alle, die schon seit Jahren mit uns wachsen
Content Note
Bitte beachten!
Auch in diesem Buch kommen wieder einige Themen auf, die für den ein oder anderen unangenehm oder sogar triggernd sein könnten. Das ist keine Schande, pass lieber einmal zu viel auf dich auf, als einmal zu wenig. Folgende Themen kommen im Buch vor:
Kindsmisshandlung & Waisen (Vergangenheit)AngstzuständeManipulation emotionale und physische Gewalt Druck durch höhere Machtstruksturenmilde HorrorelementeBedrohung und ErpressungAndrohung von Mord und TodVerlust eines Familienmitglieds (Vergangenheit)MobbingSollte eines dieser Themen triggernd für dich sein, dann solltest du das Buch mit Vorsicht lesen. Es ist wichtig seine Grenzen zu kennen und gut auf sich aufzupassen.
Zudem beinhaltet das Buch folgende Thematiken:
queere Charaktere & Beziehungen ein neurodiverser HauptcharakterHexenkunst & Auszüge aus deren PraktikenSlowburn RomanceDiese Themen sind vielleicht nicht triggernd, aber sollten sie auf Missfallen stoßen ist das Buch nichts für dich. Das wäre völlig okay. In dem Fall gibt es da draußen noch eine Menge anderer phänomenaler Bücher, die es zu lesen gilt.
Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als allen, die sich das Buch nun vornehmen, viel Spaß beim Lesen zu wünschen. Lass uns gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Besuch dazu einfach unsere Social Media oder schreib uns eine E-Mail an [email protected].
Eine Rezension wäre eine große Unterstützung für uns und danke fürs Lesen!
Adrian
Obwohl es stickig wurde, wollte ich nicht nachgeben und unter der Decke hervorkommen. Mama hatte gesagt, wenn man sich dort versteckte, würden einen die Monster nicht finden. Jetzt hatte ich Mama schon eine Woche nicht gesehen. Vielleicht sie sich auch verstecken sollen?
Ich war bei ihrem Bruder Frank, den ich nicht besonders mochte. Ich wollte endlich zurück zu meiner Mama, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das bald passieren würde. Immer, wenn ich danach fragte, bekam ich keine Antwort.
Ob die Männer in Schwarz sie hatten?
Würde sie genauso nicht wieder auftauchen wie Papa? Er war schon vor Monaten verschwunden. Mama hatte viel geweint zu der Zeit. Er hat uns beschützt und es nicht geschafft, hatte sie gesagt. Ich vermisste ihn so sehr und wusste nicht, was ich tun sollte, wenn ich sie auch noch vermissen müsste. Es war warm, doch ich zitterte trotzdem.
Ich hörte die alten Dielen knarren und machte mich noch kleiner. So würde ich nie einschlafen. Mein Onkel sagte, das Haus wäre alt. Die Geräusche wären ganz normal. Doch ich war mir da nicht so sicher. Allerdings traute ich mich auch nicht, unters Bett zu schauen, um zu sehen, wer von uns recht hatte.
Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und schlug die Decke zurück. Angestrengt schnappte ich nach Luft. Mein Blick wanderte durch das Zimmer. Der Mond schien durch die dünnen Vorhänge und ließ lange Schatten über das Parkett kriechen. Ich meinte, ein Kratzen zu hören, direkt unter meinem Bett und erschauderte. Früher hatte ich bei meinen Eltern schlafen können, wenn ich mich gruselte, doch jetzt musste ich wohl ein großer Junge sein.
Wieder hörte ich das Kratzen und ein Wimmern entfloh meinen Lippen, als ich an das Bettende flüchtete. Die Dunkelheit um mich herum wirkte bedrohlich. Wieder dachte ich an meine Mutter und fast war mir, als könnte ich spüren, wie sie mir durch die Haare fuhr.
„Adrian, du brauchst keine Angst vor der Dunkelheit zu haben, du hast das Licht“, hatte sie immer gesagt, wenn ich Angst bekommen hatte und mich in ihren Armen gewiegt.
Richtig. Das Licht.
Ich atmete tief durch und konzentrierte mich einen Moment auf das Licht in meinem Inneren, dann ließ ich es aus den Fingern fließen. Mit einem sanften ‚Plopp‘ erschien eine handgroße, sanft glimmende Kugel und schwebte vor meinem Gesicht. Wie eine Seifenblase, nur aus Licht. Ich ließ noch zwei auftauchen und sah mich wieder um. Jetzt, wo Licht das Zimmer erhellte, war es weniger gruselig. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass etwas unter meinem Bett lauerte. Der Gedanke erdrückte mich.
Schließlich kratzte ich allen Mut zusammen und sprang aus dem Bett, so weit ich konnte. Was auch immer dort lauerte, konnte so hoffentlich nicht nach meinen Füßen greifen. Ich huschte zur Tür und schlüpfte in den Flur. Meine Lichtkugeln folgten mir. Kaum waren sie durch die Tür, schlug ich sie zu und drehte den schweren eisernen Schlüssel, der im Schloss steckte.
Meine Füße wurden zu Eisklötzen. Schnell ging ich auf den Läufer, der in der Mitte des Flurs ausgebreitet war. Das fühlte sich angenehmer an als das kalte Holz. Ich lief rüber zu Onkel Franks Zimmer und warf einen Blick durch die Tür. Zu meinem Erstaunen war er nicht im Bett. War es nicht so spät, wie ich dachte? Oder war er genauso verschwunden wie meine Eltern?
Ich bekam einen Kloß im Hals und beschloss, nach meiner Schwester zu sehen. Ich musste sichergehen, dass es ihr gutging, schließlich war ich ihr großer Bruder. Sollte mein Onkel auch weg sein, war es meine Aufgabe, sie zu beschützen. Vorsichtig schloss ich die Tür und schlich mich rüber zu Adas Zimmer.
„Ihr bleibt hier“, beschwor ich die Kugeln und sie gehorchten. Ich wollte Ada nicht aus Versehen wecken. Ich drückte die Klinke runter und tippelte in den Raum. Hoffentlich hatte Ada nicht auch ein Monster unter ihrer Krippe. Gut, dass ich meins in meinem Zimmer eingesperrt hatte.
Ich trat an ihr Bettchen heran, doch als ich sah, dass es leer war, gefror ich in der Bewegung.
Wo war Ada?
Nun ließ sich der Kloß meinem Hals nicht mehr ignorieren. Ich hastete wieder zur Tür. Ich musste Onkel Frank finden. Angst breitete sich in mir aus und ließ meine Beine schwer werden, doch ich lief weiter, begleitet von meinen Kugeln. Ich eilte die Treppe runter und schlug den Weg zum Arbeitszimmer ein. Bitte. Er musste dort sein. Mit Ada auf seinem Schoß.Tatsächlich konnte ich sehen, dass die Tür angelehnt war. Aus dem Spalt drang Licht. Ich beschleunigte meine Schritte, bereit in das Büro reinzuplatzen, doch eine zischende Stimme ließ mich stoppen.
„Das ist grausam!“
Es war die Stimme einer Frau, die ich nicht kannte. Vorsichtig warf ich einen Blick durch den Spalt. Sie war blond und hatte ein rotes Kleid an. Sie erinnerte mich an eine Lady aus einem Film, den ich mit Papa angeschaut hatte. Darin ging es um die Oper. Die Dame sah aus wie eine Operndiva.
„Und es ist nicht grausam zuzusehen, wie immer mehr von uns sterben? Für was? Ein Kind?“ Ich hielt den Atem an und lehnte mich näher an den Spalt.
„Er ist nicht irgendein Kind, das weißt du genau.“
„Eben. Wenn sie ihn in die Finger bekommen, werden sie sich im besten Fall so sehr magisch an ihm bereichern, dass sie auch die nächsten 100 Jahre Theban in ihren Klauen halten können, und im schlimmsten Fall verwandeln sie ihn in ein Monster, dass sie benutzen, um sich den Rest der Welt zu krallen.“
„Trotzdem heißt das nicht, dass der Zweck alle Mittel heiligt.“ Die Frau warf ihre blonden Haare zurück und schenkte meinem Onkel einen giftigen Blick. Von wem sie wohl redeten?
Tief in mir wusste ich die Antwort. Doch ich wollte sie nicht wahrhaben. Denn dann war ich an allem schuld.
„Glaubst du das wirklich? Ich habe das nicht für mich getan.“
„Moment mal, habe?!“
Einen Augenblick herrschte Stille. „Sie haben den Köder geschluckt.“
„Den Köder?! Sie ist deine Nichte! Was würde Charlotte dazu sagen, wenn sie wüsste, dass sie dir die Kinder anvertraut hat, und du machst so was?!“ Die Frau wurde richtig laut, so sauer war sie.
„Charlotte ist tot. Sie hat zu nichts mehr eine Meinung.“
Es wurde dunkel um mich herum. Buchstäblich, denn meine Lichtblasen platzten zusammen mit der Hoffnung, Mama je wiederzusehen. Ich hatte es geahnt, aber es zu hören war etwas anderes. Meine Sicht wurde schwammig. Warum hatte Onkel Frank es mir nicht gesagt? Was sollte dieses ganze Gerede, dass Ada ein Köder wäre? Und für was? Suchten diese Männer in Schwarz wirklich nach mir? Aber warum? Ich war doch nur ein Junge! Wie sollte man aus mir ein Monster machen? Oder war ich schon eins, da wegen mir Menschen gestorben waren? Hatte ich Mama umgebracht?
„Für dich noch mal zum Mitschreiben, Nathalia: Sie hätten nie aufgehört zu suchen. Niemals. Sie wollten das Einhornkind und für die ist es auch kein Problem, dabei über unzählige Leichen zu steigen. Es war unser Glück, dass Charlotte und Steve ihre Kinder unter dem Radar gehalten haben. Alles, was diese Verbrecher wussten, war, dass sie das Kind der Harris’ suchen. Jetzt haben sie das Kind der Harris’, ohne zu wissen, dass sie ein Kind der Harris haben. Bevor sie bemerken, dass es das Falsche ist, werden Jahre vergehen, in denen wir Adrian verstecken können, damit sie ihn niemals finden werden. Ich habe dafür gesorgt, dass endlich Schluss ist! Sie denken, sie haben gewonnen, und das wird unser Überleben sichern!“
Mir war, als könnte ich meine Seele spüren und als würde ein Teil davon absplittern.
„Wir alle müssen Opfer bringen, selbst Adrian, auch, wenn er es nicht weiß!“
Nur, dass ich es wusste. Ich schluchzte und die Lady sah in meine Richtung. Also brachte es nichts mehr, sich zu verstecken. Ich schlüpfte in den Raum und sah meinen Onkel an.
„Wo ist Ada?“, wisperte ich.
Franks Augen weiteten sich einen Augenblick, als er mich da stehen sah. Dann seufzte er und rieb sich die Nasenwurzel. Er sah mit einem Mal viel älter aus, als er eigentlich war.
„Adrian, du verstehst das nicht …“
Doch ich hatte es sehr wohl verstanden. Er hatte es gut genug erklärt.
„Wo ist Ada?!“, fragte ich wieder und Tränen rannen heiß über meine Wangen. „Wie konntest du sie an die Männer in Schwarz geben?“ Sie konnte sich gar nicht wehren. Diese Menschen hatten Mama getötet und jetzt würden sie dasselbe mit Ada machen. Mama hatte gesagt, ihr Bruder würde uns beschützen, doch sie hatte sich getäuscht. Er hatte Ada nicht beschützt. Er hatte Mama angelogen. Er hatte sie verraten. Er hatte Ada verraten.
Mich verraten.
Der Gedanke löste etwas in mir aus. Ich zerriss innerlich. Mein Bauch wurde flau und mein Hals eng. Ich vergaß, wie man richtig atmete. Mein Körper wurde von Schluchzern geschüttelt.
„Sie ist doch noch so klein! Wir müssen sie beschützen. Wir müssen … wir dürfen nicht … ich will das nicht! Ich will das nicht!“
Ich schlug mir die Hände auf die Ohren, als könnte ich die Gedanken, dass das alles meine Schuld war, so verstummen lassen. Das Gefühl des Verrats bohrte sich weiter in mein Herz.
„Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht!“ Völlig verzweifelt brach dieser Satz immer wieder aus mir raus.
„Frank, er bricht, tu was!“
Er war plötzlich bei mir. Ich stolperte von ihm weg. Er war ein Verräter! Ich hätte viel besser auf Ada aufpassen müssen! Ich wollte ihn nicht mehr in meiner Nähe haben.
Doch er bekam mich am Arm zu fassen und zog mich zu sich. Dann nahm er mein Gesicht in seine Hände. Er zwang mich, ihn anzusehen.
„Ruhig, Adrian. Schau mir in die Augen. Hör mir zu. Du vergisst das, okay? Du musst das nicht wissen. Nichts davon ist je passiert. Es gibt keinen Grund sich aufzuregen oder verletzt zu sein. Vergiss es. Lass es los.“
Was? Nein, ich wollte nicht vergessen! Ich musste doch wissen, dass er … dass … ich wollte nicht vergessen. Da war was Wichtiges …
Ich zog an seinem Shirt und versuchte, mich von ihm zu lösen, aber er war stärker.
Er seufzte. „Am besten vergisst du alles. Neu anfangen ist viel leichter, wenn man gar nichts mehr weiß. Du musst nicht wissen, was vergangen ist, nur was in Zukunft kommt.“
Ich blinzelte. Was wollte dieser Mann von mir? Warum sagte er so komische Sachen?
Ich schlug um mich und strampelte mich aus seinem Griff frei. Dann flüchtete ich hinter einen Sessel, der vor einem Schreibtisch stand. Mein Blick floh durch den Raum und ich versuchte zu erfassen, wo ich hier war. Oder warum. Oder wie.
Doch die Personen im Zimmer kannte ich nicht. Wollte ich nicht …? Ich konnte mich nicht erinnern. Wo waren meine Eltern? Hatte ich überhaupt Eltern?
Ich erstarrte, als sich mir eine noch viel drängendere Frage stellte:
Wer war ich?
Jamie
Ich war dezent gestresst. Nur einen Hauch.
Mein Verstand verwandelte sich in eine gackernde Hyäne und ich war lediglich einen weiteren nervösen Gedanken davon entfernt, die Böden der etwa vier Meter hohen Bücherregale hochzukrabbeln.
Doch ich war kein Hexenbiest, bei denen das wenigstens schnell, zackig und gruselig aussah. Nein, ich war eine reguläre Hexe, ohne dämonische Anwandlungen und nicht mal im Reguläre-Hexe-Sein war ich besonders gut.
Dass ich da oben eine Antwort finden würde, war unwahrscheinlich, also konnte ich meine vergebliche Suche hier unten auf dem Boden der Tatsachen fortführen. Die lagen hier rum, man musste sie sich nur eingestehen.
Tatsache eins zum Beispiel: Ich würde sterben.
Wie sollte ich diese Aufgabe erfüllen, wenn ich nicht mal einen einfachen Lokalisierungszauber auf die Reihe bekam? Da stand einfach schon im Namen!
Ich irrte wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die altehrwürdige Saffargh, die Zentralbibliothek der Hexenschaft in Theban und meine einzige Freundin.
„Bitte, hilf mir! Du zierst dich doch sonst nicht“, wisperte ich flehend. Zunächst passierte gar nichts. Doch dann konnte ich das leise Summen ausmachen, welches ich immer hörte, wenn die Magie der Bibliothek Dinge in Bewegung brachte. Im nächsten Moment fiel ein Buch auf mich herab. Von ganz oben. Ich wich flink aus und schnaubte beleidigt. Unfassbar.
„Willst du mich erschlagen? Geht‘s noch?“
Das waren neue Allüren. Scheinbar war sie zornig. Was sollte ich machen? Ich wollte nicht sterben, also blieb mir nichts anderes übrig, als den Auftrag anzunehmen, meine Finger zu kreuzen und zu beten, dass ich erfolgreich sein würde. Egal, was es kostete.
Mit einem gestressten Schnauben hob ich das Buch auf. Es war ein Ratgeber: ‚Was tun, wenn der Friseur einen miesen Job gemacht hat?‘
„Ha, ha“, sagte ich, dann stopfte ich es zurück zwischen zwei andere Bücher. Geschafft lehnte ich mich mit der Stirn an die Rücken der in altes Leder eingebundenen Bücher und atmete durch. Der Geruch nach Pergament, der mich sonst wie ein Schlaflied beruhigte, reichte heute nicht aus, um meine Gedanken in geordnete Bahnen zu lenken.
Ich liebte die Bibliothek und dass sie sauer auf mich war, tat mir leid. Doch ich konnte im Moment auch nichts sagen, dass sie wieder beruhigen würde. Mein Blick wanderte zur Mitte der Bibliothek, von der aus verschiedene Gänge in unterschiedliche Abteilungen führten – und das auf 13 Etagen. Sich hier ohne Hilfe zurechtzufinden, brauchte Jahre. Das war auch der Grund, warum die Bücherrückgabe ein ruhiger Tornado war, der sanft von ganz unten bis oben hin wirbelte und in den man die Bücher einfach hineinstecke. Sie flogen dann von selbst an die richtige Stelle. Die Saffargh wusste, wo sie hingehörten.
Es hatte massive Vorteile, wenn die Bibliothek einen gernhatte, denn dann musste man sie nur fragen und sie holte alles heran, was sie hatte. Ich hatte bisher nie erlebt, dass sie ein Buch nicht auf Lager gehabt hätte. Oder dass sie meine Fragen ignorierte. Diese Bücher waren zum Teil seit Jahrhunderten hier. Doch sie teilten ihre Geheimnisse nicht mit jedem und heute offenbar auch nicht mit mir.
Ein aggressives Räuspern ließ mich aufschrecken. Was ebenfalls schon seit Jahrhunderten hier sein musste, war bösen Zungen zufolge Rosamunde.
Ich richtete mich erschrocken auf und trat einen halben Schritt von dem Regal weg, an dem ich gelehnt hatte. Doch das schien ihr nicht zu reichen. Sie durchbohrte mich mit ihren von Falten umgebenen Augen.
„Stell dich gerade hin und lass deine ölige Stirn von den Büchern, Junge!“, fuhr sie mich an. Ich lächelte. Immerhin das hatte funktioniert. Sie hielt mich für einen Jungen.
Das war wichtig für meinen Auftrag, ich musste als Mann durchgehen, auch wenn ich keiner war. Meine Aufmachung reichte, um Rosamunde zu täuschen. Wenn auch nur für einen Augenblick, denn dann sah sie mir in die Augen und erkannte mich.
„Was ist mit deinen Haaren passiert? Das ist eine Jungenfrisur!“ Das verurteilte sie anscheinend sehr. Wahrscheinlich waren die langen Haare das Einzige gewesen, was sie an mir halbwegs respektiert hatte. Jetzt hatte sie nicht mehr als Verachtung im Blick. Sie schob ihre Brille, die an einem Brillenband befestigt war, höher auf ihre Nase, und die Falten um ihre Augen herum wurden tiefer.
„Ist egal. Ich will es gar nicht wissen. Sieh zu, dass du vernünftig mit den Büchern umgehst, Amethyst.“
„Ja, Ma’am“, murmelte ich, denn ich würde mich sicher nicht mit der Bibliothekarin anlegen. Dabei war sie selbst nur ein Halbedelstein. Ein Jaspis. Das passte zu ihr. Willensstärke und Umsetzungskraft. Nur wo ihre Lebensfreude hin war, wollte ich gern wissen. Wahrscheinlich war der Dutt auf ihrem Kopf zu fest gebunden und deswegen war darin kein Raum für Freude.
Ich schimpfte innerlich mit mir selbst. Vielleicht hatte sie auch einen Grund. Ob ihr Zirkel sie ebenfalls unter Druck setzte? Hatte sie überhaupt einen, oder hatte sie alle anderen überlebt, weil sie zu stur war, abzutreten? Was es auch war, sie schien einsam zu sein und das konnte ich nachfühlen. Dennoch nahm ich mir vor, dass ich, falls ich so alt werden sollte wie sie, nicht so fies werden wollte wie Rosamunde es war.
Ich sah ihr nach. Nur noch ein Hauch Omaparfüm in der Luft deutete darauf hin, dass sie mit mir gesprochen hatte. Um Hilfe brauchte ich sie nicht fragen. Sie würde sich nie dazu herablassen. Es sei denn, ich wachte eines Tages auf und meine Augen wiesen mich als etwas Einflussreicheres als einen Amethyst aus.
Wenn man einer der Großen Fünf war, dann kroch sie einem in den Hintern. Egal, ob die Saffargh ebenfalls der Meinung war, dass sie dies verdienten. Echte Edelsteine waren mit enormer Macht verbunden. Aber sollte es nicht auch Respekt einbringen, ein Kind der Saffargh zu sein? Ich schätzte mich glücklich, dass ich dazuzählte, denn ohne sie war ich aufgeschmissen.
„Saffargh … bitte …“
Doch sie erhörte mich heute nicht. So wie Rosamunde sonst immer wegen des verdammten Steins. Ich wünschte, ich hätte die Edelsteinrune nie bekommen. Jedes Mal, wenn ich die Tätowierung auf meinem linken Oberarm betrachtete, erinnerte ich mich an Norma. Ich vermisste sie schmerzlich.
Hätte ich einen Wunsch frei, dann würde ich sie mir zurückwünschen und mit ihr abhauen. Doch ich war nicht bei ‚Wünsch-dir-was‘. Alles, was mir blieb, war den Fluch an Auftrag zu erfüllen. Dazu brauchte ich Informationen über Themen, die ich nicht verstand und um die ich mich bisher nie geschert hatte.
Ich musste herausfinden, wie man ein Herz brach.
Jay
Das rhythmische Piepen des Monitors war das einzige Geräusch, das im Moment zu hören war. Für den Augenblick war ich froh darum. Wenn Susann mir weiter mein Ohr abkaute, würde es bald abfallen. Also hatte ich mich freiwillig bereit erklärt, die nächste Check-up-Runde zu übernehmen.
Gerade war ich im Zimmer von Mrs. Buckbird. Die alte Dame war am Nachmittag mit Herzbeschwerden eingeliefert worden, doch jetzt schlug ihr Herz ruhig und kräftig, genauso wie es sollte.
Ich machte ein paar Vermerke auf dem Patientenbogen, dann verließ ich das Zimmer auf leisen Sohlen wieder. Wir hatten 02:37 Uhr. Die Nachtschicht würde bis 6:30 Uhr gehen, dementsprechend musste ich noch vier Stunden durchhalten. Vier Stunden Susann-Gesabbel. Vielleicht sollte ich mich nach der Runde runter in die Notaufnahme schleichen.
„Mr. O’Ceallaigh?“
Ich gefror. Ach, scheiße, das würde wieder Fragen geben.
„Was machen Sie denn heute hier?“
Ja. Diese zum Beispiel. Ich drehte mich um und schenkte Dr. Benett, einer unserer Chefärzte, ein möglichst unschuldiges Lächeln.
„Ich habe … eine Schicht getauscht?“
„Warum kann ich mir genau denken, mit wem?“ Er klang streng, doch ich wusste, dass sein Missfallen nicht mir galt. Zumindest nicht hauptsächlich.
Ich seufzte und rieb mir den Nacken.
„Ich hatte wirklich nichts weiter vor und ich kann Nachtschichten auch besser ab als er. Es ist schon okay, Dr. Benett.“
Ich mochte Dr. Benett. Ich bewunderte ihn sogar. Er war ein großartiger, kompetenter Arzt. Doch als er mir angeboten hatte, während des Praktikums mein Mentor zu sein, hatte ich abgelehnt. Ich konnte mir nicht sicher sein, ob er es nur machte, weil ihn der eine Tag, an dem ich die Kontrolle verloren und er die Folgen davon mitbekommen hatte, nicht losließ.
„Sie sind zu nett, Mr. O’Ceallaigh. Sie können sich nicht immer so rumschubsen lassen. Es ist egal, ob sie heute nichts weiter vorhatten. Mr. Sinclair hat sicher auch nichts Wichtiges vor, er hatte nur keinen Bock, am Wochenende hierherzukommen. Also nehmen Sie es ihm nicht ab, sondern machen Sie frei, wenn ich es Ihnen eintrage. Verstanden?“
Ich wich seinem bohrenden Blick aus und starrte auf ein Plakat, das die Besucher des Krankenhauses daran erinnerte, sich die Hände zu desinfizieren.
„Ja, Sir.“
„Kein Getausche mehr mit Mr. Sinclair.“
„Ja, Sir.“
Für einen Moment herrschte Stille zwischen uns beiden.
„Und wie läuft es mit Ms. Summer?” Ich konnte die Belustigung in seiner Stimme hören. Der Standpaukenpart war vorbei, also gönnte ich es mir, mein Pokerface fallen zu lassen und betont angestrengt zu schnauben.
„Sir, wenn sie so weitermacht, lande ich unten in der Notaufnahme. Aber nicht, um zu helfen, sondern weil meine Ohren bluten.“ Es war nicht ihre Schuld. Die Frau war einfach kommunikativ. Sie konnte nichts dafür, dass ich nach drei Sätzen meine kommunikativen Kompetenzen aufgebraucht hatte.
Der Arzt prustete. „Na, das wollen wir doch nicht. Wenn Sie möchten, können Sie ihr sagen, dass ich Sie unten in der Notaufnahme brauche. Beenden Sie Ihre Runde hier und kommen Sie dann runter.“
Ich lächelte dankbar. Ja, wegen des Vorfalls damals mochte ich auf der Hut sein, wenn es um Dr. Benett ging, doch er verfehlte nie, mich vor extrovertierten Nachtkrankenschwestern zu retten.
Ich beendete meine Runde, gab die Daten bei Susann ab und ging in die Notaufnahme. Auch diese war nachts ruhiger, aber allemal spannender, als im Schwesternzimmer darauf zu warten, dass etwas passierte. Außerdem kannte ich die Leute hier unten.
Ich hatte den Platz an der UCL nicht sofort bekommen und die Wartezeit hatte ich damit verbracht, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter zu machen. Dementsprechend war ich in der Notaufnahme quasi zu Hause. Als es darum ging, einen Praktikumsplatz im Rahmen des Studiums zu finden, hatte ich nicht gezögert, mich wieder hier zu melden.
Ich warf einen Blick in den Pausenraum und entdeckte bekannte Gesichter. Darren und Bernard hatte ich seit Ende meiner Ausbildung nicht mehr gesehen. Sie bemerkten mich, als ich auf ihren Tisch zuhielt. Ihre Mienen hellten sich auf.
„Unser verlorener Sohn!”, rief Darren aus und wischte sich eine imaginäre Träne weg. Ich lachte nur und klopfte locker auf ihren Tisch.
„Ich habe nicht viel Zeit, ich helfe bei Dr. Benett aus. Aber ich wollte trotzdem sehen, ob ich euch hier erwische. Wie lange habt ihr noch Pause?“
„Noch zehn Minuten. Danach geht es daran, den Wagen auszuwischen. Er ist so viel schlechter organisiert, seit wir dich nicht mehr haben. Wie geht‘s dir? Läuft das Studium gut?“, fragte mich Bernard.
„Ich komme dank meiner Vorkenntnisse gut mit und generell macht mir das Studium viel Spaß. Ich bin echt glücklich damit. Auch wenn ich euch Säcke manchmal vermisse.“
„Hört, hört.“ Darren grinste mir zu.
Im Gegensatz zu Bernard war er nicht viel älter als ich und wenn er wieder sein Sunnyboy-Lächeln sehen ließ, erinnerte er mich daran, wie ansprechend er war. Doch zu meiner Zeit als Auszubildender unter Bernard und ihm hatte ich den flüchtigen Crush auf ihn ignoriert. So was gehörte sich auf der Arbeit nicht. Danach hatte sich der Kontakt nicht gehalten, also war es wohl besser so.
„Nun gut, Jungs. Habt noch eine schöne Restpause. Ich gehe mich bei Dr. Benett versklaven. Ihr könnt mir ja später was Spannendes vorbeibringen.“
Manchmal sollte ich einfach meine Klappe halten.
Ich spürte, dass sie herangefahren wurde, noch bevor Darren die gläsernen Doppeltüren aufstieß. Es war dieses Rufen, das nur ich hören konnte. Wobei ‚hören‘ der falsche Begriff war. Vielmehr spürte ich es. Ich hob den Blick und heftete ihn auf die Tür. Ich hätte das nicht tun sollen, denn es handelte mir die Aufmerksamkeit von Dr. Benett ein, die nur dadurch von mir genommen wurde, dass Darren und Bernard mit einer Patientin durch die Tür kamen.
„Jay?“ Ich blinzelte. Irgendwie war es ironisch, dass Darren nach mir brüllte, obwohl Dr. Benett direkt neben mir stand. Ich war hier nur der Praktikant.
Trotzdem trat ich hinter dem Counter hervor und hastete ihnen entgegen.
„Du hast doch gesagt, du willst was Spannendes.“Ich hatte da eher an einen Snack gedacht, verdammt. Ein Ü-Ei oder so was.„Sie übergibt sich in einer Tour und scheint auch nicht ganz bei Sinnen zu sein. Redet wirres Zeug. Sie konnte uns nicht sagen, wer sie ist, aber wir haben ihre Brieftasche gefunden. Ihr Name ist Mandy Grendel und sie ist 25.“
Sie fuhren die junge Frau in eines der vorgesehenen Abteile.
„Nun, was haben wir hier?“, fragte mich Dr. Benett. Ich hätte es beinahe nicht mitbekommen, denn mein Fokus lag auf ihr.
Die Männer um mich herum waren entspannt. Sie sahen eine junge Frau, die vielleicht beim Feiern übertrieben hatte. Kein großes Drama. Würde ich nicht bemerken, dass sie gerade starb, würde ich nichts anderes vermuten.
Dummerweise war ich nicht so normal, wie ich es gerne wäre.
Was in meiner Kindheit mit platzenden Glühbirnen und leuchtenden Haaren angefangen hatte, hatte sich inzwischen zu Kräften entwickelt, die ich weder begriff noch wirklich kontrollieren konnte. Sie machten, was sie wollen.
Zum Beispiel jetzt, wenn meine Finger anfingen zu kribbeln und ein Teil meines Verstandes sich nach ihrem Rufen ausstreckte, um darauf zu antworten. Es war Fluch und Segen zugleich.
Rein technisch war es nicht übel für einen zukünftigen Arzt, Wunderheilungen vollbringen zu können. Ich wusste, dass ich es konnte, denn ich hatte es bereits getan. Damals vor drei Jahren, als sich meine Kräfte verselbstständigten und mich überwältigt hatten. Ich hatte eine Frau geheilt, die Dr. Benett ein paar Minuten zuvor für tot erklärt hatte.
Die Fähigkeiten in mir wollten es wieder tun.
Sie meldeten mir, dass das Problem nicht ist, dass sie zu tief ins Glas geschaut hätte. Nein, vor meinem inneren Auge konnte ich ihr Herz sehen, das – völlig aus dem Takt geraten – sein Bestes gab, mit der geplatzten Herzkranzader klarzukommen. Die Kräfte wollten zum nächsten Schritt übergehen und es richten. Alles wieder reparieren und so sehr ich ihr helfen wollte, ich drängte all das von mir. Ich fokussierte mich darauf, mich nicht mehr von ihrem Ruf einfangen zu lassen, und ignorierte ihn.
Ich sah zu Dr. Benett. „Sie hat einen Herzinfarkt.“
Er musterte mich irritiert. „Woran machen Sie das fest?“
Tja, gute Frage. Da wollte ich unauffällig sein und verbot es mir, diese Kräfte zu benutzen, damit mein Leben halbwegs normal verlief, und hatte jetzt keine vernünftige Erklärung. Ich konnte schlecht sagen: ‚Ach, ich habe da diese Intuition, die mir das sagt. Ich kann es gerne auch gleich heil machen.‘ Das ging einfach nicht.
Ich sollte ihm eine Antwort schuldig bleiben, denn die Frau verlor in diesem Moment das Bewusstsein und sackte zusammen. Damit kam Bewegung in die Gruppen. Darren und Bernard senkten das Kopfende des Bettes ab und Dr. Benett machte sich daran, die Patientin zu untersuchen.
„O’Ceallaigh, sind Sie sich ganz sicher?“
Ich nickte. Was sollte ich auch sonst tun? Ich wollte ja, dass er sie rettete. Sie würde es schaffen, denn sie war in guten Händen. Dr. Benett nickte mir zu.
„Wir machen sie fertig für den OP, wecken Sie Dr. Williams und Dr. Roody!“, wies er eine der Krankenschwestern an, die sich inzwischen im Raum eingefunden hatte. Dann löste er die Bremsen am Bett und fuhr die Frau aus der Nische raus.
„Sie hat doch gar keine Anzeichen eines Infarkts gehabt“, murmelte Darren neben mir und ich drückte seine Schulter.
„Nun ja, wenn du die typischen ‚Brustschmerz bis in den linken Arm‘- und Atemnot-Symptome haben wolltest, hättest du mir einen Mann vorbeibringen müssen“, meinte ich aufmunternd. Wahrscheinlich würde das reichen, um Darrens Verwirrung zu zerstreuen. Doch ich wusste, dass es hier jemanden gab, den ich nicht so leicht täuschen konnte.
Es war wieder an der Zeit, Dr. Benett möglichst geschickt aus dem Weg zu gehen, bis ich eine plausible Ausrede hatte.
Jamie
Die Saffargh hatte nicht aufgehört zu schmollen, und als ich ein paar Tage später in meinem neuen „Zuhause“ saß, hatte ich gar keinen Plan mehr. Mein Blick irrte durch das schnuckelige Zimmer, welches der Zirkel für mich bezahlte, damit ich hier undercover den unglückseligen Auftrag erfüllen konnte.
Ich wohnte nun in einem Männerwohnheim. (Ich war jetzt schon entzückt bei dem Gedanken, im Halbschlaf nackten Männern im Bad zu begegnen.) Deswegen die Verkleidung. Damit ich hier unterkommen und mich an Jacob O’Ceallaigh ranschmeißen konnte. Laut Imoda stand er auf Kerle.
Entsprechend brauchte ich als Mädchen gar nicht erst versuchen, sein Herz zu erobern und dann zu brechen. Dass es mir als Junge gelingen würde, bezweifelte ich stark. Ich ging kaum als einer durch. Ich konnte von Glück reden, dass meine Stimme relativ tief war. So war die Verkleidung passabel, solange keiner auf die Idee kam, dass ich ein Mädchen sein könnte. Anderenfalls war es sofort offensichtlich.
Doch was Menschen nicht erwarten, das sehen sie auch nicht. Eine weitere von Imodas glorreichen Weisheiten. Aber da sie mein ganzes Leben bereits damit verbrachte, mich zu ärgern und zu verarschen, gab ich nicht viel auf ihre Sicht der Dinge. Sie erzählte mir seit unserer Kindheit, dass ich wie ein Junge aussähe. Mir war das damals wie heute verdammt egal. Ich sah eben androgyn aus. Na und?
Ich stand auf und öffnete das Fenster. Der Blick von meinem Zimmer aus war bildhübsch. Er war auf einen Park gerichtet. Die Uni war ganz in der Nähe. Nah genug, dass viele Studierende ihre Pausen hier verbrachten.
Für einen Moment stellte ich mir vor, wirklich Studentin hier zu sein. Das musste ein traumhaftes Leben sein. Ich lehnte mich auf die Fensterbank und stützte meinen Kopf auf der Hand ab, während ich das bunte Treiben auf dem Campus beobachtete. Studierende spazierten von A nach B, einige lagen auf der Wiese, die sich zwischen den Wegen befand, und fingen in ihrer Pause ein paar Sonnenstrahlen ein. Manche saßen auf den Bänken und lasen. Ich drehte die kleine Grünlilie, die ich mir mitgebracht hatte, ein wenig und lächelte. Sie würde mir Gesellschaft leisten, bis …
Nur allzu schnell kamen ihre Stimmen wieder in meinen Kopf.
Du kannst uns nicht weiter so enttäuschen, Jamie.
Das wusste ich. Ich hatte noch nie eine nennenswerte Leistung für den Zirkel erbracht und ich hasste es, in diesen hineingeboren worden zu sein. Ein schwarzer Zirkel, der sich mächtig was einbildete auf das Schwarz.
Das ist deine letzte Chance, Jamie.
Warum dann ein Auftrag, den ich von vornherein nur vermasseln konnte? Sie wollten mich sicher loswerden. Denn ich war Schund als Hexe. Keine Ahnung, wo es meine Magie hinzog, aber Schwarz war es nicht. Ich war jedoch auch nicht Weiß. Selbst simple Zauber beider Seiten wollten mir nur mäßig gelingen.
Das war Müll.
Tja, und was machte man mit Müll? Man warf ihn weg.
Das hier war eine Art und Weise, den Abfall zu entsorgen. Da war ich sicher. Nicht, dass sie eine Begründung brauchten. An manchen Tagen töteten sie Leute für weniger. Eine Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen, als ich daran dachte, wie ich dabei hatte helfen müssen, eine Frau zu begraben, die ihnen widersprochen hatte. Es war jetzt schon ein paar Wochen her, doch noch immer verfolgte mich der Anblick der Leiche in meinen Träumen. Der Zirkel war groß, ich kannte nicht jeden von ihnen, schon gar nicht beim richtigen Namen, dennoch war es ein Schock gewesen.
Die Frau war vertrocknet gewesen, als sei alles aus ihr herausgezogen worden. Von ihr war nur eine Mumie übrig geblieben. Oswald hatte auf dem Friedhof hinter der Mansion ein Loch ausgehoben und ich hatte ihm dabei helfen müssen, den steifen Körper dort hineinzulegen. Dann hatte er das Loch zugemacht und war gegangen. Es gab keine Trauerrede, keinen Stein. Nur ein weiterer frischer Erdhügel, der irgendwann wieder mit Gras überwuchert sein und vergessen werden würde. Ich hatte mich an das Grab gehockt und ein kleines Gebet für sie gesprochen. Bei den Göttern, das war alles gewesen, was ich für sie tun konnte.
Vielleicht war schon das nächste Loch, das Oswald ausheben würde, für mich. Die Ältesten waren unberechenbar. Sie entschieden je nach Stimmung, wer verdiente zu leben und wer starb. Aber ich nahm mir vor, es ihnen zu zeigen, denn ich wollte nicht entsorgt werden. Bemüht atmete ich durch. Ich unterstand ihrer Willkür, so wie alle anderen in unserem Zirkel. Ich musste versuchen, ihnen keinen Grund zu liefern, ihre Laune an mir auszulassen.
Mit schwerfälligen Bewegungen richtete ich mich wieder auf. Gern wollte ich mich der Vorstellung, eine echte Studentin zu sein, noch eine Weile länger hingeben. Aber dazu hatte ich keine Zeit. Stattdessen trottete ich zu dem Waschbecken, das ich in meinem winzigen Einzelzimmer hatte, und wusch meine Hände. Danach öffnete ich eine Packung farbiger Wegwerflinsen in der natürlichen Farbe braun. Ich konnte schließlich nicht mit violetten Augen über den Campus flanieren. Dann könnte ich mir auch gleich ein Schild umhängen auf dem ‚verdächtig‘ stand.
Nachdem ich mir das vierte Mal aus Versehen in die Augen gepikt hatte, tränten sie stark. Nicht nur von der Irritation, sondern auch vor Tränen der Wut. Das war also der kurze Rest meines Lebens? Ich blinzelte angestrengt und betrachtete mich im Spiegel. Kein Zauber der Welt vermochte es, eine Edelsteiniris zu verändern. Farbige Linsen konnten es. Irgendwie ironisch. Da verkackte ich einmal nicht mit Magie, da waren es eben Menschensachen, die ich nicht auf die Reihe bekam. Erst nach einer halben Stunde hatte ich es geschafft.
Meine Augen waren jetzt dunkelbraun und bestimmt nicht gerötet oder glubschig. Aber hey, mein Ziel war ein Medizinstudent. Mit den geplatzten Adern sah ich aus, als hätte ich zu viele stimulierende Kräuter geraucht. Vielleicht fand diese Art Charme ja Anklang bei ihm und weckte das Bedürfnis seinerseits, mein Blut mal ordentlich durchzuchecken. Dann hatten wir immerhin ein Gesprächsthema. Yeay.
Ich schulterte meine Tasche und zog die Tür hinter mir zu. Diese sprang wieder auf. Als hätte ich nicht lange genug gebraucht, um die Linsen reinzukriegen! Danke, Tür! Ich mühte mich mit ihr ab. Ich fürchtete schon, ich sei zu spät, um ihn abzupassen.
Meine Hausaufgaben hatte ich gemacht. Jacobs Stundenplan (und somit seine Routine) herauszubekommen, war nicht schwer gewesen. Ich musste mich beeilen, wenn ich ihn noch erwischen wollte, um ihn möglichst nett oder verführerisch (?!) anzusprechen.
Sollte das Chaos beginnen.
Ich hielt Ausschau nach dem Rubin. Wenn die Ältesten ihn losschickten, dann war das ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr daran glaubten, dass ich ihnen die wichtigste Zutat für die Mondschattennacht liefern konnte: ein gebrochenes Einhorn.
Ja. Jacob war ein Einhorn.
Nein, er war kein Pferd mit Horn. Das waren sie nie gewesen. Was normale Menschen nicht ahnten, war, dass Einhörner einst diese Gestalt wählten. Nur eine von ihren zahlreichen Erscheinungsformen, jedoch die legendärste.
Entgegen jeder Vorstellung waren sie Wesen des Äthers. Pure Magie. Man konnte alles von ihnen für magische Zwecke gebrauchen. Haare, Augen, Splitter ihrer Seele, sogar die Nägel. Doch für schwarzmagische Absichten wurden sie faszinierend, wenn sie gebrochen waren. Wenn ihr Herz in tausende Fetzen zerrissen war und sie allen Lebenswillen verloren hatten. Dann konnte man sie in ein Nocnamora verwandeln.
Einhörner waren vor Jahrtausenden gejagt und ausgerottet worden. Selten tauchten unter den heutigen Hexen Nachkommen auf, bei denen das Einhornblut wieder komplett durchschlug und die eine Kraft und Reinheit innehatten, die einem den Atem nahm.
Das passierte auch bei mir, als ich um die Ecke lugte und ihn das erste Mal sah. Eine warme, sanfte Aura umgab ihn. Er strahlte Energie ab, die ich bis zu mir spürte. Menschen nahmen sowas nicht wahr, zumindest nicht bewusst. Ich sah, was er war, und zweifelte. Ein Teil von mir wollte sich gern in der Güte verstecken, die er abstrahlte. Doch dazu war ich nicht hier.
Ich straffte die Schultern und richtete mich auf. Zu meiner vollen Größe von etwas mehr als eins-sechzig.
Warum gleich hatte ich diesen Auftrag? So langsam dämmerte es mir, dass sie mich nicht nur loswerden, sondern auch noch was zum Lachen haben wollten. Ich gab bestimmt tolles Material ab, um sich darüber lustig zu machen. Ich bezweifelte zwar, dass die Ältesten Humor hatten, doch sie verweilten den ganzen Tag im Aetherium unter der Mansion. Vielleicht langweilten sie sich.
Gerade als Jacob an mir vorbeiging, huschte ich um die Ecke, damit ich in ihn reinrennen konnte. Der Zusammenstoß schmerzte mehr als erwartet und ich stolperte zurück. Ich stieß mit dem Rücken an die Wand und zischte. Au Backe. Wo war mein Atem?
„Entschuldigung“, sagte er irritiert.
Ich konzentrierte mich auf mein Opfer. Außerdem darauf, die tiefere Stimme zu benutzen, wie ich es geprobt hatte. Wie ich es vor dem Spiegel geübt hatte, ließ ich den Blick von oben nach unten wandern, dann wackelte ich verführerisch mit den Augenbrauen.
„Hey Babe“, sagte ich, „öfter du kommst du hier?“
Warte nein, das war Theban Grammatik. Das klang nicht richtig.
Dass es falsch war, sagte mir auch der verwirrte Ausdruck in Jacobs grünbraunen Augen. Er betrachtete mich einen Moment argwöhnisch.
„Hast du Drogen genommen?“, fragte er. Von Begeisterung konnte nicht die Rede sein. Dennoch funktionierte mein Plan, irgendwie. Wir hatten ein Thema. Ich konzentrierte mich auf die Worte, damit ich nicht wieder alles verdrehte.
„Vielleicht“, antwortete ich und lächelte gewinnend, „aber die brauche ich jetzt nicht mehr, denn ich habe dich gesehen.“
Ha! Punktlandung. Für einen Moment war ich sehr stolz auf mich wegen der korrekten Grammatik. Zumindest so lange, bis ein prustendes Lachen erklang. Aber das kam nicht von Jacob. Es kam von dem Typen neben ihm.
Ich hatte ihn bisher gar nicht wahrgenommen, doch sein Lachen störte meine Konzentration. Ich strafte ihn mit einem kühlen Blick. Sein Gekicher steigerte sich weiter, bis er sich den Bauch hielt und eine Lachträne wegwischte.
Jacob betrachtete ihn streng. „Das reicht, Mikael.“
„Aber Jay. Das war so süß. Komm schon. Wenn du ihn nicht willst, dann nehme ich ihn.“
Warte was? Was sollte das denn heißen? Der junge Mann wandte sich mir zu und fuhr sich durch die naturroten Haare. Jacobs Haar dagegen war unauffällig braun, fast schwarz. Ich wollte mich gerade wieder an Jacob wenden, da stand der andere plötzlich vor mir und stützte sich an der Wand neben mir ab. Überrascht sah ich zu ihm auf. Mein Herz machte einen überrumpelten Stolperer, um dann gehetzt weiter zu schlagen. Er erwiderte meinen Blick mit einem amüsierten Funkeln in den blauen Augen.
„Das kann ich nachfühlen“, sagte er und grinste dabei gelassen, „ich wollte eigentlich auf dem Klo strategisch heulen gehen, um meine Traurigkeit loszuwerden. Aber das brauche ich jetzt nicht mehr, denn ich habe dich gesehen.“
Wärme kroch in meine Wangen. Der konnte mir doch nicht einfach so auf die Pelle rücken! Er lachte mich weiter aus und ich trat seitwärts von der Wand weg, damit ich wieder Abstand von ihm bekam.
„Ich … äh …“
Dazu fiel mir nichts mehr ein. Ich warf beiden einen Blick zu. Wie ich mit der Situation umgehen sollte, wusste ich nicht. Wie auch? Meine einzige Freundin war eine verdammte Bibliothek!
Ich machte auf dem Absatz kehrt und ließ die beiden stehen. Dieser Auftrag kostete mich am ersten Tag schon alle Nerven.
Yep. Ich war so was von tot.
Jay
Was. Zur. Hölle?!
Ich war noch immer völlig überfahren von diesem Auftritt. Irritiert beobachtete ich den jungen Mann bei seiner Flucht und fragte mich, warum er gerade mich angemacht hatte. Das war seltsam. Ich ließ mir seine Worte noch mal durch den Kopf gehen und irgendwie wurde mir flau dabei. Es wurde besser, jetzt wo er das Weite suchte.
Neben mir konnte ich Mikael glucksen hören. Im Gegensatz zu mir hatte er scheinbar eine fantastische Zeit.
„Der war echt niedlich“, äußerte er und löste seinen Blick von der Ecke, hinter der der seltsame Kerl verschwunden war.
„Ich weiß ja nicht.“ Ich war selbst überrascht, wie schnippisch ich klang. Mika zog eine Augenbraue hoch und musterte mich eindringlich.
„Alles okay?“
Ich presste einen Moment die Lippen aufeinander. Da war etwas absolut nicht okay. Aber ich konnte nicht festmachen was. Das musste nicht zwangsläufig an dem lausigen Flirtversuch liegen, dessen Zeuge ich eben geworden war. Dieses Gefühl des ‚Irgendwas stimmt nicht‘ hatte ich seit gut zwei Wochen. Doch ich hatte es Mika verschwiegen. Meine Nerven spielten mir gerne mal Streiche. Das war nichts Neues.
„Jay.“
Ich blinzelte und zwang mich, meine Konzentration wieder auf Mika zu lenken. Er neigte stumm den Kopf, dann deutete er nach oben. Ich folgte dem Wink. Die Lampe über mir flimmerte gefährlich. Ich atmete tief durch und sie ließ es bleiben.
„Es ist nichts“, beteuerte ich, doch ich entlockte Mika damit nur ein Schnauben.
„Ich kenne dich, Jay.“ Er seufzte und setzte sich in Bewegung. Ich folgte ihm den Flur runter bis zu der Tür, die uns ins Freie entlassen würde.
Es sollte mir recht sein. Frische Luft war eine gute Sache. Sie war weg von muffigen Hörsälen und Neonröhren, die mysteriöserweise platzen könnten. Ich ärgerte mich über mich selbst. Das war mir schon lange nicht mehr passiert.
Das wusste auch Mika, also würde er sich es im Leben nicht nehmen lassen, weiter in diese Richtung zu bohren. Wir traten nach draußen und blinzelten der Sonne entgegen. Es war ein richtig schöner Tag. Die zwanzig Grad, die im Wetterbericht versprochen worden waren, fühlten sich wärmer an.
„Bock auf ein Eis?“, fragte Mika und ich nickte das ab.
Nicht viel später hatten wir eine der Bänke im Park der Universität besetzt. Wir waren in einem winzigen Supermarkt in der Umgebung gewesen und hatten uns eine Packung Eis gekauft.
Manchmal lebte ich für Wassereis. Es war mir lieber als ein überteuerter Becher in einem überfüllten Café. Mika wusste das und ich wusste zu schätzen, wenn er sich mir in dieser Beziehung anpasste.
Mikael hatte sein Eis aufgegessen und warf den Stiel im hohen Bogen in den Mülleimer neben der Bank. Dann wandte er sich mir zu.
„Gut, bevor ich jetzt den nächsten Finger esse, frage ich dich noch mal freundlich, was los ist“, kündigte er an und wedelte mit dem Eis, das die lächerliche Form eines Fingers besaß.
„Willst du echt zwei essen?“
„Ja, und du wirst es auch tun.“
Ich rieb mir die Nasenwurzel. So sehr liebte ich Wassereis nun auch wieder nicht. „Ich will aber gar nicht.“
„Jacob O’Ceallaigh. Du kennst die Regeln. Vier Eis, zwei Männer, ein Ziel. Nimm den Finger in den Mund.“
Meine Damen, Herren und Freunde. Das ist er. Mein Bruder.
„Du bist peinlich.“ Ich verdrehte demonstrativ die Augen. „Gut, dass ich nur adoptiert bin.“
Mikael grinste. Spielerische Anfeindungen dieser Art kratzten ihn nicht. Generell hatte Mikael ein dickes Fell und Nerven aus Stahl. Sonst hätte er wahrscheinlich einen Bogen um mich gemacht, wie so viele andere.
Ich seufzte und wickelte mein zweites Eis aus. Zum Wegschmeißen war es zu schade.
„Ich nehme an, wenn ich dir nichts Vernünftiges liefere, dann fragst du mich bis heute Abend noch zehn Mal?“
„Exakt.“
„Nun dann.“ Ich hob den Blick und bemühte mich, seinem standzuhalten, doch der Ausdruck seiner blauen Augen war suchend geworden, also konzentrierte ich mich lieber auf mein Eis. Mikael konnte mich lesen wie ein Buch – hatte er diesen Blick drauf, wurde das noch schlimmer.
„Es ist nicht wirklich was“, sagte ich lasch und knabberte einen Moment an dem süßen Wassereis. „Ich glaube die Anmache dieses Typen hat mich einfach unvorbereitet getroffen.“
„Aber du bist sonst nicht so, Jay. So … abwertend. Man kann dich in Verlegenheit bringen, aber nicht irritieren. Der Typ hat dich aber irritiert. Wieso? Was verschweigst du mir?“ Ich ließ meinen Blick über den Park gleiten. Hier und da saßen Studierende in der Sonne und genossen die letzte Wärme des frühen Herbstes. Irgendwie schienen mir meine schweren Gedanken im Angesicht dessen unpassend. Aber Mikael würde nicht lockerlassen.
„Das ist doch komisch!“, platzte es schließlich aus mir heraus.
„Wieso? Du bist ein hübscher Junge. Kann doch mal sein, dass dich jemand anmacht. Warum freakt dich das plötzlich so aus?“
Ich seufzte leise und zuckte mit den Schultern. „Es macht keinen Sinn. Offensichtlich ist er ein Neuling. Und dann baggert er den ersten Typen an, den er findet? Das ist doch seltsam. Zumal: Ich bin ein Mann, er ist ein Mann. Wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, dem du dich an den Hals wirfst, just deine Neigungen teilt?“
Mikael lachte hämisch und seine Augenbrauen wanderten einen Moment in die Höhe. „Nun ja, hoch genug, denn es war ein Treffer.“
Ich schenkte ihm einen kühlen Blick. Doch ich konnte nicht mal was dagegen sagen.
„Da ist noch mehr? Oder Jay?“
Er kannte mich zu gut. Außerdem war ich eine Niete, wenn es darum ging, zu lügen. Also nickte ich ergeben.
„Es ist sicher nichts. Aber … ich fühle mich beobachtet. Schon seit zwei Wochen. Wahrscheinlich zu viel Stress. Es geht mal wieder mit mir durch. Ich bin nervös und da ist so eine merkwürdige Anmache … einfach nur umso komischer, oder nicht?“
„Nun, es ist ja nicht das erste Mal, dass du dich so fühlst.“
„Ja, und es ist nie etwas passiert, ich weiß. Ja, wahrscheinlich ist es der Stress. Kein Grund durchzudrehen.“ Zumindest redete ich mir das ein. Doch irgendwie war es dieses Mal anders. Als wäre die Person eine andere. Ich hatte eindeutig zu viel Fantasie und zu wenig Schlaf.
Mikael hatte sein zweites Eis aufgegessen und schmiss den Stiel in den Eimer. So lange ließ er sich wohl Zeit, um nachzudenken.
„Okay. Lass uns nicht ausflippen. Aber nehmen wir das auch nicht auf die leichte Schulter. Es kann nicht schaden, wenn wir ein bisschen unsere Aufmerksamkeit erhöhen. Du kannst dir sicher sein, dass ich auf dich aufpasse.“
Ich nickte. Mikael wusste stets, was er sagen konnte, um mich zu beruhigen. Ich glaubte ihm. Er brauchte mir nicht mehr zu beweisen, dass ich ihm vertrauen konnte – das hatte er oft genug. Er würde zu den Augen in meinem Hinterkopf werden, wenn ich ihn darum bat. Dieser Gedanke schaffte es, meine gestressten Nerven zu entspannen.
„Danke, Mika. Ich mach mich dann mal auf die Socken. Das Krankenhaus ruft. Ich übernehme heute noch mal eine Spätschicht.“
„So viel zu weniger Stress. Soll ich dich abholen?“ Das Angebot war verlockend, aber ich sollte nicht so ein Baby sein. Also schüttelte ich den Kopf.
„Schon okay. Ich komm klar. Wir sehen uns spätestens morgen früh.“
„Ja, pass auf dich auf, in Ordnung?“
Ich nickte und schmiss den Rest meines Eises in den Mülleimer, bevor ich mich auf den Weg machte.
Jamie
Nach dieser Niederlage war ich erstmal nach Hause gelaufen. Ganz nach Hause, in mein kleines Dachkämmerchen. Alle Waisenkinder, um die sich der Coven kümmerte, wohnten zusammen in je einem Zimmer, getrennt nach Mädchen und Jungen. Dort blieben sie, bis sie entweder starben, weil sie zu schwach waren, die Runen auszuhalten, die man ihnen viel zu früh tätowierte, oder sie alt genug waren, um das Ranking zu bekommen.
Eins bis zwölf.
Normal war sechs oder sieben. Ab acht war man schon ziemlich gut. Zehn? Holymoly, sieh dir diese Hexe an! Sie ist ein halber Gott. Zwölf? Geh aus dem Weg und danach küsse den Boden, auf dem sie gegangen ist.
Alles unter sechs wurde verschrottet oder als Bauernopfer eingesetzt. Irgendwann wenn man eins brauchte. Zum Beispiel wurden sie zu anderen Zirkeln geschickt, um Sachen zu stehlen und wenn sie nicht wieder kamen, dann war das so. Mit manchen wurde auch experimentiert.
Wie viele Runen konnte eine Hexe vertragen, bis das Energiefieber sie dahinraffte? Jeder musste seinen Nutzen erfüllen. Wenn man das nicht aus eigener Kraft konnte, dann wurde man nützlich gemacht. So lief das in unserem Zirkel.
Im Moment hatten wir drei Zehnen und eine Elf. Die Elf war obendrauf ein Rubin. Er war der Stolz der Ältesten. Sie hatten immer wichtige Aufträge für ihn. Wenn ich aber daran zurückdachte, dass er damals geschickt worden war, um Norma und mich wieder einzusammeln, dann musste er wohl auch unwichtige Dinge machen.
Ich kannte nicht mal seinen richtigen Namen, aber ich fürchtete ihn mit meiner ganzen Seele. Glücklicherweise sah ich ihn nicht oft. Er hatte, wie alle mit einem Ranking über acht, ein eigenes Haus bekommen. Die Hexen mit einem schwächeren Ranking wohnten in der Mansion, dem Zentrum unseres Zirkels. Dabei war die riesige Villa nicht der wichtigste Part.
Im Erdgeschoss befand sich eine reich verzierte Tür. Diese führte nach unten. Dort ruhte das Aetherium. Das Aetherium war ein beeindruckender Ort. Obwohl tief unter der Erde, war es immer von indirektem Tageslicht beleuchtet, welches aus Rissen in der steinernen Decke drang. Die Wände waren aus rauem Fels. Eine gigantische Höhle, die sich wie eine andere Welt anfühlte und vielleicht auch eine war. Inmitten von magisch gestaltetem Licht und Wasser, üppigen Pflanzen und pompöser Architektur saßen die Ältesten an einem langen, reich verzierten Tisch. Die Zirkelmeister.
Sie bestimmten alles, was den Coven anging. Eigentlich herrschten sie nicht nur über den Coven, sondern hatten ganz Theban in ihren Klauen. Ich fragte mich, ob sie mal richtige Menschen gewesen waren. Falls ja, dann war da nichts übrig. Ich konnte nicht mal mehr sagen, wer von ihnen Frauen oder Männer waren. Sie waren uralte Gestalten, gehüllt in wehende Gewänder, die sich fast wie eine Einheit zu bewegen schienen. Ich hatte sie nie außerhalb des Aetheriums gesehen. Waren sie schon eine Entität?
Es spielte keine Rolle. Wenn man vor die Ältesten trat, hatte man Grund, sich zu fürchten. Als sie mich das letzte Mal zu sich gerufen hatten, war ich mit diesem verdammten Auftrag bedacht worden. Danke nochmal, Zirkelmeister.
Es war eine Katastrophe. Ich hatte mich mehr als blamiert und die Schamesröte wollte nicht von meinen Wangen weichen.
Ich schämte mich nicht nur für mein Auftreten. Nein, sondern auch für meinen Auftrag. Jacobs Präsenz ließ einen spüren, dass es ein Unsegen war, jemanden wie ihm Schaden zuzufügen. Das konnte ich doch nicht machen!
Er war größer als ich. Als alles.
Wer ernsthaft in Betracht zog, ihm wehzutun, hatte keine Seele. Oder war ein Feigling, so wie ich.
Ich musste nachdenken. Wie machte man das am besten in Theban, wenn man keine Freunde zum Reden hatte? Man folgte einfach dem IntrovertLifestyleThebanTM.
Nicht, dass ich mich als introvertierte Person sehen würde. Im Gegenteil. Doch ich war nicht nur ungeschickt, ich war auch ein böses Omen. Sobald ich jemanden als engen Freund betrachtete, dann verschwand er. So wie Norma und Yosha.
Ich wusste nicht, woran das lag. Manchmal hatte ich das Gefühl, die Ältesten liebten es, mich leiden zu sehen und das war der einzige Grund, warum ich noch lebte. Wäre ich tot, dann wäre auch das Leid vorbei. Was hatte ich falsch gemacht? Eine Frage, auf die ich wohl nie eine Antwort erhalten würde. Ich hatte versucht, allein durchzukommen, nachdem auch Yosha spurlos vom Erdboden verschwunden war.
Daher hatte ich diesen Lifestyle adaptiert.
Mir blieben zwei Dinge – Erstens: Durch die Saffargh rennen, aber der erste Versuch war schon kein Erfolg gewesen. Zweitens: Runter in die Kesselräume und etwas brauen.
Eine Sache, in der ich gut war (wahrscheinlich, weil man keine Magie dafür brauchte), war Alchemie. Brauen half mir, den Kopf freizubekommen. Es war beruhigend. Jedes Kraut hatte seine Bedeutung und Wirkung. Jeder Schritt war logisch. Ich liebte es, wenn Dinge Sinn ergaben und wie kleine Zahnräder ineinandergriffen, um etwas zu schaffen, das von Nutzen war.
Ich rieb mir über die Arme und verschränkte sie dann. Ich baute riesigen Mist mit diesem Auftrag und das konnte ich nicht abschütteln. Schnell huschte ich die Gänge entlang und bis runter in den Keller.
Dort gab es einen großen Raum mit mehreren Kesseln und einem gigantischen Kräuterschrank. Ich sammelte alles zusammen, was ich für einen Heiltrank brauchen würde. Die konnte man immer gebrauchen. Selbst wenn ich ihn hier unten stehen ließe, der Nächste würde ihn dankend mitnehmen. Zumindest solange er sich nicht bei mir bedanken musste.
Ich warf die Ringelblumen ins Wasser und wartete, bis es kochte, bevor ich die anderen Zutaten hinzugab. Die Arnika und die Callaponhaare musste ich zeitgleich hineinwerfen. Dann angelte ich mir einen zweiten Löffel und rührte mit der linken Hand im und mit der rechten außen gegen den Uhrzeigersinn.
Das Glück war mir jedoch nicht wohlgesonnen, denn kurz, nachdem ich die Flammen runtergestellt hatte, kam Imoda die Treppe runter. Meine persönliche Mobberin seit der Kindheit. Warum sie mich so hasste, war mir ein Rätsel. Ich hatte ihr nie was getan.
„Was suchst du denn hier, Jester? Solltest du nicht einen wichtigen Auftrag verfolgen?“ Ihr Blick fiel auf meine Hände. Dann wanderte ihre Augenbraue nach oben. „Was tust du da?“
„Ich braue einen Heiltrank.“
„Die sind vierhändig.“
Ich rührte weiter in zwei verschiedene Richtungen.
Imoda schien eine Antwort zu erwarten, also sagte ich einfach: „Ja.“
„Was?“
„Vierhändig allein ist eine Herausforderung, aber möglich, wenn man schnell und präzise ist und sich beim Rühren nicht selbst bamboozelt.“ Damit machte ich den Deckel drauf. Vierhändig brauen bedeutete, dass normalerweise zwei Leute an dem Trank arbeiteten, weil es zu umständlich war, es allein zu tun. Doch bei manchen Tränken ging es ganz gut. Das war alles eine Sache der Übung.
Mit dem Heiltrank war ich jetzt schon durch. Der Rest war nur warten und köcheln lassen. Ich räumte wieder auf, um gleich zu verschwinden, sobald der Trank fertig war.
Imoda zischte leise und hob den Deckel an, bevor ich sie aufhalten konnte. Na super, so ruinierte man einen perfekten Heiltrank. Schnell schloss ich ihn wieder. Doch ich sagte nichts. Ich hatte selten Kraft, mich mit ihr zu streiten.
„Hey, ich rede mit dir.“ Oh Mann. Eigentlich hatte ich zuletzt was gesagt. Doch das war Imoda. Ich war nichts anderes von ihr gewöhnt. Auch sie war eine Waise und deswegen hatten wir uns jahrelang ein Zimmer geteilt. Sie war älter und entsprechend hatte ich zwei Jahre länger im Sammelzimmer verweilt.
Als Rang Neun hätte sie eigentlich ein Haus bekommen, aber auf eigenen Wunsch hin war sie in der Mansion geblieben und hatte irgendwo im dritten Stock ein tolles großes Appartement. Ein Zimmer, aber magisch vergrößert in mehrere. Sie hatte es mir einmal gezeigt, um mich neidisch zu machen. Aber ich hatte mich nur für sie gefreut. Sie liebte ihre Wohnung und ich gönnte ihr das.
Aus irgendeinem Grund hatte sie das verärgert. Seitdem hatte sie mich nicht noch mal mitgenommen. Stattdessen war sie in meine Dachkammer gewalzt und hatte mich für das winzige Zimmer ausgelacht, welches ich als Fünf bekommen hatte.
In Wahrheit war ich nur eine Vier. Doch Yosha hatte mein Ranking gefälscht, damit ich nicht sofort Probleme bekam. Nicht nur war die Vier problematisch, weil sie zu schlecht für unseren Zirkel war. Dass meine Magie nicht als schwarz deklariert worden war, sondern als nicht festgelegt, war eine weitere Katastrophe. Ich wusste nicht mal, was das zu bedeuten hatte, doch ich konnte auch niemanden fragen außer die Saffargh. Ich hatte bisher Angst vor der Frage gehabt, deswegen schleppte ich das schon gute drei Jahre mit mir herum.
Unbestimmte Vier war nicht akzeptabel. Doch schwarz und fünf hatte die Ältesten erst mal zufrieden gestellt und mir noch ein bisschen Zeit verschafft. Dafür war ich Yosha dankbar. Hoffentlich ging es ihm gut.
Ich schob mich vor den Kessel, der eine halbe Stunde bei geschlossenem Deckel köcheln sollte, und nicht einmal vier und einmal 26 Minuten. Einfach, damit sie den Prozess nicht noch mehr verhackstückelte und die Qualität des Tranks dadurch minimierte. Im Moment war das mein einziges Problem. Nur für den Moment.
Verglichen mit meinen anderen Problemen nahm ich das gern an.
„Ich … wollte brauen, um den Kopf freizubekommen.“ Ich gab mir Mühe, freundlich zu klingen. Auch wenn ich mich fragte, was sie hier unten verloren hatte. Sie braute so gut wie nie.
„Typisch du. Was für ein Nonsens!“ Ihr Blick huschte über mein Gesicht, als würde sie nach etwas suchen. Doch ich zuckte nur mit den Schultern.
„Ja, typisch ich. Das ist meine Art. Was ist deine?“ Also, außer ein Biest zu sein, meinte ich.
Finster sah sie mich an. Sie antwortete nicht. Stattdessen bohrte sie ihren Blick in meinen. Sie war ein Aventurin. Entsprechend waren ihre Augen hellgrün. Das passte auch gut zu ihren honigblonden Haaren. Der Aventurin stand für Wohlstand und Glück. Außerdem sollte er für Gelassenheit sorgen bei Wut und Ärger und das hatte sie schon nötig.
Sie war von einem zornigen Kind irgendwann zu einer zornigen Frau geworden.
Die Edelsteine, die sich offenbarten, passten immer zu einem, aber sie unterstützten die Hexe auch. In ihrem Fall war sie vorher schon ein kleiner Glückspilz gewesen mit einem hübschen Gesicht und großartigen Fähigkeiten wie das willkürliche Verändern ihres Aussehens. Sie war eigentlich dazu geboren, ein Star zu werden. Doch sie wurde schnell wütend und hatte auch sonst Probleme damit, ihre Gefühle zu kontrollieren. Dass sie ein Aventurin geworden war, nachdem sie ihre Rune bekommen hatte, hatte mich nicht gewundert.
Ich war ein Amethyst. Diese standen ebenfalls für Gelassenheit. Nur hatte ich die schon, sonst hätte ich Imoda im Leben nicht ausgehalten. Amethyste beruhigten und förderten die Konzentration. Zerstreut wie ich war, war das wohl der Part, wo mein Stein mich unterstützen sollte. Doch meine Gedanken waren trotzdem überall und nirgendwo.
„Wieso musst du den Kopf frei kriegen? Da ist doch eh nichts drin.“ Imoda beleidigte mich in jedem zweiten Satz, den sie an mich richtete. Das war normal. Dann ging es ihr gut.
„Ich kann doch kein Einhorn brechen.“ Vielleicht hatte sie ja einen Tipp. Sie war schließlich gern eine Bitch.
„Und warum nicht?“, fragte sie spitz.
Ich verschränkte die Arme und sah auf den Boden. Würde es denn reichen, wenn ich mich mit ihm anfreundete und dann die Freundschaft verraten würde? Allein der Gedanke stimmte mich traurig. Lieber hätte ich eine echte Freundschaft.
„Abgesehen davon, dass es nicht richtig ist, habe ich doch gar keine Kraft und kann nichts. Also, selbst wenn ich wollte, ich könnte nichts ausrichten“, antwortete ich niedergeschlagen.
Ihr Blick fiel wieder auf den Kessel hinter mir und sie verdrehte die Augen. „Mit der Einstellung kommst du auf jeden Fall nicht weit. Aber was soll man auch von einer wie dir erwarten?“