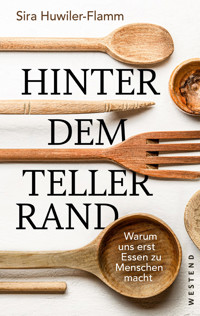
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wir alle essen - mal mit Genuss, mal mit schlechtem Gewissen, mal mit Freunden oder der Familie, mal ganz für uns alleine. Wir kochen mit Stolz unser erstes eigenes Steinpilzrisotto, freuen uns auch mit 40 Jahren noch, wenn Oma ihre Pfannkuchen macht und probieren mit Verwunderung die andersartigsten Geschmäcker der Welt. Sira Huwiler-Flamm hat mit vielen Spitzenköchen gesprochen und zeigt, dass die Art und Weise wie wir unser Essen zubereiten, uns erst zum Menschen gemacht hat. Denn Essen prägt unser Miteinander, bestimmt unser Zugehörigkeitsgefühl, nährt unsere Seele und hält unseren Körper gesund. Kurz: Essen ist etwas ganz Besonderes, das viel mehr Aufmerksamkeit und Respekt verdient hat!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Mit Unterstützung von
Sira Huwiler-Flamm
Hinter dem Tellerrand
Warum uns erst Essen zu Menschen macht
Impressum
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-115-6
1. Auflage 2025
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Lektorat: Emil Fadel
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Titelbild
VORWORT Was Essen für uns Menschen bedeutet
KAPITEL 1 20 Thesen, die Essen ESSENziell machen
1. These: ESSEN IST … HEIMAT
Kulturelle Heimat: Abenteuerurlaub? Nicht ohne meine Butterbrezel
Emotionale Heimat: Mit Geschmack und Duft zurück in die Kindheit
2. These: ESSEN IST … NATUR
Aha-Momente: Fast alles ist essbar
Warum Oma die wilde Küche dank Dosenravioli verlernt hat
Die Wiederentdeckung: Natürliches mit Repräsentationscharakter
3. These: ESSEN IST … LEBEN
Wenn der Körper in den Überlebensmodus schaltet
ESSENzielles Lebenselixier: Kein Nährstoff ist böse
4. These: ESSEN IST … MENSCHSEIN
Warum uns erst Kochen zum Menschen macht
5. These: ESSEN IST … GESELLIGKEIT
Höhepunkte des Alltags: Zusammen isst man weniger allein
Die Küche ist das lebendige Herz des Hauses
Rituale und Tischmanieren schaffen Verbindung
Essen fördert das (Business-)Netzwerk
6. These: ESSEN IST … WILLKOMMEN
Herzlich willkommen in Jordanien
Essen für die Integration
Die meistbewirtete Frau der Welt
7. These: ESSEN IST … ABSCHIED
Ein weltberühmtes Abschiedsessen
Die Henkersmahlzeit: Kuriosität, Versöhnung und Vergebung
Die kulinarische Wunsch-Erfüllerin im Hospiz
8. These: ESSEN IST … STATEMENT
Warum Essen die neue Religion ist
Andersartigkeit erntet Spott und Anerkennung
Fleischlos glücklich: Total normal in Zukunft?
9. These: ESSEN IST … ERLEBNIS
Genusserlebnis: Ohne das ist alles doof
Spektakel beim Dinner: Erlebnisgastronomie
Kochfernsehen: Miterleben und Inspiration tanken
10. These: ESSEN IST … LEID
Das Schuldgefühl, gesündigt zu haben
Die Trostgummibärchen-Erkenntnis
Vom Leid, es nicht zu haben: #IchBinArmutsbetroffen
11. These: ESSEN IST … GLOBALISIERUNG
Warum wir Kolumbus die Kartoffel verdanken
Genuss-Globalisierung: Geschmäcker aus aller Welt
Die Schattenseite der Globalisierung
12. These: ESSEN IST … RASSISMUS
Übermaß und Unterversorgung – ein Rassismusproblem?
Warum Pizza Hawaii und Mohrenköpfe verboten sind
Von Spaghettifressern und deutschen Kartoffeln
13. These: ESSEN IST … KÖRPERLICHE GESUNDHEIT
Zehn Jahre länger Leben – mit Essen
Chronisch Kranke erzählen: »Wir haben uns gesund gegessen«
Medizin aus dem Vorratsschrank
14. These: ESSEN IST … GEISTIGE GESUNDHEIT
Von labberigem Brot und Krankenhauskoller
Beim Essen dreht sich alles um Gehirnfutter
Du fühlst, wie du isst
15. These: ESSEN IST … MÄNNERSACHE?
Alleine unter Männern
Raue Brise unter der Dunstabzugshaube
Mehr Respekt – für die Zukunft des Kochberufs
Wie Frauen Heimchen am Herd und Männer Spitzenköche wurden
16. These: ESSEN IST … VERSCHWENDUNG
Tonnen für die Tonne
Sind wir denn von allen Sinnen?
Warum Smileywurst Entfremdung und Verschwendung beflügelt
17. These: ESSEN IST … WERTSCHÄTZUNG
Essen aus Abfall?
Von der Nase bis zum Schwanz und vom Blatt bis zur Wurzel
Die tun was: Kämpfer und Gründer als Genuss-Retter
18. These: ESSEN IST … WIRTSCHAFTSMACHT
Das Milliardengeschäft der Lebensmittelriesen
Auf Inflation folgt Shrinkflation und Skimpflation
Warum man mit Sterneküche eher kein Geld verdient
19. These: ESSEN IST … LIEBE
Geht Liebe durch den Magen?
Warum es bei Mama am besten schmeckt
Keine Banane beim ersten Date!
20. These: ESSEN IST … GENUSS
Kochen: Der Zauber der Verwandlung
Würzen: Mehr als nur salzen und pfeffern
Genießen: Sind Essiggurken mit Nutella tabu?
Am Ende zählt nur: Schmecken muss es!
KAPITEL 2 20 Spitzenköchinnen und -köche im Gespräch
Alexander Herrmann
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Bobby Bräuer
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Tohru Nakamura
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Haya Molcho
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Johann Lafer
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Stefan Wiesner
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Kevin Fehling
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Meta Hiltebrand
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Johannes King
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen …
Christoph Rüffer
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Ricky Saward
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Maria Groß
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Mike Süsser
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen …
Mario Lohninger
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen …
Marco Müller
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Cynthia Barcomi
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Clemens Rambichler
1. Essen ist für mich …,
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Ludwig »Lucki« Maurer
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Thomas Bühner
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
Sonja Baumann
1. Essen ist für mich …
2. Essen begeistert die Massen, weil …
3. Als Henkersmahlzeit würde ich mir Folgendes wünschen:
NACHWORT Essen hat Respekt verdient!
DANKSAGUNGEN
Navigationspunkte
Titelbild
Inhatlsverzeichnis
VORWORTWas Essen für uns Menschen bedeutet
Wir alle essen – mal mit Lust und Genuss, mal mit schlechtem Gewissen und Scham, mal mit Freunden und der Familie, mal ganz für uns alleine. Wir kochen mit Stolz unser erstes eigenes Steinpilz-Risotto, freuen uns auch mit 30 oder 40 Jahren noch, wenn unsere Großmutter Pfannkuchen oder ihren Sonntagsbraten macht – der nur bei ihr genauso schmeckt, wie er schmecken soll! Wir probieren mit Verwunderung zum ersten Mal peruanische Leche de Tigre oder koreanisches Kimchi und reisen bei Restaurantbesuchen durch die buntesten, vielfältigsten und andersartigsten Geschmäcker, die unsere weite – zum Glück globalisierte – Welt zu bieten hat. All diese Momente haben eines gemeinsam: Sie wecken Emotionen in uns!
Essen ist das Normalste der Welt und doch gleichzeitig etwas sehr Besonderes. Es hält uns am Leben und trägt zur körperlichen und geistigen Gesundheit bei. Diverse Studien zeigen: Wer sich gut, vielseitig und ausgewogen ernährt, lebt länger. Aber es ist auch etwas sehr Soziales, bringt Menschen an einen gemeinsamen Tisch, an dem geteilt, debattiert, verhandelt, gestritten und sich wieder versöhnt wird. Ein mit Zeit und Liebe zubereitetes Mahl drückt Wertschätzung aus und schenkt Geborgenheit. Mit Essen zollen wir geliebten Menschen, fremden Gästen und auch Sterbenden Respekt. Essen kann Willkommen und Abschied bedeuten. Essen kann Festtag und Alltag bedeuten. Essen kann Wertschätzung und Verschwendung bedeuten. Essen hat die Macht, Menschen und ganze Kulturen einander näher zu bringen – oder ganz im Gegenteil: Sich abzugrenzen und nur einem auserwählten Kreis vorbehalten zu sein. Essen kann aber auch Mittel zum Zweck sein: Lifestyle, politisches Statement oder Instrument, um mit Verzicht auf Fleisch, Selbstversorger-Anbau im Hochbeet oder strikt lokaler, plastikfreier Einkaufsstrategie, die Welt mit den eigenen kleinen Mitteln ein Stückchen besser zu machen. In den letzten Jahren gibt es einen regelrechten Food-Start-up-Boom: Junge Gründer, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit hyperregionalen, nachhaltigen oder veganen Produkten einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten und gleichzeitig Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite werden eine Handvoll Großkonzerne durch den gekonnten Anbau, Handel und Verkauf gewisser Lebensmittel und Fertigprodukt-Zusammensetzungen stinkreich, während Menschen in den ärmsten Regionen dieser Erde auch heute noch Hunger leiden.
Mit diesem Buch will ich genauer hinschauen. In 20 Thesen beleuchte ich verschiedene Bedeutungen des Essens. Dass mein Sachbuch aber nicht nur trockene Theorie, sondern auch jede Menge fesselnde, anschauliche und berührende Geschichten erzählt, ist mir sehr wichtig.
Ich selbst bin begeisterte Hobbyköchin, faszinierte Restaurantgängerin und binge an verregneten Wochenenden am liebsten Kochsendungen, die in internationale, ausgefallene, kulinarische Welten entführen. Dass hinter dem Thema Essen aber sehr viel mehr steckt, als nur Genuss, habe ich auch in meinem Berufsalltag als Journalistin gelernt. Ich lernte in den vergangenen 16 Jahren Menschen kennen, für die Essen der größte Feind ist – sei es, weil die Kilos auf der Waage und der Blick in den Spiegel quälend sind oder weil sie sich fast zu Tode gehungert haben. Bei Reportagen ließ ich mich von Leidenschaft und Tatendrang veganer Bäckerinnen anstecken; ich aß preisgekrönte Schwarzwälder Kirschtorte, die die Bäckermeisterin Ramona Bizenberger auch schon für die Queen, Michael Jackson und Paul McCartney serviert hat. Ich lief mit Sterneköchen und Kräuterhexen durch Wälder und Wiesen, um frisch von der Wiese gepflückte Wildkräuter und -blüten zu kosten, putzte bei meinem einzigen Fernsehpraktikum in ganz jungen Jahren Johann Lafers Grill und wurde danach mit Häppchen von Zebra-Bratwurst und einem dankbaren Lächeln der Fernsehkoch-Legende belohnt. Ich besuchte Bauernhöfe, die Blümchenkaffee aus Lupinen machen; lernte von Ärzten, Heilpraktikern und Patienten, dass man sich gesund essen kann – auch wenn es vermeintlich schon zu spät ist! Ich las Bücher, sprach mit Experten, recherchierte; aß mit alemannischen Narrenvereinen zur Fasnacht traditionelle Mehlsuppe oder probierte mich während des zweiten Corona-Lockdowns in einer Online-Degustation durch die torfigsten und ausgefallensten Whiskeys der Welt. Ich besuchte Start-ups, die mit technologischen Ideen und ausgefeilten Produkten Foodwaste reduzieren wollen – oder sogar Rindfleisch im Labor züchten, um den Welthunger in Zukunft ohne Tierleid stillen zu können. Ich erntete Feldsalat, Spargel und Erdbeeren im Markgräflerland frisch vom Acker, kostete scharfe Micro-Greens aus der hochmodernen Aquaponik-Kreislauf-Anlage in Zürich; sprach mit einst erfolgreichen Unternehmerinnen, die Big-Business und Festanstellung liebend gerne gegen einen Bio-Schweinchenhof oder den Vertrieb selbst gemachter Grünkohl-Chips eingetauscht haben. Ich besuchte Menschen, die plastikfrei leben, guerilla-mäßig brachliegende Stadtflächen mit Essbarem bepflanzen, Fairteiler-Stellen für übrig gebliebene Lebensmittel organisieren, oder Getreidemüller, die bereits seit 200 Jahren, in sechster Generation, die Familientradition im Südschwarzwald aufrechterhalten.
Über die Jahre habe ich unzählige Menschen getroffen, interviewt und begleitet, für die Essen eine besondere Bedeutung hat. Manche habe ich für dieses Buch ein zweites oder drittes Mal gesprochen, andere erst ganz neu kennengelernt. Bei all den Alltagshelden, Foodbegeisterten, Forschenden, Spitzenköchinnen und -köchen möchte ich mich für die Unterstützung bedanken. Was ich von Ihnen allen gelernt habe? Essen ist ein großartiges Thema, über welches zu lernen, zu sehen, zu erschmecken und zu schreiben ich nie müde werden könnte.
KAPITEL 120 Thesen, die Essen ESSENziell machen
1. These: ESSEN IST … HEIMAT
Kulturelle Heimat: Abenteuerurlaub? Nicht ohne meine Butterbrezel
Nach dem Abitur reiste ich mit meiner Freundin sechs Wochen lang durch Südostasien: Wir aßen duftende Chicken-Currys, frittiertes Street Food, exotische Früchte, die ganz neu und aufregend für unsere süddeutsch geprägten Geschmacksknospen waren. Schön und gut, aber wir begannen irgendwann von Butterbrezeln und Omas Hackbraten zu träumen – und hätten für eine Scheibe Vollkornbrot alles getan. Als wir dann nach über drei Wochen auf Reisen in Nordbali plötzlich vor einem kleinen, schnuckeligen Laden mit dem Schild »German Bakery« standen, konnten wir unser Glück kaum fassen: Vollkornbrötchen und Bierschinken, Emmentaler, Leberwurst und ein ganzes Glas Essiggurken verputzten wir schmatzend und überglücklich direkt vor dem Laden auf Plastikhockern. Die Sehnsucht nach heimischen Geschmäckern war so groß, dass wir den CO2-Fußabdruck und auch die rund 30 Euro für ein Abendessen in Kauf nahmen (normalerweise konnte man davon als Backpacker drei bis vier Tage lang gut leben).
Wer fernab der Heimat sein ganz persönliches Soul Food isst, fühlt sich geborgen, aufgehoben und daheim! Der Volkskundler Ulrich Tolksdorf beschreibt das als eine »Konstanz der traditionellen Ernährungsweise«, etwa bei Flüchtlingen, Emigranten und Gastarbeitern zu beobachten, und bezieht sich dabei auf zahlreiche Ernährungsuntersuchungen. So wie wir als Deutsche in Asien von Vollkornbrot statt Reissuppe zum Frühstück träumen, so mag ein Italiener in Norddeutschland vermutlich auch nicht ständig Salzkartoffeln essen, nur weil man das dort eben so macht. Dass wir mögen, was wir schon immer gemocht haben, ganz nach dem Motto »Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht« nennt man »Geschmackskonservatismus«. Laut Spektrum-Magazin führt allein der häufige Kontakt mit Speisen zu einer Präferenz für das entsprechende Nahrungsmittel. »Auf diese Weise wird durch die Essgewohnheit die Nahrungsmittelpräferenz von einer Generation an die nächste weitergegeben.«
Übrigens: Von unserem sechswöchigen Südostasien-Trip zurück im kalten Deutschland angekommen, kochte ich dann wieder liebend gerne seifig-scharfe Glasnudelsalate mit frischem Koriander, Hähnchen in Sesammantel mit Erdnusssoße – und an einem Heiligabend sogar einmal für meine komplette Familie Gemüse-Tempura-Spieße und ein scharf-würziges Thaicurry. Essen kann Lücken füllen und sowohl Heimweh als auch Fernweh stillen – je nach aktuellem Bedürfnis!
Essen ist immer auch ein Stück weit Kultur. Weltweit landen nämlich die unterschiedlichsten Zutaten in Kochtöpfen. Und je nachdem, wo und zu welcher Zeit man aufgewachsen ist, kann man damit etwas anfangen oder nicht. Für meine Oma ist die Vorstellung, Sushi – beziehungsweise rohen Fisch – zu essen, schon verstörend. Die »Seafood-Studie 2014« des Marktforschungsunternehmens Ipsos zeigt, dass tatsächlich zwei Drittel der über 50-Jährigen in Deutschland nie Sushi essen. Mein ältestes Patenkind Emma (2011 geboren) hat hingegen schon mit vier Jahren am liebsten California Rolls gegessen, weil sie mit dem japanischen Restaurant um die Ecke aufgewachsen ist und ihre Mama Sushi liebt.
Eine Journalisten-Kollegin erzählte mir mal von einer Hochzeit, zu der sie und ihr Mann in der chinesischen Provinz Shandong eingeladen waren – und bei der tatsächlich jede Menge China-Klischees auf der Festtafel standen: Schildkrötensuppe im Panzer zur Vorspeise, unzählige Tellerchen mit Käfern, Hühnerfüßen und Hundefleisch zum Hauptgang. »Wir konnten es einfach nicht glauben – und natürlich auch nichts davon essen«, sagte sie kopfschüttelnd, »der Kopf hat das einfach nicht zugelassen!« Weitere Essensbeispiele, die einem Deutschen die Nackenhaare zu Berge stehen lassen, gibt es unzählige: Meerschweinchen in der Andenregion (Cuy), Froschschenkel in Frankreich, der Westschweiz, Belgien und Luxemburg (Cuisses de Grenouille), Gammel-Grönlandhai in Island (Hakarl), Quallensalat oder Seeigel in Japan, Ameisen-Larven in Mexiko (Escamol), gegrillte Ratte sowie sehr weit angebrütete Enten- oder Hühnereier in großen Teilen Südostasiens (Balut). Warum das für uns nicht wirklich Kochzutaten oder lecker klingende Gerichte sind? Zum einen bestimmt die Region das Angebot, zum Beispiel werden am Meer viele verschiedene Meeresfrüchte, Fische und Algen gegessen, während der Durchschnittsdeutsche in der Regel regelmäßig nicht viel mehr als Lachs (26 Prozent), Garnelen (12 Prozent), Seelachs (10 Prozent) und Thunfisch (9 Prozent) – oft in Fertiggerichten oder aus der Dose – zubereitet. Zweitens hat die wirtschaftliche Situation der Menschen sicher einen Einfluss darauf, ob wilde Kräuter, Wurzeln und Krabbeltiere regelmäßig auf dem Esstisch landen oder mittlerweile mehr auf kultivierte Gemüse- und Fleischsorten zurückgegriffen wird. Doch zusätzlich sind unsere kulinarischen Vorlieben auch stark von unseren Werten und Erfahrungen geprägt: »Es sind die Normen und Konventionen der Gesellschaft, die bestimmen, was als Nahrungsmittel angesehen wird, was und wie es bei welchem Anlass (in welcher Situation) gegessen wird«, schreibt Ulrich Tolksdorf. In jedem Kulturkreis gibt es also relativ klare Regeln und Normen, was auf den Speiseplan gehört – und was nicht. Wir essen keine Hunde oder Meerschweinchen, weil sie bei uns geliebte Haustiere sind. Wir möchten keine Ratten oder andere Krabbeltiere essen, weil sie spätestens seit den großen Pestausbrüchen im Mittelalter als dreckige Krankheitsüberträger gelten.
Außerdem prägt die vorherrschende Religion, ob wir nun an Gott glauben oder nicht, die Essgewohnheiten ganzer Kulturkreise. Denn innerhalb von Religionsgemeinschaften gelten oft klare Verbote, wie im Islam und im Judentum etwa der Verzicht auf Schweinefleisch und -blut, weil es als »unrein« gilt; im Hinduismus gilt die Kuh als heiliges Tier – was zum Verzicht auf Rindfleisch führt. Christen sollen in der Fastenzeit, also in den 40 Tagen zwischen Aschermittwoch und Ostern komplett auf Fleisch und tierische Produkte verzichten. Findige Schwaben haben deshalb, vermutlich bereits zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648), die vielseitigsten Maultaschen-Rezepte entwickelt. In der würzigen Füllung versteckt sich in der Regel Fleisch, aber weder Gott noch die Mitmenschen können das sündige Innere erahnen. »Herrgottsb’scheißerle« nennen Schwaben ihre Maultaschen deshalb auch liebevoll. »Praktisch jede Religion greift in das Essverhalten ihrer Anhänger ein«, schrieb der Deutschlandfunk-Journalist Christian Röther 2020 in einem Beitrag mit dem Titel »Speisevorschriften in Religionen – Du bist, was du isst«. Aber warum eigentlich? Das biete Orientierung, schaffe Ordnung, stifte Identität und biete die Möglichkeit der Abgrenzung zu anderen Glaubensgemeinschaften, zitiert Röther den Religionswissenschaftler Mehmet Kalender von der Universität Göttingen. Speiseverbote sind »sowohl Symptom als auch Instrument der sozialen Gliederung«, schreibt auch der deutsche Soziologe Karl Heinz Pfeffer.
Emotionale Heimat: Mit Geschmack und Duft zurück in die Kindheit
Kochen ist Heimat, der Geschmack eines Familienrezepts erfüllt uns mit Geborgenheit und Liebe. Und die Spaghetti Bolognese oder den Schweinebraten mit Knöpfle können nur Mama oder Papa so einmalig, so einzigartig, so lecker zubereiten. Der Hamburger Fernsehkoch Tim Mälzer, der bereits mehrere Heimat-Kochbücher herausgebracht hat und sich selbst eher als emotionalen Koch bezeichnet, statt auf aufwändiges Chichi zu setzen, sagte 2018 in einem Interview mit der SZ-Redakteurin Carolin Gasteiger:
»Heimat hat ja wenig mit der Region zu tun, in der man aufwächst, sondern mit dem Elternhaus. Je nachdem mit welchem Essen man von klein auf konfrontiert wird – der kulinarische Eindruck bleibt. Und der bildet schließlich die geschmackliche Heimat.«
Sein höchstes kulinarisches Ziel? »Ich möchte die Leute berühren und einen heimatlichen Gedanken in meine Gerichte hineinbringen.« Gelingen könne das nur mit Emotionalität und nicht mit Perfektion. »Diese Emotionalität zu erzeugen, schaffe ich mit Produkten und Aromen, die uns bekannt sind«, sagt Mälzer.
Und das Bekannte schmeckt uns eben nicht nur, sondern weckt auch auf faszinierende Weise Erinnerungen: Wenn mein Mann Apfelschorle trinkt, fühlt er sich augenblicklich an den Mittagstisch von seiner Oma Resi versetzt – und ist wieder der kleine Bub, der gleich mit dem Turnbeutel am Fahrradlenker zum Fußballtraining den Berg hinauf zum Sportplatz fahren muss. Beim Geschmack von Himbeersirup und -konfitüre stehe ich sofort unbeschwert und voller kindlicher Sammelfreude im Garten meiner Schweizer Großmutti mit knallroten Fingerkuppen zwischen den Himbeerbüschen und pflücke die süßen, reifen Früchte in mein Weidenkörbchen. Marcel Proust führt in seinem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (1913) »bedrückt durch den trüben Tag und die Aussicht auf den traurigen folgenden, einen Löffel Tee mit dem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine drin an die Lippen« und verspürt von einer auf die andere Sekunde »ein unerhörtes Glücksgefühl«. Der Sandkuchen in Form einer Jakobsmuschel mit schwarzem Lindenblütentee von Tante Léonie schmeckt ihm nicht nur hervorragend: »Mit einem Schlage waren mir die Wechselfälle des Lebens gleichgültig, seine Katastrophen zu harmlosen Missgeschicken, seine Kürze zu einem bloßen Trug unsrer Sinne geworden; es vollzog sich damit in mir, was sonst die Liebe vermag«, beschreibt er, »ich hatte aufgehört, mich mittelmäßig, zufallsbedingt, sterblich zu fühlen.« Viele Jahre später isst er solch ein Madeleine wieder und all die schönen Gefühle, die er damals verspürt hat, leben wieder in ihm auf, er fühlt seine komplette Kindheitswelt erneut und resümiert:
»Aber wenn von einer früheren Vergangenheit nichts existiert nach dem Ableben der Personen, dem Untergang der Dinge, so werden allein, zerbrechlicher aber lebendiger, immateriell und doch haltbar, beständig und treu Geruch und Geschmack noch lange wie irrende Seelen ihr Leben weiterführen.«
Diese berühmte Szene hat Geschmackserinnerungen auch den Namen Proust- oder Madeleine-Effekt eingebracht.
Doch was bei Marcel Proust so herrliche Glücksgefühle weckt, geht auch andersherum: Eine weniger tolle Erinnerung ruft bei mir zum Beispiel der Geruch von Gänsefleisch hervor: Für mich bedeutet er Tod, weil eines Nachmittags die schneeweißen, schnatternden Gänse unseres Nachbarn, die wir als Kinder immer mit leuchtenden Augen gefüttert hatten, von der Wiese verschwunden waren und ich den Gänsebraten dann zu Weihnachten essen sollte. Das ganze Haus roch nach dem Schweigen der Gänse. Bis heute überkommt mich ein Würgereiz, wenn ich Gänsefleisch oder Gänseschmalz rieche.
Tatsächlich wird unser Geschmacksempfinden laut der Universität Koblenz-Landau zu 80 Prozent vom Geruch bestimmt. Und Rachel Herz, Geruchsforscherin an der Brown University (USA), fand heraus, dass der Geruchssinn der einzige unserer Sinne ist, der direkt mit dem Emotionszentrum unseres Gehirns verbunden ist. Auch Wissenschaftler der Universität Toronto bestätigten mit Versuchen an Mäusen, dass es eine direkte Verbindung gibt, die Duftreize ungefiltert in das limbische System befördert, das für die Emotions- und Gedächtnisverarbeitung zuständig ist. Kein Wunder also, dass Gerüche Ängste, Glück, Ekel, Trauer und Freude wie keine andere Sinneswahrnehmung wecken können. Der Freiburger Volkskundler Andreas Hartmann schrieb 1994:
»Eine einzige, unerwartet aufblitzende Geschmacksempfindung, ein flüchtiger, von anderen Menschen kaum bemerkter Duft, selbst schon der bloße Gedanke an ein bestimmtes Aroma vermag längst vergangene Lebensabschnitte so deutlich in Erinnerung zu rufen, dass die Jahrzehnte, die sie von der Gegenwart trennen, dahinschwinden.«
In seinem Buch Zungenglück und Gaumenqualen. Geschmackserinnerungen (C. H. Beck, 1994) hat Hartmann kulinarische Erinnerungen dutzender Menschen gesammelt – mal lustig, mal erschütternd, mal wie eine innige, warme Umarmung. Schnell wird beim Lesen wenig überraschend klar: »Kindheit schmeckt süß«, denn vor allem süße Köstlichkeiten wie Streuselkuchen, frische Erdbeeren oder Pfannkuchen wecken bei vielen Menschen Gefühle von Geborgenheit und Unbeschwertheit, weil sie damit einst von der Mutter oder Großmutter liebevoll umsorgt, getröstet und beglückt wurden. Aber auch urkomische Geschmackskombinationen haben wohl die Macht, wohlige Erinnerungen in uns zu wecken. Eine Frau erinnert sich in Hartmanns Sammelband zum Beispiel daran, wie köstlich Omas Eier mit Metalllöffeln geschmeckt haben: »Diesen eigentümlichen Geschmack, der aus der chemischen Verbindung von Messing und Eiweiß offenbar entstehen muss, hielt ich für das absolut besondere an Omas Eiern.« Für einen anderen Erzähler ist Grießbrei mit Leberwurstbrot der ultimative Kindheitsgeschmack.
Oft sind Geschmackserinnerungen, so verrückt sie auch klingen mögen, schönes Zungenglück. Doch sie können eben auch Gaumenqualen sein, und zwar nicht nur, wenn wir uns daran erinnern, dass wir uns nach dem Motto »Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt« durch Leber, Rosenkohl und (bei mir ganz schlimm) Paprika quälen mussten. Manchmal erzeugt ein Geschmack auch pure Angst oder rüttelt längst verdrängte Schockerlebnisse wach: Der Geruch von gekochtem Fleisch löste bei einem ehemaligen Soldaten in Hartmanns Sammlung etwa die Erinnerung an die Bergung einer Leiche im Zweiten Weltkrieg aus: »In Lokalen und der eigenen Küche fliehe ich bei Wahrnehmung dieses mir so unerträglichen Geruchs, und es dauert jedes Mal eine Zeit, bis ich mich wieder gefangen habe.« Auch Geruchsforscherin Rachel Herz berichtete in Interviews schon mehrfach von einer US-Soldatin, die den Geruch von gegrilltem Fleisch nicht erträgt, weil die tödlichen Anschläge in Afghanistan ähnlich gerochen haben müssen. Ein Geruch oder Geschmack kann Menschen also so sehr triggern, dass sowohl pure Glücksgefühle als auch schlimme traumatische Emotionen voller Ekel und Angst wiederbelebt werden. Diese Tatsache zeigt, wie viel Macht und Potenzial Essen hat, zu unserem Wohlbefinden beizutragen.
2. These: ESSEN IST … NATUR
Aha-Momente: Fast alles ist essbar
Als ich 2008 zum ersten Mal mit meiner thailändischen Stiefmutter in ihrem Heimatdorf war, machten wir einen Spaziergang, vorbei an sattgrünen Reisfeldern, dichten Büschen und Tümpeln, in denen sich Wasserbüffel suhlten. Und bei jedem Schritt ließ sie den Blick schweifen, pflückte hier und da Blätter und Beeren, vermeintliche Grasbüschel und Pilze, bis die Plastiktüte, die sie in der Hosentasche dabeihatte, randvoll mit Grünzeug war: »Das ist Gemüse fürs Abendessen«, sagte sie. Ich war verwundert, wie viele Pflanzen in Thailand scheinbar essbar sind.
Doch zurück in Deutschland war mein Interesse geweckt und über die Jahre hatte ich immer wieder solche Schlüsselmomente. Als Journalistin begleitete ich Kräuterpädagoginnen, Sterneköche und Buchautoren auf Streifzügen durch die Natur und aß dabei honigsüße Taubnesselblüten und senfig-scharfes Wiesenschaumkraut direkt vom Wegesrand. Der Schweizer Koch Maurice Maggi erzählte mir zum Beispiel voller Begeisterung, wie er zu den verschiedenen Jahreszeiten mitten in der Großstadt Zürich Löwenzahn, Veilchenblüten, junge Baumblätter und sogar schwarze Trüffel erntet. Privat machten mich diese Erlebnisse mutiger: Ich begann Pesto und Butter aus Bärlauch zu machen, Honig aus Löwenzahnblüten zu kochen und besuchte extravagante Restaurants, die sich der Verarbeitung wilder Zutaten verschrieben haben. Sternekoch Raimar Pilz aus Bad Säckingen serviert in seiner »Genussapotheke« beispielsweise Wildkräuterpestos und dekoriert seine kulinarischen Köstlichkeiten mit den buntesten essbaren Wald- und Wiesenblüten. Und beim Schweizer Sternekoch Stefan Wiesner bekommt man Reh mit Moos-Sößchen, Flechten und eingelegten Zirbennadeln kredenzt, kann Bachforelle mit Bachwasser, Blattgold und Kieselstaub probieren oder mit Vogelbeeren, Heu und Kohle verfeinerte Zwischengänge genießen. Zugegeben: Der auch als »Hexer vom Entlebuch« bekannte Sternekoch treibt es europaweit mit seinem kulinarischen Konzept auf die Spitze. Aber eines kann man von solch naturnahen und kreativen Köchen lernen: Auch in unseren Breitengraden ist fast alles essbar – zumindest bei korrekter Zubereitung! Und Hunderttausende von Jahren ernährten wir Menschen uns von dem, was die Natur uns schenkte – ganz ohne Anbaupläne, Massenproduktion und Convenience-Angebote.
Warum Oma die wilde Küche dank Dosenravioli verlernt hat
Erinnert sich meine Oma (1940 geboren) an ihre Kindheit, erzählt sie von langen Sonntagswanderungen durch die Täler des Südschwarzwaldes: »Wir haben wilden Spinat, Heidelbeeren und Feldsalat gesammelt, um damit frisch zu kochen.« Oder: »Meine Mutter war sehr einfallsreich, um Vielfalt auf den Nachkriegs-Tisch zu zaubern, hat sie zum Beispiel immer Honig aus jungen Tannentrieben gemacht – der war lecker!« Aber sie gibt auch zu bedenken: »Wir haben das damals gemacht, um nicht zu verhungern, weil Nachkriegszeit war und wir nix hatten!« Verhungern? Das ist natürlich ein sehr überspitztes Wort. »Dass die Großmama eben nicht verhungerte, lag damals nicht an wilden Genüssen, sondern an den Alliierten, die trotz akuter Versorgungsprobleme in ihren eigenen Heimatstaaten unsere deutsche Bevölkerung schlicht versorgten«, gibt der auf Konsum- und Ernährungsgeschichte spezialisierte Historiker Uwe Spiekermann zu bedenken und ergänzt: »Aber gewiss, ›Wildes‹ war in der Nachkriegszeit Ergänzung im Speiseplan vieler, um Mangel- und Fehlernährung zu bekämpfen.«
Doch später, als meine Oma selbst Mutter und irgendwann meine Großmutter wurde, kamen ihr diese wilden Zutaten nicht mehr in die Küche. Höchstens ein paar frische Löwenzahnblätter darf ich ab und zu für sie pflücken, die sie im Frühling unter ihren Salat mischt. »Heute haben wir ja alles, müssen nicht mehr stundenlang durch den Regen spazieren auf der Suche nach Nahrung«, erklärt sie. Supermarktprodukte bedeuten für diese Generation Wohlstand. Und nicht zuletzt, weil Supermärkte laut Spiekermann in den 1960er-Jahren in Westdeutschland aufkamen und ab den 1970ern in großer Zahl das Stadtbild und schließlich das Konsumverhalten der Menschen prägten. Lebensmittelgiganten gab es bereits im 19. Jahrhundert. Doch erst in der Nachkriegszeit entstanden diverse bezahlbare Fertigprodukte, die durch den Supermarktboom plötzlich für jeden verfügbar waren. Konzerne wie Nestlé, Knorr, Dr. Oetker, Pfanni & Co. brachten nach und nach ihre bekannten Fertigknödelpulver (ab 1949), Dosenravioli (ab 1955), Fischstäbchen (ab 1959) und Tiefkühlpizzen (ab 1970) auf den Markt und priesen das Convenience-Food als fortschrittlich, zeitsparend und die Erlösung der überlasteten Hausfrauen an, die zum Leben in der Küche verdonnert waren. »Im Nu«, »Wenn man’s eilig hat« oder »Knorr macht es uns Hausfrauen leicht« war damals als Werbebotschaften auf Plakaten, in Tageszeitungen und im Fernsehen zu lesen und zu hören. Die Konzerne trafen damit den Nerv der Zeit, denn in den 1970er-Jahren arbeiteten zwar immer mehr Frauen, sie hatten aber immer noch (in der Regel alleine) Haushalt und Kindererziehung nebenbei zu stemmen. Diese Doppelbelastung trug zusätzlich zum Aufstieg von Fertigprodukten bei. »Die Conveniencewelle der 1970er-Jahre wurde außerdem durch die zunehmende Technisierung beflügelt«, sagt Uwe Spiekermann, »in der Produktion hielten neue Kunststoffverpackungen, Trocknungs- und Kühltechniken sowie Vorverarbeitungsmethoden, etwa von Fleisch, Einzug. Haushalte verfügten immer häufiger über eigene Kühlschränke, Grills und Mikrowellen.« Die schnellen Leckereien waren seither aus den Küchen der modernen Frauen, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, nicht mehr wegzudenken. Etwas zugespitzt kann man also sagen, dass Oma das Kochen mit wilden Zutaten dank Dosenravioli verlernt hat.
Die Wiederentdeckung: Natürliches mit Repräsentationscharakter
Der wohl berühmteste Naturkoch, Stefan Wiesner, der mit naturnaher Küche in der Schweiz (erst im »Rössli« in Escholzmatt, seit 2023 im »Weitsicht« in Bramboden, Kanton Luzern) seit 2007 einen Michelin-Stern hält und seit 2021 auch zwei grüne Sterne für nachhaltige sowie saisonale Gastronomie hat, sagt ebenfalls: »Die Menschen haben das Kochen mit urnatürlichen Zutaten verlernt, weil die Nahrungsindustrie und die Werbung sie stark beeinflusst haben.« Er beobachtet in den letzten Jahren aber eine Rückbesinnung auf das Natürliche: »Zum Glück entdecken wieder immer mehr junge Köche natürliche Zutaten für sich, zeigen Interesse, Neugier und damit auch Respekt vor unserer Natur.« Er selbst geht mit offenen Augen durch die Welt und nutzt fast alles, was die Natur bereithält für seine Gerichte: Wilde Kräuter und Blüten zum Würzen und Verfeinern, Erde, Steine, Kohle und Leder zum Aromatisieren und Räuchern. Aber auch alles vom Baum – von den zarten Blättern, Nadeln, Knospen, Nüssen und Blüten, bis hin zur scheinbar nutzlosen Baumrinde oder dem Baumsaft, den er destilliert, um ganz neue Geschmäcker zu erzeugen. »Ich lasse zum Beispiel auch Ameisen arbeiten, um Kürbisse oder andere frische Zutaten zu fermentieren«, sagt er. Im Kochfernsehen sieht er öfter, dass tote Ameisen zum säuerlichen Würzen von Speisen genutzt werden. »Das wäre für mich unvorstellbar«, so Wiesner, »ich arbeite lieber mit den Tieren, als sie der Natur zu entreißen.« Sein Credo: »Mit Anstand und Demut mit der Natur kochen!« Hobbyköchen, die sich der naturnahen Küche annähern möchten, empfiehlt er: »Lernen Sie Ihre Umgebung kennen und entdecken Sie mit Neugier und Freude wilde Beeren, Blüten und Kräuter – fast alles ist essbar und heraus kommen wunderbare Gerichte!«
Maria Groß
© Adria Liebau
Auch die Erfurter Köchin Maria Groß, die vielen als TV-Jurorin aus »Die Küchenschlacht« (ZDF) und »The Taste« (Sat.1) bekannt sein dürfte – und 2013 mit 34 Jahren Deutschlands jüngste Sterneköchin war, sagt: »Wir sollten uns von der Industrie nicht einreden lassen, dass Natur nicht essbar ist!« Ob süße Früchte, bittere Gesundmacher, scharf-würzige Senföle – sie schenken uns so viel. Nach vielen Jahren in der Spitzengastronomie hat sie sich 2015 gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Matthias Steube in ihrer Heimat Erfurt selbstständig gemacht. In der »Bachstelze« setzt das Paar auf authentische Natürlichkeit – und kocht mit regionalen, saisonalen und natürlichen Zutaten:
»Ich liebe es, die Natur mit allen Sinnen zu entdecken – vom Bärlauch im Frühling bis zum knackig-krautigen Giersch im Herbst, auch im Blumengarten kann man wahnsinnig viel essen, wie zum Beispiel frische Dahlien, die man gezupft einfach über den Salat streuen kann.«
Die Geschmäcker und Möglichkeiten seien schier grenzenlos. Das Problem: »Wir vertrauen heutzutage der Industrie mehr als der Natur, haben Angst vor dem Fuchsbandwurm, Angst, dass wir ein falsches Kraut erwischen – aber wir sind Teil der Natur und sollten lernen, Mutter Natur wieder zu vertrauen.« Bei unserem Telefoninterview fragt sie: »Wie kann es sein, dass wir Angst vor einer frisch gepflückten wilden Brom- oder Heidelbeere haben, aber gleichzeitig nicht hinterfragen, dass Supermarkt-Heidelbeeren mittlerweile so unnatürlich groß wie Cocktailtomaten sind?« Wilde Walderdbeeren im Frühsommer, Blaubeeren im Sommer, schwarzer Holunder im Herbst – diese Beeren seien winzig und nicht mehrere Jahre haltbar wie manch ein Convenience-Food. »Aber sie sind einfach superlecker, hyperregional und frisch«, sagt die Spitzenköchin.
Im Zweifelsfall kann man zum Einstieg gemeinsam mit Wildkäuter-Pädagogen über die heimischen Wiesen streifen und die wilden Genüsse Blatt für Blatt und Stängel für Stängel kennenlernen. »Wenn ich im Urlaub bin, entdecke ich auch gerne Pflanzen anderer Regionen«, sagt Maria Groß, »Einheimische können gut dabei helfen, Neues zu entdecken!« Und nicht zuletzt sei das Kochen mit wilden Zutaten auch ein Beitrag für die Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel: »Man tut am meisten Gutes, wenn man registriert, wo man lebt und das nutzt, was unsere Region und unsere Natur uns bieten.«





























