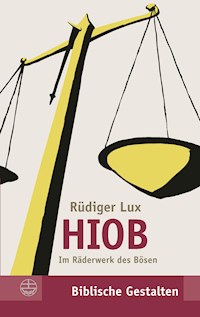
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biblische Gestalten (BG)
- Sprache: Deutsch
Hiob, der leidende Gerechte, wurde in der Weltliteratur zum Symbol für das Rätsel des Bösen. Literaten, Theologen und Philosophen haben sich von dieser Gestalt immer wieder anregen lassen und nach Antworten gesucht. Diese sind so zahlreich wie die Leser des Buches. Jedoch bleibt jede hinter dem, was Hiob erdulden musste, hinter seiner Klage, seiner Anklage und seinem Schweigen zurück. Eine Antwort auf das Theodizeeproblem gibt es nicht. Einfühlsam, klug und in feiner Sprachform sagt Rüdiger Lux warum. Weil Hiob mehr ist als ein Problem! Er ist ein unschuldig leidender Mensch, einer der paradigmatisch für die Leiden seines Volkes Israel in der Geschichte sowie die Leiden aller Menschen steht. Mit ihm rühren der Glaube und das Denken an ihre Grenze, an Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biblische Gestalten
Herausgegeben von
Christfried Böttrich und Rüdiger Lux
Band 25
Rüdiger Lux
Hiob
Im Räderwerk des Bösen
Rüdiger Lux, Dr. theol., Jahrgang 1947, studierte Evangelische Theologie in Halle/Saale und in Greifswald. Er war Gemeinde- und Studentenpfarrer in Cottbus und Halle/Saale sowie nach seiner Promotion (1977) und seiner Habilitation (1992) Dozent für Altes Testament an der Kirchlichen Hochschule in Naumburg. Von 1995 bis zu seiner Emeritierung 2012 war er Professor für Exegese und Theologie des Alten Testaments an der Universität Leipzig und viele Jahre Universitätsprediger.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar.
3. Auflage 2018
© 2012 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Umschlaggestaltung: behnelux gestaltung, Halle/Saale
Satz: Steffi Glauche, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
ISBN 978-3-374-05762-7
www.eva-leipzig.de
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
A Einführung
1. »Widerstand und Ergebung«
2. Vom Leiden als »Fels des Atheismus«
3. Unde malum – Woher das Böse? I
B Darstellung
1. »Hiob« im Alten Orient
1.1. Ludlul bēl nēmeqi
1.2. Das »Gespräch des Lebensmüden mit seinem Ba«
2. Hiob außerhalb des Hiobbuches
3. Das Hiobbuch – Aufbau und Entstehung
4. Der Prolog
4.1. Hiobs Glück
4.2. Satans erster Anschlag
4.3. Hiobs erste Bewährung
4.4. Satans zweiter Anschlag
4.5. Hiobs zweite Bewährung
Exkurs 1: Hiobs Frau?
4.6. Hiob und seine Freunde.
5. Die Dialogdichtung
5.1. Hiobs Klage
5.2. Die Freundesreden
5.2.1. Elifas: Unheil wächst nicht aus dem Acker
Exkurs 2: Unde malum – Woher das Böse? II
5.2.2. Bildad: Frage doch die vor dir waren
Exkurs 3: Ich weiß, dass mein Löser lebt
5.2.3. Zofar: Dies irae – Tag des Zorns
5.2.4. Gescheiterte Seelsorge!?
5.3. Wo will man Weisheit finden?.
5.4. Bilanz eines Lebens
5.4.1. Seine Leuchte über meinem Haupt
5.4.2. Ein Bruder der Schakale bin ich
5.4.3. Wäge mich auf gerechter Waage
5.5. Elihu – der verspätete Freund
5.5.1. Da entbrannte der Zorn
5.5.2. Gott ist größer als der Mensch
5.5.3. Ferne sei es, dass Gott frevelt
5.5.4. Blicke zum Himmel auf.
5.5.5. Wer ist ein Lehrer wie er?
5.6. Gottes Reden aus dem Wettersturm.
5.6.1. Wo warst du, als ich die Erde gründete?
5.6.2. Hast du einen Arm wie Gott?.
Exkurs 4: Wie viel Macht hat der Allmächtige?
5.6.3. Darum widerrufe ich
6. Reden über Gott – reden zu Gott?
7. Mehr als ein Happy End!
C Wirkung
1. Stimmen der Neuzeit
2. Sören Kierkegaard – Welt als Wiederholung?
3. Rudolf Otto – Vom Recht des Irrationalen
4. Carl Gustav Jung – Wandlungen Gottes
5. Ernst Bloch – Wandlungen Hiobs
6. Vom Trost der Musik – eine Hiobspredigt
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
VORWORT
Der Mensch kennt viele Gestalten des Leidens. Nicht über jede Erfahrung im Räderwerk des Bösen kann er reden. Es gibt eine Leidenswucht, die ihn auf den Mund schlägt und verstummen lässt. Oft hat er sich dann, wenn ihm die eigenen Worte fehlten, die Sprache anderer Leidender geliehen. Was er selbst nicht sagen konnte, fand er in den Erzählungen, Klagen und Gebeten Israels wieder. Der sprachlos Leidende richtete sich auf an der Sprache derer, die vor ihm gelitten hatten, an Hiob, dem leidenden Gerechten. Mit seinen Klagen und Anklagen brachen die Verstummten ihr Schweigen. Denn was in diesem Buch verhandelt wird, das war ihnen keine fremde Geschichte, das wurde zur eigenen Geschichte.
Selbst wenn die Geschichte des Hiob zu keiner Zeit so geschah, frei erfunden ist, sie ist auf ihre eigene Weise eine wahre Geschichte. Wahrhaftiger, echter und tiefer ist sie als jede gewissenhafte Chronologie des Bösen es jemals sein könnte. An einem Einzelnen wird die Leidensgeschichte der Menschheit demonstriert. Johann Gottfried Herder hat davon gesagt: »Seine (des Hiobbuches) starke und tiefe Poesie machts zur Geschichte wie es wenige gibt: es wird die Geschichte aller leidenden Rechtschaffenen auf der Erde.« So verwundert es nicht, dass dieses Buch immer wieder das Interesse von Malern, Dichtern, Musikern, Philosophen, Psychologen und vielen anderen fand, um mit ihm den Erfahrungen des Leidens und des Bösen standzuhalten, die unser Leben und Wissen verdunkeln.
Das vorliegende Buch ist aus Vorlesungen und Seminaren hervorgegangen, die ich in 25 Jahren Lehrtätigkeit an der Kirchlichen Hochschule in Naumburg und an der Theologischen Fakultät in Leipzig gehalten habe. Dabei haben sich mit den Jahren die Perspektiven immer wieder verschoben. Ständig erschienen Hiob, seine Freunde und der Gott des Hiobbuches in einem anderen Licht. Dazu hat nicht nur die neuere Hiobforschung beigetragen. Eine Auseinandersetzung mit ihr konnte dem Charakter der Reihe der »Biblischen Gestalten« entsprechend nur am Rande geführt werden. Der Kenner weiß ohnehin um die Probleme, die auch hinter den in diesem Band vertretenen Positionen stehen.
Neben der zu Rate gezogenen Forschungsliteratur, von der im Literaturverzeichnis nur eine Auswahl geboten wird, waren für mich im Prozess des Nachdenkens und Schreibens die Fragen und Anregungen der Studierenden wichtig, die oft mit Eifer bei der Sache waren. Ihnen sei an dieser Stelle für ihr Mitdenken und ihre kritischen Rückfragen gedankt.
Ein besonderer Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Leonie Ratschow hat Literatur beschafft, das Manuskript sorgfältig durchgesehen und wertvolle Hinweise zur sprachlichen und sachlichen Gestaltung des Textes gegeben. Friederike Kaltofen hat gewissenhaft Korrektur gelesen und Daniel Schumann die Druckvorlagen für die Abbildungen erstellt. Meinem ehemaligen Assistenten, PD Dr. Raik Heckl, danke ich für viele wichtige Anregungen und Gespräche im Vorfeld der Entstehung dieses Buches. Frau Dr. Annette Weidhas und den Mitarbeitern des Verlages, die mit der Lektorierung, dem Satz sowie der Herstellung und Drucklegung beschäftigt waren, sei für die gute Zusammenarbeit gedankt. Bleibt schließlich nur der Wunsch, dass auch der Hiob unter den »Biblischen Gestalten« seinen Weg zu interessierten Lesern finden möge.
Leipzig, am Reformationstag 2011Rüdiger Lux
»Dieses Buch ist für den einzelnen, der durch die Finsternis gegangen ist. Wir, die wir nicht auf diese Art gelitten haben, sind nicht ermächtigt, seine Antwort zu der unseren zu machen. Natürlich können wir in Ijob einen ›Reiter in die Morgendämmerung‹ sehen – doch dazu müssen wir ihm zuerst einmal durch die Finsternis folgen.«
Albert H. Friedlander
A EINFÜHRUNG
1. »WIDERSTAND UND ERGEBUNG«
Die Lektüre des Hiobbuches gleicht einer Reise in die Dunkelheit. Dabei handelt es sich aber nicht um jedes Dunkel schlechthin, sondern um eine ganz bestimmte Finsternis. Man kann sie als Gottesfinsternis bezeichnen, von der Martin Buber gesagt hat, sie sei »in der Tat der Charakter der Weltstunde, in der wir leben«.1 Wer sich auf diese Reise einlässt, kann allerdings die Erfahrung machen, dass ihm dabei ungeahnte Kräfte und ein tiefer Trost widerfahren. Denn das Hiobbuch ist keine Schrift, die ihren Lesern lediglich die sprichwörtlich gewordenen Hiobsbotschaften präsentiert, Botschaften von bösen Schicksalsschlägen und tiefem Leid. Dieses Buch wird sich bei näherem Hinsehen und einer ernsthaften Auseinandersetzung mit ihm auch als ein Trostbuch erweisen, das viele Menschen im Räderwerk des Bösen stärkte. Es ist ein Buch von wahrer und falscher Freundschaft, von tiefer Einsamkeit und dem verzweifelten Ringen um einen letzten Halt, von tabulosen Fragen und vorläufigen Antworten, von Widerstand und Ergebung. Dietrich Bonhoeffer hat in einem Brief aus der Haft an den Freund Eberhard Bethge deutlich gemacht, wie aus beidem ein Ahnen hervorgehen kann, dass menschliches Leben und Leiden mehr ist als ein blindes Schicksal. Er schrieb am 21. Februar 1944:
»Neulich mußte ich einmal anläßlich Hiob cap. 1 daran denken, daß der Satan sich vom Herrn die Erlaubnis holt zu versuchen, mich in dieser Zeit von meinen Freunden zu trennen – und daß ihm das nicht gelingen soll!«2
Für den Häftling in der Militärabteilung des Gefängnisses in Berlin-Tegel wird das Hiobbuch zum Spiegel eigener Erfahrung. Die Haft wird zur Versuchungsgeschichte. Die satanische Prüfung besteht in der Trennung von den Freunden, im Versinken im Abgrund der Einsamkeit. Bonhoeffer ist jedoch gewiss, dass der »Satan« an ihm und den Freunden scheitern wird. Aber diese Gewissheit kommt nicht besserwisserisch und selbstsicher daher. Es ist eine suchende, um den rechten Weg ringende Gewissheit, die Gott nicht für sich und das eigene Leben vereinnahmt. Vielmehr respektiert sie die Freiheit Gottes, sich auch hinter einem undurchschaubaren und nur schwer zu ertragenden Geschick zu verbergen:
»Ich habe mir hier oft Gedanken darüber gemacht, wo die Grenzen zwischen dem notwendigen Widerstand gegen das ›Schicksal‹ und der ebenso notwendigen Ergebung liegen. Der Don Quijote ist das Symbol für die Fortsetzung des Widerstands bis zum Widersinn, ja zum Wahnsinn – ähnlich Michael Kohlhaas, der über die Forderung nach seinem Recht zum Schuldigen wird – […] der Widerstand verliert bei ihm letztlich seinen realen Sinn und verflüchtigt sich ins Theoretisch-Phantastische. […] Ich glaube, wir müssen das Große und Eigene wirklich unternehmen und doch zugleich das selbstverständlich- und allgemein-Notwendige tun, wir müssen dem ›Schicksal‹ – ich finde das ›Neutrum‹ des Begriffes wichtig – ebenso entschlossen entgegentreten wie uns ihm zu gegebener Zeit unterwerfen. Von ›Führung‹ kann man erst jenseits dieses zwiefachen Vorgangs sprechen, Gott begegnet uns nicht nur als Du, sondern auch ›vermummt‹ im ›Es‹, und in meiner Frage geht es also im Grunde darum, wie wir in diesem ›Es‹ (›Schicksal‹) das ›Du‹ finden, oder m. a. W. […] wie aus dem ›Schicksal‹ wirklich ›Führung‹ wird.«3
Das Hiobbuch lotet diese Spannung zwischen Widerstand und Ergebung, die das Leben Hiobs förmlich zu zerreißen droht, bis in eine Tiefe hinein aus, die ihresgleichen in der Literatur der Antike wie auch der Moderne sucht. Es schreit nach dem Du Gottes, der die teilnahmslose Larve des Es trägt. Einerseits widersetzt sich Hiob mit all seiner ihm verbliebenen Kraft dem Geschick, das über ihn wie aus dem Nichts hereingebrochen ist und für das er doch keinen anderen als Gott selbst verantwortlich zu machen wüsste. Er klagt vor Gott und den Menschen (Hi 3), ja, er geht so weit, dass er Gott selbst mit einer Schärfe anklagt, die dem frommen Leser den Atem raubt. Dabei schreckt er nicht davor zurück, Gott als seinen Feind zu brandmarken, der seine giftigen Pfeile auf ihn abgeschossen und seine Nieren gespalten habe (Hi 6,4;16,3). Schlimmer noch! Hiob macht Gott einen geradezu ungeheuerlichen Vorwurf:
Die Erde wurde in die Hand eines Verbrechers (rascha’) gegeben.
Das Angesicht ihrer Richter verhüllt er.
Wenn nicht (er), wer ist es denn sonst? (Hi 9,24)
Gott ein Verbrecher, der die Augen der Richter verhüllt, diejenigen mit Blindheit schlägt, die für Recht und Gerechtigkeit einzustehen haben? Gott ein seelenloses Es, ein Ding, das wie eine gewaltige Kriegsmaschine die Menschen ohne Ansehen der Person in Staub und Asche legt? So hatte noch keiner gewagt, von Gott zu reden. In dieser Freiheit hatte noch keiner dem widerstanden, aus dessen Hand er bisher alles widerstandslos hingenommen hatte, das Gute und das Böse (Hi 2,10).
In Hiob kommt damit zweierlei zum Durchbruch: Das Ende der Geduld, auch der Geduld mit Gott, und die Freiheit des Leidenden Widerstand zu leisten, zu klagen und anzuklagen. Aber nach schmerzhaften Dialogen und Monologen, in denen sich weder Hiob und seine Freunde, noch Gott und Hiob gegenseitig etwas schenken, folgt schließlich auch jenes dem Leser beinahe ärgerlich und kleinlaut scheinende Wort der Ergebung:
Darum verwerfe ich (meine Anklage) und bereue
– auf Staub und Asche! (Hi 42,6)
Ist Hiob mit seinem Widerstand gegen Gott am Ende doch gescheitert? Sind Ergebung und Unterwerfung der Preis, den er zahlen musste, um am Ende schließlich doch gerechtfertigt (42,7) und wieder hergestellt zu werden (42,10–17)? Und war dieser Preis angesichts des abgrundtiefen Leides, das ihm widerfuhr, nicht viel zu hoch? Oder konnte sich Hiob am Ende in sein Geschick ergeben, weil sich ihm die Gottesfinsternis aufgehellt hatte, weil er hinter der undurchsichtigdämonischen Maske des Es, eines blinden Fatums, das Du des lebendigen Gottes entdeckt hatte, eines Gottes, der auch in der Finsternis auf der Seite der Leidenden steht? Ja, konnte er schließlich jenseits von Widerstand und Ergebung und im Abstand dazu so etwas wie Gottes führende Hand in alledem entdecken?
Das Hiobbuch ist ein in hohem Maße riskantes Buch. Einerseits riskiert Gott in ihm die Absage seines treuen Knechtes Hiob. Ja, er riskiert, dass in der himmlischen Wette am Ende der Satan Sieger bleibt. Andererseits riskiert aber auch der anklagende Hiob den Verlust Gottes, des Gottes, der ganz darauf setzt, dass er, der Dulder, die Kraft finden wird, dem Satan zu widerstehen, dass auch das Leid ihn nicht von Gott weg, sondern zu ihm hinführen wird. Was hier riskiert wird, das ist die Gottesbeziehung – die Hiobs zu Gott und die Gottes zu Hiob. Sie wird durch das Leiden einer geradezu erbarmungslosen Prüfung unterzogen. Und dabei ist das Scheitern keineswegs von Anfang an ausgeschlossen. Gibt es nicht genug Hiobsgestalten in der Geschichte des jüdischen Volkes und der Völker, denen ihr Gottvertrauen unwiderruflich zerbrach? Und werden diese leidgeprüften Glaubensstreiter nunmehr in einer undurchdringlichen Gottesfinsternis versinken? Oder ist gar das Scheitern ihres Glaubens ein erster Schritt in die Freiheit, eine Freisetzung der Vernunft, die endgültig darauf verzichtet, Gott als Argument in die Debatte der großen Welt- und Lebensrätsel einzuführen, zu denen das Böse gehört? Ist der Abbruch der Gottesbeziehung also kein Absturz in die Gottesfinsternis, sondern der Mut, sich fortan nur noch vom Licht der eigenen Vernunft leiten zu lassen?
2. VOM LEIDEN ALS »FELS DES ATHEISMUS«
Im 3. Akt des Dramas »Dantons Tod« von Georg Büchner (1835) trifft man auf eine Runde von Gefangenen im provisorisch zur Haftanstalt hergerichteten Palais du Luxembourg, die auf ihre Hinrichtung warten. Unter ihnen kommt es zu einer lebhaften philosophischen Debatte über die Revolution, den Sinn des Lebens, den Tod, die Unsterblichkeit und Gott. In ihr deklamiert der Häftling Payne:
»Schafft das Unvollkommene weg, dann allein könnt ihr Gott demonstrieren; Spinoza hat es versucht. Man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmerz; nur der Verstand kann Gott beweisen, das Gefühl empört sich dagegen. Merke dir es, Anaxagoras: warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus. Das leiseste Zucken des Schmerzes, und rege es sich nur in einem Atom, macht einen Riß in der Schöpfung, von oben bis unten.«4
Dieser Debattenbeitrag im Schatten der Guillotine ist in mehrfacher Hinsicht von Interesse. In ihm wird die Theodizeeproblematik, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts einer unvollkommenen von Naturkatastrophen, Seuchen, Kriegen und vielfältigen Leiden heimgesuchten Lebenswirklichkeit, auf den Punkt gebracht. Wie kann Gott angesichts des Bösen in der Welt zugleich allmächtig und gut sein? Müsste die Welt nicht, wenn er allmächtig und gut wäre, vollkommen sein? Kann also nur eine Welt der Vollkommenheit und ungetrübten Harmonie Gott demonstrieren, ihn glaubhaft und einsichtig machen, ja, gar beweisen? Und wäre eine solche Welt nicht der Garten Eden, den Adam, der Mensch, längst verspielt hat, das Paradies, der Himmel auf Erden? Eine Welt unserer Träume?
Aber, das Gedankenexperiment sei gewagt: was für ein Gott wäre das, was für eine Welt und was für ein Mensch, die keine Brüche, Risse, Spannungen, Kämpfe und Streit, keine Übel, Schmerzen, Leiden, Trauer, Tränen und Tod mehr kennen würden? Ist uns eine solche Vollkommenheit überhaupt vorstellbar? Und sollte dies der Fall sein, wäre sie wirklich wünschenswert? Eine Welt, in der alles bestens geregelt ist, ohne Absurdes, Widersinniges, Erschreckendes, Verwegenes, unangenehm Überraschendes, Mühsames, ohne Mangel und Not, wäre sie nicht zeitlos, da ohne Veränderungen unterwegs zwischen gestern und morgen? Gefangen in vollkommener Harmonie, in sich selber kreisend? Wäre es nicht eine Welt ohne Geschichten und daher auch ohne Geschichte, weil ohne Vergänglichkeit und Tod? Und könnte sie wirklich Gott demonstrieren? Vielleicht den Gott der Philosophen, das ens perfectissimum, das »vollkommenste Wesen«, nicht aber den Gott der Bibel, der sich aufs Unvollkommene einlässt, auf den Menschen und seine Welt, auf Leiden, Schmerz, Vergänglichkeit und Tod. Der Mose der Tora, die prophetische Urgestalt Israels schlechthin, weiß sehr wohl darum, dass die Abschaffung der Unvollkommenheit nicht notwendig zur Gotteserkenntnis führt, sondern eher die Gefahr der Gottvergessenheit mit sich bringt:
Wenn dich JHWH, dein Gott, in das Land bringt, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, Häuser, angefüllt mit allerlei Gutem, die du nicht gefüllt hast und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbaumgärten, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du dann isst und satt wirst, dann hüte dich davor, dass du JHWH nicht vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus dem Sklavenhaus. (Dtn 6,10–12)
Israel hatte offensichtlich ein feines Gespür dafür, dass eine vollkommene Welt des Guten und der Fülle der Güter nicht zwangsläufig dazu geeignet ist, Gott zu erinnern, ihn zu demonstrieren und im Gespräch mit ihm zu bleiben. Vielmehr überlässt sie sich in ihrer Gottvergessenheit nur zu gern einem praktischen Atheismus. Verführt das Vollkommene, wenn es zum Normalen wird, zur Undankbarkeit?
Die Vorstellung von einer vollkommenen Welt kann auch Angst machen, da die Unvollkommenheit immer noch das Maß des Menschlichen ist. Könnte eine lückenlos perfektionierte Welt nicht auch zum Ort eines apathischen, leidenschaftslosen und leidenslosen Menschen degenerieren, in Gang gehalten von einem gleichmütigen, an die ewigen Gesetze des Kosmos, der Sterne und der Seele gebundenen höchsten Wesen? Und wäre sie dann im besten Falle nicht eine Welt gnadenloser Langweiler? Gegen derartige Überlegungen ließe sich einwenden, dass die so beschaffene Welt dann eben nicht vollkommen sei. Aber dieser Einwand macht lediglich deutlich, wie schwer es uns fällt, ein solches vollkommenes Weltkonstrukt zu denken.
Das Hiobbuch nötigt uns vielmehr dazu, unsere Welt-, Menschen- und Gottesbilder radikal infrage zu stellen, und sie nicht mit unseren Wünschen zu verwechseln. Ist unser Glaube an einen guten und allmächtigen Gott, unser Verständnis von dem, was Güte und Allmacht bedeuten, nicht viel zu naiv? Es besteht kein Zweifel: Leid und Schmerz sind derjenige Ort, an dem sich die Gottesfrage wie ein Vulkan mit geradezu eruptiver Gewalt auftut. Aber wenn man der Versuchung nachgibt und sich dazu durchringt, sie ein für allemal im Sinne des Atheismus zu beantworten, das Geheimnis Gottes als erledigt zu den Akten zu nehmen, dann ist damit ja nicht das Ende aller Fragen gegeben. Nebenkrater der Sinnsuche öffnen sich, Lavaströme des Zweifels und Selbstzweifels werden aus dem brodelnden Urgrund der menschlichen Existenz an die Oberfläche geschleudert: Wie eigentlich steht es mit der Güte und der Bosheit des Menschen? Wie mit seiner Macht? Wie weit reicht seine Vernunft? Warum ist er so, wie er ist? Woher die Kette der Störungen und Kränkungen des Lebens, die nicht abreißen will und meinen Weg säumen? Warum hat die unheilbare Krankheit, der Unfall, das große Beben ausgerechnet diesen und keinen anderen getroffen? Wird eine Welt ohne Gott vernünftiger, durchsichtiger? Ist der Mensch ohne Gott – ganz auf sich selbst zurückgeworfen – eher und besser dazu in der Lage, die schmerzlichen Kontingenzerfahrungen zu bestehen? Emanuel Lévinas hat den vermeintlichen Gewinn an Vernunft, den atheistische Denker mit der Abschaffung Gottes als großen Befreiungsschlag häufig für sich in Anspruch nehmen, eindrücklich infrage gestellt:
»Was bedeutet dieses Leid der Unschuldigen? Zeugt es nicht von einer Welt ohne Gott, von einer Erde, auf der allein der Mensch das Gute und das Böse misst? Die einfachste, normalste Reaktion wäre, auf Atheismus zu erkennen. Auch die gesündeste Reaktion für alle diejenigen, denen ein etwas einfältiger Gott bisher Preise verteilte, Sanktionen auferlegte oder Fehler verzieh und in seiner Güte die Menschen wie ewige Kinder behandelte. Doch mit welch borniertem Dämon, welch merkwürdigen Zauberer habt ihr denn euren Himmel bevölkert, ihr, die ihr ihn heute für verödet erklärt? Und weshalb sucht ihr unter einem leeren Himmel noch eine vernünftige und gute Welt?«5
Auch der Atheismus löst die Frage des Menschen nach sich selbst und seinem Schicksal nicht. Im Gegenteil, an ihm bricht sie mit einer ganz unvermuteten Wucht wieder auf, die Frage des Schmerzes, des Versagens, der Schuld und der Vergänglichkeit. Jetzt, nachdem er Gott abgeschworen hat, muss der Mensch diese Fragen mit sich selbst ausfechten, gefangen in einer unendlichen Kette der Monologe und Selbstthematisierungen. Das Gegenüber, nach dem Hiob in seiner Verzweiflung geschrien hat, ist ihm abhanden gekommen. Er bleibt mit seinen Fragen, seinen Klagen und mit sich allein zurück, schwankend zwischen der Hoffnung auf die Allmacht der Vernunft und der Verzweiflung abgrundtiefer Einsamkeit. Im Atheismus bleibt Hiob kein Gegenüber und keine Chance.
Odo Marquard hat in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht, dass mit dem Ausfall Gottes dieser auch nicht mehr vor das in der neuzeitlichen Philosophie als Theodizee bezeichnete menschliche Tribunal zitiert werden könne. Die Folge davon ist eine zunehmende »Tribunalisierung der modernen Lebenswirklichkeit«.6 Wenn Gott nicht mehr zu rechtfertigen ist, dann hat sich das Nichtgöttliche, also der Mensch und die Welt, alles und jedes zu legitimieren:
»Denn heute bedarf offenbar alles der Rechtfertigung: die Familie, der Staat, die Kausalität, das Individuum, die Chemie, das Gemüse, der Haarwuchs, die Laune, das Leben, die Bildung, die Badehose; nur eines bedarf – warum eigentlich? – keiner Rechtfertigung: die Notwendigkeit der Rechtfertigung vor allem und jedem.«7
Und weil dieser Rechtfertigungsdruck der Moderne sehr schnell zu einem unerträglichen Überdruck werden kann, hat der Mensch eine Reihe von überaus ambivalenten Entlastungsstrategien entwickelt, um ihm auszuweichen.
Die Autonomisierung: Autonomie wurde zum Zauberwort der Moderne. In der Hierarchie der Werte hat sich die Selbstbestimmung auf den Thron des Schöpfers gesetzt. Mit der Entmachtung Gottes ermächtigt sich der Mensch »zur Autonomie des Übermenschen«,8 der glaubt, in einer gewaltigen Eruption oder durch das lebenslange Diktat der Arbeit an seiner Selbstbefreiung jede Form der Heteronomie, der Fremdbestimmung überwinden zu können. Weil damit aber der »böse Schöpfer« als Verantwortungsträger für die bleibenden Weltübel ausfällt, und der »Übermensch« für sie die Verantwortung weder übernehmen kann noch will, flüchtet er sich immer wieder in die Rolle des »guten Erlösers« seiner selbst, der sich um der künftigen Erlösung willen von der Verantwortung für alle Übel freispricht. Und wo ihm das nicht gelingt, werden die Übel von ihm oft noch forciert, um die Temperatur der Erlösungssehnsucht der Massen bis zum Siedepunkt anzuheizen, von dem man sich schließlich den revolutionären Umschlag in das Reich der Freiheit verspricht. In ihm degenerieren dann alle Übel der Welt zu einer Quantité négligeable. Theodizee wird zur säkularen Eschatologie umfunktioniert9 mit all ihren beklemmenden Folgen, die die gewalttätigen Ideologien des 20. Jh. hervorgebracht haben.
Malitätsbonisierung: Die vielfältigen Übel unserer Lebenswirklichkeit werden damit zum Zwecke der Entlastung funktionalisiert. Es wird ihnen ein Zweck zugeschrieben, der sie in dieser oder jener Hinsicht doch noch für etwas gut erscheinen lässt, sie rechtfertigt und »entübelt«. Die »Neugier wird aus einem Laster zur zentralen Wissenschaftstugend« erklärt, das »Nichtschöne« und »Hässliche« wird ästhetisiert, der »Sündenfall« wird zur »Freiheitspflicht« gemacht, »der Schmerz wird als Sensibilitätsgewinn gefeiert«,10 das Altern wird zur Gelegenheit für einen aktiven Neustart in eine nun nicht mehr fremdbestimmte, sondern erfüllte zweite Arbeitsbiographie ausgerufen. Jedes malum, jedes Übel, wird zu einem bonum, zu etwas Gutem uminterpretiert, zuweilen wohl auch umgelogen.
Kompensation: Die Übel der Welt werden durch eine Fülle von Erfahrungen des Guten und der Güter aufgewogen. Die »Gutmachung der Übel« wird durch »Wiedergutmachung« ersetzt.11 Wenn der Mensch schon an Alter, Krankheit und Tod nicht vorbeigehen kann und an all den Schmerzen und Defiziterfahrungen, die seine Endlichkeit unweigerlich mit sich bringen, dann soll er sich wenigstens auf das Gute konzentrieren, auf Essen und Trinken, auf Wohlstand, Glück und die Liebe. Carpe diem heißt die Devise der Kompensatoren, die bereits der Skeptiker Kohelet seinen Lesern ins Stammbuch geschrieben hat:
Geh und iss mit Freude dein Brot
und trink mit frohem Herzen deinen Wein,
denn längst hat Gott dein Tun gefallen.
Zu jeder Zeit mögen deine Kleider weiß sein
und an Öl auf deinem Haupte möge es nicht mangeln.
Achte auf das Leben mit der Frau, die du liebst,
alle Tage deines vergänglichen Lebens,
die er dir gegeben hat unter der Sonne,
alle deine vergänglichen Tage.
Denn das ist dein Teil am Leben und deiner Mühe,
mit der du dich abmühst unter der Sonne. (Koh 9,7–9)
Dass all diese Strategien im Umgang mit dem Bösen entlastende Momente enthalten, soll hier gar nicht bestritten werden. Der Ausfall des Theodizee-Tribunals, das der Mensch mit Gott veranstaltete, und die damit gegebene immer weiter um sich greifende Tribunalisierung der Welt- und Lebenswirklichkeit haben aber letztlich auch keine befriedigenden Antworten auf die Frage nach dem Bösen geliefert. Daher bleibt für Odo Marquard eine wache Skepsis immer noch der angemessene Modus des Denkens, das sich den Fragen nach der Theodizee und dem Bösen stellt.
»Es existieren menschliche Probleme, bei denen es gegenmenschlich, also ein Lebenskunstfehler wäre, sie nicht zu haben, und übermenschlich, also ein Lebenskunstfehler, sie zu lösen. […] Deshalb ist der Skeptiker verliebt in jene Metaphysik, die so viele Antworten produziert, daß sie einander wechselseitig neutralisieren, und gerade dadurch – teile und denke! – die Probleme offenläßt, so daß es ihr im Fazit ergeht wie jenem löwenfreundlichen Löwenjäger, der, gefragt, wie viele Löwen er schon erlegt habe, gestehen durfte: keinen, und darauf die tröstende Antwort bekam: bei Löwen ist das schon viel.«12
Wir werden also weiter fragen müssen, auch dann und gerade dann, wenn dem Löwen des Bösen keine Waffe, kein Jäger und kein Kraut gewachsen ist. Das jedenfalls können wir von Hiob lernen, dass ein Abschied von Gott die Probleme nicht löst, die er zu beklagen hat.
3. UNDE MALUM – WOHER DAS BÖSE? I
In diesen beiden Worten – »Unde malum – Woher das Böse?« – hat Tertullian im 2. Jh. n. Chr. zusammengefasst, was den Menschen seit jeher bewegt.13 Die Vernunft sucht nach Gründen. Sie deutet die Phänomene, die ihr begegnen, indem sie nach ihrem Woher, ihren Ursachen und Wirkungen fragt. Stellen sich Schmerzen ein und wird der Arzt konsultiert, dann interpretiert er diese als Wirkung, die eine Ursache haben muss. Er stellt eine Diagnose, die es ihm ermöglichen soll, die Ursachen der Schmerzen zu beseitigen und auf diese Weise ihre leidvollen Wirkungen zu unterbinden. Dieses Kausalitätsdenken, das einen Nexus zwischen Ursache und Wirkung herstellt, gehört offensichtlich zu den Grundformen und Grundnormen geistiger Arbeit. Bereits die antiken Mythen sind vom ätiologischen Denken geprägt. Erscheinungen in der Natur, Gegebenheiten des Lebens, aber auch Sitten und Bräuche der Völker werden durch Erzählungen von Göttern und Menschen erklärt, die den Grund dafür angeben, wie es zu alledem gekommen sei. Und unsere moderne Wissenschaftskultur bedient sich mit dem Regelwerk ihrer eigenen Logik nach wie vor in erster Linie der Frage nach den causae auf ihrer Entdeckungsreise durch die Welt. Welche Ursachen liegen den Erscheinungen zugrunde?
Ohne Zweifel hat das Kausalitätsdenken die Geistesgeschichte in hohem Maße geprägt und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte aufzuweisen. Ja, zuweilen ist es so erfolgreich gewesen, dass manche – einen ungebrochenen Wissenschaftspositivismus pflegende – Zeitgenossen meinen, mit dem Kausaldenken den Generalschlüssel für die Interpretation der Wirklichkeit, auch der des Bösen, in den Händen zu halten. Für ihren Fortschrittsoptimismus ist letztlich alles nur eine Frage der Zeit, bis die Wissenschaft die heute noch verborgenen Ursachen für die großen Welträtsel und die Geheimnisse des Lebens aufgedeckt hat.
Manch einer verspricht sich die Lösung des Rätsels von der Entdeckung der Weltformel, die dazu in der Lage sein müsste, die Letztursache für das Werden unseres Universums zu benennen. Friedrich Dürrenmatt hat in seiner Komödie »Die Physiker« mit feinem Humor und tiefem Ernst gezeigt, vor welche wissenschaftsethischen Probleme der Mensch auf der Jagd nach der Weltformel gestellt wird. Und die seriöse Wissenschaft ist sich ohnehin darin einig, dass – wenn es eines Tages gelänge eine solche Weltformel zu erstellen – diese wohl nur für den Bereich messbarer physikalischer Größen Gültigkeit beanspruchen könnte. Eine Erweiterung des Geltungsbereiches auf die Geistes-, Lebens- und Sozialwissenschaften, die Politik, die Ethik und Ästhetik, die Psychologie, Philosophie, Theologie und Kunst sei weder intendiert noch wirklich sinnvoll. Die komplexen Probleme, die in diesen Lebens- und Wirklichkeitsbereichen herrschen, sind ganz anderer Natur und lassen monokausale Erklärungen sowie ihre reduktionistische Rückführung auf eine Letztursache kaum als sinnvoll erscheinen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass das Kausaldenken auf diesen Feldern des geistigen, wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeitens sinnlos ist. Im Gegenteil! Auch in diesen Wirklichkeitsbereichen und ihrer wissenschaftlichen Erforschung hat es einen festen Platz und stellt ein unentbehrliches Instrument dar. Aber in der Begegnung mit den Phänomenen, die hier zu bedenken sind, stößt der aufmerksame Beobachter immer wieder auf die Grenzen derjenigen Erklärungsmuster, die sich in der Abfolge von Ursache und Wirkung bewegen.
Das Nachdenken über Ursachen, Wirkungen und Verantwortung führt immer wieder zu der Einsicht, dass es Probleme gibt, die – selbst wenn wir die Gründe und Verursacher kennen – sich hartnäckig einer wirklich befriedigenden Erklärung verweigern. Hat man zum Beispiel einen Menschen als Verursacher des Bösen ausgemacht, dann tut sich dahinter eine neue Warum-Frage auf: Warum hat er das getan? Hat man herausgefunden, dass der Täter in sozialen Verhältnissen aufgewachsen ist, die ihn in seine Untat getrieben haben, dann stellt sich die Frage: Wie konnte es zu solchen Verhältnissen kommen? Wurden die Verhältnisse eingehend analysiert, dann kann gefragt werden, warum bei gleichen Lebensverhältnissen die einen zu Tätern des Bösen werden und andere nicht. Hat man hirnphysiologische Ursachen für ein gewaltbereites Verhalten ausfindig gemacht, dann wirft dies die Frage auf, warum diese Disposition ausgerechnet bei dem einen gegeben ist und bei anderen nicht. Hat man die Ursachen für eine Naturkatastrophe, eine Krankheit herausgefunden, dann stellt sich die Frage: Warum gerade jetzt und an diesem Ort? Das Warum-Fragen will kein Ende nehmen, weil sich hinter ihm häufig eine viel tiefere Frage auftut: Die Sinnfrage! Welchen Sinn macht es, dass Mensch und Welt so sind, wie sie sind?
Zu diesen Sinnfragen gehört in ganz prominenter Weise die nach dem sogenannten Bösen. Selbst wenn wir seine Ursachen kennen, bleibt die Frage: Welchen Sinn macht das Böse, oder ist es nicht das Widersinnige, Absurde schlechthin, das sich all unseren Denkbemühungen erfolgreich entzieht? Und ist es daher nicht sinnlos, überhaupt nach einem Sinn des Bösen zu fragen? Selbstverständlich lassen sich auch die Erfahrungen des Bösen kategorisieren und systematisieren. Aber lässt sich ihnen damit ein Sinn abgewinnen? Gottfried Wilhelm Leibniz hat in seiner Schrift über die Theodizee drei Gestalten des Bösen voneinander unterschieden: Das malum morale, das moralische Übel, im religiösen Bereich als Sünde bezeichnet, lässt sich auf die Untaten von Menschen als seine Verursacher zurückführen, die dafür auch die Verantwortung tragen. Das malum physicum oder naturale, das physische oder auch natürliche Übel, eine Krankheit oder eine Naturkatastrophe, erklärt sich aus natürlichen, biologischen oder auch physikalischen Gegebenheiten heraus. Eine Verantwortungszuschreibung fällt hier schon schwerer. Auch wenn wir heute wissen, dass eine Vielzahl von Zivilisationskrankheiten oder Umweltkatastrophen ebenfalls auf menschliches Fehlverhalten zurückgehen, bleiben immer noch eine Fülle von Übeln, deren natürliche Ursachen wir zwar kennen, die aber nicht dem Menschen zugerechnet werden können. Noch schwieriger ist es hingegen mit dem malum metaphysicum. Für dieses lässt sich keine innerweltliche Größe verantwortlich machen. Mit ihm kommt vielmehr die unvermeidliche Unvollkommenheit der Schöpfung als solche zur Sprache. Da es neben Gott als dem Absoluten schlechthin kein zweites Absolutes geben kann, muss die Schöpfung, die sich vom Schöpfer wesensmäßig unterscheidet, eben ein malum haben, ein Defizit, etwas Unvollkommenes, das vor allem in der Endlichkeit ihrer Geschöpfe, in Leid und Tod zum Ausdruck kommt.14 Damit gründen aber letztlich auch das malum morale sowie das malum physicum im malum metaphysicum, also darin, dass die Schöpfung unvollkommen und endlich ist, ja, letztlich so sein muss, weil nur der Schöpfer absolut, das heißt vollkommen und ewig sein kann. Könnte das Geschaffene ebenfalls den Rang des Absoluten und Ewigen für sich beanspruchen, dann stünde es auf einer Stufe mit dem Schöpfer. Gott bekäme einen Nebengott, der seine Macht und Möglichkeiten begrenzte. Und da der Absolute dann absolut nicht mehr absolut wäre, könnte er auch nicht mehr Gott sein. Wen also will man für das malum metaphysicum verantwortlich machen, wenn nicht einmal mehr Gott dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann? Wen, wenn Gott um seiner Gottheit willen, das heißt um seiner Vollkommenheit und Absolutheit willen gerechtfertigt ist, die eben kein zweites Absolutes und Vollkommenes neben sich zulassen kann? Wie aber kann Gott absolut und vollkommen sein, wenn er doch unter einem solchen Zwang steht, das Unvollkommene, Defizitäre, Böse nicht nur zuzulassen, sondern sogar zu schaffen? Ist und bleibt damit nicht jede Theodizee, jeder Versuch, Gott zu rechtfertigen, zum Scheitern verurteilt? Wäre es nicht die einzige Möglichkeit des Schöpfers gewesen, sich diesem Zwang zu entziehen, auf die notwendigerweise unvollkommene Schöpfung als sein Gegenüber zu verzichten? Klingt demnach die Frage unde malum? nicht in unauflösbaren Paradoxien aus, im Nichtwissen und im Schweigen?
Polytheistische oder dualistische Gotteskonzeptionen hatten und haben es leichter, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Sie vermochten gut und böse unterschiedlichen Figuren, kosmischen und chaotischen Mächten im Pantheon zuzuweisen, die sich gegen seitig bekämpften. Das Hiobbuch selbst ringt noch mit derartigen Welt- und Gotteskonzepten, wenn es mit Leviatan (Hi 3,8;40,25–41,26) und Behemot (Hi 40,15–24) die mythischen Bilder der im Alten Orient bekannten und bedrohlichen numinosen Chaoswesen aufruft, oder mit der Gestalt des Satans (Hi 1,6–12;2,1–7) einen Gegenspieler Gottes einführt. Wie sich allerdings zeigen wird, werden diese Konzepte durch die Autoren des Hiobbuches letztlich dekonstruiert. Mit ihrem »Helden« Hiob bleiben sie konsequente Verfechter des Monotheismus und setzen sich der schier unlösbaren Aufgabe aus, Gott, den Schöpfer der Welt, sowie gut und böse nicht auseinanderfallen zu lassen, sondern zusammenzudenken (vgl. Hi 1,21;2,10). Wie nahe sie dabei dem unerlegbaren »Löwen des Bösen« kommen, und worin der Gewinn bestehen könnte, den einen, einzigen Gott des Monotheismus nicht aus der Verantwortung für die menschlichen Erfahrungen des Bösen zu entlassen, das soll in der nun folgenden Darstellung des Hiobbuches ausgelotet werden.
»Hiob würde wahrscheinlicher Weise vor einem jeden Gerichte dogmatischer Theologen, vor einer Synode, einer Inquisition, einer ehrwürdigen Classis, oder einem jeden Oberconsistorium (ein einziges ausgenommen), ein schlimmes Schicksal erfahren haben. Also nur die Aufrichtigkeit des Herzens, nicht der Vorzug der Einsicht, die Redlichkeit, seine Zweifel unverhohlen zu gestehen, und der Abscheu, Überzeugung zu heucheln, wo man sie doch nicht fühlt, vornehmlich nicht vor Gott […]: diese Eigenschaften sind es, welche den Vorzug des redlichen Mannes in der Person Hiobs vor dem religiösen Schmeichler im göttlichen Richterausspruch entschieden haben.«
Immanuel Kant
B DARSTELLUNG
1. »HIOB« IM ALTEN ORIENT
Hiobsgestalten hat es in der Geschichte immer gegeben und wird es auch immer wieder geben. Schon lange vor der Entstehung des Hiobbuches, das uns beschäftigt, haben Erfahrungen des Bösen, die großes Leid mit sich brachten, die Gottesbeziehung von Menschen in eine tiefe Krise gestürzt. Diese Erfahrungen haben sich auch in einer Reihe von Texten aus dem alten Ägypten und Mesopotamien niedergeschlagen. Sowohl in ihrer Thematik, in den Motiven und ihrer literarischen Form weisen diese Texte eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit dem Hiobbuch auf.15 Charakteristisch für sie ist das Ringen eines Leidenden mit seinem persönlichen Gott, von dem er Aufklärung über sein als ungerecht empfundenes Geschick sowie eine Rehabilitierung erbittet. Dabei spart er nicht mit massiven Vorwürfen, die er der Gottheit macht. Dorothea Sitzler hat die infrage kommenden Texte analysiert und dabei das sie tragende Motiv Vorwurf gegen Gott gründlich untersucht.16
Damit hat die biblische Hiobtradition Anteil an dem außerbiblischen Nachdenken über die Frage, warum der Gerechte leiden muss, was Gott und die Götter mit dem Leiden und dem Unheil in der Welt zu tun haben, und wo die Einbruchstellen des Chaos und des Bösen in den Kosmos und das menschliche Leben zu suchen sind. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht erst das Hiobbuch diese Fragen stellt, sondern dass ihm selbst solche Fragen schon lange vorausgingen, auf die es eine Antwort sucht. Im Folgenden sollen als Beispiele je ein Text aus Mesopotamien und Ägypten vorgestellt werden.
1.1. Ludlul bēl nēmeqi
Die akkadische Dichtung ludlul bēl nēmeqi wurde nach ihren ersten Worten »Ich will preisen den Herrn der Weisheit« benannt. Sie gehört damit wie auch das biblische Hiobbuch zu den großen Texten der altorientalischen Weisheitsliteratur. Die 480 Verse umfassende Dichtung liegt auf vier Tafeln in mehreren Abschriften aus Kalach, Assur, Ninive, Babylon und Sippar vor. Alle durch den Spaten der Ausgräber ans Tageslicht beförderten Ausgaben des Textes sind nur teilweise erhalten und wurden um 800 v. Chr. aufgezeichnet.17
Hauptfigur der Dichtung ist Schubschi-meschre-Schakkan (»Bewirke Reichtum für mich Schakkan«). Handelt es sich bei dem Träger des Namens um eine Symbolgestalt oder eine historische Person? Schakkan ist eine Gottheit, die auch als Sumuqan bekannt ist. Es handelt sich um den Gott der Viehherden. Der Name des Helden ist demnach ein sogenannter »Wunschname«, mit dem die Hoffnung zum Ausdruck gebracht wurde, die Gottheit Schakkan möge dem Träger des Namens Reichtum in Gestalt von großen Herden und reichem Viehbesitz zukommen lassen. Damit ist bereits durch den Namen eine thematische Verbindung zum biblischen Hiob gegeben, der ja ebenfalls als reicher Herdenbesitzer dargestellt wird (Hi 1,3). Eine literarische Abhängigkeit lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.
Tafel I setzt mit einem Hymnus auf den Gott Marduk, den Herrn der Weisheit, ein:
»[Ich will preisen] Marduk, den Herrn der Weisheit, den umsich[tigen] Gott;
er zürnt zur Nachtzeit, verzeiht (aber) am Tage,
dessen Grimm wie ein Gewittersturm eine Steppe (bewirkt),
dessen Wehen (aber) schön ist wie das des Morgenwindes.
Sein Zorn ist nicht abzuwehren, seine Wut ist ein Flutsturm;
fürsorglich (aber) ist sein Sinn, sein Gemüt zum Verzeihen bereit.« (I,3–8)18
Das bereits in diesen ersten Versen anklingende Gottesbild ist markant. Marduk ist ein emotional bewegter, bipolar besetzter Gott. Seine Emotionen schwanken zwischen einem alles vernichtenden Grimm einerseits und einem stets zur Vergebung bereiten Gemüt andererseits. Der Zorn wird dabei der Nachtzeit zugeordnet. In ihr bricht mit dem Dunkel immer wieder das Chaos in den geordneten Kosmos ein. Der rettende, verzeihende Gott hingegen zeigt sich am Morgen des Tages, wenn das Licht hervorbricht und sich die Welt neu ordnet.19 Von diesem Marduk darf man daher beides erwarten, das Gute wie das Böse, Heil und Unheil. Er ist der Chaos und Kosmos wirkende Gott gleichermaßen. Die Frage, die sich damit stellt, ist die, ob es bestimmte Prinzipien und Regeln gibt, nach denen er Heil oder Unheil wirkt, Zorn und Güte zum Zuge kommen lässt. Ist sein Handeln an ein ethisches Reglement gebunden? Verteilt er das Gute und das Böse fein säuberlich auf seine Anhänger und seine Gegner, auf Fromme und Ganoven? Diese Frage nach der Gerechtigkeit Gottes und nach einsichtigen Regeln seines Handelns bleibt zunächst offen. Wenn aber davon die Rede ist, dass er auch ein Gott der Vergebung ist, dann darf man wohl voraussetzen, dass man in ihm nicht den Urheber eines blinden, planlosen Schicksals sah. Er ließ sich offensichtlich durch tätige Reue und kultische Verehrung in seinem Verhalten gnädig stimmen.
Auf diese hymnische Einleitung folgt eine breite Schilderung des Unglücks, das den hohen Beamten des Königs, Schubschi-meschre-Schakkan, befallen hatte. Er musste einen entwürdigenden sozialen Abstieg in Kauf nehmen. Durch üble Intrigen und Verleumdungen hat er sein Amt am Hofe verloren. Seine persönlichen Schutzgötter haben sich von ihm abgewandt:
»Voll war der gute Schutzgenius an meiner Seite [des Zorns] gegen mich;
es erschrak mein (weiblicher) Schutzgeist; sie sah sich nach einem andern um.
Fortgenommen wurde meine Würde, meine Männlichkeit wurde verdunkelt;
was mein Wesen ausmachte, flog davon, übersprang mein ›Schutzdach‹«20. (I,45–48)21
Der Verlust der persönlichen Schutzgötter bewirkte offensichtlich, dass Schubschi-meschre-Schakkan nun auch beim Staatsgott und Oberhaupt des Pantheons, Marduk, in Ungnade fiel. Er hatte seine himmlischen Fürsprecher verloren, und mit diesen sein staatliches Amt:
»Der König, leibgleich den Göttern, die Sonne seiner Menschen:
sein Herz wurde verhärtet, zu böse um zu verzeihen.
Die Höflinge tauschen böse Nachrede über mich aus;
sie hocken zusammen und belehren einander in Niedertracht.
Wenn der eine (sagt): »Ich werde ihn sein Leben ›hinschütten‹ lassen«,
sagt ein zweiter: ›Ich entferne (ihn) aus seinem Amt.‹« (I,55–60)22
Der Anschlag derjenigen, die ihm seinen Posten nicht gönnen, hat Erfolg. Der berufliche Absturz führt aber nicht nur zum Verlust des öffentlichen Prestiges, sondern auch zur sozialen Isolierung innerhalb seines engsten Lebenskreises, seines Hauses, seiner Verwandtschaft und seiner Familie.
»Offen in der Öffentlichkeit verfluchte mich mein Sklave;
meine Sklavin vor der Menschenmenge sprach Schmähung(en) gegen mich aus.
Es sah mich der Bekannte und drückte sich zur Seite;
wie einen nicht Blutsverwandten behandelte mich meine Familie.« (I,89–92)23
Diese Klage erinnert thematisch unmittelbar an das Geschick Hiobs (Hi 19,14–19). Soziale Isolation ist die irdische Komponente, die sowohl der königliche Beamte Schubschi-meschre-Schakkan als auch der biblische Hiob erfuhren (vgl. auch Hi 30).
Die irdische Handlungsebene ist aber nur die eine Seite der Medaille. Nicht nur die Hioberzählung stellt dieser eine himmlische Handlungsebene an die Seite, sondern eben auch der babylonische Erzähler. Auf Tafel II beginnt der Leidende darüber nachzudenken, was sein Schicksal mit der Welt der Götter zu tun haben könnte. Er beklagt, dass es ihm gehe wie einem Gottlosen:
»Wie einer, der das Opfer dem Gotte nicht regelmäßig darbrachte,
oder bei der Mahlzeit die Göttin nicht nannte;
der die Nase nicht senkte, Niederwerfung nicht kannte,
in dessen Mund aufhörten Gebet (und) Flehen;
der den Feiertag des Gottes versäumte, den Monatsfeiertag missachtete,
nachlässig wurde und ihre Riten gering schätzte; […]
eben denen glich ich.« (II,12–17.23)24
Jedoch das Gegenteil von alledem trifft zu. Schubschimeschre-Schakkan ist sich keines dieser kultischen Vergehen bewusst. Allen seinen Verpflichtungen gegen die Götter und die Obrigkeit – so seine Unschuldsbeteuerung – kam er in vollem Umfang nach und war stets ein Vorbild für das einfache Volk. Zwar ist er sich darüber im Klaren, dass auch sein Leben nicht frei von Schuld und Sünde ist und er daher auf Vergebung angewiesen bleibt. Im Vergleich zum Geschick derjenigen aber, die die Verehrung der Götter auf die leichte Schulter nahmen, das religiöse Leben vernachlässigten und das soziale Miteinander verletzten, stehen die Übel, die ihm widerfuhren, in keinem Verhältnis. Dies führt ihn zu einem weit reichenden religiösen Nachdenken über die Welt der Götter und die der Menschen. Er stellt sich die Frage, ob die irdischen Beurteilungskriterien menschlichen Handelns auch denen der Götter entsprechen. Vielleicht legen diese ja ganz andere Verhaltensmaßstäbe an als der Mensch:
»Wüsste ich doch (gewiss), dass hiermit der Gott einverstanden ist!
Was einem selbst gut erscheint, könnte für den Gott ein Frevel sein;
was dem eigenen Sinn sehr schlecht dünkt, könnte dem Gott gut gefallen!
Wer kann den Willen der Götter im Himmel erfahren? Wer begreift den Ratschluss des Anzanunzu?25
Wo je erfahren den Weg des Gottes die Umwölkten?« (II,33–38)26
Damit kommt die babylonische Dichtung zu dem Schluss, dass trotz aller mantischen und kultischen Künste der Opferschauer, Traumdeuter und Zeichenbeschwörer der Mensch letztlich keine Einsicht in das Handeln der Götter gewinnen kann. Der Himmel und die Wassertiefe geben ihr Geheimnis nicht preis. Die Welt der Götter bleibt uns verschlossen. Der Himmel spricht zum Menschen, aber wir verstehen seine Sprache nicht. Diese in der Weisheitstradition verankerte Einsicht erinnert an eines der spätesten Stücke des Hiobbuches, das Lied von der Weisheit (Hi 28), zu der kein Sterblicher den Weg findet, so sehr er auch nach ihr sucht wie ein Bergmann in den Tiefen der Erde oder ein Edelsteinhändler auf dem Basar. Allein Gott kennt den Weg zu ihren Quellen.
Nachdem unser leidender Gerechter einmal zu dieser Erkenntnis gekommen ist, weiß er sich nahezu schutzlos den unablässigen Angriffen der Dämonen ausgesetzt. Schwere Krankheiten befallen ihn:
»Darüber hinaus zog sich nun die Krankheit in die Länge. Da ich nicht essen konnte, wurde mein Gesicht ent[stellt]; mein Fleisch schwand dahin, mein Blut versieg[te].
Der Knochen war eingezeichnet in die abdeckende Haut, entzündet waren meine Bänder, Gelbsucht zog ich [mir zu]. Ich nahm das Bett als Haftort, Ausgang für mich war (nur) das Seufzen;
zu meinem Gefängnis wurde mein Haus.
In eine Handfessel für meinen Leib sind gelegt meine Arme;
durch Selbstfesselung befallen sind meine Füße.
Die Schläge waren für mich qualvoll, die Verletzung ist schwer;
die Peitsche schlug mich, sie war voll Dornen;
ein spitzer Stab durchbohrte mich, er war mit Stacheln überzogen.
Den ganzen Tag verfolgt mich der Verfolger;
während der Nacht lässt er mich für keinen Augenblick aufatmen.« (II,90–103)27
Diese ergreifende Elendsmeditation von einem schwerkranken Gelähmten auf seinem nächtlichen Lager, der hilflos den Krankheitsdämonen ausgeliefert ist, lässt wieder vielfältige Anklänge an das Hiobbuch erkennen. Auch Hiob beklagt seine schier unerträglichen Leiden auf dem Krankenlager (Hi 7,5–7.13–15).
Die Texte stecken voller thematischer Gemeinsamkeiten. Sie ergeben sich aus der analogen Situation, die in ihnen beschrieben wird. Die Krankheit hat ihre eigene von Zeit und Ort weitestgehend unabhängige Sprache; die Auflösung des menschlichen Leibes produziert zu jeder Zeit Bilder des Grauens, die man nebeneinander legen kann. Das unablässige Sich-Wälzen auf dem Lager, lange, nicht enden wollende, qualvolle Nächte, die Abmagerung des Körpers, in alledem lassen sich die Klagen des Hiob und des Schubschimeschre-Schakkan vergleichen. Auch darin, dass die Krankheit im Alten Orient selbstverständlich als Komponente eines psychosozialen Prozesses betrachtet wurde. Krankheit war Ausdruck eines ganzheitlichen, das gesamte Leben des Kranken umfassenden Geschehens, das bis in die religiösen Tiefenschichten des Menschen hinein reichte. Der Verlust der gesellschaftlichen und familiären Integrität setzte sich im Verlust der körperlichen und psychischen Kräfte sowie in einer Krise der Gottesbeziehung fort. Dieses von uns erst nach und nach wieder entdeckte ganzheitliche Verständnis von Krankheit wurde – dem antiken Weltbild entsprechend – von Schubschi-meschre-Schakkan auf böse Dämonen zurückgeführt. Werden diese Krankheitsdämonen vom Erzähler des Hiobbuches durch die Gestalt des Satans ersetzt (Hi 2,4–7)?
Abb. 1: Assyrische Bronzetafel mit dem Krankheitsdämon Pazuzu, Ninive 8. Jh. v. Chr.
Tafel III des ludlul bēl nēmeqi bringt dann die Wende im Geschick des Leidenden. In nächtlichen Gesichten erscheinen ihm mehrere Personen, die diese Schicksalswende in Gang setzen. Zuletzt tritt der Beschwörungspriester Ur-Nin-tin-ugga auf, der offensichtlich den Auftrag hatte, die Krankheitsdämonen zu bannen und den Kranken zu heilen. Dieser breit geschilderten Heilungszeremonie ging allerdings der Entschluss Marduks voraus, dem Leidenden seine Sünden zu vergeben:
»Nachdem sich das Herz meines Herrn be[ruhigt hatte], des barmherzigen Marduk Gemüt sich begü[tigt hatte], er mein Flehen [ange]nommen hatte, […],
seine gütige Verzeihung […],
[sprach er] das ›Es ist genug‹ für mich, […]
[…]
Meine Sünden ließ er den Wind davontragen.« (III,50–54.60)28
Krankheit und Sünde werden hier nach antikem Verständnis noch ganz unmittelbar in einen Zusammenhang miteinander gebracht. Die Vergebung der Sünde ist die Voraussetzung für die Heilung. Erst muss das Verhältnis zwischen Gott und dem Leidenden wieder im Reinen sein, muss die seelische Krankheit der Sünde aus der Welt geschafft werden, bevor es auch zu einer Heilung des Leibes kommen kann. Theologisch vertritt der Autor des ludlul bēl nēmeqi damit exakt die Position, die auch die Freunde in ihren Debatten mit Hiob einnehmen.
Die Heilung des Leibes wird schließlich durch den Beschwörungspriester bewirkt:
»[Er brachte] heran seine Beschwörungsformel, die [zum Weichen] bringt [meine Sünde];
[er ver]trieb den bösen Wind bis zum Horizont.
Bis an den Rand der Erde brachte er [die Kopfkrankheit];
ins Grundwasser [hinunter] trieb er den bö[sen] Geist.
Den nicht umzuwendenden Utukku29 schickte er zurück ins Ekur30;
er stieß weg die Lamaschtu31, zwang sie hochzusteigen ins Gebirge.
Die Flut des Meeres ließ er anbranden gegen die Kälteschauer;
die Basis des Muskelschwundes riss er wie eine Pflanze aus.
[…]
Aus Weh und Ach, es umzuwenden gleich Menschen, ließ er aufsteigen wie einen Nebel, die Erde … […].
Die chronische Kopfkrankheit, die wie ein [Mühl]stein [lastend war],
schaffte er weg wie den Tau der Nacht, entfernte sie von mir.
Meine verklebten Augen, die überdeckt waren mit einem Schorf zum Tode,
3600 Meilen brachte er (diesen) weg, hellte [meinen] Blick auf.«
(III,77–84.87–92)32
Die magischen Heilpraktiken des Beschwörungspriesters sind nicht uninteressant. Die Krankheiten werden von ihm in einer Abfolge von Eliminationsriten regelrecht aus der Welt geschafft





























