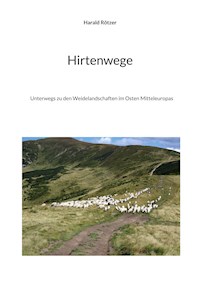
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Seit seinem Landwirtschaftsstudium faszinieren den Autor die Landschaften im Osten Mitteleuropas. Außer den endlosen Wäldern der Karpaten findet man hier die artenreichsten Wiesen der Welt. Wandernde Viehherden haben hier nicht nur in der Natur ihre Spuren hinterlassen, sondern auch im kulturellen Erbe. Das Buch verführt zu Streifzügen von der Gegend um Wien bis an das Schwarze Meer. Es führt in Landschaften, die oft gar nicht weit weg, aber doch noch immer ein wenig hinter dem ehemaligen »Eisernen Vorhang« versteckt sind. Es bietet zunächst einmal Reise- sowie Lesetipps. Darüber hinaus lädt es dazu ein, sich über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Landschaft Gedanken zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AUTOR
Harald Rötzer wurde 1970 in Wien geboren. Er studierte Landwirtschaft und beschäftigt sich mit den Pflanzen, die auf Wiesen und Weiden wachsen, und damit auch mit der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Seine Leidenschaft für Reisen und Wanderungen führt ihn immer wieder in die Landschaften in und um die Karpaten.
Inhalt
Den Hirtenwegen folgen … (ein Vorwort)
Wege Richtung Osten (ein Überblick)
Lange Geschichte der Weiden
Perchtoldsdorfer Heide:
Ein Stück Steppe am Stadtrand Wiens
Schneeberg:
Almen am östlichsten Zweitausender der Alpen
Steinfeld:
Eine der westlichsten Steppen Europas
Marchfeld:
Sanddünen »wie in den asiatischen Steppen«
Hainburger Berge:
Schafweide als ein Pilotprojekt des Naturschutzes in den »Österreichischen Karpaten«
Weiße Karpaten und Mährische Walachei:
Eines der artenreichsten Wiesengebiete Europas und ein lebendiges Museum
Land um die Tatra:
Bergtourismus mit Brimsen, Liptauer und Räucherkäse
Połoniny und Bieszczady:
Almberge in einem ewigen Grenzland
Seewinkel:
Steppe hinter dem Neusiedler See
Hortobágy:
Faszination der Puszta in der Ungarischen Tiefebene
Kiskunság:
Sandpuszten zwischen Donau und Theiß
Deliblat und Eisernes Tor:
Durch die Vojvodina in die »Europäische Sahara« und an das Ende der Karpaten
Huzulenland:
Ein geheimnisvolles Bergvolk in einem Kerngebiet der ukrainischen Kultur
Maramuresch und Bukowina:
Traditionelle Landwirtschaft am Oberlauf von Theiß und Moldova
Siebenbürgen:
Bei den Sachsendörfern um Sibiu/Hermannstadt
Mărginimea Sibiului und Retezat-Gebirge:
Auf den Spuren der Transhumanz in den Südkarpaten
Széklerland und Gyimes:
Wiesen und Weiden in den Ostkarpaten
Walachei und Dobrudscha:
Steppen in der Nähe des Donaudeltas
Im Süden der Ukraine und darüber hinaus:
Ein Blick in die osteuropäische Steppenzone
Wohin geht die Reise?
Perspektiven der Weidewirtschaft
Bildteil
Den Hirtenwegen folgen … (ein Vorwort)
Aufgewachsen bin ich in Wien und in den Leiser Bergen im niederösterreichischen Weinviertel. Hirtenweg war damals dort die Bezeichnung eines Wanderweges, der Orte miteinander verband, die von der Urgeschichte bis ins Mittelalter ihre große Zeit gehabt hatten. Gerade weil es damals in der Gegend keine Hirten und auch kein Weidevieh gab, war dieser Name für meine Fantasie sehr anregend. Wie die meisten Österreicher begegnete ich der Hirtenkultur und der Weidewirtschaft zunächst auf den Almen, den hochgelegenen Sommerweiden in den Alpen. Dort schien das auch hinzugehören, und dort ist es nach wie vor ein zentraler Aspekt der österreichischen Kultur. Im Osten des Landes gab es hingegen Acker- und Weinbau und damals auch noch ab und zu ein paar Rinder im Stall. Gleichzeitig war da gerade in den Leiser Bergen dieses faszinierende Grasland, das ein- oder zweimal im Jahr besonders bunt wurde und dazwischen im Sommer oft austrocknete. Irgendwann erfuhr ich, dass dieser Trockenrasen, auch dieses Wort lernte ich erst nach einiger Zeit kennen, mit dem damals niemand so recht etwas anzufangen wusste, ein besonderes Sorgenkind des Naturschutzes war.
Auf den Trockenrasen der Leiser Berge freute ich mich im zeitigen Frühling über die Kuhschellenblüte, im Frühsommer über das Federgras, und manchmal beobachtete ich Ziesel, putzig kleine Nagetiere. In den 1980er-Jahren entstand in Österreich ein Trockenrasenkatalog, der auch heute noch ein faszinierender Führer zu diesen speziellen Teilen der Landschaft ist. Ich erfuhr, dass man die Trockenrasen als Vorposten der Steppen in der Ukraine, in Russland und noch weiter im Osten sehen kann, von denen ich damals allerdings keinerlei konkrete Vorstellung hatte. Auch lernte ich, dass diese Trockenrasen früher einmal Weideland waren. So bekam die Bezeichnung Hirtenweg in dieser Gegend für mich Sinn. Bei fehlender Nutzung wurden die früheren Weiden nach und nach von Gebüschen bewachsen. Auch das konnte ich beobachten. Wenn niemand eingriff, würden sie langsam wieder zu Wald werden. Tatsächlich erfuhr ich, dass auch der von mir oft erkundete Wald hinter »meinem« Dorf vor Jahrhunderten noch Weide gewesen war. Der Förster erzählte mir, dass möglicherweise ein paar besonders große knorrige Buchen in der ersten Zeit ihres Lebens auf der mehr oder weniger offenen Weide gestanden waren. Auch auf Hügeln, wo heute Äcker sind, waren einmal Weideflächen. Im Nachbardorf gibt es noch einen Hirtenberg. Und dort, wo mein Großvater als Kind auf der Gemeindeweide von einem Stier verletzt wurde, steht heute noch ein Kreuz, das aus Dankbarkeit für sein Überleben errichtet wurde. Ganz oben auf diesem Hügel fand ich noch ein paar Trockenrasenpflanzen. So konkret konnte Geschichte sein.
Gerade diese Geschichten waren ein Grund dafür, dass ich mich Anfang 1989 entschloss, Landwirtschaft zu studieren. Ich hatte bald das Gefühl, genau das gefunden zu haben, was mich interessierte. Noch im gleichen Jahr geschah eine Art von Wunder, das das Leben so vieler Menschen in Mitteleuropa von Grund auf veränderte. Mit dem Ende des kommunistischen Systems im damaligen Ostblock war der »Eiserne Vorhang« Geschichte, jene scharfe Grenze, die den Kontinent vorher brutal in zwei Teile geteilt hatte, zwischen den Städten Wien und Bratislava mitten durch, knapp an den Leiser Bergen vorbei. Bis dahin hatte ich sowohl vom Leben der Menschen wie auch von den Landschaften dahinter kaum etwas gewusst. Über Tschechien gab es vor allem irgendwie unwirklich gewordene Erinnerungen der Großelterngeneration an Städte wie Brünn, Prag, Karlsbad oder Olmütz. Ähnlich war das auch mit Bratislava/Pressburg in der Slowakei. Hier begann ich bald mit Erkundungen.
Ich entdeckte die Städte und bald auch das Land. Ich hatte das Gefühl, dort etwas anderes zu suchen als die meisten meiner Landsleute, die damals entweder zum billigen Einkaufen fuhren, alte Erinnerungen verklärten, oder auch gleich einmal nach wirtschaftlichen Chancen Ausschau hielten. Ich tat es zunächst vor allem den TschechInnen und SlowakInnen gleich, für die Reisen, Wandern und ab und zu im Zelt Übernachten ein wichtiger Teil ihrer Kultur geworden waren. Ich fuhr oft mit langsamen Zügen durch die Gegend, kaufte in den Dörfern ein, wanderte durch die Wälder und über die Wiesen, aß und trank mit Begeisterung das, was die anderen Ausflügler und Wanderer dort so genossen, freute mich über die Fremdsprachenkenntnisse so vieler junger Leute von dort, und schloss bald erste Freundschaften. Ein bisschen begann auch für mich Anfang 1990 eine eigentlich gar nicht so recht erwartete Zeit der Freiheit.
Bald hatte ich so auch die Karpaten entdeckt, die ersten Male bei einem Spaziergang am Rand von Bratislava und nach einer Nachtzugfahrt zur Hohen Tatra. Das unbekannte Gebirge beginnt ja praktisch vor der Haustür Wiens. Ebenso faszinierte mich die weite Ungarische Tiefebene, die auch fast bis an den Wiener Stadtrand reicht. Immer mehr merkte ich, dass ich in diesen Landschaften nicht nur Natur entdeckte. In Wiesen und Weiden, Hecken und Obstbäumen, in alten Bauernhäusern und Almhütten, in Melkschemeln und alten Käsereitechnologien manifestierte sich das Erbe einer alten Kultur, die genauso Respekt verdient wie alte Schlösser, Bibliotheken oder Musikstücke. Die Hirtenkultur reicht bis in Urzeiten zurück, sie hat Gemeinsamkeiten und gemeinsame Wurzeln mit dem Nomadismus in anderen Teilen der Welt, und sie kennt im Grund genommen keine Grenzen. Und schließlich muss auch diese Kultur gepflegt und bewahrt werden, was sie auch mit anderen Formen des kulturellen Erbes gemeinsam hat. Naturschutz ist letzten Endes ein Teilaspekt dieses Bewahrens einer bedrohten Vielfalt. Und gerade nach dem Ende des die Natur oft ziemlich rücksichtslos behandelnden Systems des Kommunismus in meinen Nachbarländern hatten wir viele Ideen für den Naturschutz.
Ich war wie gesagt oft langsam unterwegs, und so vergingen ein paar Jahre, bis ich auch Rumänien entdeckte, das Land hinter der Ungarischen Tiefebene. Wieder war ich fasziniert, und ich erinnere mich noch heute an meine erste Zugfahrt über Cluj in die Bukowina, bei der ich über Hirten mit Fellumhang vor dem Zugfenster genauso staunte wie über Bauern mit Sensen, die auf der Bahnstrecke über die Karpaten ein paar Stationen mit dem Zug mitfuhren. Noch später führte mich meine Neugier in für mich ähnlich spannende Gegenden im Süden Polens, im Südwesten der Ukraine und im Norden Serbiens.
In der Zwischenzeit war ich landwirtschaftlicher Vegetationsökologe geworden, der sich vor allem mit den Wiesen und Weiden Niederösterreichs beschäftigte, in meiner Dissertation dann auch mit einem Vergleich der Steppen im Marchfeld, einem Teil dieses Bundeslandes, mit denen im Osten. Der Osten Mitteleuropas war aber nicht nur ein Urlaubsziel, das ich bei Übernachtungen im Zelt oder im Zimmer am Bauernhof ganz besonders genoss, ich begann mich auch immer mehr mit der Geschichte dieser Landschaften zu beschäftigen. Nicht zuletzt erlebte ich besonders in Rumänien und zwischendurch auch in den ukrainischen Karpaten die Landschaft und ihre Bewirtschaftung oft auch wie durch eine Art Zeitfenster, durch das ich etwas »live« erleben konnte, was in Österreich, in Deutschland, aber auch in Tschechien und in der Slowakei schon Geschichte war.
Dabei denke ich jetzt nicht nur an so manches Pferdefuhrwerk, von dem ich als Wanderer auf der Landstraße mit freundlichen Worten ein Stück mitgenommen wurde. Ich denke vor allem an die Hirten, denen ich auf Bergpfaden in den Karpaten begegnete oder ab und zu auch auf einem Acker in der Ebene. Sie beeindruckten mich nicht nur durch trotz der Sprachdefizite meinerseits oft besondere Herzlichkeit und gelegentlich die Bereitschaft, ihren Käse und mein Brot miteinander zu teilen. Sie erinnerten mich auch daran, wie sehr dieses Land von alten Hirtenwegen durchzogen ist, und wie sehr diese ein Schlüssel sind, um Kultur, Landschaft und auch die Biodiversität zu begreifen.
Reisetipp:
Der Hirtenweg ist zwar aus dem touristischen Angebot des Naturparks Leiser Berge verschwunden, die Gegend ist aber immer noch ein guter Tipp, um bei Spaziergängen und Wanderungen um den höchsten Berg des Weinviertels (Buschberg, 492 m Seehöhe) eine Landschaft mit Wäldern, Äckern und recht großflächigen Steppenrasen kennen zu lernen. Nur 50 km nördlich von Wien ist die Gegend mit ihren kleinen Dörfern erstaunlich entlegen, und die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfordert etwas Geduld. Wenn es eine längere Wanderung sein soll, kann man von der Bahnstrecke Wien–Laa an der Thaya aufbrechen. Mit dem Bus kommt man nach Ernstbrunn, nach genauem Fahrplanstudium auch mitten ins Gebiet.
Lesetipp:
HOLZNER, Wolfgang: Österreichischer Trockenrasenkatalog. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, Wien 1986
Wege Richtung Osten (ein Überblick)
Vom Großraum Wien–Bratislava aus kann man sich grundsätzlich in zwei Richtungen auf den Weg in den Osten machen, durch die Karpaten oder die Donau abwärts durch die Tiefebene. Auf dem Weg durch die Berge folgen die Kleinen Karpaten, die Weißen Karpaten und die Beskiden, womit wir, zunächst einmal im Kopf, über den östlichen Rand Tschechiens schon bis nach Polen gereist sind. Fatra und Tatra sind bekannte Gebirgsstöcke in der Slowakei, die Waldkarpaten ziehen sich dann ein Stück durch die Ukraine und schließlich nach Rumänien hinein. Dort folgen Ost- und Südkarpaten, bis schließlich am Eisernen Tor an der Grenze mit Serbien wieder die Donau erreicht wird. Der höchste Berg der Karpaten mit 2.655 m Seehöhe befindet sich in der Hohen Tatra. In ihrem über 1.300 km langen Bogen umschließen die Karpaten ein Becken, das man grob in die Ungarische Tiefebene und das Hochland von Siebenbürgen einteilen kann. Die Ebene wird von der Donau durchflossen und ist eine Art Vorposten des weitläufigen Flachlandes Osteuropas.
Alpen und Karpaten sind gewissermaßen das Rückgrat der mitteleuropäischen Landschaften. Dabei kommt den Karpaten, zumindest bei den Menschen, die westlich des ehemaligen »Eisernen Vorhanges« leben, die Rolle des »vergessenen Gebirges« zu. Interessanterweise hat das auch schon vor über 200 Jahren der Geograf und Naturforscher Balthasar Hacquet so gesehen. Er wurde um 1739 in Frankreich geboren, war Professor in Lemberg und Krakau und starb 1815 in Wien. Im Geist der Aufklärung unter Kaiser Josef II. beschrieb er die Karpaten in seinen Büchern, die den köstlichen Titel »Physikalisch-Politische Reisen« tragen und in den letzten Jahren in einer gekürzten Neuauflage erschienen sind. Er beobachtete, ersann Verbesserungsvorschläge für das Leben der Bergbewohner und trug gleichzeitig zur Eingliederung der Karpatenlandschaften in die Verwaltungsstrukturen der Habsburgermonarchie bei. Schon in der Vorrede zu seinem Werk schrieb er: »Unter der Gebirgskette von Europa hat der Strich, welcher die Karpaten ausmacht, das Schicksal gehabt, von Naturforschern am wenigsten bereist zu werden.«
Vieles hat sich seit damals geändert, der Ruf der Wildheit, Unbekanntheit und Vergessenheit ist den Karpaten aber geblieben, gerade auch im Vergleich mit den Alpen, die mittlerweile touristisch erschlossen sind wie kein anderes Gebirge der Welt. Tatsächlich lassen auch heute noch manche Landschaften der Karpaten an das denken, was aus den Alpen in Landschaftsgemälden aus dem 19. Jahrhundert überliefert ist. Dazu passt eine oft deutlich einfachere Infrastruktur, aber im Grunde sind die Karpaten einfach zu bereisen. Es gibt nicht unbedingt schnellen, aber meistens gut organisierten öffentlichen Verkehr, zumindest in Tschechien und der Slowakei ein perfekt markiertes Wanderwegenetz, und auch in Polen, der Ukraine und Rumänien letztlich gar nicht so wenig Karpatentourismus, der meistens ein Binnentourismus der jeweiligen Länder ist. In allen Ländern gehören da heutzutage auch ein paar Schigebiete dazu.
In vielen Teilen der Karpaten gehören die Wiesen- und Weidelandschaften zu den artenreichsten der Welt. Wie ihre Bewirtschaftung organisiert ist, ist von Gegend zu Gegend und von Land zu Land heute sehr unterschiedlich. Die Zukunftsperspektiven der Wiesen und der Landwirtschaft sind heute nicht leicht einzuschätzen. Je weiter man nach Osten kommt, desto mehr spielt eine auf den ersten Blick sehr traditionell wirkende Form der Landwirtschaft zur Selbstversorgung eine große Rolle. Aber wie überall wirken sich auch hier gesellschaftliche Veränderungen auch auf die Landwirtschaft aus. Es gibt auch einige Spezialitäten aus der Karpatenlandwirtschaft, die auch eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung erreicht haben, nicht zuletzt Brimsen und ein paar andere spezielle Käsesorten. Mit Ausnahme der Ukraine und Serbiens sind heute alle Länder der Region Mitglied der EU und nehmen somit auch an einem vielfältigen landwirtschaftlichen Förderungssystem teil, das nicht kostendeckende Produktpreise ausgleichen und ökologische Leistungen der Landwirtschaft abgelten soll. Gleichzeitig bemüht sich mit unterschiedlichen Ansätzen und Möglichkeiten in allen Ländern auch staatlicher und zivilgesellschaftlich organisierter Naturschutz um die Erhaltung der Artenvielfalt. Außer den Wiesen und Weiden gehören auch die Buchenwälder zum wichtigen Naturerbe der Karpaten.
In der Ukraine und in Rumänien können die Karpaten auch als die Grenze Mitteleuropas zu Osteuropa gesehen werden. Auf der östlichen Seite folgt weitgehend ebenes Land, oft mit eingeschnittenen Flusstälern. Während heute der Ackerbau dominiert, reiste man hier in früheren Jahrhunderten durch endlose Steppenlandschaft, die unzähligen Viehherden als Weideland diente.
Wählt man von Wien weg den erwähnten Weg durch die Ebene, stößt man nach dem Wiener Becken zunächst auf das Leithagebirge, einen recht sanften und isolierten Ausläufer der Alpen. Dahinter folgt die Kleine Ungarische Tiefebene, in die beim Neusiedler See auch das österreichische Staatsgebiet hineinreicht. Grob der Donau folgend werden bei Budapest wieder niedrige Berge gequert: das Ungarische Mittelgebirge. Dahinter erstreckt sich dann die Große Ungarische Tiefebene, die sich dann auch ein ordentliches Stück nach Serbien und Rumänien hinein zieht. Uralten Wegen folgend können wir von Belgrad aus durch fruchtbare Täler zwischen den Gebirgen der Balkanhalbinsel hindurch Mitteleuropa Richtung Mazedonien und Griechenland verlassen. Nicht zufällig kam diese alte Route Richtung Mittelmeer in den letzten Jahren als »Balkanroute« in die Medien. Oder wir folgen der Donau Richtung Schwarzes Meer, von wo sich Weiterwege weit nach Asien hinein ergeben, nicht zuletzt die berühmte Seidenstraße Richtung China. Oder wir queren doch das Hochland von Siebenbürgen, bis wir im Osten auf den Hauptkamm der Karpaten treffen.
In verschiedener Weise teilt die Ungarische Tiefebene ihre Geschichte mit der Steppenzone Osteuropas. Auch sie wurde von wandernden Viehherden geprägt. Sie kamen im Westen bis in die Gegend um Wien, im Osten auf die Karpatenalmen und bis an das Schwarze Meer, und mitunter in beide Richtungen noch weiter. Am Eisernen Tor treffen nicht nur die Karpaten wieder auf die Donau und nähern sich dem Balkangebirge an, hier kommen sich die Ebenen Ungarns und die Steppen Osteuropas nahe. Südlich der Karpaten beginnt hier die Ebene der Walachei, die schon zur Steppenzone Osteuropas zu zählen ist.
Noch weiter im Osten sind die Grenzen zwischen Europa und Asien erstaunlich unscharf. Es folgen die aus europäischer Perspektive endlosen Steppen Kasachstans und der Mongolei. Die Steppenzone zieht sich dann sogar noch ein Stück nach China hinein, und mit einem kleinen Umweg kann man auch noch die Gebirgssteppen Tibets dazuzählen.
Lesetipp:
SCHARR, Kurt (Hrsg.): Die Karpaten – Balthasar Haquet und das »vergessene« Gebirge in Europa. Innsbruck 2004
Lange Geschichte der Weiden
Weidelandschaften sind aus den Bemühungen der Menschen um die Erzeugung von Nahrung entstanden. Sie sind keine »unberührte Natur«, aber auch keine »gezähmte Natur« wie ein Acker, ein Garten oder ein Park, wo in erster Linie »nützliche« oder vom Menschen erwünschte Pflanzen wachsen. Sie sind »naturnah« in dem Sinn, dass hier viele Prozesse vom Menschen unbeeinflusst ablaufen. Sie sind deshalb auch wunderbare Orte, um über das Verhältnis von Mensch und Natur nachzudenken, über die Spannung und das Zusammenspiel zwischen Natur und Kultur, und dabei auch Fragen zu stellen wie diese: In welche Richtung kann und soll sich dieses Verhältnis weiterentwickeln, für sich persönlich, für eine Region oder die gesamte menschliche Gesellschaft? Vielleicht liegt ja auch an der Relevanz dieser Fragen einer der Gründe für die Faszination der Weidelandschaften.
Die Geschichte unserer Weiden beginnt jedenfalls sehr früh. Wenn wir wollen, können wir sogar auf den Anfang der Menschheit in den tropischen Savannenlandschaften Afrikas zurückblicken. Wir sehen dort eine Landschaft, die erstaunlicherweise einer »halboffenen« Weide in Mitteleuropa gar nicht so unähnlich ist, wenn auch natürlich ohne landwirtschaftliche Nutztiere und mit ganz anderen Gräsern, Bäumen und wilden Weidetieren. Irgendwann im Laufe der Altsteinzeit, des mit Abstand längsten und aus unserer Perspektive am wenigsten verstehbaren Teils der Menschheitsgeschichte, wanderten von dort aus Menschen in mehreren Migrationswellen und mit Zwischenstationen nach Mitteleuropa. Wildfrüchte sammelnd und Wildtiere jagend kamen sie hier in eine Welt mit aus unserer heutigen Perspektive recht großen Tieren wie Wildrindern, Wildpferden, Hirschen, Bären und sogar Elefanten und Nashörnern, aber nicht unbedingt immer sehr menschenfreundlichem Klima. Sie lebten hier in Wäldern, dann wieder nach Klimaänderungen viele Generationen lang in Steppen. Dieser Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten, letztere auch Eiszeiten genannt, ging für uns unvorstellbar langsam vor sich, gerade auch im Vergleich mit dem derzeit vom Menschen verursachten Klimawandel. Die letzten vier Eiszeiten kann man anhand der Spuren von Gletschern und Flüssen in der Landschaft gut nachvollziehen. Dabei dauerte allein die letzte Eiszeit um die 60.000 Jahre, bevor sie in die derzeitige Warmzeit überging.
Im Wechsel der Warm- und Kaltzeiten änderte sich auch der Tierbestand, der den Menschen als Jagdbeute diente. So lebten in den Wäldern der Warmzeiten zum Beispiel Waldelefanten, Mammuts hingegen in den eiszeitlichen Kältesteppen der nicht vergletscherten Teile Mitteleuropas. Darüber, wieweit diese riesigen, behaarten Elefanten tatsächlich von den altsteinzeitlichen Menschen gejagt wurden, vielleicht auch von darauf spezialisierten Gruppen von Menschen, und ob gar die Bejagung zu ihrem Verschwinden beitrug, gibt es wilde Spekulationen. Eine mögliche Kultur der Mammutjäger regt jedenfalls immer wieder Forschergeist und Fantasie an. Über diese Großtiere hinaus nutzten die altsteinzeitlichen Menschen aber sicher ein vielfältiges Nahrungsspektrum. Möglicherweise geht sogar unsere besondere emotionale Verbundenheit mit Bären darauf zurück, dass Menschen aus dem Beobachten dieser Tiere mit doch recht ähnlichen Nahrungsgewohnheiten lernen konnten, wie man in Mitteleuropa überlebt. Wildes Obst wie Heidelbeeren und Himbeeren spielten dabei gewiss eine Rolle, ebenso Blätter, Nadeln, Knospen und natürlich auch Früchte von Bäumen, die Samen von Gräsern, wohl auch Fische, und schließlich ein doch recht breites Spektrum an Säugetieren und Vögeln unterschiedlicher Größe als Jagdbeute, schließlich wahrscheinlich auch die leicht zu erbeutenden Eier der Wildvögel.
Zumindest ein Teil der Menschen durchstreifte auf langen Wanderungen, bei denen sie den Herden des von ihnen gejagten Wildes folgten, große Landschaftsräume. Dabei stiegen sie in Zeiten und Regionen, in denen sich Wälder in den Tieflagen ausbreiteten, im Sommer auch über die Waldgrenze der Gebirge auf. Dort blieben immer gehölzfreie Flächen bestehen, die von den Wildtieren als Sommerweiden genutzt wurden. Deren Nahrungsbasis war mit der Ausbreitung der Wälder in den Warmzeiten nicht unbedingt besser geworden. Einerseits sind die nahrhaften Teile der Bäume für Weidetiere nicht immer so leicht zu erreichen wie Gräser und Kräuter auf dem Boden, andererseits sind die Blätter ausgerechnet der heute in Mitteleuropa häufigsten Baumarten, der Buchen und Eichen, aufgrund ihrer Inhaltsstoffe nur wenig als Nahrung für Mensch und Tier geeignet. Wenn man jetzt die Frage stellt, ob es denn deshalb gar keine Offenflächen unterhalb der Waldgrenze gegeben hat, kann diese aber nicht so einfach beantwortet werden. Erstens gibt es auch im Tiefland Standorte, die nur wenig für Waldwuchs geeignet sind, sei es wegen Trockenheit oder Vernässung. Zweitens muss doch auch den Pflanzenfressern eine gewisse Fähigkeit zugeschrieben werden, den Wald aufzulichten oder gar gebietsweise zurückzudrängen, sei es durch mechanische Beschädigungen oder den Verbiss von Jungbäumen. Man kann sich vorstellen, dass das für Elefanten und Nashörner noch mehr gegolten hat als für Rinder, Pferde oder Hirsche. Drittens waren die vorherrschenden Baumarten nicht immer die gleichen, sie wanderten in mehreren Wellen nach Mitteleuropa ein, wobei gerade die Buche nach der letzten Eiszeit erst sehr spät auftrat. Entscheidend ist auch, dass man die Größe des Raumes und die Länge des Zeitraumes in Betracht zieht. Man kann sich schnellere und langsamere dynamische Entwicklungen denken, bei denen in einzelnen Gebieten mehr oder weniger große gehölzfreie Flächen entstanden und wieder vergingen. Dieses Offenland kann jedenfalls auch als Weideland wilder Pflanzenfresser gesehen werden.
Auf dieser Basis kann man sogar spekulieren, ob schon damals die Menschen dabei nachhalfen und, beispielsweise durch das Legen von Feuer, die Nahrungssituation ihrer Jagdbeute verbesserten. Genauso ist aber in den langen Zeiträumen da und dort der umgekehrte Einfluss der Menschen denkbar, indem durch eine Reduktion der Bestandesgröße wilder Weidetiere der Wald gefördert wurde. Mit beiden Überlegungen sollte man aber etwas zurückhaltend sein, weil doch aller Wahrscheinlichkeit nach die Bevölkerungsdichte der altsteinzeitlichen Menschen zumindest in Mitteleuropa recht gering war.
Ein wichtiger Schritt im Verhältnis zwischen Menschen und Tieren geschah jedenfalls noch in der Zeit des Sammelns und Jagens. Nach und nach wurden aus Wölfen zunächst Jagdgefährten des Menschen und dann Hunde, die ersten Haustiere. Das ist nicht nur in Hinblick auf unsere heutigen vierbeinigen Gefährten interessant, sondern auch, weil sich später ein ähnliches Zusammenleben auch mit Weidetieren entwickeln sollte. Nebenbei sind auch Hinweise auf eine frühe Aufspaltung der Wolfsrudel in sesshafte und nomadische »Kulturen« interessant. Das dürfte mehr oder weniger parallel zu einer Spezialisierung von Menschengruppen auf unterschiedliche Lebensweisen schon in der Altsteinzeit geschehen sein.
Spannend, aber äußerst spekulativ sind Überlegungen, wie noch längst in der Altsteinzeit direkt aus Afrika oder aus der von ihnen schon länger besiedelten Region um das Schwarze Meer zugewanderte »moderne« Menschen die hier schon lange lebenden, anatomisch anders gebauten Neandertaler verdrängten. Beide lebten jedenfalls lange Zeit nebeneinander und führten wahrscheinlich sogar einen ähnlichen Lebensstil. Dabei darf man sich das altsteinzeitliche Leben in Europa keineswegs als ein kümmerliches Dahinvegetieren vorstellen. Wenn auch die individuelle Lebenserwartung deutlich kürzer war als heute, muss man doch von bemerkenswerten kulturellen Leistungen sprechen. Die Menschen schafften es, hier viele Generationen lang zu überleben, sie erfanden immer wieder neue Werkzeuge, nutzten das Feuer und brachten sogar in Form von Felszeichnungen und Steinfiguren die ersten Kunstwerke hervor. Möglicherweise wurde ein Abgehen von dieser »ursprünglichen« Lebensweise gar nicht so richtig als Fortschritt erlebt. Eventuell könnten sogar weit verbreitete Mythen, die von einem vergangenen Paradies erzählen, in ihrem Kern an ein friedliches, naturverbundenes Leben in der Altsteinzeit erinnern. Es gibt jedenfalls deutliche Hinweise, dass die individuelle Lebenserwartung mit dem Beginn des Ackerbaus zunächst eher abnahm.
Um vom Weideland der von den Menschen gejagten Wildtiere zu den ersten richtigen Weiden zu kommen, müssen wir Mitteleuropa noch einmal verlassen und in eine Region blicken, aus der eine neuerliche Einwanderungswelle die vielleicht gewaltigste Veränderung der menschlichen Lebensweise hierherbringen sollte. Ackerbau und Viehzucht begannen sich vor etwa 10.000 Jahren im Vorderen Orient zu entwickeln. An den Abhängen der Gebirge von Israel bis in den Iran, einer Region am Rand der Wüste, die wegen der Form auf der Landkarte auch »fruchtbarer Halbmond« genannt wird, weideten zunächst die Vorfahren unserer Schafe und Ziegen in Steppen aus wilder Gerste und wildem Weizen. Auch die Rinder wurden dort erstmals zum landwirtschaftlichen Nutztier. Das Leben als Jäger und Sammler wurde dabei allmählich von der gezielten Zucht von Haustieren und vom Anbau von Kulturpflanzen ersetzt. Man spricht von der neolithischen Revolution und nennt das Zeitalter, das daraus entstehen sollte, Jungsteinzeit oder Neolithikum.
Man wird sich den Anfang dieser Neuerungen wohl wie ein experimentelles Herantasten über eine längere Zeit vorstellen müssen und kaum als einmalige Erfindung. Gut möglich ist es auch, dass die Menschen immer wieder ganz gut mit einigen der Zwischenstufen am Weg zum Haustier oder zur richtigen Kulturpflanze lebten, bevor dann wieder ein Schritt weiter gemacht wurde. Eine Theorie besagt zum Beispiel, dass Getreide, aus dem zum Beispiel eine Urform des Biers als vielleicht erstes alkoholisches Getränk produziert wurde, zunächst eher aus spirituellen oder kultischen Gründen genutzt wurde. Dadurch erreichte ein früher Ackerbau bereits eine größere geographische Verbreitung, bevor ihm dann einige Zeit später eine größere Bedeutung für die Ernährung zuteilwurde. Dabei revolutionierte der Getreideanbau die Lebensweise der Menschen und erzwang eine neue Form der Sesshaftigkeit. Die These wird jedenfalls vom Evolutionsbiologen Josef H. Reichholf aus München vertreten.
Vielleicht galt ja auch für die ersten Haustiere, dass nicht von Anfang an Nützlichkeitsüberlegungen hinter der Domestizierung standen. Viel später waren ja Pferde in manchen Gebieten auch eher Statussymbole einer Oberschicht als verbreitete Nutztiere. Ziemlich sicher erforderte der Schritt vom Wild- zum Haustier ein langes, intensives Zusammenleben von Mensch und Tier, das wir uns heute eigentlich auch nicht mehr konkret vorstellen können.
Die in Mitteleuropa auf altsteinzeitliche Weise lebenden Menschen haben wohl lange Zeit von diesen Entwicklungen in anderen Teilen der Welt nichts mitbekommen. Für sie endete mehr oder weniger gleichzeitig die letzte Eiszeit. Allerdings geschah auch das alles andere als mit einem Schlag, sondern, wie man heute vermutet, mit einer relativ raschen Erwärmung vor etwa 14.000 Jahren, einem neuerlichen jahrtausendelangen Temperaturrückgang und einer von einzelnen Kälteeinbrüchen unterbrochenen Wärmeperiode, die vor etwa 11.000 Jahren begann und die in Grund genommen bis heute anhält. Die flächige Vergletscherung im Norden Europas schmolz zu Beginn der Warmzeit ab, in den Alpen zogen sich die Gletscher in das Hochgebirge zurück, aus den Karpaten verschwanden sie völlig. Aus ihren Rückzugsräumen, überwiegend wahrscheinlich im Südosten und Südwesten Europas, da und dort aber wohl auch an geeigneten Standorten am Rand der mitteleuropäischen Gebirge, kehrten die Waldbaumarten in mehreren Einwanderungswellen nach ganz Mitteleuropa zurück. Als letzte Art kam, wie schon erwähnt, die Buche, heute der vorherrschende Waldbaum weiter Teile Mitteleuropas.
Vermutlich erreichte die jungsteinzeitliche Landwirtschaft die großen Täler und Becken im Inneren Europas um etwa 5500 v. Chr. Am Weg aus dem Vorderen Orient hierher haben wohl die Region um das Schwarze Meer und hier vor allem die Vorländer des Kaukasus eine wichtige Rolle gespielt. Der wichtigste Ausbreitungsweg führte dann wohl die Donau entlang aufwärts. Weitere Wege in das Innere Europas führen über Griechenland und die »Balkanroute« oder um das Mittelmeer herum über Spanien. Ob dabei jetzt eine zugewanderte Bevölkerung die Ureinwohner verdrängte, oder ob diese freiwillig oder auch unter Zwang die neue Lebensweise übernahm, wird wohl immer ein Rätsel bleiben, wie wir auch von den steinzeitlichen Sozialstrukturen immer nur sehr vage Vorstellungen haben werden. Möglicherweise können in den Alpen und Karpaten (wie auch in anderen Gebirgen) verbreitete Sagen von »wilden Menschen« in einsamen Bergregionen als ein Hinweis für ein längeres Nebeneinander beider Kulturen gedeutet werden.
Der Ackerbau bewirkte jedenfalls eine größere Ortsfestigkeit der menschlichen Ansiedlungen, wobei man aber auch dabei nicht zu sehr mit heutigem Maß messen sollte. Möglicherweise gab es auch schon sehr früh ein Nebeneinander einer sesshaften Bevölkerung mit nomadisch lebenden Menschengruppen, die einerseits in einem gewissen Austausch miteinander standen und andererseits ihre jeweilige Lebensweise immer weiter spezialisierten. Es ist sogar denkbar, dass es schon zwischen sammelnden und jagenden Menschen Vorbilder für eine ähnliche Arbeitsteilung gegeben hatte. Andererseits musste auch nicht jede Siedlung von Ackerbauern langfristig am gleichen Ort bleiben. Oft war das wahrscheinlich nur für wenige Jahre bis Jahrzehnte der Fall.
Gewiss waren, wie uns zahlreiche archäologische Ausgrabungen beweisen, hochwassersichere Orte im Nahbereich von Flüssen in fruchtbaren Tiefländern Mitteleuropas von Anfang an ein optimaler Siedlungsplatz für Menschen, die Ackerflächen kultivieren und Weidetiere ernähren mussten. Bekannt ist die Bandkeramikkultur, die sich als erste jungsteinzeitlich-bäuerliche Kultur von Ungarn bis in die Niederlande ausgebreitet haben dürfte. Während sich im Mittelmeerraum damals vor allem die Haltung von Schafen und Ziegen durchgesetzt hatte, züchteten diese frühen Bäuerinnen und Bauern hauptsächlich Rinder und Schweine.
So richtig spannend wird es in unserem Zusammenhang, wenn wir uns jetzt vorzustellen versuchen, wie die Landschaft aussah, in der in Mitteleuropa die ersten Bäuerinnen und Bauern, Viehhirtinnen und -hirten tätig wurden. Dazu gibt es bisher im Wesentlichen drei Theorien: Erstens: Die jungsteinzeitlichen Menschen besiedelten ein dicht bewaldetes Land, das sie nach und nach rodeten, um Platz für Äcker und Weiden zu schaffen. Zweitens: Die menschliche Besiedelung begann in den günstigsten Lagen schon so früh nach der letzten Eiszeit, in der sich der Wald weitgehend aus Mitteleuropa zurückgezogen hatte, dass eine Kontinuität von der eiszeitlichen Kältesteppe zum landwirtschaftlich genutzten Offenland gegeben war. Drittens: Nach der Eiszeit hatten Herden wilder großer Pflanzenfresser wie Wildrinder und Wildpferde für die Offenhaltung der Landschaft gesorgt. Die Menschen ersetzten diese Tiere nach und nach mit ihren Rindern, Schafen, Ziegen und später auch Pferden.
Diese Theorien sind auf einen zweiten Blick nicht so widersprüchlich zueinander wie auf den ersten. Zunächst gibt es keinen Grund für die Annahme, dass sich diese Entwicklung in ganz Mitteleuropa nach dem gleichen Modell vollzogen hat. In entlegenen Teilen der Karpaten oder des Böhmerwaldes erfolgte eine Waldrodung zur landwirtschaftlichen Nutzung tatsächlich erst vor zwei- oder dreihundert Jahren, in anderen landwirtschaftlich ungünstigen Lagen im Mittelalter. Umgekehrt liefert vor allem die Bodenkunde starke Hinweise für die kontinuierliche Waldfreiheit in landwirtschaftlichen Gunstlagen seit dem Ende der letzten Eiszeit. Die mächtigen Schwarzerdeböden über den in den Eiszeiten aus den nahen Gletschern angewehten Lössdecken, typisch für trockene Beckenlagen in Mitteleuropa und die Ebenen Osteuropas, hätten sich nämlich unter längerfristiger Waldbedeckung zu anderen Bodentypen weiterentwickelt. Und zum Einfluss der wilden Großpflanzenfresser für die Geschichte des Weidelandes ist ein differenzierter Blick erforderlich und das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.
Fast ein wenig revolutionär für die Vegetationsökologie waren in diesem Zusammenhang jedenfalls die im Jahr 2000 publizierten Überlegungen des niederländischen Naturschutzexperten Franciscus W. M. Vera. Er wendet sich gegen die bisher in der vegetationsökologischen Literatur vorherrschende These, Mitteleuropa sei unterhalb der Waldgrenze der Gebirge nach dem Ende der letzten Eiszeit von dichten Wäldern bedeckt gewesen, und untermauert seine Schlussfolgerungen mit zahlreichen Beispielen zur Waldgeschichte. Eine zentrale Überlegung ist, dass sich die mitteleuropäischen Eichenarten – nach den Buchen hier die zweitwichtigste Gattung von Waldbäumen – nur in »parkartigen« Landschaften nachhaltig verjüngen können und nicht in geschlossenen Wäldern. Auf Weiden hingegen wachsen junge Eichen im Schutz dorniger Gebüsche heran. Ergänzt werden diese Überlegungen mit einer Analyse des Bedeutungswandels der Begriffe »Wald« und »Forst«, die bis in die Neuzeit nicht unbedingt für geschlossene Wälder im heutigen Sinn standen, sondern für Flächen mit einem bestimmten rechtlichen Status. Die Beweidung durch wilde und domestizierte Pflanzenfresser sieht er insgesamt als entscheidenden Faktor in der Wald- und Landschaftsgeschichte Mitteleuropas.
Überlegungen, dass Weiden eine sehr alte Geschichte haben, gibt es schon viel länger. Für die Schwäbische Alb formulierte der Geograf Robert Gradmann Ende des 19. Jahrhunderts die so genannte Steppenheidetheorie. Sie besagt, dass die jungsteinzeitlichen Menschen zunächst in klimabedingt waldfreien, jedoch mit Gebüschen strukturierten Landschaften gesiedelt hätten und noch nicht dazu fähig gewesen wären, den Wald zu roden. In dieser Form wurde die Theorie bald widerlegt. Den Blick wieder auf die Weidelandschaften der Karpatenländer richtend, können wir aber ein paar Tatsachen festhalten. Zunächst sind dichter Wald und baumfreies Grasland nicht die einzigen Optionen in der Landschaft. »Halboffene« Weidelandschaften sollten auch eine wichtige Rolle in unseren Überlegungen spielen. Weiters fehlen heute in Mitteleuropa große grasfressende Wildtiere. Hirsche, Rehe, Gämsen und Wildschweine sind hier heute die größten wildlebenden Pflanzenfresser. Elche leben nur in einem sehr kleinen Teil Mitteleuropas und auch dort nur in sehr bescheidener Anzahl. Keines dieser Tiere ist ein typisches Weidetier. Man kann sie eher mit dem englischsprachigen Ausdruck als Browser, also als Blätterfresser oder als Konzentratselektierer bezeichnen. Die unterschiedlichen Nahrungsgewohnheiten der Pflanzenfresser werden uns später noch ein wenig beschäftigen. Einstweilen halten wir einmal fest, dass Wildpferde und Wildrinder nicht nur ein Stück größer sind als die heutigen wilden Pflanzenfresser Mitteleuropas, sondern im Gegensatz zu diesen auch tatsächlich in erster Linie Grasland als Futterbasis nutzen. Sie lebten tatsächlich bis vor nicht allzu langer Zeit in Mittel- und Osteuropa.
Der Tarpan als letztes europäisches Wildpferd starb erst im 19. Jahrhundert aus. Die Ursachen dafür waren der Verlust des Lebensraumes und die Bejagung. Unterschieden wurde der Waldtarpan Westeuropas vom Steppentarpan, der von den Karpaten bis zum Ural vorkam. Die letzten Tarpane lebten in den Steppen der Südukraine. In der Jungsteinzeit wurden die Pferde wahrscheinlich hauptsächlich in der Gegend zwischen den südukrainischen und den westkasachischen Steppen zu Haustieren, wobei zahlreiche Zwischenstufen und Formen des überregionalen Austausches anzunehmen sind. Vermutlich kreuzten sich etwa immer wieder gezähmte Stuten mit wilden Hengsten. Über weitere, zusätzlich zu den Tarpanen früher in Mitteleuropa lebende Arten von Wildpferden kann nur spekuliert werden. Was es auch heute noch gibt, sind mehrere Hauspferderassen, die dem Tarpan sehr nahe stehen, und die berühmten Przewalskipferde. Das sind richtige Wildpferde, die im Jahr 1878 von Nikolai Michailowitsch Przewalski, einem Offizier der russischen Armee, bei einer Forschungsreise in den westlichen Ausläufern der Wüste Gobi entdeckt wurden. Darüber, ob es sich um eine rein asiatische Wildpferdeart handelt oder ob diese Tiere früher auch in Europa vorkamen, gehen die Meinungen auseinander. Jedenfalls unterscheiden sich die Tiere anatomisch und genetisch eindeutig vom Tarpan und gelten nicht als Stammform der Hauspferde. Während Przewalski nur Haut und Schädel eines der später nach ihm benannten Pferde nach St. Petersburg brachte, wurden später solche Wildpferde in Zentralasien eingefangen und in europäischen Zoos gezüchtet. So konnte wenigstens eine Wildpferdeart überleben, die mittlerweile in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet auch schon ausgestorben wäre. Derzeit werden Przewalskipferde in geeigneten Steppenlandschaften wieder ausgewildert. Eine davon, die Hortobágy-Puszta in Ungarn, werden wir auf unseren Streifzügen durch die Weidelandschaften des östlichen Mitteleuropas noch besuchen.
Ähnlich kompliziert verhält es sich mit den Wildrindern. Auerochsen lebten in Europa und Asien von der Atlantik- bis zur Pazifikküste, wobei die Hausrinder im Wesentlichen nicht von den mitteleuropäischen, sondern von vorderasiatischen Auerochsen abstammen dürften. Auerochsen lebten in Wäldern, Auen, Steppen und Gebirgen. Sie waren vermutlich eine wichtige Jagdbeute der Steinzeitmenschen. Die domestizierten Rinder dienten zunächst wie die gejagten Wildrinder als Fleischlieferanten und erst viel später der Milchproduktion. Wo es welche gab, wurden die wilden Auerochsen natürlich auch von einer vorrangig landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung weiterhin gejagt. Die letzte Auerochsenkuh starb im Jahr 1627 in der Nähe von Warschau, obwohl die Tiere dort ein paar Jahrzehnte vorher unter den Schutz des polnischen Königs gestellt worden waren. In den 1920er-Jahren wurden in deutschen Zoos robuste Rinder gezüchtet, die den Auerochsen zumindest äußerlich ähnlich sehen. Nach den Brüdern Heinz und Lutz Heck, die mit dieser sogenannten »Rückzüchtung« begannen, heißen diese Rinder Heckrinder. Daneben gab es in Europa mit dem Wisent noch eine zweite Wildrinderart. Diese ähnelt mit dem tief angesetzten Kopf dem amerikanischen Bison, ist jedoch etwas kleiner. Wisente waren bis ins frühe Mittelalter in Europa weit verbreitet und wurden immer wieder auch mit Auerochsen verwechselt. Mehr noch als Auerochsen sind Wisente Bewohner strukturreicher Waldlandschaften, wo sie sich von der Krautschicht, von Sträuchern und teilweise auch von der Baumrinde ernähren. Ebenso wie die Auerochsen ziehen sie im Sommer auch in die Hochlagen der Gebirge. Mit viel Glück entgingen die Wisente in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im heutigen polnisch-weißrussischen Grenzgebiet und im Kaukasus der Ausrottung und besiedeln dort auch heute noch weitläufige Waldlandschaften.
Die Wildformen von Schafen und Ziegen, erstere auch Mufflons genannt, sind eigentlich in Mitteleuropa nicht heimisch. Allenfalls besiedelten Wildschafe vom nahen Balkangebirge aus Teile der Karpaten, bis sie dort schon in vorgeschichtlicher Zeit durch die Bejagung ausgerottet wurden. Wildschafe und -ziegen überlebten in den Gebirgen Kleinasiens und auf einzelnen Mittelmeerinseln. Dort ist es aber fraglich, ob es sich nicht doch um die Nachkommen verwilderter Haustiere handelt. Als herrschaftliches Jagdwild kamen Mufflons und teilweise auch Wildziegen dann erst im 19. Jahrhundert in die Karpaten und andere Teile Mitteleuropas. Als Haustiere gehörten Schafe und Ziegen aber von Anfang an zur mitteleuropäischen Landwirtschaft. Ihre Milch wurde auch schon in der Jungsteinzeit genutzt.
Bei diesem kurzen Blick auf die Wildformen der größten europäischen Weidetiere haben wir so nebenbei auch Wichtiges über ihre Ansprüche an Nahrung und Lebensraum erfahren. Dass Pferde, Rinder und wohl auch Schafe und Ziegen in erster Linie Gras fressen, das auf weitgehend gehölzfreiem, wiesenartigem Grasland wächst, liegt auf der Hand, ist aber doch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Zunächst einmal müssen wir uns die Wälder der Vergangenheit anders vorstellen als die heute üblichen Wirtschaftswälder, in denen die Bäume mit einem bestimmten Alter, das meist um Jahrhunderte von ihrer natürlichen Lebenserwartung entfernt ist, geschlägert werden. Im mitteleuropäischen Urwald gab es schon aus Gründen der natürlichen Waldentwicklung immer wieder lückige bis offene Stellen, somit Gras am Waldboden und Futter für wilde und domestizierte Weidetiere. Diese wiederum fressen zumindest im Winter nicht nur Gras, sondern auch junge Gehölze sowie Laub und Knospen der Waldbäume, sofern sie dieses nahrhafte Futter erreichen können. Mitunter schälen sie auch die Rinde von den Bäumen. Trockenes Laub war auch in der bäuerlichen Landwirtschaft bis vor kurzem als Winterfutter in manchen Regionen sogar wichtiger als Gras. Besonders gut geeignet sind dafür manche eher seltene Waldbaumarten wie Eschen, Ahorn und Ulmen.
Begrenzend für die Bestandesdichte der Weidetiere war in Mitteleuropa das Futterangebot im Winter. Jahreszeitliche Wanderungen in schneearme Gebiete wie die Auen der großen Flüsse oder, wenn das möglich ist, einfach ein Stück Richtung Süden, kann dieses erweitern. Darüber hinaus ist es die Frage, wieweit die wilden Weidetiere die Fähigkeit hatten, auch großflächig für offenes Grasland zu sorgen, oder ob dabei immer schon die Menschen ihre Hände im Spiel hatten, sei es durch zusätzliche Auflichtung des Waldes, spätestens ab der Jungsteinzeit auch durch Vorratshaltung von getrocknetem Gras oder Laub für den Winter, oder auch durch eine gezielte Weideführung der Haustierherden.
Auf einen in der Fülle der Detailfragen faszinierenden Umstand wurde ich vor ein paar Jahren im polnischen Białowieża-Nationalpark aufmerksam gemacht. Dort leben die schon erwähnten Wisente in einer Landschaft, die aus einem erhalten gebliebenen Urwaldrest, heutzutage ausgedehnten Wirtschaftswäldern und einzelnen, von Wiesen umgebenen Dörfern besteht. Durch Jahrhunderte hindurch haben die Bauern dort das Heu für die Winterfütterung ihrer Hausrinder und -pferde in »Heumandeln« auf den Wiesen gelagert und so zunächst unabsichtlich auch den Wisenten über den Winter geholfen. Später ordneten die Förster, die das ungewöhnliche Jagdwild für polnische Könige und später russische Zaren sichern wollten, genau diese Art der Heuaufbewahrung als Winterfütterung für die Wisente an. Ob und wie weit die Wisente sonst im Winter nach Süden gewandert wären, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Jedenfalls verbesserte hier die Vorratshaltung der Bauern in diesem Fall auch die Überwinterungsmöglichkeiten der wilden Pflanzenfresser. Für unsere Fragestellung ist jedenfalls wichtig: Eine größere Zahl überwinternder Weidetiere bedeutet über das ganze Jahr gesehen einen stärkeren Einfluss auf die Landschaft und damit größere Offenlandanteile. Deshalb gibt es zumindest seit der Jungsteinzeit nicht nur Waldweiden und »halboffene« Weiden mit Gehölzanteilen, sondern auch weitgehend gehölzfreies, offenes Weideland, das sowohl Wild- als auch Haustieren zur Verfügung stand.
Wenn die Futterbasis im Sommer knapp wird, kann, wie schon erwähnt, in gebirgigen Regionen nach oben ausgewichen werden. Oberhalb der Waldgrenze der Gebirge befindet sich Grasland, das ein paar Monate lang hervorragende Nahrung für Weidetiere bietet. Diese Flächen wurden auch von wilden Auerochsen und Wisenten genutzt. Altsteinzeitliche Jäger und Sammler waren den Wildwechseln gefolgt. Jetzt nutzten die Hirten mit ihren Herden die entstandenen Pfade hinauf in die Berge. Die Almwirtschaft mit der jahreszeitlichen Wanderung von Haustierherden begann in den Alpen und Karpaten schon in der Jungsteinzeit. Dabei wurde die Waldgrenze auch deutlich abgesenkt. Einerseits geschah das direkt durch den Verbiss der Weidetiere, andererseits auch durch ein gezieltes Auflichten des Waldes durch die Menschen, um die Futterbasis der Herden zu verbessern. Wald wurde darüber hinaus auch gerodet, um im Zuge der Ausweitung der Besiedlung im Bergland den Bedarf an Brenn- und Bauholz zu decken. Um wie viele Höhenmeter die Waldgrenze verschoben wurde und wie hoch die ursprüngliche Ausgangsbasis lag, ist bei der vielfältigen Topografie der Gebirge eine recht kniffelige Frage. Wesentlich ist, dass eine Absenkung um 100 bis 300 Höhenmeter in einzelnen Berggruppen eine Vervielfachung der als Weideland nutzbaren Offenflächen und einen Zusammenschluss der vereinzelten Hochgebirgsrasen zu zusammenhängenden Almen bewirkt hat. Wie hoch nun die Waldgrenze tatsächlich liegt, ist nach den Klimaverhältnissen und der Nutzungsgeschichte regional sehr verschieden. In den Karpaten liegt sie im Allgemeinen deutlich tiefer als in den Alpen, zwischen 1.150 m auf isolierten, randlichen Bergen im Norden bis zu 1.900 m in den Südkarpaten.
Die Weidetiere nutzten aber auch die Wälder unterhalb der Waldgrenze. Waldweide steht erst seit dem 19. Jahrhundert im Ruf der Waldverwüstung und ist entsprechenden Anfeindungen der modernen Forstwirtschaft ausgesetzt. Zumindest als »Schneeflucht« bei sommerlichen Kälteeinbrüchen ist sie für das Weidevieh auf vielen Almen aber noch immer ein tatsächlich überlebenswichtiger Teil der Almwirtschaft. Bei stärkerem Beweidungsdruck löst sich der Wald zu einer »halboffenen« Weide mit kleinen Waldstücken, Gebüschbeständen und Einzelbäumen auf. Solche Weidelandschaften wirken erstaunlich vertraut, nicht zuletzt, weil sie im 19. Jahrhundert auch zu einem Vorbild für die Parkgestaltung geworden sind. Tatsächlich spricht man heute sogar von »parkartigen« Weidelandschaften. Heute entsprechen sie nicht nur dem ästhetischen Idealbild vieler Menschen, wegen ihres Artenreichtums sind sie in vielen Fällen auch zu einem Leitbild des Naturschutzes geworden.
Beim Thema Gehölze auf der Weide berühren wir auch gleich noch einmal die Frage nach den anderen Arten von Pflanzenfressern in Mitteleuropa. Unter den nach dem Ende der letzten Eiszeit in Mitteleuropa lebenden Wildtieren haben wir ja höchstens größeren Herden von Rindern und Pferden zugetraut, selbst für gehölzfreie, gräserdominierte Flächen zu sorgen. Elefanten und Nashörner kamen hier jetzt im Gegensatz zu früheren Eis- und Zwischeneiszeiten nicht mehr vor. Elche, Rothirsche, Rehe und Gämsen können zwar bei größeren Bestandesdichten die Gehölzverjüngung beeinträchtigen, wie die Forstleute aus oft leidvoller Erfahrung wissen, sie fressen jedoch kaum Gras, sondern selektieren gezielt nährstoffreiche Pflanzenteile wie die Knospen der Gehölze oder Blütenstände von Kräutern. Das Nahrungsangebot in einer Landschaft ist daher für sie viel schneller erschöpft als für grasende Weidetiere. Sie erreichen, zumindest ohne ständige Fütterung durch die Menschen, wie das in Wildgattern geschieht, nie die Bestandesdichten der »Graser« und können daher grasdominiertes Offenland auf Dauer nicht gehölzfrei halten. Unter den Haustieren nehmen Schafe und Ziegen eine Zwischenstellung zwischen den »Grasern« und den Konzentratselektierern ein, wobei die Schafe näher bei den »Grasern« wie den Rindern stehen und die Ziegen näher bei den Selektierern wie den Rehen oder Gämsen. Auf Grasland gilt ihre Vorliebe eher den Kräutern als den Gräsern, wobei sie darüber hinaus auch immer viel an Gehölzen und Zwergsträuchern knappern. Im Winter verschiebt sich bei Wildschafen und -ziegen das Nahrungsspektrum vom Gras zu Samen, Früchten und Gehölzen. Auf dieser Basis könnten auch die von ihnen abstammenden Haustiere auch in halbwegs milden Klimagebieten ganz gut überwintern, was aber heutzutage den Förstern nicht viel Freude machen würde.
Geschickte SchafhirtInnen kennen die nach der Jahres- und sogar Tageszeit unterschiedlichen Fressgewohnheiten der Tiere und lenken so den Einfluss ihrer Herden auf die Vegetation. Auch dadurch wird eine ertragreiche Weide langfristig gesichert, für die Ernährung der Weidetiere ungünstige Pflanzen werden zurückgedrängt. In den Karpaten wurde vor allem die Haltung und Behirtung der Schafherden über die Jahrhunderte perfektioniert. Neben dem Einsatz von Hunden zum Treiben und zum Schutz der Herden gehörten dazu kürzere und weitere Wanderungen, die sowohl dem Tages- wie auch dem Jahresrhythmus folgten. Mitunter wurde dabei der Hauptkamm der Karpaten zweimal im Jahr überquert. Diese halbnomadische Form der Tierhaltung war in ein komplexes wirtschaftliches Gefüge mit anderen Formen der Landnutzung eingebunden. Wir werden das bei unseren Streifzügen in verschiedenen Teilen der Karpaten noch kennen lernen.
Typisch für die traditionelle Weidewirtschaft im Osten Mitteleuropas ist auch, dass hier meistens mehrere Tierarten die gleiche Weide nutzten. Wenn wir diesmal nicht das Gebirge, sondern die ungarische Puszta in der Tiefebene als Beispiel nehmen, finden wir vor nicht allzu langer Zeit Herden von Rindern, Pferden, Schafen, Schweinen und sogar Hausgänsen auf weitläufigem Weideland.
Diese Beispiele zeigen, dass die Landwirtschaft in Mitteleuropa immer durch eine große Vielfalt von Produktionsformen geprägt war. Zwischen Weidewirtschaft, Ackerbau und Waldnutzung bestanden vielfältige gegenseitige Abhängigkeiten, ebenso zwischen der Tierhaltung in den Bergen und in den Ebenen. Der Ackerbau konnte nur dort langfristig aufrecht gehalten werden, wo die Viehhaltung genug Dünger abwarf, oder eine abwechselnde Nutzung der Flächen als Grasland und Acker möglich war. Wald und andere Baumbestände lieferten Brenn- und Bauholz sowie Laub und Baumfrüchte als Futter und teilweise auch als menschliche Nahrung und ermöglichten so die Besiedelung walddominierter Landschaften. Ein Wechsel zwischen Sommer- und Winterweiden konnte die Möglichkeiten zur Tierhaltung und Nahrungsproduktion beachtlich steigern. Durch diese vielfältigen Nutzungen entstanden besonders vielfältige Landschaften.
Das Leben der Weidetiere in den Gebirgen und Ebenen Mitteleuropas entsprach dabei bis ins 19. oder oft auch ins 20. Jahrhundert hinsichtlich der Nahrungsbasis und der jahreszeitlichen Wanderungen in groben Zügen dem, was seit urgeschichtlicher Zeit der Stand der Dinge war. Es kamen kaum neue Tierarten hinzu, allenfalls gab es gewisse Trends hinsichtlich der Verteilung zwischen den einzelnen Arten wie einen Boom der Schafhaltung zur Wollproduktion in einem vorindustriellen Stadium im 18. Jahrhundert. Je nach Region war irgendwann im Mittelalter oder in der Neuzeit dazugekommen, dass Winterfutter für die Tiere nicht nur in Form des Laubs der Bäume, sondern auch durch Mahd und Trocknung von Gras gewonnen wurde. Dabei wurde zunächst im Wald wachsendes Gras gemäht, später auch auf Teilen des Weidelandes. Vor ein paar Jahrhunderten waren so aus den Weidelandschaften heraus nach und nach die Wiesen als neue Teile der Kulturlandschaft entstanden. In vielen Fällen entwickelten sich auch Mähweidenutzungen, bei denen das gleiche Stück Land abwechselnd gemäht und beweidet wird.
In den Karpatenländern gab es eine erstaunliche Kontinuität hinsichtlich der Tierrassen und der Methoden der Milchverarbeitung, während sich in Westeuropa (bis in die westlichsten Teile Österreichs) nach und nach die neue Methode der Hartkäserei durchsetzte. Pionier- und Modellcharakter kam bei dieser neuen Käsereimethode vor allem den Niederlanden und der Schweiz zu, wo diese grundsätzlich schon den Römern bekannte Methode zur Herstellung haltbaren Käses ab dem späten Mittelalter betrieben wurde. In weiten Teilen des Alpenraumes stand diese Umstellung in der Käsereiwirtschaft auch in Zusammenhang mit dem Rückgang der Schaf- und Ziegenhaltung zugunsten mehr oder weniger milchbetonter Rinderrassen.
Wann die gesellschaftlichen Veränderungen, die in der Folge der industriellen Revolution ab der Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Landwirtschaft erfassten, tatsächlich zu grundsätzlichen Änderungen in der Produktion führten, ist von Region zu Region und oft auch von Hof zu Hof sehr unterschiedlich. Stichworte zu diesem Reigen der Veränderungen sind zunächst einmal neue Kulturpflanzen wie Klee, Kartoffeln und Mais, dann der Bau der Eisenbahnen, der in vielen Gebieten erst eine Produktion von Getreide und Milch, aber auch Holz für den Markt ermöglichte, und die gezielte Düngung von Acker- und Wiesenflächen zunächst mit Stallmist und später auch mit Gülle und Handelsdünger. Die letzten entscheidenden Veränderungen in der Bewirtschaftung der Wiesen und Weiden waren die Düngung mit Gülle, die eine spezielle Bauweise der Ställe mit »Spaltenböden« aus Beton voraussetzt, und die Konservierung des Futters für den Winter in Form von (vergorener) Silage statt (getrocknetem) Heu. In Österreich beispielsweise setzten diese Änderungen im Wesentlichen um den Zweiten Weltkrieg von Westen her ein. Viele Gebiete im Osten des Landes erreichten sie erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts, weite Teile der Karpaten hingegen bis heute gar nicht.
Konsequent zu Ende geführt, verändert die »grüne Revolution«, wie die Neuorganisation der landwirtschaftlichen Produktion im 20. Jahrhundert zeitweise auch genannt wurde, schließlich nicht nur Ackerbau und Wiesenbewirtschaftung, sondern auch die traditionelle Weidewirtschaft. Hutweiden, auf denen die Weidetiere von Hirten »gehütet« werden, werden von Koppelweiden abgelöst, auf denen der Herde das Futter mithilfe von Weidezäunen zugeteilt wird. Wird die Weidenutzung weiter im Sinne einer effizienten Produktion auf beschränkter Fläche rationalisiert, ermöglicht die Portionsweide oder eine intensivierte Mähweidenutzung eine weitere Ertragssteigerung. Ziel ist es dabei, dass das Gras von der Weide im optimalen Entwicklungszustand von den Weidetieren, hier sind es jetzt praktisch ausschließlich Milchkühe, gefressen wird. Heutzutage gehen dann intensive Milchbetriebe gleich noch einen Schritt weiter, verzichten auf Beweidung und stellen auf Ganzjahressilagefütterung um. Im Sinne von (zugegebenermaßen auch immer konsequenteren) Tierschutzbestimmungen muss diese Tierhaltung dann um einen Auslauf ergänzt werden, der aber auch auf befestigten Flächen erfolgen kann und dann mit Weide nichts mehr zu tun hat.
Interessant ist, dass sich die Landwirtschaft in den mitteleuropäischen Ländern, die eine Periode des Kommunismus durchmachten, grundsätzlich in die gleiche Richtung entwickelte wie unter den Rahmenbedingungen des Kapitalismus. Der Trend ging weg von der Selbstversorgung bäuerlicher Familien und letztlich auch von einer kleinbäuerlichen gemischten Produktion unterschiedlicher Produkte auf einem Hof zu einem System spezialisierter größerer Strukturen. Im Kommunismus versuchte man, diesen Strukturwandel in kurzer Zeit zu erreichen, und schreckte dabei immer wieder auch vor gewaltsamen Aktionen gegen traditionelle Lebensstile nicht zurück. Es ist aber auch eine Tatsache, dass da wie dort auch kleinere und größere Nischen bestehen blieben, in denen die alten, bewährten Lebens- und Produktionsformen der Bauern und Hirten auch weiterhin ihre Bedeutung hatten und haben.
Heute gibt es in ganz Mitteleuropa neben Betrieben mit Milchkühen, die durch den Züchtungsfortschritt und einen ebenso beachtlichen Technologieschub beim Stallbau und der Melktechnik eine gewaltige Steigerung sowohl der jährlichen Milchleistung pro Kuh als auch der Tierzahl pro Betrieb erlebt haben, auch ebenso spezialisierte Rinderzucht-, Mutterkuh-, Milchschaf-, Mutterschaf-, Milchziegen- und Pferdebetriebe und sogar Landwirte, die sich auf die Erzeugung von Heu zum Verkauf an Tierhalter verlegt haben. Gleichzeitig und mit unterschiedlichen Wechselwirkungen mit der modernen Landwirtschaft leben viele alte, traditionelle Formen der Tierhaltung und Landbewirtschaftung fort, sei es aus Tradition, aus Naturschutzgründen, weil heute traditionelle Bewirtschaftungsformen, die artenreiches Grasland hervorbringen, finanziell gefördert werden, oder in vielen Fällen auch aufgrund von Armut und einer Art von regionaler »Unterentwicklung«.
In weiten Teilen der Alpen haben Bergbauern- und Almwirtschaften in einem Umfeld von Tourismus und landwirtschaftlichen Förderungen durchaus auch heute noch ihre Bedeutung und ihre Zukunftsperspektiven. Gar so weit davon sind wirtschaftlich weiterentwickelte Teile der Karpaten in Tschechien und der Slowakei auch nicht entfernt. Die Reste der ungarischen Puszta werden aus einer Mischung von Naturschutz und romantisierender Nostalgie mit traditioneller Tierhaltung in staatlichen Nationalparks weiter bewirtschaftet, wobei auch hier dem Tourismus eine entscheidende Rolle im System zukommt.
Typisch für die östlichen Teile der Karpaten in Rumänien und der Ukraine ist eine Situation, in der sich zuerst fast archaisch anmutende Formen der Land- und Weidewirtschaft bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts behaupten konnten, die dann auf staatlichen Druck mit teils radikalen, teils aber oberflächlichen bleibenden Reformen durch eine moderne, produktionsorientierte Landwirtschaft ersetzt werden sollten. Wirtschaftlicher Niedergang bewirkte dann früher oder später sogar eine erstaunliche Renaissance des traditionellen Landlebens und gegenwärtig ist nicht wirklich klar, wohin der weitere Trend geht. Noch gibt es gerade dort noch die Bergbauernsiedlungen mit ihren Holzhäusern, die Bauernfamilien, mitunter mit einer einzigen Milchkuh, die Almen, auf denen Käse auf offenem Feuer produziert wird, und schließlich die Pferde- und Schafherden in den Bergen mit ihren Hirten. Noch gibt es dort auch die Weiden, die seit Urzeiten Weidetieren und Menschen das Überleben gesichert haben. Ihr Bestehen ist heute eine oft verwirrende Mischung aus materieller Armut und kulturellem Reichtum. Und es gilt, für sie gute Wege in die Zukunft zu finden.
Lesetipps:
VERA, Franciscus W. M.: Grazing Ecology and Forest History. Wallingford u. New York 2000
WOKAC, Ruth M.: Zur Nahrungsökologie rezenter und vorzeitlicher Pflanzenfresser – Gedanken zum natürlichen Landschaftscharakter Mitteleuropas. in: HOCHEGGER, K u. W. HOLZNER (Hrsg.): Kulturlandschaft – Natur in Menschenhand. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie. Graz 1999
REICHHOLF, Josef H.: Warum die Menschen sesshaft wurden. Frankfurt 2010
Perchtoldsdorfer Heide:Ein Stück Steppe am Stadtrand Wiens
Wien wird oft das Tor zum Balkan genannt. Tatsächlich sind hier aber die Karpaten und die Ungarische Tiefebene viel näher als die Berge und Schluchten der Balkanhalbinsel. Die Stadt gibt einem tatsächlich oft das Gefühl, an der Grenze zwischen West und Ost zu sein. Das gilt nicht nur in kultureller Hinsicht, sondern auch naturräumlich. Mit dem Durchbruch der Donau zwischen Leopoldsberg und Bisamberg gibt es hier einen zwar nicht wirklich spektakulären, aber doch eindrucksvollen Schlusspunkt des Alpenbogens, wenn auch geologisch gesehen die Alpen noch ein kleines Stück weiter nach Norden und Osten reichen. Gleich neben dem Leopoldsberg ist es die berühmte Aussicht vom Kahlenberg, die an die Übergangslage Wiens zwischen dem bewaldeten Mittelgebirge des Wienerwaldes und der Ebene des Wiener Beckens erinnert, zusätzlich noch bereichert durch ein paar Hügel mit Weingärten. Gerade die Flusslandschaft der Donau mit alten Schwarzpappeln, wilden Auwäldern und, wenn man auch eher wenig besuchte Teile Wiens kennt, weitläufigen Überschwemmungswiesen gibt schon im Stadtgebiet einen Vorgeschmack auf die Ebenen des östlichen Europas. Die Buchenwälder nehmen im Wienerwald ein vorläufiges Ende, erstrecken sich aber in den Karpaten dann doch noch weit in den Osten. Die Berglandschaften der Karpaten reichen zwar nicht bis nach Wien, sind aber mit den Hainburger Bergen und den Kleinen Karpaten am Horizont gut zu sehen und in einem kurzen Tagesausflug erreichbar. Ebenfalls an klaren Tagen von Wien aus zu sehen ist der Schneeberg, der östlichste Zweitausender der Alpen.
Der Alpenostrand bei Wien ist auch Teil einer der deutlichsten klimatischen Grenzen Europas. Grundsätzlich wird das Klima auf der eurasischen Landmasse immer kontinentaler, je weiter man sich vom Atlantik entfernt. Die Niederschlagsmengen nehmen ab, die Unterschiede zwischen Sommer- und Wintertemperaturen zu. Für die Buche als vorherrschendem Waldbaum West- und Mitteleuropas sind es vor allem die Spätfröste, die ihre Verbreitung in den Ebenen des Ostens verhindern. In diesem großräumigen Verlauf des Klimas gibt es mitunter auch deutliche Sprünge, einen sehr deutlichen gerade hier. Wer in Wien wohnt, überlegt sich zum Beispiel, wenn der Wetterbericht Niederschlag von Westen ankündigt, den Sonntagsausflug vielleicht diesmal Richtung Osten zu unternehmen. Nicht selten enden Regen oder Schnee dann tatsächlich am westlichen Stadtrand.
Immer schon hatte diese Grenzlage Bedeutung für das Leben der Menschen. In der Vergangenheit begann in Wien eine steppenartige Landschaft, die sich über Ungarn und Osteuropa, unterbrochen von einzelnen Flussläufen und kleineren Gebirgszügen, bis weit nach Asien hinein erstreckte. Die Steppe war jahrtausendelang Raum für wandernde Viehherden und Reiternomaden. Aus dem 13. Jahrhundert ist überliefert, wie die Westgrenze der Steppe noch einmal wichtige Bedeutung bekam: Weit im Osten hatten die nomadisch lebenden Mongolen ein gewaltiges Reich errichtet, das mit Reiterheeren auch nach Europa vordrang. Im Jahr 1241 endete dieser Vorstoß genau hier, wo die Steppenlandschaft ein Ende nahm und Wälder begannen, die den Reitern aus der Steppe nicht vertraut waren.
Meistens waren naturräumliche Grenzen aber keineswegs unüberwindbare Hindernisse. Dahinter war oft so etwas wie eine andere Welt, die Menschen neugierig werden ließ, und die sie immer wieder dazu brachte, neue Wege zu finden. So wurde der Weg entlang der Donau herauf in das Innere Europas, auf dem im Mittelalter die Mongolen kamen, auch schon viel früher genommen. Unterwegs entstanden Ansiedelungen, die kurz- und längerfristig genutzt wurden, oft gerade dort, wo der landschaftliche Übergang eine Herausforderung darstellte. Diese Migrationen, die immer wieder neue Lebensweisen und Kulturen vom Osten her nach Mitteleuropa brachten, können bis in die Steinzeit zurückverfolgt werden.





























