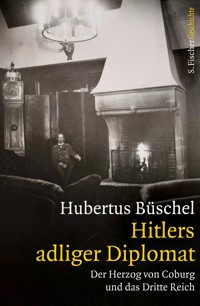
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch ›Hitlers adliger Diplomat. Der Herzog von Coburg und das Dritte Reich‹ erzählt der renommierte Historiker Hubertus Büschel auf Grundlage neuer Quellen aus dem Familienarchiv packend und fundiert, wie ein britischer Prinz in Deutschland zum glühenden Verehrer Hitlers wurde. Carl Eduard war ein Enkel der britischen Königin Victoria und wurde 1905 Regent in Coburg. Bereits 1927 lud er Adolf Hitler zur Trauerfeier für Houston Stuart Chamberlain nach Coburg ein. Nicht zuletzt dank Carl Eduards Einfluss wurde Coburg zur ersten nationalsozialistisch regierten Stadt Deutschlands. Zur Reichstagswahl 1932 veröffentlichte der Herzog einen Wahlaufruf für Hitler. Als Repräsentant des »Dritten Reichs« ließ er nach der Machtergreifung seine internationalen Verbindungen spielen, um den Nationalsozialismus salonfähig zu machen, und leugnete schließlich als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes die Gräuel der Konzentrationslager. Die Unterstützung für den Nationalsozialismus durch den deutschen und den europäischen Hochadel wurde lange unterschätzt. Die Biographie des Coburger Herzogs zeigt exemplarisch, wie Adlige im Bestreben, ihre eigene Macht wiederherzustellen, einen Pakt mit den Nationalsozialisten eingingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Hubertus Büschel Prof. Dr.
Hitlers adliger Diplomat
Der Herzog von Coburg und das Dritte Reich
Über dieses Buch
In seinem neuen Buch ›Hitlers adliger Diplomat. Der Herzog von Coburg und das Dritte Reich‹ erzählt der renommierte Historiker Hubertus Büschel auf Grundlage neuer Quellen aus dem Familienarchiv packend und fundiert, wie ein britischer Prinz in Deutschland zum glühenden Verehrer Hitlers wurde.
Carl Eduard war ein Enkel der britischen Königin Victoria und wurde 1905 Regent in Coburg. Bereits 1927 lud er Adolf Hitler zur Trauerfeier für Houston Stuart Chamberlain nach Coburg ein. Nicht zuletzt dank Carl Eduards Einfluss wurde Coburg zur ersten nationalsozialistisch regierten Stadt Deutschlands. Zur Reichstagswahl 1932 veröffentlichte der Herzog einen Wahlaufruf für Hitler.
Als Repräsentant des »Dritten Reichs« ließ er nach der Machtergreifung seine internationalen Verbindungen spielen, um den Nationalsozialismus salonfähig zu machen, und leugnete schließlich als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes die Gräuel der Konzentrationslager.
Die Unterstützung für den Nationalsozialismus durch den deutschen und den europäischen Hochadel wurde lange unterschätzt. Die längst fällige Biographie des Coburger Herzogs zeigt exemplarisch, wie Adlige im Bestreben, ihre eigene Macht wiederherzustellen, einen Pakt mit den Nationalsozialisten eingingen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Die Zeit des Nationalsozialismus
Eine Buchreihe
Begründet und bis 2011 herausgegeben von Walter H. Pehle
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: © Stiftung der Familie von Sachsen-Coburg und Gotha
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403225-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Das Ende des Krieges auf der Veste Coburg
Der Herzog von Coburg – Ämter und Funktionen unter Hitler
Ein gebürtiger Brite als Hitlers Weltdiplomat
Das eigentliche Ende der Monarchie in Deutschland und ein Gemälde
Das Verhör: Einer der »intimsten Freunde und Helfer Hitlers«
Seine Königliche Hoheit: Wahrnehmungen, Zeugnisse und Persilscheine
Der Streit um die Biographie
Ein Täter der zweiten Reihe
I Der Weg zu Hitler
1 Das Coburger Milieu: Europäischer Hochadel und deutscher Nationalismus
Die Einäscherung Houston Stewart Chamberlains
Der »Deutsche Tag« und seine Folgen
Erste Begegnungen mit Hitler
2 Ein englischer Prinz wird deutscher Herzog
Der Ausländer und die deutsche »Volksgemeinschaft«
Charles Edward Duke of Albany: Der Sohn eines Toten
Charly und der Kaiser
Zwischenwelten in England und Deutschland
3 Der Erste Weltkrieg und der Bruch mit England
In der Schule von Nationalismus, Gewalt und Antisemitismus
In der Schule der Diplomatie: Die Balkanmission 1915
Der englische König und der Bruch mit den deutschen Verwandten
4 Der Exherzog und die »Neuen Rechten«
Ein Thronverzicht, der keiner war
Die Burg für den »Führer« von morgen
Der Tod der Republik: Beschützer und Förderer der Rechtsterroristen
Gekauft: Hoffnung auf die Wiederherstellung der Monarchie
II Hitler zu Diensten
1 Die erste nationalsozialistische Stadt
Der Landesvater der Nationalsozialisten und sein Geschenk
Die Coburger Machtergreifung: Im Laboratorium des Dritten Reiches
Vormarschieren und Überreden: Die herzogliche Familie und die erste nationalsozialistische Volksgemeinschaft
Europas Fürsten unter Hakenkreuzen
Der Traum, mit Hitler wieder zu regieren
Der Taschenkalender des Herzogs
2 In der Berliner NS-Elite
Raum von Macht und Einfluss: Die Adjutantur des Herzogs von Coburg
Die Gleichschaltung der Berliner Hautevolee
3 Das Spiel zwischen Distinktion und Zugehörigkeit: Adlige Scheindiplomatie für Hitler
Die Verschleierung von Kriegswillen und Expansionsplänen
4 Ribbentrops Gehilfe in London
Der Türöffner in die Londoner Upper Class
Die englische Königsfamilie und Hitler
Der unzuverlässige Zuträger
Die hohe Kunst der Diplomatie: Aushorchen bei Kerzenschein
Die Bestattung Georgs V. und der Herzog in Wehrmachtsuniform
Der ungeschickte Botschafter und der Meister der Etikette
5 Ämter als Belohnung: Der Friedenslügner
Goebbels’ Handlanger in der Deutsch-Englischen Gesellschaft
Der Frontkämpfer, der nie einer war
Beeindrucken, beruhigen und Hitlers Friedenslügen
Friedensdiplomatie als Siegeszug
Der Weg zum Münchner Abkommen
Provozieren auf dem Weg in den Krieg
6 Schweigen, dulden, beruhigen: Der Präsident des DRK
Prinz Carl von Schweden und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
Der neue Präsident des DRK
Ohne Macht und politisch bedeutungslos?
Die britische Aristokratie und die deutschen Konzentrationslager
Ein Abendessen mit Heydrich
7 Die erste Weltreise 1934
Der Menschenfreund
Japans Kaiserhaus und Hitler
8 Die SS und das DRK: Ausplünderung und Krankenmord
Die Präsidenten des DRK und die Ermordung der Kranken und Behinderten
9 Die zweite Weltreise 1940
Die große Lüge im Weißen Haus
Hitlers Botschaft an Hirohito
Die Verbrechen von Mandschukuo
10 Der Herzog von Coburg und der Holocaust
Im Generalgouvernement
Die Verbrechen aus der zweiten Reihe: Wegschauen, leugnen und unterlassene Hilfeleistungen
Schluss
Anhang
Quellen und Literatur
Archivalien
Gedruckte Quellen
Literatur
Dank
Personenregister
Einleitung
11. April 1945:
Das Ende des Krieges auf der Veste Coburg
Am frühen Morgen des 11. April 1945 erreichten amerikanische Truppenverbände die oberfränkische Kleinstadt Coburg. Es hatte in den Tagen zuvor heftige Kampfhandlungen gegeben, bis schließlich der für den Frontabschnitt zuständige Kommandant der Wehrmacht und der Coburger Oberbürgermeister kapitulierten.[1] Allmählich war weitgehend Ruhe eingekehrt. Nur noch vereinzelt hörte man Schüsse oder die Explosion einer Handgranate.
Am Nachmittag des gleichen Tages kroch eine Wagenkolonne der US-Armee den Coburger Festungsberg hinauf. Die Amerikaner hatten auf der gesonderten Übergabe der sogenannten »Veste« über der Stadt bestanden – einer ausladenden Burg, in der sich einige Wehrmachtsoldaten verschanzt hatten. Die Amerikaner verfolgten aber auch ein anderes Ziel. Sie wollten einen international bekannten, mit Monarchen in Schweden, England, Bulgarien, Belgien, den Niederlanden und vielen anderen europäischen Ländern verwandten[2] hochrangigen »Nazi-Bonzen« verhören,[3] der als Getreuer Hitlers der ersten Stunde galt, zahlreiche wichtige Ämter im Dritten Reich innegehabt und weltweit für das Regime geworben hatte.[4] Ihr Interesse galt Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha, der unter den Nationalsozialisten meist nur kurz »Herzog von Coburg« genannt wurde.[5] Als Einziger der 1918 abgesetzten deutschen Bundesfürsten hatte sich Carl Eduard bis 1945 für Hitler eingesetzt. Dabei war der deutsche Herzog ein gebürtiger Engländer und als Enkel Queen Victorias Mitglied der britischen Königsfamilie.
In den Jeeps, die hinauf zur Veste Coburg fuhren, saßen neben Paul J. Friedman, einem Captain der US-Armee, sein begleitender Offizier Robert H. Roberts, einige Militärreporter, Fotografen, zwei Coburger Bürgermeister und ein Oberstleutnant der Wehrmacht.[6] Alles sollte dokumentiert und später bezeugt werden. Bedeutendes war zu erwarten.
Die Wagenkolonne überquerte die steinerne Brücke am Wall der Veste, durchfuhr einen hochgewölbten, spärlich beleuchteten Tunnel – schemenhaft waren eiserne Tore und ein Fallgitter zu erkennen – und parkte im ersten Burghof. Dort wartete bereits ein Mann, der sich als Bodo Voigts und Generalbevollmächtigter des Herzogs vorstellte.[7]
Vermutlich waren die Amerikaner sehr angespannt an diesem Nachmittag – nicht nur aufgrund der heftigen Kämpfe um die Stadt Coburg und der ihnen nun bevorstehenden Begegnung mit dem Herzog. Die militärischen Dienststellen hatten gemeldet, dass in diesen Stunden das Konzentrationslager Buchenwald befreit werde, knapp 150 Kilometer nordöstlich von Coburg.[8] Das Grauen, die Leichenberge und die bis auf die Knochen abgemagerten Häftlinge, die man dort vorfinden würde, konnten die amerikanischen Offiziere zu diesem Zeitpunkt nur erahnen. Doch schon einige Tage vor der Einnahme von Coburg, am 5. April, hatte die US-Armee das Außenlager von Buchenwald in Ohrdruf befreit und war dabei auf die verkohlten Überreste von mehr als 3000 Menschen gestoßen, welche die SS vor ihrem Rückzug ermordet und auf Scheiterhaufen zu verbrennen versucht hatte.[9]
Nun würden die amerikanischen Offiziere mit dem Herzog von Coburg sprechen, den sie in unmittelbare Verbindung mit solchen Verbrechen brachten. Denn neben zahlreichen anderen hochrangigen Posten hatte Carl Eduard seit Ende 1933 das Amt des Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) inne. Unter seiner Präsidentschaft war aus der karitativen und humanitären Hilfsorganisation ein von der SS infiltriertes Sanitätskorps geworden, das unter dem Verdacht stand, für die Verbrechen des Regimes in den Konzentrationslagern, für die als »Aktion T4« getarnte Ermordung zehntausender Insassen von Heil- und Pflegeanstalten und für den Massenmord an den Juden mit verantwortlich, wenn nicht sogar maßgeblich beteiligt gewesen zu sein.[10] So war der Reichsgesundheitsführer und SS-Obergruppenführer Leonardo Conti mit dem DRK verbunden, der als ein maßgeblicher Initiator der »Euthanasie«-Verbrechen gilt.[11] Carl Eduards Stellvertreter als Präsident des DRK war der SS-Reichsarzt Ernst-Robert Grawitz gewesen, der ebenfalls ein Drahtzieher der Krankenmorde war. Grawitz war überdies verantwortlich für Menschenversuche in Konzentrationslagern und für die Auswahl von Ärzten, welche die »Selektionen« in den Vernichtungslagern durchführten.[12]
Am 8. April hatten die Briten einen Funkspruch aus dem Führerhauptquartier in Berlin abgefangen, in dem es hieß: Der Herzog von Coburg dürfe »auf keinen Fall in die Hände des Feindes« fallen.[13] Das ließ vermuten, dass Carl Eduard von Hitler höchstpersönlich als Geheimnisträger hinsichtlich der Verbrechen des Regimes eingestuft worden war.
Die Präsidentschaft im DRK war allerdings bei weitem nicht das einzige Amt, das der Herzog von Coburg im Nationalsozialismus innehatte. Bei ihm liefen zur Zeit des Dritten Reiches mehr Funktionen zusammen als bei jedem anderen einstmals regierenden Monarchen Deutschlands. Dabei hatte Carl Eduard immer auch abgewogen, was ihm das Eintreten für die NSDAP auch persönlich bringen könnte – an Einfluss, Macht und Vermögen. Wenngleich er seit 1919 in zahlreichen nationalkonservativen und rechtsradikalen Bünden engagiert war – wie dem Stahlhelm –, stand er wie viele seiner Bundesgenossen Hitler zunächst eher kritisch und abwartend gegenüber.[14]
Der Herzog von Coburg – Ämter und Funktionen unter Hitler
Zur Reichstagswahl 1932 allerdings entschied sich der Herzog von Coburg endgültig für Hitler und ließ einen entsprechenden Wahlaufruf veröffentlichen.[1] Das brachte ihm vonseiten der Nationalkonservativen vehemente Kritik, von den Nationalsozialisten freilich Lob für sein »heldenhaftes Eintreten für die Bewegung« ein.[2] Später als viele seiner Verwandten – erst am 1. Mai 1933 – trat Carl Eduard schließlich in die NSDAP ein.[3]
Fortan war sein Engagement allerdings ungebremst: Noch im gleichen Jahr wurde er »förderndes Mitglied« der SS, was bedeutete, dass er dort zwar nicht aktiv tätig war, aber regelmäßig finanzielle Unterstützungen leistete.[4] Im Juli 1933 erfolgte die Ernennung zum SA-Gruppenführer und 1938 – von Hitler persönlich veranlasst – die Beförderung zum SA-Obergruppenführer.[5] Seit 1936 beteiligte sich Carl Eduard als Reichstagsabgeordneter an der parlamentarischen Farce des Hitler-Regimes.[6]
Über sein Engagement für die deutsche Automobilfahrt wurde der Herzog von Coburg Obergruppenführer und Ehrenvorsitzender des NS-Kraftfahrkorps (NSKK). Diese SA-nahe Massenorganisation[7] organisierte seit 1939 auch die Motorisierung der SS und der Polizeibataillone und war somit zumindest mittelbar an der Deportation und Ermordung von Juden in den besetzten Gebieten beteiligt.[8]
Ein weiteres durchaus brisantes Amt übte der Coburger Herzog seit April 1937 aus: Zu diesem Zeitpunkt wurde er Ehrenführer der deutschen Luftfahrt im Nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) und dort gleichzeitig Obergruppenführer. Allen, die mit dem NSFK verbunden waren, konnte zu dieser Zeit nicht entgangen sein, dass diese durch Führererlass im Frühjahr 1937 in der Nachfolge des Deutschen Luftsportverbandes (DLV e.V.) gegründete paramilitärische Organisation auf die Vorbereitung eines aggressiven Angriffskrieges ausgerichtet war.[9] Entsprechend unterstand das NSFK unmittelbar dem Reichsluftfahrtminister Hermann Göring. Alle Mitglieder des NSFK wurden von den Wehrmeldeämtern für den künftigen Kriegsfall erfasst.[10]
Bereits 1933 erhielt der Herzog von Coburg einen Sitz im Senat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (KWG). Von 1935 bis 1937 war er sogar deren erster Schriftführer.[11] Über seinen Schreibtisch liefen somit zentrale wirtschaftliche und wissenschaftsstrategische Entscheidungen. Viele Forscher der Kaiser-Wilhelm-Institute (KWI) waren zutiefst korrumpiert[12] und stellten ihre Arbeiten in den Dienst der Rüstungs- und NS-Rassenforschung, wobei es oft unmittelbare Verbindungen zum DRK gab.[13] Auch beteiligten sich Forscher der KWG an den verbrecherischen Menschenversuchen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern bzw. bauten mit ihren Studien auf deren Ergebnissen auf.[14]
Carl Eduard war außerdem Mitglied von Aufsichtsräten wichtiger deutscher Firmen, die Profit aus dem Expansionskrieg, aus der Zwangsarbeit und aus der Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung zogen: Seit 1928 saß er im Aufsichtsrat der Wanderer-Werke in Schönau bei Chemnitz, die unter anderem Motorräder sowie Automobile für das NSKK produzierten sowie die Schreibmaschinen, auf denen die Deportations- und Todeslisten der SS getippt wurden.[15]
Zudem war der Herzog von Coburg auch im Aufsichtsrat der Rhein-Metall-Borsig AG tätig, die während des Zweiten Weltkrieges vollends in den Dienst der Rüstung gestellt und schließlich – unter Beibehaltung der alten Garde des Aufsichtsrates – den »Reichswerken Hermann Göring« einverleibt wurden. In den Rheinmetallwerken waren Tausende von Zwangsarbeitern eingesetzt, unter anderem in einem Außenlager des Konzentrationslagers Bergen-Belsen.[16]
Als die Deutscher Ring Lebensversicherung AG gleichgeschaltet und in die Deutsche Arbeitsfront (DAF) integriert wurde, trat Carl Eduard auch hier dem Aufsichtsrat bei. Unverzüglich legte die Gesellschaft fest, künftig keine Juden mehr zu versichern, wozu der Aufsichtsrat seine Zustimmung zu erteilen hatte.[17] 1934 wurde der Herzog von Coburg in die Aufsichtsräte der Deutschen Bank und Discontogesellschaft und der Centralboden-Kredit AG berufen. Die Deutsche Bank profitierte enorm von den sogenannten »Arisierungen« und expandierte kontinuierlich im Zuge der Besetzung Europas.[18] Sie übernahm 1938 Kreditanstalten im Sudetenland sowie in Böhmen, Mähren und Österreich. Vor allem über die einstige Böhmische-Union-Bank beteiligte man sich an der »Arisierung« in Osteuropa zugunsten der Reichswerke Hermann Göring oder unmittelbar der SS. Es wird vermutet, dass die Deutsche Bank auch Profit aus dem Handel mit dem Gold ermordeter Juden schlug. Sie finanzierte zu ihrem Vorteil Unternehmungen im Lagerkomplex Auschwitz, wie beispielsweise für die IG-Farben.[19] Ähnlich verhielt es sich mit der Centralboden-Kredit AG, in deren Aufsichtsrat Carl Eduard und andere NS-Größen jüdische Bankiers ersetzten, die in die Emigration gezwungen worden waren.[20]
Im Jahr 1938 schließlich wurde der Herzog von Coburg der Vorsitzende des Aufsichtsrates bei der Europäischen Güter- und Reisegepäckversicherung, einem Unternehmen, das mit der Münchner Rückversicherung sowie der Allianz verflochten war und Millionen Reichsmark durch die Versicherung des Gepäcks emigrierender Juden, bei der Absicherung der Transporte von Raubgut und -kunst sowie der Habseligkeiten von Angehörigen der Wehrmacht, NS-Diplomaten und Verwaltungsmitarbeitern in den besetzten Gebieten und vor allem im Generalgouvernement verdiente.[21]
Über seine Ämter pflegte Carl Eduard regelmäßig Umgang mit Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Rudolf Heß, Joachim von Ribbentrop und immer wieder auch mit Hitler selbst.
Dieser Umgang war ebenso wie die vielen Posten an Schlüsselstellen der Wirtschaft und Politik des NS-Staates für einen Aristokraten einzigartig. Denn Hitler hegte grundsätzlich ein Misstrauen gegenüber Alteliten wie dem Adel. Auch erschien ihm die Vorstellung der von Geburt her emporgehobenen Aristokraten unvereinbar mit dem Konzept der unter Ariern egalitären nationalsozialistischen »Volksgemeinschaft«.[22] Gegenüber Carl Eduard galten solche Bedenken offensichtlich nicht. Dies ist umso bemerkenswerter, als der Herzog von Coburg gar kein gebürtiger Deutscher, sondern Brite war und aus dem englischen Königshaus stammte.
Ein gebürtiger Brite als Hitlers Weltdiplomat
Aufgrund seines ehemaligen Standes als regierender Bundesfürst und seiner Zugehörigkeit zum britischen Königshaus führte der Coburger Herzog sein Leben lang den Titel »Königliche Hoheit«. Das erregte bei den Funktionsträgern der SS, SA und bei Hitler selbst, die in ihren Schreiben Carl Eduard entsprechend anredeten, erstaunlicherweise keineswegs Argwohn. Es waren gerade die internationalen Verbindungen des Herzogs von Coburg nach Großbritannien, die ihn für die Nationalsozialisten so interessant werden ließen, setzten Hitler und sein »Beauftragter für außenpolitische Fragen«, der SS-Ehren- und Standartenführer Ribbentrop,[1] doch zunächst durchaus auf Allianzen mit dem Vereinigten Königreich.[2]
Aufgrund ihres nicht zuletzt auch politischen Einflusses waren für die Nationalsozialisten einige englische Adelsfamilien von besonderer Relevanz, die unter anderem vor dem Hintergrund ihres wirtschaftlichen und sozialen Abstiegs nach dem Ersten Weltkrieg[3] eine besondere Affinität für die britischen Faschisten und hier vor allem für die »Blackshirts« Oswald Mosleys hegten.[4] Besonders der Kronprinz, der 1936 König Edward VIII. werden sollte und ein Großcousin Carl Eduards war, zeigte sich der Hitler-Bewegung gegenüber sehr aufgeschlossen.[5] Mit solchen exklusiven Verbindungen im Rücken gelangte der Herzog von Coburg 1934 in die Position eines »Repräsentanten der Reichsregierung im Ausland mit Sonderauftrag« und führte als Vertreter Hitlers vertrauliche Unterredungen, wobei er seinen Zugang zur britischen Königsfamilie und zu anderen hochrangigen Persönlichkeiten nutzte.[6]
Im Dezember 1935 formte Ribbentrop außerdem mit dem Herzog von Coburg als Präsidenten und Ehrenvorsitzenden die sogenannte Deutsch-Englische Gesellschaft (DEG), ein Sammelbecken nationalkonservativer und antisemitischer Adliger und bürgerlicher Partei- und Wirtschaftsmagnaten aus dem Deutschen Reich und Großbritannien. Die DEG sollte (vorgeblich unter der Sicherung des Friedens) zwischen beiden Ländern vor allem Sympathien für den Faschismus und Hitlers Nationalsozialismus wecken. Die in der DEG organisierte Wirtschaftselite des Deutschen Reiches witterte vor allem lukrative Geschäftsbeziehungen, während Goebbels als Ehrenmitglied auf den nationalsozialistisch opportunen Zuschnitt der Tafelrunden und kulturellen Veranstaltungen achtete.[7] Ganz ähnliche Freundschafts- und Friedenspropaganda betrieb Carl Eduard als Präsident der im Oktober 1936 von Ribbentrop geschaffenen Vereinigung Deutscher Frontkämpfer-Verbände.[8]
Man gewann mit ihm somit einen willigen und treu ergebenen Unterstützer des Nationalsozialismus von internationaler Prominenz und mit besten Verbindungen. Die gleichgeschaltete deutsche Presse hielt keineswegs damit hinterm Berg, dass der Herzog von Coburg für das Ansehen Deutschlands im Ausland wichtig war, denn er sei »infolge seiner vielseitigen persönlichen Beziehungen wohlbekannt«.[9]
So unternahm Carl Eduard von 1933 bis 1944 in Hitlers Diensten mindestens 39 Auslands- und zwei Weltreisen.[10] 1934 besuchte er innerhalb von vier Monaten England, Kanada, die USA, Japan, China, Singapur, Indien, Ägypten und Italien.[11] Hierbei visitierte er nicht nur die Auslandsorganisationen der NSDAP,[12] sondern knüpfte auch für das nationalsozialistische Regime wichtige politische und wirtschaftliche Kontakte – beispielsweise zu amerikanischen Wirtschaftsmagnaten, zu internationalen Rot-Kreuz-Vertretern und zum japanischen Kaiserhof.[13]
Von Februar bis Juni 1940 begab sich Carl Eduard als Präsident des DRK und Sonderbeauftragter der Reichsregierung auf eine zweite Weltreise in die USA, nach Japan und in die Sowjetunion. Im Weißen Haus hatte er Gelegenheit, mit dem amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt zu sprechen, in Tokio mit Kaiser Hirohito.[14]
Nur wenige Monate nach der Reise des Herzogs von Coburg – am 27. September 1940 – wurde der Dreimächtepakt zwischen Japan, Italien und dem Deutschen Reich geschlossen. Hitler hielt die »Achse Berlin–Rom–Tokyo« für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft.[15]
Es scheint, dass Hitler die Dienste des Coburger Herzogs bei seinen Ämtern und diplomatischen Missionen bis zum Ende des Dritten Reiches schätzte und würdigte: Der Führererlass vom 19. Mai 1943, dass aus der Staatsbürokratie, Partei und Wehrmacht alle Personen zu entfernen seien, die verwandtschaftliche Beziehungen ins »feindlich gesinnte Ausland« unterhielten, blieb für Carl Eduard auf Hitlers Befehl ausgesetzt.[16] Bis zum Ende des Krieges verblieb er in allen seinen Ämtern. Darüber hinaus bezog der Herzog von Coburg aus Hitlers Privatschatulle regelmäßig hohe Summen an »Aufwandsentschädigungen« als Gratifikation für seine Dienste.[17]
Das eigentliche Ende der Monarchie in Deutschland und ein Gemälde
Der amerikanische Captain Friedman und sein Offizier Roberts, die am Nachmittag des 11. April 1945 Carl Eduard das erste Mal verhören sollten, waren über die internationale Prominenz des Coburger Herzogs, seine Ämter und diplomatischen Missionen weitgehend im Bilde.[1] Wie es um die Haltung Carl Eduards zur NSDAP bestellt war, hatten die Amerikaner schon feststellen können, als sie im Anmarsch auf Coburg waren. Als sie auf der Straße unterhalb des verwaisten Anwesens Schloss Callenberg auf Coburg zufuhren, konnten sie deutlich das mannshohe Hakenkreuz sehen, das Carl Eduard bereits 1932 auf dem Schlossturm hatte anbringen lassen.[2] Zu solch einem Schritt hatte sich kein anderer Aristokrat im Deutschen Reich entschließen können.
Carl Eduards Generalbevollmächtigter Voigts richtete den Amerikanern nun aus, der Herzog von Coburg sei bereit zur Kapitulation.[3] Die Abordnung ging auf den Fürstenbau zu, ein mehrstöckiges, hoch aufragendes Gebäude mit Fachwerkverblendung und bleiverglasten Fenstern. Sein gewölbtes Dach hatte durch die Gefechte nur einige wenige Blessuren abbekommen.[4] Der Weg führte über eine breite Holztreppe ein Stockwerk hoch in die mit einer dunklen Holzdecke überspannte Jagdgalerie, an deren Wänden unzählige Gehörne und Geweihe hingen, darunter das ausgestopfte Haupt eines seltenen weißen Hirsches.[5] Es folgten ein spärlich beleuchteter fensterloser Zwischengang mit Ahnenbildern an den Wänden und noch ein Treppenaufstieg. Im zweiten Stockwerk befanden sich die Privaträume der herzoglichen Familie.
Im sogenannten »Cranachzimmer« sollte das Verhör stattfinden. Hierbei handelte es sich um ein mit Eichenpanelen ausgetäfeltes Wohnzimmer, wo über einem Flügel ein berühmtes Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren hing, das die sich erdolchende Römerin Lucretia zeigte. Kunsthistoriker waren sich einig, dass die Coburger Fassung das weitaus beste der zahlreichen Lucretia-Bilder von Cranach und aus seiner Werkstatt war. Das Bild war weltberühmt.[6] Im 6. Jahrhundert vor Christus aufgekommen, stand der Lucretia-Stoff für das Ende der Monarchie und den Beginn der römischen Republik.[7] Es war eine gewisse Pointe der Geschichte, dass die Amerikaner gerade unter diesem Bild zum ersten Mal dem Herzog von Coburg begegnen sollten. Gewissermaßen wurde hierbei nicht nur die Kapitulation der Nationalsozialisten in Coburg vollzogen, sondern auch das Ende einer monarchischen Herrschaft, die selbst unter Hitler zumindest in diesem Teil Deutschlands südlich des Thüringer Waldes weiter bestanden hatte: Denn kaum ein Aristokrat hatte es im Dritten Reich verstanden, seinen Herrschafts- und Lebensstil so weiterzuführen wie der Herzog von Coburg.
Im Luxus standesgemäßer Wohnungen und den Annehmlichkeiten eines großen Fuhrparks, beflissener Adjutanten, Verwaltern und Bediensteten sowie reichlich Devisenmitteln zeigte sich die weltdiplomatische Bedeutung, die Carl Eduard für das Hitler-Regime hatte. Wer in den 1930er Jahren wie selbstverständlich im Londoner Kensington-Palast abstieg, wo Carl Eduards Schwester Alice Athlone ein luxuriöses Apartment bewohnte, der musste auch zu Hause über entsprechende Räumlichkeiten verfügen. Carl Eduard lebte im Nationalsozialismus unbehelligter als in der Weimarer Republik auf der Veste Coburg und auf seinen zahlreichen anderen Schlössern. Der Streit um Besitztümer in Thüringen und Österreich, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges von den Landesbehörden konfisziert worden waren, war nicht zuletzt durch die Intervention hochrangiger nationalsozialistischer Parteifreunde bald zugunsten der herzoglichen Familie beigelegt worden.[8]
Entsprechend seines aristokratischen Lebensstils erwartete Carl Eduard die Amerikaner in einer Hofjagduniform. Seine nationalsozialistischen Ehrenzeichen und Orden hatte er vorsichtshalber nicht angelegt. Er schien um eine betont entspannte Atmosphäre bemüht. Die Kapitulation war ein rein formeller Akt und rasch erledigt. Das darauffolgende Gespräch glich eher einem Empfang bei Hofe als einem Verhör: Es wurde Wein gereicht, und man nahm in bequemen Sesseln Platz.[9] Die Fotografen suchten nach einer guten Beleuchtung für ihre Aufnahmen und rückten den Herzog auf seinem Sitz ein wenig hin und her. Die Coburger Honoratioren sollen sich später über dieses respektlose, einem deutschen Herzog und Angehörigen des britischen Königshauses gegenüber unpassende Verhalten empört haben.[10] An anderen Orten starben Tausende in den letzten Tagen des Krieges. Hier achtete man auf die Einhaltung der höfischen Etikette.
Das Verhör: Einer der »intimsten Freunde und Helfer Hitlers«
Einen Auszug aus dem folgenden Verhör strahlte einige Tage später der alliierte Sender Radio Luxemburg im Rahmen der »Bunten Bühne für die Wehrmacht« aus.[1] Hierbei handelte es sich um eine Propagandasendung, mit der sich der Deutsche Dienst der BBC an Wehrmachtsoldaten und deutsche Zivilisten wandte, um sie zur Kapitulation zu bewegen. Verantwortlich für die Beiträge war der deutsch-jüdische Literat Stefan Heym, der 1935 in die USA emigriert war und für eine Einheit der amerikanischen Armee zur psychologischen Kriegsführung arbeitete.
In dieser Radiosendung wurde der Herzog von Coburg nun als einer der »intimsten Freunde und Helfer Hitlers« vorgestellt. Diese Haltung sei auch noch nach der Kapitulation in Coburg unübersehbar gewesen. Der verhörende Captain sei sehr beeindruckt gewesen von dem »Mangel an Verantwortungsgefühl und der für amerikanische Verhältnisse unerhörten Arroganz« des Herzogs. Gleich zu Beginn der Befragung erklärte Carl Eduard – so die Radiosendung –, dass der Krieg begonnen habe, weil »Polen Deutschland überfallen« hätte. Als ihm gesagt wurde, dass das Gegenteil der Fall war, erwiderte er, »das habe er nicht gewusst«. Auf die Frage, was er vom Nationalsozialismus angesichts der Niederlage und der Zerstörungen in Deutschland halte, erklärte der Herzog: »Die nationalsozialistische Idee sei wundervoll.« Die »Nazis« hätten nur »leider über das Ziel hinausgeschossen«. Gefragt, was er als Präsident des DRK über die Konzentrationslager und die »Grausamkeiten denke, die in ganz Europa im Namen Deutschlands begangen wurden«, antwortete er: »Ja, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin ja nur ein kleiner Mann.« Zu seinen Vorstellungen von einer künftigen Regierung Deutschlands erklärte er: »Nun, diese Regierung kann natürlich nur von Leuten gemacht werden, die entsprechend ihrer Intelligenz und Tradition zum Regieren vorbestimmt sind. Eine Demokratie, das gibt es nicht in Deutschland. Das deutsche Volk kann sich nicht selbst regieren.« Als schließlich gemeldet wurde, dass man begonnen habe, die unzähligen in den Kasematten der Veste gelagerten Lebensmittel auf Lastwagen zum Abtransport zu verladen, habe Carl Eduard »plötzlich sehr besorgt, da es um seinen eigenen Bauch ging«, geschrien: »Sie wollen uns verhungern lassen!«
Solche Radiosendungen zielten freilich darauf ab, durch die Diskreditierung von Angehörigen der NS-Elite den Durchhaltewillen der Wehrmacht und deutschen Zivilbevölkerung zu schwächen. Aus einem internen Geheimbericht, den Friedman und Roberts am 1. Mai 1945 an das amerikanische Headquarter schickten, geht allerdings hervor, das Carl Eduard sich sogar noch drastischer äußerte, als es die BBC berichtete.
Ein erster Punkt betraf die Judenverfolgung: Die Methoden seien zu hart gewesen, und er habe nie hierzu seine Zustimmung gegeben. Aber es sei »Zeit gewesen, die Juden zu beseitigen«; ihr »Einfluss« sei nach 1918 zu »groß« geworden.[2] Ein zweiter Punkt bezog sich auf Carl Eduards Vorstellungen zu einer künftigen Regierung Deutschlands. So wurde der Coburger Herzog nicht nur – wie die Radiosendung vermittelt – um eine Stellungnahme zu seinen allgemeinen Visionen gebeten.[3] Friedman – so jedenfalls sein Bericht – ging so weit, Carl Eduard zu fragen, was er tun würde, wenn er zum Staatsoberhaupt eines neuen deutschen Staates ernannt würde. Daraufhin habe Carl Eduard zunächst zu seiner Ehefrau Viktoria Adelheid geschaut, die »lebhaft zustimmend« genickt habe. Schließlich antwortete Carl Eduard: Man solle ihm »24 Stunden geben, um die Namen seiner Mitarbeiter zu benennen«. Durchaus sei er für eine solche Aufgabe sehr geeignet, denn er stamme aus der »Führungsschicht« des Deutschen Reiches, eben aus den »leitenden Kreisen«, die das Regieren gewöhnt seien.[4] Auf Friedmans Nachfrage, woher der Herzog sein Regierungskabinett rekrutieren würde, entgegnete er: Die einzige Partei, mit der er zusammenarbeiten könne, sei die NSDAP.[5] Nur mit ihr könne es gelingen, Deutschland wieder zu einer »großen Nation« aufzubauen.[6]
Die mangelnde Läuterung und Einsicht über die eigenen Verfehlungen verband Carl Eduard mit sehr vielen Protagonisten des Hitler-Regimes, auch solchen aus dem Kreis des Adels. Tausende Nationalsozialisten verübten im Frühjahr 1945 Selbstmord – vermutlich weniger aus Scham oder aus Angst vor Verfolgung und Bestrafung, sondern weil sie in einer Welt ohne Hitler nicht leben wollten oder glaubten, dies nicht zu können.[7] Der Herzog von Coburg und seine Familie entschieden sich nicht für einen solchen Schritt. Im Gegenteil: Carl Eduard stand bereit, um selbst die Regierung Deutschlands zu übernehmen, und schien zu glauben, dass die Amerikaner ihm diese Aufgabe auch anvertrauen würden. Nur wenige Nationalsozialisten hatten solche Hoffnungen.[8] Der Herzog von Coburg aber schüttelte zum Abschied herzlich die Hände der Amerikaner und äußerte, er habe große Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit, schließlich seien die Amerikaner, Briten und Deutschen einander »rassisch sehr nah«.[9]
Das Verhör auf der Coburger Veste im April 1945, die Ämter Carl Eduards und seine Missionen für das Dritte Reich werfen viele Fragen auf. Wer war dieser Mann, der nach dem Ende des Krieges noch daran glauben konnte, dass man ihm die Regierung eines Deutschlands nach Hitler anvertrauen würde? Wie hatte er seinen Weg zum Nationalsozialismus gefunden, und was tat er genau als Präsident des DRK und Hitlers Diplomat? Ist seine Rolle im Dritten Reich außergewöhnlich oder mit der anderer Vertreter der deutschen Alteliten zu vergleichen? Und zunächst: Wie nahmen eigentlich die Zeitgenossen den Herzog von Coburg wahr?
Seine Königliche Hoheit: Wahrnehmungen, Zeugnisse und Persilscheine
Der Herzog von Coburg sei ein »wahrer Edelmann«, schrieb Joseph Goebbels am 7. März 1930 in sein Tagebuch. Er hatte Carl Eduard gerade bei einem Empfang des Deutschen Automobilclubs im Berliner Hotel Kaiserhof kennengelernt.[1] Auch in der offiziellen nationalsozialistischen Propaganda und Hagiographie wurde der Herzog von Coburg häufig als wichtiger Vertreter des Regimes genannt und gepriesen.[2]
Ganz anders hingegen berichtete die Gesellschaftskolumnistin Bella Fromm[3] über ihre Begegnung mit Carl Eduard. Es war der Abend des 25. November 1933 bei einem Ball der Berliner Presse: Wie eine Witzfigur sei der Herzog von Coburg herumstolziert, »zwergenhaft und gebeugt«, am Gürtel »seinen Faschistendolch, eine Ehrengabe Mussolinis«.[4]
Ähnlich diskreditierend äußerte sich der Labour-Abgeordnete Harold Nicolson in seinen Erinnerungen an einige Gespräche mit Carl Eduard im Jahr 1936: Coburg sei ein »furchtbarer Snob« gewesen, der vor allem »fest davon überzeugt« gewesen sei, Hitler »mit seinen Verbindungen in höchste Kreise zu beeindrucken«. Carl Eduard sei nicht davon abzubringen gewesen, zwischen den Briten und Deutschen gegenseitiges Verständnis zu wecken, so oft ihn auch Nicolson auf die wahre »Natur des Regimes« in Deutschland ansprach. Und in der Tat habe Carl Eduard bis zum Krieg regen Umgang mit dem britischen Königshaus, zahlreichen englischen Adligen und Politikern gehabt, trotz oder gar aufgrund seiner völlig offen vertretenen Verehrung für Hitler.[5]
Marie Balser, die Ehefrau des hessischen Diplomaten Karl August Balser, der 1938 der Generalkonsul des Auswärtigen Amtes in Kôbe-Ôsaka war, vermittelte ein völlig anderes Bild von Carl Eduard als eines versierten, an Kultur und Kunst interessierten Menschen, der es überdies verstand, mit seinen Angestellten sehr gut umzugehen. Bei seiner Japanreise 1940 habe der Herzog aufgrund »seiner verständnisvollen Art überall große Sympathien« geweckt.[6] Von seinen Untergebenen habe sich Carl Eduard nie mit dem Titel »Königliche Hoheit«, sondern mit dem Spitznamen »Köhei« anreden lassen.[7]
Ganz ähnlich äußerte sich der Schweizer Diplomat Carl Jakob Burckhardt, der den Herzog von Coburg als Delegierter des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mehrfach traf: In seinen Memoiren schilderte er Carl Eduard als skrupulösen, umsichtigen, diplomatisch versierten und auch ein wenig ängstlichen Mann, der gegenüber der SS und Heydrich sehr vorsichtig agiert habe.[8] Gegenüber einer Spruchkammer im Rahmen der Entnazifizierungsverfahren Carl Eduards erklärte Burckhardt, als Präsident des DRK sei der Herzog von Coburg immer für die »notleidende Bevölkerung in den besetzten Gebieten« eingetreten.[9] Auch für Insassen der Konzentrationslager habe Carl Eduard viel getan: Ihm sei »zum großen Teil zu verdanken«, dass auch Juden Lebensmittelspenden ausländischer Rot-Kreuz-Verbände erhalten hätten. Gegen Ende des Krieges habe er viele Mordaktionen der SS in den Lagern zu verhindern gewusst. Seit 1941 habe der Herzog von Coburg immer wieder mit »Trauer und Bitterkeit über die schwere Enttäuschung« gesprochen, die ihm Hitler und sein Regime bereiten würden. Man könne es einem »in England erzogenen und landfremden Prinzen« nicht verdenken, dass er die Nationalsozialisten anfangs nicht habe richtig einschätzen können. Burckhardts Aussagen hatten zu dieser Zeit noch Gewicht. Erst später wurde bekannt, dass er selbst eine gewisse Faszination für Hitler gehegt hatte[10] und ein dezidierter Antisemit war.[11]
Ähnlich verhielt es sich mit dem wohl bedeutendsten Prominenten, der sich für Carl Eduard in seinen Entnazifizierungsverfahren einsetzte: der Ehrenpräsident der KWG Max Planck, der 1919 den Nobelpreis für Physik erhalten hatte. Plancks Zeugnis wog umso schwerer, da er einigen Widerstand gegen die Nationalsozialisten geleistet hatte und sein Sohn Erwin aufgrund der Beteiligung am Attentat vom 20. Juli hingerichtet worden war.[12] Nun beteuerte Planck, dass der Herzog von Coburg die Versuche der KWG, jede politische Beeinflussung aus der Arbeit der Gesellschaft herauszuhalten, »mit vollster Überzeugung unterstützt« habe.[13] Überhaupt sei »seine Königliche Hoheit« in jeder Hinsicht »achtungswürdig«, geleitet von »hohem Idealismus« und »menschlich wertvollen Eigenschaften«. Man dürfe ihm aus seiner bloßen »Zugehörigkeit zu der nationalsozialistischen Bewegung« keinen Vorwurf machen.[14] Erst seit einigen Jahren haben Historiker erforscht, wie sehr diverse Institute der KWG in Forschungen zur Rassenideologie des NS-Regimes und auch in Menschenversuche von Konzentrationslagern verstrickt waren,[15] ein Umstand, der ein neues Licht auf Plancks Zeugnis wirft.
Aus dem Kreis der engeren Familie und Vertrauten waren bei den Gerichtsverfahren gegen Carl Eduard nach 1945 ohnehin nur entlastende Aussagen zu vernehmen: So attestierte Viktoria Adelheid ihrem Ehemann »vornehme Gesinnung« und ein »feines Empfinden für alles Gute«; allenfalls habe er einer etwas »weltfremden Ideologie« angehangen. Als Präsidenten des DRK hätten die Nationalsozialisten den Herzog von Coburg überhaupt nicht ernst genommen.[16] Voigts, der Generalbevollmächtigte Carl Eduards, behauptete wiederum: Auf keinen Fall sei Carl Eduard Antisemit gewesen; da er in England aufgewachsen sei, habe er den »Unterschied zwischen Juden und Christen« gar nicht gekannt.[17]
Solche Zeugnisse, sogenannte Persilscheine, sind für die Einschätzung des Handelns von Funktionseliten im Dritten Reich in der Regel völlig unbrauchbar. Sie dienten vor allem dazu, die Angeklagten von jeder Schuld an Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit reinzuwaschen – aus persönlicher Verbundenheit, materiellen Interessen oder aus dem Bemühen heraus, von eigener Verstrickung und Schuld abzulenken.[18] Damit stehen auch die Zeugnisse für Carl Eduard keineswegs für sein Verhalten im Dritten Reich, sondern für soziale Beziehungen, Bindungen oder Eigennutz.[19]
Umso schwerer wiegen einige wenige Aussagen, die den Herzog von Coburg durchaus als überzeugten Nationalsozialisten, als kriminell und zutiefst korrumpiert beschrieben – wie die von Ilse Klingler, der Witwe des im Juli 1933 in Folge von Misshandlungen durch die SA verstorbenen SPD-Landtagsabgeordneten und Herausgeber des Coburger Volksblattes Friedrich Klingler.[20] Schon in den 1920er Jahren – so gab Klingler im Februar 1948 der Coburger Polizei zu Protokoll – habe sich Carl Eduard mit polizeilich gesuchten politischen Mördern eingelassen, ihnen gefälschte Pässe besorgt und sie auf der Veste beherbergt.[21] Es gebe keinen Zweifel, dass der Herzog von Coburg bis zum Ende des Krieges ein vehementer Nationalsozialist gewesen sei; das habe nicht nur sie mit eigenen Augen beobachten können.[22]
Schlussendlich wurde Carl Eduard 1950 nach mehreren Spruchkammerverfahren als »Mitläufer« und Minderbelasteter eingestuft.[23] Wie im Fall von mehr als 95 Prozent aller NS-Funktionäre in der amerikanischen Zone kamen die Spruchkammerverfahren auch beim Herzog von Coburg zu dem Ergebnis, er habe die »nationalsozialistische Gewaltherrschaft nicht aktiv unterstützt«.[24] Die Frage nach Schuld und Unschuld wurde in fast allen Entnazifizierungsverfahren – und so auch in dem Carl Eduards – zugunsten der Angeklagten ad absurdum geführt.[25] In den biographischen Versuchen zum Herzog von Coburg, die bislang vorliegen, wurde sie wieder aufgegriffen.
Der Streit um die Biographie
Im Februar 1978 traf im idyllischen mittelalterlichen Gebäude der Coburger Hofapotheke ein mehrseitiger Brief voller Vorwürfe und Richtigstellungen ein.[1] Adressat war der Inhaber der Apotheke Rudolf Priesner, ein kunstsinniger älterer Laienhistoriker, der viel Umgang mit der herzoglichen Familie gepflegt und ein paar Monate zuvor die erste längere Biographie zu Carl Eduard veröffentlicht hatte.[2] Absender des Schreibens war der jüngste Sohn des Herzogs, Prinz Friedrich Josias. Der Prinz machte keinen Hehl aus seiner Verärgerung. Er hatte eine Reihe von Materialien über seinen Vater gesammelt, verfügte über dessen Taschenkalender mit Notizen und andere wichtige Quellen und wollte nun selbst eine Biographie über den Herzog von Coburg verfassen.[3] In seinem Schreiben wies er Priesner auf inhaltliche Fehler und »Geschmacklosigkeiten« hin, die diesem in seiner Biographie unterlaufen seien.[4] Vor allem fand der Prinz, dass sein Vater viel zu milde davongekommen war. Er wisse genau, dass der Herzog von Coburg schon in den 1920er Jahren Waffen zur Ausrüstung »einer ganzen Armee« gehortet hatte, mit der er die Rechtsradikalen unterstützte.[5] Auch sei Carl Eduard ganz genau über die Massenmorde an den Juden im Bilde gewesen. Sein zweitältester Sohn Hubertus habe bei seinem Einsatz an der Ostfront die Eisenbahntransporte in die Vernichtungslager selbst gesehen und öfter darüber gesprochen.[6] Dem auf seinen Ruf bedachten Nachkommen, der nach Carl Eduards Tod Chef des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha geworden war, war es offensichtlich gar nicht recht, allzu Beschönigendes über seinen Vater zu lesen. Die geplante Biographie hat er allerdings nie veröffentlicht.[7]
In diesem Spannungsfeld zwischen persönlicher Beteiligung und Lokalgeschichte ist auch die neueste Geschichte zum Leben Carl Eduards angesiedelt, die ein Coburger Laienhistoriker veröffentlichte. Hier wurden chronologisch alle Informationen zusammengetragen, die zu finden waren. Wissenschaftliche Analysen und Nachweise über die Quellen wurden allerdings kaum erbracht. Es ging – durchaus berechtigt – eher darum, das vermeintliche Hineinschlittern Carl Eduards in alles, was er tat, geradezurücken und seine Mitschuld an den Verbrechen des Regimes herauszustellen.[8] Ähnlich verhält es sich mit der von Karina Urbach veröffentlichten Studie, in der sie den Herzog von Coburg in eine Reihe von Adligen einordnet, die ähnlich wie er international für Hitler warben.[9]
Im Gegensatz dazu soll es in diesem Buch darum gehen, das Leben des Herzogs von Coburg in den Kontext der Zeit einzuordnen. Nur am Rande wird dabei nach den Motiven gefragt, für Hitler einzutreten, die vermutlich – wie bei vielen deutschen Aristokraten – aus einer Mischung von Ideologie, Pflichtverständnis, Angst, materiellen Vergünstigungen und dem Wunsch bestanden, wieder Macht und Einfluss auszuüben.[10] Stärker als die Beweggründe oder die Frage nach Schuld bzw. Unschuld sollen die Handlungen des Herzogs von Coburg im Mittelpunkt stehen. Denn die zentrale Rolle Carl Eduards im nationalsozialistischen Herrschaftsapparat ist zweifelsfrei belegt. Sie kann allein schon aufgrund seiner Ämter und diplomatischen Reisen im Dienste Hitlers als unstrittig gelten.
Ein Täter der zweiten Reihe
Die Studien von Alf Lüdtke und Michael Wildt zur sozialen Herrschaftspraxis des Nationalsozialismus[1] oder von Raul Hilberg zu »Tätern, Opfern und Zuschauern« haben eindrücklich gezeigt,[2] dass man sich einem Verständnis der Wirkungsmechanismen des Nationalsozialismus und seiner Gräuel besonders gut annähern kann, wenn das häufig ambivalente und vielschichtige Handeln von Einzelpersonen untersucht wird, die schließlich Protagonisten der Untaten, des Hinnehmens oder Wegschauens waren. In Anlehnung an diesen Ansatz wird es in diesem Buch darum gehen, zu beschreiben, wie der Herzog von Coburg durch aktive Beteiligung, durch Duldung und Mitwisserschaft Hitler mit zur Macht verhalf und die Verbrechen des Nationalsozialismus mittrug.
Das Eintreten deutscher Adliger für die Nationalsozialisten ist allerdings noch ein recht junges Forschungsthema: Stephan Malinowski legte 2003 eine grundlegende Studie vor, die erstmals aufzeigte, wie vehement sich viele deutsche Aristokraten von der nationalsozialistischen Ideologie infizieren und für Hitler einnehmen ließen.[3] Fabrice d’Almeida hat wiederum gezeigt, wie wichtig der »schöne Schein des Dritten Reiches« für die Stabilisierung der innenpolitischen Herrschaft Hitlers war und welche zentrale Rolle Aristokraten hierbei zukam.[4] Die Bedeutung des sozialen und kulturellen Kapitals[5] adliger Netzwerke und Umgangsformen für Hitlers Außenpolitik ist erstaunlicherweise bislang kaum untersucht worden.[6] Dabei ist die transnationale Verflechtungsgeschichte des Nationalsozialismus gerade gegenwärtig ein stark diskutiertes Feld, wobei auch immer wieder die Rolle von Akteuren im Sinne von »Vermittlern« betont wird.[7]
So ist es das vorrangige Ziel in diesem Buch, anhand der Person Carl Eduards eine transnationale Kulturgeschichte der Diplomatie des Dritten Reiches zu entwickeln und dabei die atmosphärische Wirkung aufzuzeigen, die das einschläfernde Gift der Weltdiplomatie des Hitler-Regimes haben konnte – gerade wenn sie von so glänzend vernetzten und in Umgangsformen versierten Akteuren wie dem Herzog von Coburg betrieben wurde. Dass das Ausland und internationale Organisationen wie das Genfer IKRK nicht viel entschiedener gegen Judenverfolgung, die Entrechtung politisch Andersdenkender, den Mord an Kranken und Behinderten, die Zustände in den Konzentrationslagern, die Überfälle auf die Nachbarstaaten und schlussendlich den Holocaust eingeschritten sind, lässt sich nicht allein durch Nichtwissen, Verwunderung, Überrumpelung, Wegschauen oder abwartend politisches Kalkül erklären.
Auch der Glaube an die Repräsentanten einer alten Gesellschaftsordnung, die Aura von großen Namen und edler Herkunft und die Atmosphäre von feinsinnigen Gesprächen, Kammerkonzerten und Sektempfängen spielten eine wichtige Rolle. Oft konnten amerikanische, britische, schwedische oder schweizerische Gesprächspartner einfach nicht glauben, dass Diplomaten die Untaten des Regimes beschönigten oder – wissentlich oder unwissentlich – verharmlosten.
Carl Eduard war zweifellos kein Täter der ersten Reihe. Dennoch ist die Wirkung seines Handelns nicht zu unterschät- zen. Wenngleich schon seit längerem im Gefolge Christopher Brownings oder auch Daniel Goldhagens die Täterforschung insbesondere zu den unmittelbar am Holocaust Beteiligten boomt,[8] ist das Handeln von Tätern der zweiten Reihe, zu denen auch der Herzog von Coburg zählt, kaum hinreichend analysiert worden. Außenpolitisch waren es nur selten die prügelnden Schergen der SA, die Schlächter der SS und der Polizeibataillone, die im Buckingham-Palast, der Downing Street oder im Weißen Haus als das wahrgenommen wurden, was Hitlers Herrschaft ausmachte. Es waren vielmehr jene Sonderbotschafter wie Carl Eduard, die weltläufig ihre fatale »Kunst« des diplomatischen »Handelns«[9] ausübten und mit geschliffenen Manieren Zweifel säten, ob es unter Hitler wirklich so brutal und menschenverachtend zugehe, wie allenthalben berichtet wurde. Wie viel sie auch immer im Detail von den Verbrechen des Regimes wussten, wie einflussreich oder ohnmächtig sie auch waren: Sie halfen mit, eine Politik zu kaschieren, die sich ganz unverhohlen Rassismus und Antisemitismus sowie dem aggressiven Expansionskrieg verschrieb – und letztendlich zum Tod von Millionen Menschen führte.
Über viele jener Täter der zweiten Reihe – ob sie nun Sekretäre, Polizisten, Zugführer oder eben Diplomaten wie Carl Eduard waren – gibt es kaum Quellen.[10] Für den Herzog von Coburg sind hingegen viele Unterlagen überliefert. Sein Leben hat Spuren in Bibliotheken und Archiven in Deutschland, England und den USA hinterlassen. Dabei wurden für dieses Buch auch viele neue Quellen eingesehen. Erstmals war es möglich, Unterlagen im Hausarchiv der Familienstiftung von Sachsen-Coburg und Gotha zu untersuchen, die auch die Taschenkalender Carl Eduards für die Jahre 1932 bis 1953 enthalten, in denen er Termine vermerkte und kurze Eindrücke von seinen Begegnungen und Reisen festhielt.
IDer Weg zu Hitler
1Das Coburger Milieu: Europäischer Hochadel und deutscher Nationalismus
Coburg, 12. Januar 1927:
Die Einäscherung Houston Stewart Chamberlains
Am Morgen des 12. Januar 1927 begleiteten uniformierte Mitglieder des Stahlhelm und einige Dutzend »Nationalsozialisten in Hitlertracht« die Leiche des zwei Tage zuvor in Bayreuth verstorbenen englischen Publizisten Houston Stewart Chamberlain zum Krematorium auf dem Coburger Friedhof.[1] Aus Bayreuth, Nürnberg und München waren Kohorten der SA angereist, bereit loszuschlagen, sollte es zu Protesten gegen den Aufmarsch kommen. Schon zu Lebzeiten galt Chamberlain, ein Schwiegersohn Richard Wagners, als einer der wichtigsten Ideengeber der Nationalsozialisten und sonstigen Antisemiten.[2] Zu seiner Coburger Trauerfeier waren zahlreiche prominente Vertreter der »Neuen Rechten«[3] erschienen. Neben Mitgliedern der Familie Wagner, Abgesandten der Städte Bayreuth und Coburg, der SA und des Stahlhelm hatten sich mit ihren Fahnen und Standarten Männer nationalistischer und antisemitischer Verbände versammelt. Dazu gehörten der Bund Wiking und der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund,[4] der nach zeitgenössischer Einschätzung des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung »größte, tätigste und einflussreichste antisemitische Verband in Deutschland«.[5] Auch Hitler war gekommen, der den von ihm hochverehrten Chamberlain etwas mehr als drei Jahre zuvor das erste Mal in Bayreuth besucht hatte und sich in seinen antisemitischen Hetzreden immer wieder auf ihn bezog.[6]
Nicht zuletzt waren drei Angehörige des europäisch-deutschen Hochadels anwesend: der seit 1918 im Coburger Exil lebende ehemalige Zar von Bulgarien Ferdinand I., der Kaisersohn August Wilhelm von Preußen und Ernst II. zu Hohenlohe-Langenburg, der bis zur Volljährigkeit Carl Eduards 1905 Regent von Sachsen-Coburg und Gotha gewesen war.[7] Der Herzog von Coburg war mit allen dreien eng verwandt. Er selbst war durch eine dringende anderweitige Verpflichtung verhindert, andernfalls hätte auch er es sich gewiss nicht nehmen lassen, Chamberlain die letzte Ehre zu erweisen.
Ferdinand von Bulgarien, den Carl Eduard vertraulich »Onkel« nannte, stand dem Bayreuther Kreis und dem verstorbenen Schriftsteller besonders nahe. Er war ein großer Liebhaber von Wagners Opern, unterstützte die Festspiele durch großzügige Spenden und hatte sich mit Chamberlain nahezu wöchentlich über seine völkischen und antisemitischen Ideen ausgetauscht. Auch mit Hermann Göring traf er sich regelmäßig, und mitunter warb er für die NSDAP, die in Bayreuth und Coburg in den 1920er Jahren bereits zahlreiche Mitglieder bzw. Wähler hatte.[8] August Wilhelm von Preußen kannte Chamberlain nur vom Hörensagen, war aber begeistert von dessen Schriften.[9] Ernst II. zu Hohenlohe-Langenburg schließlich war ein ebenso entschiedener Anhänger Chamberlains und überhaupt des Rechtsradikalismus.[10]
Glaubt man zeitgenössischen Zeitungsberichten, dann verfolgte die Coburger Bevölkerung mit großer Anteilnahme und erwartungsvoller Neugier dieses Zusammentreffen von Angehörigen des Hochadels, völkischen Verbänden und Nationalsozialisten und nicht zuletzt Hitlers Auftreten am Sarg Chamberlains.[11] Eine so deutlich auf künftige Allianzen zwischen den Repräsentanten der längst vergangenen monarchischen Ordnung und den Nationalsozialisten verweisende Begegnung hatte es bislang weder in Coburg noch sonst im Deutschen Reich gegeben.
Coburg war nach 1918 zu einem regelrechten Reservat für abgedankte Fürsten des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha geworden, die sich keineswegs mit ihrer politischen Entmachtung zufriedengaben und ähnlich wie der Herzog von Coburg die Nähe zu rechtsradikalen Kreisen suchten. Nach der russischen Oktoberrevolution war Großfürst Kyrill von Russland nach Coburg geflohen, ein Enkel Zar Alexanders II., der die Tochter Herzog Alfreds geheiratet hatte. Kyrill hatte nach dem Zarewitsch an dritter Stelle der Thronfolge gestanden. Zwischen Coburg und Paris pendelnd scharte er die sogenannten Mladorossy um sich, eine Gruppe junger russischer Adelssöhne im Exil, die sich in ihrem Auftreten an faschistische Jugendorganisationen – wie die italienischen Schwarzhemden und die SA – anlehnten. 1924 ließ sich Kyrill in Paris als Kaiser im Exil ausrufen. Immer wieder nahm er auch in Coburg an »vaterländischen Kundgebungen« unter Carl Eduard teil.[12] Auch Philipp von Sachsen-Coburg und Gotha, den die österreichische Republik aufgrund seiner Weigerung, die Adelstitel abzulegen und Enteignungen hinzunehmen, 1918 des Landes verwiesen hatte, fand in Coburg Unterschlupf, ebenso wie sein Bruder Ferdinand, der abgedankte Zar von Bulgarien.[13] Man zeigte sich nicht nur mit den »Neuen Rechten«, sondern unterstützte vor allem auch Hitler mit Geldspenden und Werbekampagnen, da Kyrill, Philipp, Ferdinand und Carl Eduard sich auf dem ersehnten Weg zurück zur Macht von ihm Unterstützung gegen ihre Todfeinde, die Republikaner und Bolschewiken, versprachen.[14]
Coburg, 14. Oktober 1922:
Der »Deutsche Tag« und seine Folgen
Hitler war anlässlich der Trauerfeier für Chamberlain 1927 nicht das erste Mal in Coburg. Bereits am 14. Oktober 1922 hatte er auf Einladung des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes an einem »Deutschen Tag« teilgenommen, begleitet von Julius Streicher, Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg und 600 SA-Männern. Sie marschierten auf, um linke Gegendemonstranten einzuschüchtern, antisemitische Parolen zu brüllen und den Coburger Juden lauthals mit Mord zu drohen. Das eher gemäßigte bildungsbürgerliche Coburger Publikum schien erschrocken, aber auch beeindruckt. Man begann sich für diesen Mann zu interessieren, der kein Blatt vor den Mund nahm zu seinen Vorstellungen über die Zukunft Deutschlands und es verstand, die gefürchteten »roten Horden« im Zaum zu halten.[15] Außerhalb der oberfränkischen Kleinstadt hatten gemäßigte Zeitungen vor dem »nackten Straßenterror der bis auf die Zähne bewaffneten Knüppelgarde« Hitlers gewarnt.[16] Linksliberale Blätter, Demokraten und jüdische Verbände nahmen den Coburgern übel, dass sie den NS-Schergen zugesehen und gar applaudiert hatten: Bald galt die Stadt europaweit als »Hakenkreuzparadies« und als ein »Schandfleck« für ganz Deutschland.[17]
In der Tat war es Hitler in Coburg erstmals gelungen, außerhalb Münchens aufzumarschieren und Straßenkämpfe anzuzetteln.[18] Hier wurde eingeübt und öffentlich vorgeführt, »wie man Stoßtrupps aufzieht und durch eigene Kraft den Mob im Zaume hält«.[19] Die Gewalt auf den Straßen Coburgs wurde von den radikalen Rechten mit einer gewissen Bewunderung für Hitler allenthalben gerühmt: In einem Bericht an den Alldeutschen Verband war gar davon die Rede, dass die in Coburg »zerschlagenen Hirnschalen der Roten erst wieder zusammenwachsen« müssten.[20]
Tatsächlich verfehlten die Ereignisse im Oktober 1922 nicht ihre Wirkung: In der Stadt wurde eine der ersten und militantesten Ortsgruppen der NSDAP gegründet,[21] die innerhalb weniger Monate bereits mehrere hundert Mitglieder zählte.[22] Coburger Nationalsozialisten brüsteten sich damit, dass ihre SA die am meisten »gefürchtete« weit und breit sei. Sie mache »ihrem Ruf alle Ehre«.[23] Hitler selbst rühmte die Ereignisse in Coburg als Durchbruch seiner Bewegung[24] und verkündete: »Mit Coburg habe ich Geschichte gemacht.«[25] Zehn Jahre nach dem Marsch auf Coburg sollte er das »Coburger Ehrenzeichen« stiften, das an die »Kämpfer der Bewegung« an diesem »Deutschen Tag« verliehen wurde und gleich nach dem »Blutorden« rangierte, der höchsten Parteiauszeichnung.[26]
Erste Begegnungen mit Hitler
An diesem »Deutschen Tag«– genau genommen am Abend des 14. Oktober 1922 – traf auch der Herzog von Coburg Hitler das erste Mal persönlich.[27] Hitler hatte in einer Coburger Bierhalle eine seiner unverhohlen antisemitischen Gewaltpredigten vor mehr als 3000 Zuhörern gehalten. Carl Eduard und seine Ehefrau saßen auf Ehrenplätzen in der ersten Reihe. Sie erlebten, wie das Publikum zu den Parolen des »Führers« nach anfänglichem Zögern in frenetischen Jubel und Applaus ausbrach.[28] Seit diesem Abend verfolgte Carl Eduard aufmerksam Hitlers allmählichen Aufstieg zur Macht.
Bereits ein Jahr später traf man sich wieder auf den »Deutschen Tagen« in Nürnberg, Bamberg und vermutlich auch in Bayreuth.[29] Man begegnete sich bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele, die seit 1924 wieder allsommerlich stattfanden. Als Hitler 1927 und 1929 Reden in Coburg hielt, war Carl Eduard abermals im Publikum.[30] Seit 1929 unterstützte er die NSDAP dann auch finanziell.[31]
Spätestens im Dezember 1929 sprachen der Herzog von Coburg und Hitler das erste Mal unter vier Augen. Man frühstückte im Familienkreis auf Schloss Callenberg, was im Frühjahr 1930 und im Januar 1931 wiederholt wurde.[32] Offensichtlich hatte man sich eine Menge zu sagen und hegte gewisse Sympathien füreinander. Der junge Herzog, der meist in schlichter Jägeruniform oder bayerischer Tracht erschien, seine aufgeschlossen-leutselige Frau, die wohlerzogenen Kinder und die alles in allem schlichte, zurückhaltende Lebensweise auf dem Callenberg hatten nur wenig gemein mit dem Feindbild, das Hitler vom deutschen Adel hatte. Hier war nichts zu spüren von der überkommenen arroganten Opulenz der Aristokraten und den einflussreichen Höflingen, die er in »Mein Kampf« als »berufsmäßige Kriecher und Schleicher« und »Spulwürmer« bezeichnete.[33] Mit dem Herzog von Coburg – so schien es – könnte man sich künftig nicht nur arrangieren, sondern auch gemeinsame Wege gehen.
Am 11. Oktober 1931 lernte Carl Eduard auf dem »Harzburger Treffen« auch Goebbels, Göring, Heß und Himmler kennen.[34] Eine Woche später war der Herzog von Coburg beim Braunschweiger SA





























