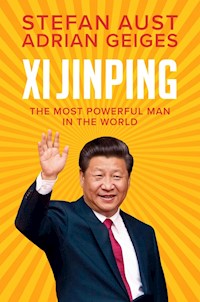12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er war einer seiner schärfsten Kritiker, und doch soll Hitler sich bei Veranstaltungen manchmal geweigert haben, mit seiner Rede zu beginnen, bevor er nicht eingetroffen war: Konrad Heiden. Als Mitarbeiter der angesehenen «Frankfurter Zeitung» gehörte er zu den ersten Publizisten, die den Aufstieg der Nazis kritisch begleiteten. Auf seiner zweibändigen Hitler-Biographie, die 1936/37 in der Schweiz herauskam, bauten fast alle späteren Lebensbeschreibungen des Diktators auf. Und doch ist Heiden heute nahezu vergessen. Stefan Aust porträtiert diesen faszinierenden Mann und lässt aus seiner Perspektive Hitlers Aufstieg und Herrschaft lebendig werden. Heiden, Sozialdemokrat jüdischer Herkunft, hatte sich bereits während seines Studiums in München Anfang der zwanziger Jahre gegen den Nationalsozialismus engagiert. «Marsch ohne Ziel, Taumel ohne Rausch, Glauben ohne Gott und selbst in seinem Blutdurst ohne Genuß» – so charakterisierte er die Bewegung in einem Buch, das Ende 1932 im Rowohlt Verlag herauskam. Im März 1933 zur Flucht gezwungen, setzte Heiden seinen Kampf gegen das Regime unter Lebensgefahr fort. In den USA galt er als führender Experte für das NS-Regime und dessen «Staatsfeind Nr. 1». 1966 starb er in New York. Es ist höchste Zeit, sich dieses Hitler-Gegners der allerersten Stunde wieder zu erinnern. Der Autor arbeitet an einem Doku-Drama für die ARD über Heiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Stefan Aust
Hitlers erster Feind
Der Kampf des Konrad Heiden
Über dieses Buch
Er war einer seiner schärfsten Kritiker, und doch soll Hitler sich bei Veranstaltungen manchmal geweigert haben, mit seiner Rede zu beginnen, bevor er nicht eingetroffen war: Konrad Heiden. Als Mitarbeiter der angesehenen «Frankfurter Zeitung» gehörte er zu den ersten Publizisten, die den Aufstieg der Nazis kritisch begleiteten. Auf seiner zweibändigen Hitler-Biographie, die 1936/37 in der Schweiz herauskam, bauten fast alle späteren Lebensbeschreibungen des Diktators auf. Und doch ist Heiden heute nahezu vergessen. Stefan Aust porträtiert diesen faszinierenden Mann und lässt aus seiner Perspektive Hitlers Aufstieg und Herrschaft lebendig werden. Heiden, Sozialdemokrat jüdischer Herkunft, hatte sich bereits während seines Studiums in München Anfang der zwanziger Jahre gegen den Nationalsozialismus engagiert. «Marsch ohne Ziel, Taumel ohne Rausch, Glauben ohne Gott und selbst in seinem Blutdurst ohne Genuß» – so charakterisierte er die Bewegung in einem Buch, das Ende 1932 im Rowohlt Verlag herauskam. Im März 1933 zur Flucht gezwungen, setzte Heiden seinen Kampf gegen das Regime unter Lebensgefahr fort. In den USA galt er als führender Experte für das NS-Regime und dessen «Staatsfeind Nr. 1». 1966 starb er in New York. Es ist höchste Zeit, sich dieses Hitler-Gegners der allerersten Stunde wieder zu erinnern.
Der Autor arbeitet an einem Doku-Drama für die ARD über Heiden.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Reinhard Mohr und Uwe Naumann
Umschlaggestaltung Anzinger|Wüschner|Rasp, München
ISBN 978-3-644-04051-9
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorbemerkungen
Er war Journalist, und er hatte nur ein Thema: Adolf Hitler.
Konrad Heiden, geboren 1901, studierte zu Beginn der zwanziger Jahre in München, als der zwölf Jahre ältere gescheiterte Kunstmaler aus Braunau am Inn seine verhängnisvolle politische Karriere begann. Der junge Student erkannte sofort, dass sich hier eine gefährliche Bewegung aus dem Heer der Verlierer des gerade zu Ende gegangenen Weltkrieges entwickelte.
Heiden beschloss, Reporter zu werden, Berichterstatter, Chronist der laufenden Ereignisse. Er begann als Hilfsredakteur im Münchner Büro der bürgerlich-liberalen Frankfurter Zeitung und schrieb bald täglich Berichte über das politische Chaos der Nachkriegszeit, aus dem Hitler seine Bewegung formte.
Heiden hatte Informanten im Umfeld des «Führers», wollte genau wissen, wie das System Hitler innerhalb der Partei funktionierte. Er beobachtete die frühen Parteiveranstaltungen und beschrieb präzise und nicht selten mit einem bitteren sarkastischen Unterton die Wirkungsweise Hitler’scher Redekunst. Das trug ihm sogar den Vorwurf ein, er habe «in der Gemeinheit noch die Größe» gesehen, wo allein «Abscheu und Empörung» am Platze gewesen wären. Tatsächlich beschrieb Heiden – heute würde man sagen «cool» –, was sich vor seinen Augen und seinem Schreibblock abspielte; manche Einzelheiten und Dialoge klingen so authentisch, weil er häufig mitstenographierte, was in seinem Beisein an Reden, Diskussionen oder Dialogen stattfand. Kaum ein Reporter der damaligen Zeit beschrieb aus so distanzierter Nähe den Beginn des Desasters, das Hitler über Deutschland und die Welt brachte.
Später schrieb er rückblickend über jene Zeit: «Ich habe Hitler in den Jahren seines Aufstiegs viele Dutzend Male aus nächster Nähe zugehört, ihn auch gelegentlich im privaten Zirkel aus geringer Entfernung beobachten können. Aber wenn dabei für mein damaliges Gefühl etwas Faszinierendes war, so war es das Publikum. Über die Reden selbst stand mein frühreifes Urteil fest, noch bevor ich sie gehört hatte: alles Unsinn, alles gelogen, und zwar dumm gelogen, und überhaupt alles so lächerlich, dass jeder, so meinte ich, das doch sofort einsehen müsse. Stattdessen saßen die Zuhörer wie gebannt, und manchem stand eine Seligkeit auf dem Gesicht geschrieben, die mit dem Inhalt der Rede schon gar nichts mehr zu tun hatte, sondern das tiefe Wohlbehagen einer durch und durch umgewühlten und geschüttelten Seele widerspiegelte. Mein jugendliches Urteil über Hitler hat das nicht erschüttert; wohl aber begann ich, bestürzt, etwas über Menschen zu lernen.»
Anfang der dreißiger Jahre wurde es beruflich eng für unabhängige Journalisten, und so beschloss Konrad Heiden, seine Aufzeichnungen zu einem Buch zu verarbeiten. Es erschien im Dezember 1932 unter dem Titel «Geschichte des Nationalsozialismus. Die Karriere einer Idee» im Rowohlt Verlag und wurde nach der Machtergreifung umgehend verboten. Heiden musste aus Deutschland fliehen, erst in die Schweiz, dann ging er ins Saargebiet, das damals noch unter dem Schutz des Völkerbundes stand. Dort gründete er zusammen mit anderen Journalisten die Tageszeitung Deutsche Freiheit und schrieb einen zweiten Band über Hitlers Machtergreifung mit dem Titel «Geburt des Dritten Reiches». 1936 schließlich kam im Schweizer Europa Verlag seine, die erste Hitler-Biographie heraus, ein sehr erfolgreiches Buch, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde – und heute praktisch vergessen ist –, obwohl der literarische Agent Lars Schultze-Kossack, der nur wegen des Heiden-Buches den Europa Verlag gekauft hatte, 2011 ein Neuauflage herausbrachte.
Mein Kollege Michael Kloft von «Spiegel TV», mit dem ich viele Sendungen über das Dritte Reich gemacht habe, schenkte mir die Originalausgabe von 1936 zum sechzigsten Geburtstag. Irgendwann eines Abends fand ich das alte Buch in meinem Schrank, begann es zu lesen und hörte bis zum frühen Morgen nicht mehr auf.
So aus nächster Nähe beobachtet und beschrieben hatte ich den Aufstieg Hitlers noch nie gelesen. Es entstand die Idee eines Filmes und die Idee eines Buches. Wer war dieser Konrad Heiden, von dessen Büchern die meisten späteren Hitler-Biographen profitiert haben? Manche, wie etwa Joachim Fest, erwähnten ihn, weil er die «erste bedeutende Hitler-Biographie» verfasst hatte. Der amerikanische Historiker John Lukacs schrieb 1997 in seinem Buch «Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung»:
«In Deutschland ist Konrad Heiden praktisch vergessen. Nur wenige wissen, wie dieser junge Journalist unerschrocken protokollierte und kommentierte, was sich vor seinen Augen abspielte – und sich dabei in erhebliche Gefahr begab. Und man fragt sich bei der Lektüre seiner Artikel und Bücher, warum er Dinge sah und erkannte, die andere nicht sahen oder nicht sehen wollten.»
Das Buch- und Filmprojekt trug von Anfang an den Arbeitstitel «Hitlers erster Feind». Erst später stieß ich darauf, dass Elsbeth Weichmann, die Frau des nachmaligen Hamburger Bürgermeisters Herbert Weichmann, in ihren Memoiren beschrieb, wie sie Konrad Heiden, den «Verfasser des mutigen Hitler-Buches von 1932, das ihn für die Nazis zum Feind Nr. 1 gemacht hatte», auf der Flucht in Lissabon traf.
So wie sie und andere Nazi-Gegner konnte auch Heiden nach Amerika entkommen. Dort schrieb er 1944 eine neue Variante seines Hitler-Buches mit dem Titel «Der Fuehrer». Das Buch wurde ein gewaltiger Erfolg.
Am 28. Februar 1944 wurde es von keinem Geringeren als Thomas Mann in dessen BBC-Radiokolumne «Deutsche Hörer!» rezensiert:
«Die Welt schämt sich. Sie liest ein Buch, das gerade in Boston erschienen ist und dem die Übernahme durch den ‹Book of the Month Club›, die große amerikanische Leservereinigung, eine Auflage von Hunderttausenden von Exemplaren sichert. Es ist von Konrad Heiden, einem emigrierten deutschen Schriftsteller, der früher schon eine lehrreiche Geschichte des Nationalsozialismus geschrieben hat und der nun (…), unter Benutzung neu zugänglich gewordenen Materials, sein Bildnis des übelsten Abenteurers der politischen Geschichte der Welt noch einmal in Lebensgröße und voller Anschaulichkeit vor Augen führt. Es ist ein Dokument ersten Ranges. Es wird bleiben und noch späten Geschichtsforschern und Moralisten zum Studium des Unfasslichen dienen, das im zweiten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts auf Erden möglich war. Jetzt liest es die Welt, die ihr eigenes Erlebnis darin geschildert und zergliedert findet, liest es auf Englisch, auf Spanisch, Französisch und Deutsch – und die Schamröte steigt ihr in die Wangen.»
Es sei eine Strafe und Pein, die Geschichte dieses «mörderischen Narren und Schmierenschauspielers» wieder nachzulesen; nachzulesen, wie der Nationalsozialismus, «ein Hintertreppen-Islam», sich Deutschlands bemächtigte, um es zum Verbrechen abzurichten, es zum «Instrument seiner maßlosen und idiotischen Verbrechen zu machen».
Thomas Mann kannte Konrad Heiden – der ihn 1923 zu einem Vortrag beim «Republikanischen Studentenbund» in München eingeladen hatte.
Die Lektüre vor allem der ersten Bücher Heidens ist eine Zeitreise besonderer Art. Konrad Heiden konnte ja in den zwanziger Jahren nicht wissen, was aus Hitlers Bewegung werden würde. Er beschrieb, was er sah – und nicht das, was spätere Historiker aus dem Ablauf der Geschichte bereits wussten. Das macht seine Beobachtungen, Beschreibungen und Analysen so faszinierend – und so weitsichtig.
Er sah den Aufstieg Hitlers zur Macht – als viele diesen nur als hetzende Eintagsfliege betrachteten.
Er sah den Massenmord durch Giftgas an den Juden schon voraus, als dieser noch gar nicht begonnen hatte.
Er sah als einzige Zukunft der Deutschen und der Europäer nur eine europäische Einheit.
Er war kein Politiker. Nur ein Journalist.
Das wirkte sich auf seine Texte aus. Der Historiker Lukacs war der Ansicht, die Tatsache, dass Heiden Journalist war, habe sich in seinem Fall «wegen des leserlichen und und klaren Stils» als Vorteil und nicht als Nachteil ausgewirkt. «Gleichzeitig ist das Werk seriös zu nennen.» Heidens Darstellung von Hitlers Leben und Aufstieg bis Juni/Juli 1934 sei «gespickt mit Details und oft bemerkenswert genau».
John Lukacs schätzte Heidens «aufschlußreiche und persönliche Kommentare zu politischen Persönlichkeiten und zur politischen Atmosphäre der Zeit». Zugleich sei er objektiv gewesen und habe auch Legenden und Anekdoten einer genauen Prüfung unterzogen, um sie dann gegebenenfalls zu verwerfen. Dass ihm dabei auch Fehler unterliefen, die sogar in die Werke späterer Autoren einflossen, liegt auf der Hand.
Heiden selbst bemühte sich immer wieder, Fehleinschätzungen seiner Hitler-Bücher in den späteren Ausgaben zu korrigieren. Seine Grundthese aber, so schrieb Lukacs, «gilt heute noch genauso wie vor über sechzig Jahren: Hitler wurde unterschätzt, gefährlich unterschätzt, und zwar von seinen Gegnern genauso wie von seinen zeitweiligen Verbündeten».
Im Zeitraum von fünfzehn Jahren nach Heidens Arbeit und fünf Jahren nach Hitlers Selbstmord seien trotz der unfassbaren Flut von Büchern über Deutschland und den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg keine weiteren nennenswerten Studien oder Biographien über Hitler erschienen. Die späteren dürften alle – jedenfalls was Hitlers Aufstieg zur Macht anbetrifft – von Heiden profitiert haben.
Auch der Hitler-Biograph Joachim Fest («Hitler. Eine Karriere», 1973) schrieb, er habe sich Heiden in mancher Hinsicht verpflichtet gefühlt. Seine «früheste historische Bemühung» sei «durch die Kühnheit der Fragestellung und die Freiheit des Urteils noch heute beispielhaft».
Heiden war nicht unumstritten, auch nicht unter Nazi-Gegnern. So reimte der Theaterkritiker Alfred Kerr in einem Spottgedicht höchst unfair, wie die Lektüre dieses Buches deutlich machen wird:
«Herr Konrad Heiden knickt gebührend
vor Schicklgruber in die Knie:
den blutigen Fatzke nennt er, rührend,
ein weltgeschichtliches Genie.
So, wenn er ihm gehorsam huldigt,
ist auch das deutsche Volk entschuldigt.»
Offenbar hatte Kerr nicht verstehen wollen, dass Heiden selbst keinesfalls ein Bewunderer Hitlers war, wenn er dessen Faszination auf die Massen detailliert beschrieb und etwa in dem ihm eigenen Sarkasmus sagte, Hitler sei «ein Teufel, allerdings ein großartiger Teufel».
Eine Veröffentlichung dieses Gedichts ist nicht nachgewiesen, aber der Schriftsteller Richard Friedenthal muss es gelesen haben, denn er schrieb Kerr dazu am 13. April 1946:
«Zur Frage der ungehemmten und unbehinderten Äußerung nur noch am Rande: muss man wirklich mit aller Wucht gegen Konrad Heiden, dessen Hitler-Biographie in einer damals noch sehr schwankenden Welt zum ersten Mal im Ausland ein Bild des Diktators vermittelte und gerade durch den stillen Ton Eindruck machte, anrennen?» Ihm persönlich sei nicht wohl bei einem solchen Neo-Katholizismus: «Gerecht ist es nicht.»
Über sich selbst hat Konrad Heiden wenig geschrieben. So gut wie nichts in den zwanziger und dreißiger Jahren. Nur einiges wenige später. Vereinzelte Briefe und Notizen sind erhalten, einige davon auf Englisch aus der frühen Nachkriegszeit. Es war mühsam, sein Leben zu rekonstruieren. Dabei kommt das Hauptverdienst meiner Mitarbeiterin Charlotte Krüger zu, die über Jahre alles zusammengetragen hat, was Konrad Heiden freiwillig oder unfreiwillig hinterließ.
Mein Dank geht auch an Reinhard Mohr, der das – viel zu lange – Rohmanuskript redigiert und gekürzt hat. Ich war oft so fasziniert von Heidens Texten, dass sie in diesem Buch jeden Rahmen gesprengt hätten. Die wichtigsten und eindrucksvollsten Passagen sind dennoch, in einigen Fällen auch über mehrere Seiten, erhalten geblieben. Es geht in dem Buch ja vor allem darum zu zeigen, wie ein junger Reporter den Aufstieg Hitlers erlebte und beschrieb, zu einer Zeit, als man zwar erahnen, aber nicht wissen konnte, in welchem Inferno Hitlers Griff zur Macht und zur Weltmacht enden würde.
Heiden selbst betrachtete seinen Kampf mit einer gewissen stolzen Bescheidenheit. Als er Anfang der sechziger Jahre, schwer krank und mittellos, von Amerika aus in Deutschland einen Wiedergutmachungsantrag stellte, schrieb er darin:
«Ich habe dem privaten Tort, den die Nazis mir persönlich angetan haben, bisher selten Beachtung geschenkt. Mir genügte das Bewusstsein, es ihnen in Wort, Schrift und Tat nach Kräften vergolten zu haben, obwohl persönliche Vergeltung als Motiv dabei keine Rolle spielte.»
Verdrängung aus dem Beruf, Vertreibung aus der Heimat und die Entziehung der Staatsangehörigkeit habe er als Wechselfälle in einem Kampf betrachtet, in dem es auch ihm vergönnt war, den Gegner bisweilen empfindlich zu treffen. Bei alledem habe ihm seine Überzeugung geholfen, dass er lediglich von seinen staatsbürgerlichen Rechten Gebrauch gemacht habe. «Ich hatte die Genugtuung, mit dieser Überzeugung in guter Gesellschaft zu sein. Eine Anzahl ausgezeichneter deutscher Menschen hat von den genannten Rechten gleichfalls und in gleicher Weise Gebrauch gemacht, teils früh, teils – leider – erst später, viele unter Leistung des höchsten Einsatzes.»
Dieses Buch ist auch ein Buch über Journalismus, über einen Reporter, der aufschrieb, was er sah, der sich niemals damit rühmte, ein «investigativer Journalist» zu sein, bescheiden war, nur aufklären wollte, mit Worten, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der eine Haltung hatte, diese aber nicht mit Sendungsbewusstsein überfrachtete. Nicht seine Meinung war für ihn das Wichtige, sondern die Geschichte, die er erzählte. Und zugleich war er ein Teil der Historie.
Das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte. Mit meinen Worten – vor allem aber mit denen Konrad Heidens.
Stefan Aust
PrologRückkehr nach Deutschland
Die viermotorige Propellermaschine vom Typ Constellation war am Abend in New York in Richtung Hamburg gestartet. Unter den etwa hundert Passagieren an Bord waren auch Konrad Heiden und seine Lebensgefährtin Margarethe van Weert. Der Schriftsteller kehrte zum ersten Mal nach dem Krieg zurück in seine Heimat. Es war Dezember 1951. Er machte sich Notizen, in der Sprache, die nun seit fast zwei Jahrzehnten die seine war. Doch sein Englisch war immer noch eine Übersetzung aus dem Deutschen, und auch sein Denken war ziemlich deutsch geblieben.
Plötzlich wurde einem Mann auf der anderen Seite des Ganges übel. Die anderen Passagiere machten sich über ihn lustig. Die ganze Nacht über war er fröhlich und ausgelassen gewesen, als sie den dunklen Ozean überquerten. Seine Stimme übertönte die Motorengeräusche; es war eine Art rostiges Krächzen. Er war viel herumgelaufen in der Maschine und hatte endlos mit einer Gruppe junger Norweger gezecht und herumgealbert, weißblonden, robusten Burschen, die auf dem Mittelgang mit zwei drallen skandinavischen Frauen getanzt hatten. Jetzt ging es ihm schlecht, und die trinkfesten Kerle zogen ihn auf, ohne jedes Mitleid.
«Meistens geht es mir beim Fliegen gut», murmelte er mit einem heftigen deutschen Akzent und rückte an den Rand seines Sitzplatzes gegenüber von Konrad Heiden.
«Ich bin nach dem Krieg viermal zurückgekehrt», sagte er. «Es macht mich jedes Mal ganz krank, wenn ich nach Deutschland komme.»
Er schien ausgesprochen stolz darauf zu sein, dass sein Unterbewusstsein ihm diesen Streich spielte, zumindest tat er so. Er stammte aus Hannover. Seine beiden Eltern waren in einem Konzentrationslager ums Leben gekommen. Nur in Bruchstücken halblauter Sätze bröckelten diese Informationen aus ihm heraus, und immer wieder blickte er zu den Norwegern hinüber, als wollte er ihnen sagen: «Was wißt Ihr Hohlköpfe schon über unseren Schmerz.»
Er hatte Konrad Heiden auf den ersten Blick als jemanden erkannt, dem er Vertrauen schenken konnte, eine verständnisvolle Seele, einen von der gleichen Art. Heiden fragte sich allerdings, ob das Unterbewusstsein jemanden auch dazu bringen konnte, falsche Geschichten zu erzählen. Der kleine Mann trug seine grauenvollen Erinnerungen wie eine Monstranz vor sich her. Wahrscheinlich war die schlichte Wahrheit, dass achtzehn Stunden Flug, acht trockene Martini und seine begeisterte Teilnahme an der Party zu viel für ihn gewesen waren.
Warum war er nun zum fünften Mal zurückgekehrt, wenn er das Land so hasste? Das fragte sich Heiden. Und warum war er selbst bisher nicht ein einziges Mal zurück nach Deutschland gekommen?
«Es war wirklich meine erste Heimkehr nach neunzehn Jahren», kritzelte Heiden in sein Notizbuch, «und dafür nehme ich es recht leicht, um nicht zu sagen gleichmütig.»
Er hatte sich vorgenommen, mit offenen Augen zu kommen und einer kühlen Neugier, alle möglichen Gefühle fest verschnürt. Er würde hinsehen, Punkt. Alles beobachten, was auf ihn zukam. «Ich hatte schon fast vergessen, obwohl ich es besser wußte, daß man nur etwas sehen kann, wenn man es wirklich sehen will.»
Die Sonne war auf der linken Seite aufgegangen und «füllte die Welt mit Raum». Die Maschine tauchte ein in das fließende Licht unter ihnen, flog durch die Wolken – und da lag Deutschland. «Es war, was ich hätte erwarten können», notierte Konrad Heiden, während die Maschine langsam an Höhe verlor. «Wie unerkennbar du bist, Vaterland!»
Aus der immer noch großen Flughöhe sah man aber kein Land, sondern nur geometrische Formen, ein Meer aus großen grünen und gelben Flächen, Rechtecken bis zum Horizont, Äckern und halb gefrorenen Wiesen; langgestreckte Grenzlinien, vielleicht Zäune oder Gräben. Kleine rote Kästen, wahrscheinlich Häuser. «Man konnte nicht erkennen, ob es Paläste waren oder Hütten.» In einiger Entfernung war ein Gewässer zu sehen, lang, gerade, dünn und glitzernd wie eine Nähnadel, vermutlich ein Kanal. Dunkle Flächen, die Städte sein konnten oder Wälder.
«Verwirrend und akkurat zugleich» erschien das Vaterland. «Ja, so ist Deutschland. Wie sauber, rief Heinrich Heine, der Dichter, als er nach 13 Jahren Exil zurückkehrte. Das war vor 110 Jahren. Er sagte es halb verächtlich.»
Konrad Heiden war zu dieser Zeit 50 Jahre alt, seine Lebensgefährtin Margarethe van Weert, eine kleine quirlige Person, genannt «Spatzi», fünf Jahre älter.
Heidens Gedanken wanderten in die Vergangenheit. Er hatte Deutschland vor fast zwanzig Jahren verlassen, «in den stürmischen Tagen von ebenso amateurhaften wie begeisterten Widerstandsplänen gegen die Nazis, die gerade an die Macht gekommen waren».
In eher schlichten Verstecken hatte er nach der Machtergreifung Hitlers «vor dessen noch nicht sehr effizienten Schlächtern» Zuflucht gesucht. Eine neue Generation war damals in Deutschland ans Ruder gekommen: «Neue Gesichter, neue Anführer, neue Überzeugungen; es gab nicht nur neue Herrscher, sondern auch neue Widerstandskämpfer; ein neuer Stil der Unterdrückung und ein neuer Typ von Unterdrückten.»
Es schienen, wie Heiden sarkastisch formulierte, «großartige Tage» zu werden. «Aber am Ende hatten zwei Herren vom Hauptquartier der Gestapo meinen Unterschlupf entdeckt und suchten meine Gesellschaft. Glücklicherweise, als ich gerade anderswo war. Ich harrte noch eine Weile aus, aber schließlich blieb mir keine andere Wahl, als das Land zu verlassen.»
Seitdem war er nicht zurückgekehrt. «Aus bitteren Gründen, nicht aus Hass oder Rachsucht. Aber wie es eben ist, wenn eine alte Liebe zu einem zurückkommt, nur weil der andere Typ eine Enttäuschung war. Dann bist du derjenige, der sich klein fühlt.»
Die Maschine ging langsam in den Sinkflug über. Die Dinge wurden allmählich dreidimensional und bekamen Namen. Sie überflogen eine Zusammenballung reich aussehender Häuser auf einer Hügelkette – den noblen Elbvorort Blankenese, ein Muster von roten und weißen Bauwerken mit Türmen und Steintreppen, Gärten und Terrassen, die sich wie Kaskaden den Hang hinunterzogen; samtene Rasenflächen, von dichten Büschen umgeben.
«Wie mußten die Menschen auf diesen luxuriösen Hügeln sich mit Schuld beladen haben?», fragte Heiden sich in diesem Augenblick. Er war schon nicht mehr in Deutschland gewesen, als die Nazis vollends triumphierten. Er hatte die späteren Ereignisse in den Zeitungen verfolgt und aus spärlichen Briefen, die ihn über zwölf Jahre erreichten. Nach Kriegsende schickte er Lebensmittelpakete an alte, fast vergessene Freunde. Nun war er hier und mit Deutschland noch nicht im Reinen: «Die Träume der Menschen, die Gewalt im Namen der Gerechtigkeit. Der erschreckende Untergang am Ende, die gewaltige Herabsetzung meines Landes – ich konnte das alles nicht so einfach abschütteln.»
Deutschland war für ihn eine sehr persönliche Angelegenheit, nicht viel anders als einst für Heinrich Heine: «Eine Geschichte erschütterten Stolzes, schuldbewußter Schwäche, allgemeinen Schreckens und persönlichen Elends. Deutschland hätte ein Vorreiter der Menschheit sein können – und wie hatte meine Generation das vermasselt.» Auf Englisch klagte er:
«Call it the megalomania of defeat, but Germany had been my fight. I had lost it.»
«Nennt es ruhig den Größenwahn der Niederlage, aber Deutschland, das war mein Kampf. Ich habe ihn verloren.»
Konrad Heiden kehrte nicht nur als Emigrant in seine alte, verlorene Heimat zurück, sondern auch als Journalist. Die weltberühmte amerikanische Illustrierte Life hatte ihm den Auftrag für eine Reportage über Nachkriegsdeutschland erteilt.
Im Mai 1933, kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, hatte er Deutschland verlassen. Sein erstes Buch «Geschichte des Nationalsozialismus. Die Karriere einer Idee», war noch vor dem Desaster vom 30. Januar 1933 erschienen – im Dezember 1932. Wenige Wochen später setzten es die Nazis auf die Liste der verbotenen Bücher. Heiden floh, zunächst in die Schweiz, dann ins Saargebiet, von wo aus er nach der Saar-Abstimmung am 13. Januar 1935 schon wieder fliehen musste – nach Frankreich. Eine große Mehrheit der Saarländer hatte sich für den Anschluss an Hitler-Deutschland ausgesprochen.
Es war ein Leben auf der Flucht.
Heiden war besonders gefährdet. Seine Artikel und Bücher in den zwanziger und dreißiger Jahren hatten die Nazis bis zur Weißglut gereizt. Er kannte die Nationalsozialisten fast alle aus den frühen Tagen der Bewegung in München, vielleicht zu gut. Er war tatsächlich ein alter Bekannter des «Führers» Adolf Hitler, sein kritischer, oftmals spöttischer, unerbittlicher Begleiter und Beobachter seit Jahrzehnten, ein Chronist des Aufstiegs zur Macht, ein intimer Kenner der Ränkespiele, der Freundschaften und Feindschaften, der Rivalitäten und Intrigen innerhalb der «Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei» (NSDAP).
Jetzt, bei der Landung in Hamburg, erinnerte sich Heiden an seine eigenen Erlebnisse Jahre zuvor in der Hansestadt: «Einst war Hamburg die Hauptstadt des Wohlstandes und der Sünde gewesen, wo diejenigen, die ihn sich leisten konnten, den besten Kaviar diesseits der russischen Grenze bekamen.» Im Zentrum der Stadt umgaben «drei Reihen von Palästen einen silbernen See», die Alster. Am Hafen, glitzernd und herausfordernd, lag Deutschlands größtes Rotlichtviertel, St. Pauli, in dem halbnackte Mädchen in den Hauseingängen standen. «Eines von ihnen zeigte mir, als ich noch ein halber Junge war, den Trick, den man damals Pariser Christbaum nannte», notierte Heiden. «Sie steckte ein halbes Dutzend Zündhölzer in einen delikaten Teil ihres Körpers, zündete sie an und löschte sie mit einem Schwung Wein. Spezialpreis für die kleine Schau von goldener Obszönität: fünfundzwanzig Pfennig.»
Diese Art von Leben, Laszivität zu Hungerlöhnen, so sah Heiden voraus, würde in der Stadt auch zwischen Ruinen weiterblühen. Mehr als die Hälfte von Hamburg war in einem Feuersturm hinweggefegt worden. «Darüber unter anderem sollte ich schreiben. Für mich eine Geschichte wie ein Stich ins Herz!»
Eine ohrenbetäubende Ansage aus dem Lautsprecher der Pilotenkabine teilte den Passagieren mit, dass sie ihre Sitzgurte schließen sollten. «Wir kamen an. In ein paar Minuten würde ich meinen Fuß auf deutschen Boden setzen, zum ersten Mal nach neunzehn Jahren.»
Mehr als die Hälfte seines Lebens hatte Heiden sich mit einem einzigen Thema beschäftigt: Adolf Hitler. Er hatte dessen Aufstieg zur Macht begleitet und in den ersten Jahren aus nächster Nähe beobachtet, in Gasthäusern und Sälen, bei Kundgebungen und Aufmärschen, als Kläger oder Angeklagter vor Gericht. In München ging das Gerücht um, in den zwanziger Jahren hätte Hitler auf kleineren Parteiveranstaltungen häufig erst angefangen zu reden, wenn Konrad Heiden im Saal war. Auch kritische Berichterstattung in linken und liberalen bürgerlichen Zeitungen war für ihn wirkungsvolle Propaganda.
Heiden hatte viele Männer aus Hitlers engstem Umfeld getroffen und von manchem interne Informationen aus der Partei erhalten. Er las die Propagandaschriften, hörte sich unendlich lange Reden an und nahm jeden Hinweis von den Männern aus Hitlers Umgebung auf, deren Verschwiegenheit oft nur von ihrer Wichtigtuerei übertroffen wurde. Heiden ahnte, wohin das führen würde. So wurde er gleichsam ein Seismograph, der das zukünftige Erdbeben prognostizierte.
Heiden hatte seinen Kugelschreiber im Spalt zwischen seinem Sitz und der Kabinenwand verloren. Er war besorgt, ob er in der deutschen Nachkriegswüste, wo die Leute angeblich noch in Höhlen wohnten, ein brauchbares Schreibwerkzeug finden würde, und ertappte sich bei dem Gedanken, dass er so den Schock des Wiedererkennens seiner alten Heimat verdrängte, der langsam durch seine Nervenbahnen kroch.
Inzwischen kam der Boden näher, die Räder setzten auf und rollten langsam aus: «Überall um uns herum war jetzt Deutschland.» Ein sehr ungewohntes Gefühl. Doch sogleich nahm er sein Pathos wieder zurück. «Um uns herum war in Wirklichkeit nur ein Flugfeld, eines wie überall in der Welt.» Es war furchtbar still, als sie die Maschine verließen, «eine majestätische, glänzende Leere, das Ganze wie eine hohle Muschelschale». Keine Ruinen, keine Wüste, aber auch keine Flugzeuge. Die schweren Glastüren und polierten Messingteile des Empfangsgebäudes glänzten in der milden Dezembersonne.
Und dann tauchten die ersten Deutschen auf. Es waren die höflichsten, am wenigsten kriegerischen Zoll- und Grenzbeamten, die Heiden seit langer Zeit gesehen hatte. «Hauptsächlich junge Männer mit schmalen, angestrengten Gesichtern, offenbar abgefüllt mit Lektionen über Gastlichkeit, Freundlichkeit und den Geist des Willkommens, das ein neues Deutschland an seinen Grenzen zeigen sollte.» Er konnte keine Spur «teutonischer Schwerfälligkeit und Rechthaberei», keine Anzeichen von Aggression und Machtbesessenheit erkennen, die ihn zwanzig Jahre zuvor außer Landes getrieben hatten.
Nach der Landung auf dem Hamburger Flughafen stand der kleine Mann aus der Maschine neben Konrad Heiden. «Winkt Ihnen diese entzückende Dame dort zu?», fragte er. In der Menge der Wartenden in der Empfangshalle sprang wild gestikulierend «etwas Blondes» herum, offenbar um Aufmerksamkeit zu erregen. Heiden dämmerte, dass jemand in New York an irgendjemanden in Hamburg etwas über seine Ankunft geschrieben haben musste.
Die blonde Frau wartete tatsächlich auf ihn. Heiden hatte sie nie zuvor gesehen. Er beschloss, genau hinzusehen: «Hör dir das erste Wort an. Glaube nichts davon!»
«Little day!», kreischte die blonde Frau. «Little day und willkommen in Deutschland! Sie sind also unser aller Konrad! Sind Sie endlich gekommen! Das wurde aber auch Zeit, würde ich sagen.»
Wieder rief sie «Little day!» und richtete die merkwürdigen Begrüßungsworte auch an den kleinen Mann, der sie mit großen Augen anstarrte. Vielleicht meinte sie, dass «little day» so etwas wie «guten Morgen» hieß, kleiner Tag. Das hatte sie wohl irgendwo gelesen.
«Sie war tatsächlich wunderschön, wenn auch nicht mehr ganz jung», schrieb Heiden später. «Little day sagen sie heutzutage vielleicht statt Heil Hitler.»
Die Frau war eine Freundin von Freunden von Freunden und wollte nun von Heiden wissen, was mit ihm los sei und warum er nicht längst zuvor nach Deutschland gekommen war. Sie schien Flüchtlinge abzulehnen, die sich nach dem Ende des Krieges nicht beeilten, nach Hause zurückzukehren.
Ihr Name war Frau Lilo. Das Lachen in ihrer Stimme steckte an, und Heidens Vorname sprang ihr von den Lippen, als habe sie ihn seit Jahren gekannt. Sie bot Gastfreundschaft an, angenehmen Weitertransport und eine Liste von Leuten, die sich schier umbringen würden, um Heiden zu treffen. Offenbar konnte sie nicht damit leben, dass irgendjemand anderer Meinung war als sie.
«Wie war die Reise?», fragte sie. Sie hasste es zu fliegen – «Sie auch?»
«Ich? Nein.»
«Nun, Sie sind ja hier, Gott sei Dank. Und Sie werden wohl nicht so einen Unsinn über Deutschland schreiben wie die meisten? Gott sei Dank sind Sie ja nicht so verblendet, weil, Konrad, ehrlich gesagt, ich habe von Ihnen noch nie gehört, aber das nehmen Sie mir nicht übel, oder?»
Ein offenbar besser informierter Ehegatte namens Günther, «unser aller Günther», sandte seine Grüße, die sie erweiterte auf ein herzliches Willkommen in Deutschland und ein Angebot zur Unterstützung auch von Mister … Mister?
Ihr strahlendes Lächeln war auf den kleinen Mann gerichtet. Heiden wusste seinen Namen auch nicht. Sie zuckte kaum, als herauskam, dass er sich irgendwie nach Fischelowitz anhörte.
«Das alles war perfekt», erinnerte Heiden sich später. «Damit hatte meine Ankunft die richtige Würze und Herausforderung. Hier war Deutschland, neu, fremd, verführerisch, unfaßbar und ein wenig konspirativ. Ganz sicher war Frau Lilo wohl nichts anderes als eine charmante Wichtigtuerin, die es vorgezogen hatte, mal kurz zum Flughafen zu brausen, statt den Vormittag mit Shoppen oder am Telefon beim Klatsch zuzubringen. Aber als erster Eindruck deutscher Atmosphäre war sie erstklassig.»
Es war nicht die Person Hitlers allein gewesen, nicht nur die Motive seiner Anhänger, die er damals versucht hatte, zu beschreiben und zu ergründen. Es ging ihm um die historische Situation, die den Aufstieg des Führers ermöglicht hatte.
«Die geistige Herrschaft Hitlers über Millionen und Abermillionen ist oft mit Hypnose verglichen worden», schrieb er nach dem Krieg im Vorwort zu einem Buch, in dem Himmlers Masseur seine Erlebnisse mit dem SS-Führer schilderte. «Als Vergleich mag das gelten», so Heiden, «denn es gehört auf jeden Fall eine innere Bereitschaft dazu, sich hypnotisieren zu lassen, wenn auch noch so verborgen.»
Einmal, viele Jahre zuvor, hatte ein journalistischer Kollege bei einer privaten Einladung, bei der Hitler auftreten sollte, neben ihm gesessen. Fast ein Freund, von dem er bis dahin zu wissen glaubte, dass er politisch ungefähr so dachte wie er selbst. Nach einer schwer ertragenen Stunde Hitler’scher Beredsamkeit raunte ihm Heiden ganz unbefangen zu: «Wir haben jetzt genug gehört und könnten eigentlich gehen; der Unfug ist ja nicht auszuhalten!» Der Kollege aber stieß Heiden wütend in die Seite und zischte: «Schweigen Sie, schweigen Sie, der Mann spricht ja wundervoll.»
Heiden hatte sich oft gefragt, wie es sein konnte, dass dem Mann, «der heute wohl der berühmteste Mensch auf Erden ist, bis zu seinem 30. Lebensjahr auch nicht der bescheidenste Erfolg geglückt» war. «In gesünderen Zeiten wäre ein Hitler vielleicht Sektengründer, Hypnotiseur oder Goldmacher geworden.»
Voller Gedanken über die Vergangenheit trat Heiden hinaus auf das, was für ihn seine erste deutsche Straße seit 19 Jahren war. Er schaute sich um, ob er irgendetwas wiedererkannte, einen Briefkasten vielleicht, eine Straßenlaterne. Er sog die warme, milde Luft ein, um etwas Vertrautes zu riechen. «Aber da war nichts als eine gesichtslose, geruchlose, brandneue Sache, genannt Straße, eine stille fröstelnde Warnung gegen falsche Erinnerungen. Paß gut auf!»
Dieses Land war nicht mehr dasselbe, das er 1933 verlassen hatte. «Nein, ich war nicht nach Hause gekommen. Ich mußte viel lernen. Das Schicksal hatte mich in ein Land verschlagen, das roh war, frisch aus der Asche auferstanden und nicht länger meines. Aus dem Krieg, aus der Erniedrigung, und mit schmerzhafter Lebenskraft erhob sich ein neues Deutschland, immer noch halb betäubt, aber auf eine verzeihliche Art zukunftsorientiert.»
Draußen wartete ein niedliches kleines Auto. Heiden dachte sich: gerade so groß, dass er es zusammengefaltet in seinem großen Koffer hätte unterbringen können. Ein kleiner uniformierter Chauffeur riss die Tür auf, und los ging es, in einer Geschwindigkeit, die in New York ein halbes Dutzend Polizisten dazu veranlasst hätte, hinter ihnen herzuhetzen. Heiden entdeckte keine Ruinen, aber alles wirkte ein bisschen schäbig, nur ein wenig schlimmer, als er es in Erinnerung hatte.
«Ich hatte erwartet, daß die zur Hälfte zerbombte Stadt Hamburg aussehen würde wie ein versteinerter Wald von schwarzen Hauswänden mit offenen Fensterhöhlen», sagte er.
Der Chauffeur antwortete schnell: «Auf dem Weg sehen Sie nur wenige Ruinen. Das liegt an der De-Ruinierung. Alles weg. Sie sollten die neuen Appartementhäuser sehen. Dick wie Pilze.»
«Glauben Sie kein Wort davon, Konrad», fuhr Frau Lilo dazwischen, «es gibt noch genug Ruinen, sogar mit Leichen darunter.»
«Nicht da, wo Sie leben», sagte der Chauffeur.
«Gestern waren die Deutschen die am meisten vergessene Nation auf der Erde», schrieb Heiden, «gerade noch ein Teil der Geographie, mit sprachlosen, ratlosen Menschen. Heute wirkten sie wie eine Art Barometer auf mich – und morgen? Wo Deutschland hingeht, dorthin geht auch die Welt, wer weiß? Vielleicht ist der flotte, sich artig verbeugende und dennoch offensichtlich widerspenstige Chauffeur die Zukunft.»
An einer nackten Hauswand prangte ein gewaltiges Plakat, Werbung für ein bekanntes Waschmittel. Eine tiefsitzende Kindheitserinnerung, Heiden bekam feuchte Augen.
«So, Sie haben immer noch Persil», sagte er laut.
«Darauf können Sie wetten», antwortete Frau Lilo. «Wir haben es niemals mehr gebraucht als heute; einige Leute jedenfalls.»
Sie spuckte die Worte geradezu aus. Der Chauffeur sagte nichts. Das merkwürdige Gespräch zielte auf ehemalige Nazis, die einer Verurteilung in den Entnazifizierungs-Verfahren entgangen waren. Die begehrten Entlastungspapiere wurden überall scherzhaft «Persilscheine» genannt, frei nach dem berühmten Werbeslogan «Reinigt alles, sogar die schlimmsten Flecken».
Frau Lilos Bitterkeit und das Schweigen des Chauffeurs sagten alles.
«Sie haben Ihre Probleme in Deutschland», bemerkte Heiden. «Jede Epoche hat ihren eigenen Stil dafür. Als ich zum letzten Mal hier war, aktiv im Untergrund, lernte ich, wie man mit Reiswasser unsichtbare Briefe schreibt. Man machte sie dadurch lesbar, daß man sie in unverdünntes Jod tauchte. In Verstecken und geheimen Treffen warteten wir darauf, daß Sabotageeinheiten an der Ruhr die Kohlegruben unter Wasser setzten, was niemals geschah.»
Heiden war damals verzweifelt durch das alte, großartige Nürnberg gelaufen. Die Stadt kam ihm plötzlich vor wie eine einzige Zusammenrottung von Flaggen und Fanfaren in einem braunen Meer von SA-Männern mit ihren gelbbraunen Uniformen.
An diesem Dezembertag des Jahres 1951 stiegen Konrad Heiden und Marga van Weert in einem Hotel in der Hamburger Innenstadt ab, mit livriertem Empfangspersonal und allem Komfort. Heiden hatte das Gefühl, die Ordnung sei in ein ernsthaftes und zugleich resigniertes Deutschland zurückgekehrt.
Die meisten Straßen, das fiel ihm gleich auf, waren um Mitternacht sicherer als manche Ecken seiner neuen Heimat New York gegen Mittag: «Deutsche Straßen waren sauberer. Man konnte in großen Hotels nicht immer ein Zimmer mit Bad bekommen, aber wie sie den ganzen Tag lang jeden Flecken scheuerten, säuberten und polierten! Es gab einen – häufig unwirtschaftlichen – Eifer in jeder Angelegenheit. Die Verbeugungen der Lift-Boys, ihr Lächeln und ihre Entschuldigungen, wenn sie die Fahrstuhltüren öffneten; der Dank der Kellner oder Taxifahrer für das kleinste Trinkgeld – eine ehrwürdige Höflichkeit ohne Lächeln – verriet den Wunsch, es unter allen Umständen richtig zu machen.»
Man konnte, wenn man wollte, eine Menge Armut sehen, aber man konnte sie nicht riechen – nicht einmal in den monströsen Antiquitäten, die man Taxis nannte. Sogar die Ruinen hatten eine Art, arm, aber sauber zu wirken. Der schnelle und schwere Straßenverkehr machte das Leben für die Fußgänger beschwerlich, und die Innenstadt von Hamburg, Deutschlands großartigem Schaufenster, hatte die gleichen Parkplatzprobleme wie downtown New York.
Die Mitte der Stadt war von dem dynamischen sozialdemokratischen Bürgermeister Max Brauer nach dem Motto «Weg mit den Ruinen» aufgeräumt worden. Der ehemalige amerikanische Staatsbürger schaffte es, die Stadt beinahe so aussehen zu lassen, als hätte es nie einen Krieg gegeben.
Brauer war genauso wie Heiden vor Hitler in die USA geflohen, aber zurückgekehrt, um seine Heimat wiederaufzubauen.
«Gibt es hier irgend jemanden ohne ein Dach über dem Kopf?», überfiel der Beauftragte des hanseatischen Stadtstaates Konrad Heiden mit stolzem Gesichtsausdruck. «Nein, so etwas gibt es in Deutschland nicht mehr!»
Hamburg, das musste Heiden einräumen, hatte sich an den eigenen Schnürsenkeln aus dem Morast gezogen, bevor es überhaupt Stiefel hatte.
Konrad Heidens Lebensgefährtin Marga, mit der er damals in einem schmucken grauen Holzhaus in Orleans auf der Halbinsel Cape Cod lebte, hatte Verwandtschaft in Hamburg. Ihr Bruder Adolf, ehemaliger Marineoffizier und nicht unbedingt ein Feind der Nazis, lebte hier. Die erste Begegnung mit ihm verlief denn auch etwas spröde. In der Dachgeschosswohnung waren aber noch zwei Gäste eingeladen, die Konrad Heiden aus der Zeit seines Kampfes gegen die Nationalsozialisten kannte: die Sozialdemokraten Elsbeth und Herbert Weichmann. Der spätere Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg hatte wie Heiden eine Zeitlang als Journalist für die Frankfurter und die Vossische Zeitung gearbeitet. Er und seine Frau waren wie Heiden aus Deutschland nach Paris geflohen. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Frankreich gelang es ihnen, sich über Marseille nach Spanien und schließlich nach Lissabon abzusetzen.
So saßen sie also zusammen, Anfang 1952, sieben Jahre nach Kriegsende, in einer Dachstube in Hamburg, und sprachen über die alten und die neuen Zeiten. In ihren Memoiren schrieb Elsbeth Weichmann später über den letzten Teil ihrer Flucht, als sie am 1. November 1940 auf dem Küstendampfer Genua die Fahrt Richtung New York antraten: «Die Mehrzahl der Passagiere stand am Bug des Schiffes und schaute einer neuen Heimat und einer neuen Zukunft entgegen. Wir blickten zurück auf unsere verlorene Heimat Europa und auf unsere zerstörte Zukunft dort, die sich immer weiter von uns entfernte.» In Lissabon hatten Elsbeth und Herbert Weichmann zufällig Konrad Heiden getroffen, der damals noch auf seine Papiere für die Einschiffung nach New York wartete.
Heiden und Hitler – Kinder ihrer Zeit
Als Konrad Heiden am 7. August 1901 in München zur Welt kam, war der Mann, mit dem er sich sein Leben lang beschäftigen würde, 12 Jahre alt. Adolf Hitler ging in Linz auf die Realschule und musste die 5. Klasse wegen schlechter Leistungen in Mathe und Physik wiederholen. Er hatte gerade, zur großen Verbitterung seines Vaters, beschlossen, Kunstmaler zu werden. Alois Schicklgruber wollte, dass sein Junge wie er selbst Beamter würde, doch Adolf sträubte sich. «Ein früh Gescheiterter» überschrieb Heiden später sein Kapitel über Hitlers Jugend. Aus den Schulzeugnissen blicke «ein gewecktes Kind mit lebhafter Phantasie und wenig Disziplin heraus, das sich für die bunten und leicht faßlichen Fächer interessierte und die anstrengenden vernachlässigte».
Unter Einfluss seines Lehrers Pötsch sei Hitler bereits als Schuljunge ein junger Nationalist geworden, der «mit heißem Kopf» vom siegreichen Kampf Deutschlands gegen Napoleon gelesen habe.
Konrad Heiden hingegen kam in einem Elternhaus zur Welt, das alles andere als national gesinnt war. Seine Mutter war eine Sozialistin und Kämpferin für Frauenrechte, die mit Clara Zetkin befreundet war, einer Ikone der linken Friedens- und Frauenbewegung.
Lina Deutschmann stammte aus einer jüdischen Familie, war in Berlin geboren und in München aufgewachsen, wo sie die Mädchenhandelsschule besuchte. Ihr Vater Moritz Deutschmann arbeitete als Schuhmacher. Lina war 23 Jahre alt, als sie den Rechtsanwaltsgehilfen Johannes Heiden kennenlernte. Er war der uneheliche Sohn des Bürgermeisters eines kleinen pommerschen Städtchens namens Demmin, bei dem seine Mutter als Haushälterin arbeitete.
Der Bürgermeister verweigerte seinem illegitimen Sohn jegliche finanzielle Unterstützung. Johannes Heiden war wegen einer Lungenkrankheit schon als Knabe schwächlich. Die «freudlose Jugend» prägte ihn und verlieh ihm «herbe Züge», wie es später in einem Nachruf hieß. Mit 13 Jahren war er bereits Waise und lebte auf sich allein gestellt in Hamburg. Durch harte Arbeit und Selbststudium ackerte sich Johannes Heiden zur Schreibkraft hoch und trat in die SPD ein. Er besuchte Bildungseinrichtungen der Stadt und der Partei, arbeitete bei Rechtsanwälten als Assistent und bei einer Hamburger Bierversandgesellschaft als «Correspondent und Cassierer». 1899 fand er in München eine Stellung als «Buchhalter und Bürochef» bei einem Anwalt.
In München lernte er Lina Deutschmann kennen. Rasch wurde sie schwanger, und am 24. Dezember 1900 heirateten die beiden. Am 8. August 1901, laut Geburtsurkunde vormittags um «zwölf ein viertel», wurde in der Reichenbachstraße 29 der gemeinsame Sohn geboren: Konrad Ruben Heiden.
Das Paar zog mit dem Kind nach Frankfurt in die Hohenzollernstraße 20. Johannes Heiden leitete dort inzwischen ein Gewerkschafts-Sekretariat. Er beriet Arbeiter in Rechtsfragen und schrieb gelegentlich für die Sozialistischen Monatshefte. Männer kamen zu Johannes Heiden ins Büro, weil sie Ärger mit dem Vermieter hatten oder weil sie mit dem Strafrecht in Konflikt geraten waren. Frauen suchten nach Rat, weil ihre Ehemänner überschuldet waren und sie sich gegen die Pfändung ihres Besitzes wehren wollten. Arbeiter brauchten Hilfe bei Schadensersatzklagen oder in Erbangelegenheiten. Die Anlaufstellen wurden nicht von ausgebildeten Juristen geführt, sondern von Autodidakten wie Johannes Heiden, der sich mit viel Fleiß in juristische Fragen eingearbeitet hatte.
Die Ehe zwischen Lina und Johannes Heiden kriselte schon früh. Johannes Heiden warf seiner Frau vor, ihren Pflichten als Ehefrau und Mutter nicht ausreichend nachzukommen. Lina Heiden war eine frühe Feministin. In der Neuen Zeit kritisierte sie 1906 das Frauenbild, nach dem «des Weibes Stätte das Haus» sei: «Man sieht, die Dunkelmänner sind mit allen Kräften bestrebt, die ihnen noch unterworfenen Frauen festzuhalten, einzuschließen in der Kirche Nacht, sie durch die Sorge um das Heil ihrer Seele fernzuhalten und abwendig zu machen von dem großen, weltbewegenden Kampfe der Arbeiterklasse um die Eroberung einer neuen, gerechteren Gesellschaftsordnung, der sozialistischen, die schon auf Erden das Heil der Seele und des Leibes verbürgt.»
In Frankfurt war Lina Heiden mit der Frauenrechtlerin und SPD-Politikerin Henriette Fürth befreundet, die 1901 in Frankfurt den Verein «Weibliche Fürsorge» gegründet hatte. «Gleichberechtigt wollen wir unseren Platz neben dem Manne einnehmen und behaupten», schrieb Henriette Fürth. «Sein guter Kamerad – wenn er will; sein ebenbürtiger Gegner – wenn’s ihm so lieber ist. Nicht aber seine Sklavin und nicht seine Puppe. Und in Zeiten der Not? Ja, da wollen wir mehr und anderes; oder nein: da wollen wir alles zugleich sein. Eine ganze Kraft setzen wir ein: zu trösten, zu lieben, zu hoffen und zu arbeiten! Zu arbeiten!»
Auch Lina Heiden wollte beides, arbeiten und eine liebende Mutter sein, die ihrem Kinde «neben einer sachgemäßen und vernünftigen Körperpflege alle Segnung eines reichen Fühlens, aber auch klaren Denkens» mitteilen sollte, wie Henriette Fürth es ausdrückte. Lina Heiden engagierte sich in der Frauenbildung und arbeitete als Vertrauensperson in einem Fürsorgebüro für Proletarierinnen. Sie schrieb für den sozialdemokratischen Vorwärts, für Clara Zetkins Neue Zeit und für die Zeitung Gleichheit Artikel und Buchrezensionen. Immer wieder betonte sie, dass die Freiheit der Frau erst in der sozialistischen Gesellschaft erreicht werden könne.
Lina Heiden wurde der Mehrfachbelastung als Hausfrau, Mutter und politischer Aktivistin aus der Sicht ihres Mannes offenbar nicht gerecht. Sie ging morgens um 7.45 Uhr aus dem Haus und kehrte erst um 16 Uhr nachmittags zurück. Das Kochen übernahm eine Haushälterin. Dreimal die Woche verließ sie nachmittags erneut die Wohnung, um an Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Dann kehrte sie nach 20 Uhr zurück, manchmal auch erst spätnachts.
Im November 1903, Sohn Konrad war gerade zwei Jahre alt, kam es zum ernsthaften Zerwürfnis zwischen den Eheleuten. Johannes Heiden wollte den Streit schlichten und schrieb an seine Schwägerin Hanna Deutschmann, eine Trennung wäre ein «Verbrechen an dem Kinde». Er fuhr fort: «Gatten, die kein Kind haben, mögen sich vielleicht aus Gründen so nichtiger Art trennen, wie wir es vorhaben, Eltern aber dürfen es nicht. Das alles steht mir jede Minute vor der Seele, seitdem ich am Sonntag gesehen habe, wie das Kind vor Freude hüpfte, als es mich erblickte. Ich habe laut weinen müssen.»
Lina Heiden zog mit ihrem Sohn Konrad für eine Weile nach Stuttgart zu ihrer «Genossin Z.», vermutlich Clara Zetkin, kehrte nach kurzer Zeit aber zurück zu ihrem Mann. An ihre Freundin «Z.» schrieb sie: «Jetzt lebe ich wieder schlecht und recht mit meinem Mann zusammen, und ich habe im großen Ganzen betrachtet, keinen Anlaß zu klagen.» Ihr Mann werde sich nicht mehr ändern, und sie wolle jetzt alles möglichst leichtnehmen. Schließlich habe sie ihren «Bubi», der «eine Quelle unerschöpflicher reinster Herzensfreude» sei. «Er entwickelt sich körperlich und geistig so prächtig, er ist ein solch lieber, artiger, doch liebender Junge, daß ich mich sehr hüten muß, hier viel von ihm zu schreiben, sonst könnte ich Ihnen seitenlang von ihm schwärmen, und dazu fehlt mir wohl das Recht.»
Die Familie Heiden
Die Eheleute versuchten es noch ein weiteres Jahr, doch das Zusammenleben funktionierte nicht mehr. Lina Heiden war kreuzunglücklich in der «Frankfurter Sippschaft», wie sie es in einem Brief an ihren Mann ausdrückte. Ständig hätten dort «100 Augen» ihre Schritte begleitet und «50 Mäuler» ihre Worte und Taten kritisiert. Man habe sie als «schmutzig, schlampig» und als «schlechte Hausfrau» bezeichnet, sodass sie schließlich in Frankfurt nicht mehr habe atmen können. Ein Jahr nach dem letzten bitteren Zerwürfnis, wieder kurz nach dem Hochzeitstag im Dezember 1904, packte Lina Heiden ihre Sachen und fuhr Hals über Kopf mit Sohn Konrad zu ihrer Mutter nach München. Ihr Entschluss stand fest, sie wollte nicht zurück. Im Mai 1905 wurde die Ehe geschieden. Das Gericht schrieb die Schuld der Mutter zu, da sie «ihre Pflichten als Gattin und Hausfrau» vernachlässigt habe. Sie musste auch die Prozesskosten tragen.
Johannes Heiden überließ seiner Frau das Recht, das Kind bei sich zu behalten, verlangte jedoch, dass sie ihm «zweimal monatlich über das Befinden des Kindes Bericht erstattet». Am 8. Februar 1905 schrieb sie ihm aus München und ließ den Vater von «Bubi» vielmals grüßen. «Es geht ihm recht gut, er hat schöne rote dicke Bäckchen, ist vergnügt und freut sich seines süßen Lebens. Im allgemeinen ist er sehr lieb und artig, folgt brav und ißt und schläft ordentlich.» Jeden Sonntag wolle er nun zur Parade an der Feldherrnhalle. «Wenn er Musik hört, ist er ganz bezaubert.»
Um sich und den Sohn zu ernähren, nahm Lina Heiden vorübergehend eine Stellung in Berlin an. «Ich kämpfe einen schweren Kampf wegen Konrad», schrieb sie an ihren Mann. Solle sie ihn wegen zwei oder drei Monaten in eine fremde Umgebung bringen? Sie entschloss sich, ihren Sohn nicht mitzunehmen. Vermutlich ließ sie ihn bei ihrer Mutter und ihrer Schwester Hanna, zu der Konrad ein inniges Verhältnis hatte. Johannes Heiden beschwerte sich später in einem Brief bitter darüber. Die Erinnerung an das Frühjahr 1905, als dem dreijährigen Kind «auf einen Schlag Mutter und Vater geraubt wurden, es vier Monate lang ohne die Überwachung seiner Mutter sein mußte», lasse ihn noch immer «erzittern» und er wolle das am liebsten vergessen.
Er selbst war während dieser Zeit wegen einer Lungenerkrankung zur Kur im badischen Schwarzwald.
Lina Heiden blieb mit Konrad in München bei ihrer Mutter und fand im Herbst 1905 auch wieder eine ordentlich bezahlte Stellung. In einem Brief an Henriette Fürth berichtete sie, Konrad sei inzwischen einen Meter groß und so kräftig, dass die Leute ihn auf fünf Jahre schätzten, obwohl er erst vier war. Er sei «lieb und brav trotz des lebhaften Temperaments, das der kleine Kerl zu meiner innigen Freude an den Tag legt». In dem Brief berichtet Lina Heiden auch, der Scheidungskrieg habe viele Nerven und Kräfte gekostet und im Sommer sei sie mehrfach krank gewesen.
Am 29. September 1906, kurz nach Konrads fünftem Geburtstag, starb Lina Heiden-Deutschmann in München. Eine Todesursache ist auf der Sterbeurkunde nicht verzeichnet. Sie wurde 29 Jahre alt.
«Genossin Heiden zählte zu den fähigsten, geschultesten und charaktervollsten jungen Vertreterinnen der proletarischen Frauenbewegung», schrieb die Zeitung Gleichheit in einem Nachruf. «In heißen äußeren und inneren Kämpfen hat sie sich selbst finden müssen.» Doch im Sozialismus habe sie «zum Glück» eine feste Weltanschauung gefunden, mit der sie auch «über Steine und Dornen» gegangen sei. «Die leidenschaftliche Kämpferin war eine zärtliche, treu sorgende und einsichtsvolle Mutter. Wie leuchteten ihre Augen, wenn sie von ihrem Knaben sprach, welche echte Wärme des Gefühls wehte aus ihren Zeilen, wenn sie von seiner Entwicklung schrieb. In aufrichtiger Trauer fühlen wir uns mit Genosse Heiden und den Freunden der Verstorbenen verbunden, die ihr frühes Grab umstehen. Als Persönlichkeit und als Kampfesgenossin wird uns Genossin Heiden unvergesslich bleiben.»
Konrad Heiden war jetzt Halbwaise, gerade mal fünf Jahre alt. Der Mann, mit dem er sich sein Leben lang beschäftigen sollte, war damals, 1906, siebzehn Jahre alt. Schon zu jener Zeit, so jedenfalls behauptete Adolf Hitler später, sei sein politischer Lebensweg vorgezeichnet gewesen. Er hatte viel mit der großen Bühne, dem Theater, der Oper zu tun. Dramatik, Melodramatik, großes Pathos, Volksmassen, Chöre, Lärm und Geschrei, bombastische Aufmärsche und donnernde Orchester hatten es ihm angetan. Heldengestalten, Mord und Totschlag, Verrat und Untergang fand er vorwiegend in den Opern Richard Wagners. Vor allem ein frühes Werk des Meisters faszinierte ihn seit frühen Jugendtagen, die Oper «Rienzi». Es ist die Geschichte des römischen Volkstribunen Cola di Rienzo, der im Rom des 14. Jahrhunderts altrömische Zustände wiederherstellen wollte: eine reaktionäre Revolution. Immer wieder sah und hörte Hitler sich «Rienzi» an, und die Ouvertüre zu der Oper wurde später auf jedem Reichsparteitag der NSDAP aufgeführt.
«In jener Stunde begann es», sagte Adolf Hitler später angeblich über einen seiner ersten Theaterbesuche im November 1906 in Linz. Dort wurde Wagners «Rienzi» aufgeführt. Der jugendliche Hitler besuchte die Oper zusammen mit seinem Freund August Kubizek. Der behauptete später: «Das hat er oft gesagt. Dieser Cola di Rienzo, Sohn eines kleinen Gastwirts im Rom des 14. Jahrhunderts, hat mit 24 Jahren das Volk dazu gebracht, den korrupten Staat zu vertreiben, indem er die große Vergangenheit des Imperiums beschwor. Bei dieser gottbegnadeten Musik, so sagte er, hatte er als junger Mensch im Linzer Theater die Eingebung, daß es auch ihm gelingen müsse, das Deutsche Reich zu einen und großzumachen. Wie eine aufgestaute Flut durch die berstenden Dämme bricht, brachen die Worte aus ihm hervor. In großartigen, mitreißenden Bildern entwickelte er mir seine Zukunft und die seines Volkes.»
Das, wenn die Legende des August Kubizek stimmt, war der Beginn von Hitlers lebenslanger Verehrung für den Komponisten, Revolutionär und Antisemiten Richard Wagner.
Seit dem Tod des Vaters im Jahr 1903 war Hitler Halbwaise. Sein erster Anlauf, auf der Malschule der Akademie der Bildenden Künste in Wien angenommen zu werden, scheiterte. Beim Probezeichnen im Jahr 1907 wurde er mit «ungenügend» beurteilt und abgelehnt. Den Beleg dafür fand Konrad Heiden später als junger Journalist in den Akten der Akademie. Hitler selbst verschwieg diesen Umstand. «Gebrochen» kehrte Hitler nach Linz zurück, wo seine Mutter im Sterben lag. Heidens Resümee: «Ein verspieltes, verträumtes Jugenddasein geht dem Ende zu. Klara Hitler stirbt am 21. Dezember 1907. Adolf Hitler, ein verwöhnter Junge von 19 Jahren, der nichts gelernt hat, nichts erreicht hat und nichts kann, steht vor dem Nichts.»
Dieses Nichts hieß: vier Jahre Elend in Wien. Hitler selbst habe erzählt, dass er sich in dieser ersten Wiener Zeit durch praktische Arbeit sein Brot erworben habe. Menschen, die ihn um jene Zeit gut kannten – Hausgenossen, Geschäftsfreunde, Bilderhändler –, behaupteten allerdings, Hitler sei «für körperliche Arbeit viel zu schwach gewesen, auch habe er damals nie etwas von dieser Bauarbeit erzählt». Stattdessen habe er gelesen, «Buch um Buch, Broschüre um Broschüre». Seinen Quartiergebern erklärte Hitler, er wolle sich zum Schriftsteller ausbilden.
Zu dieser Zeit wurde Konrad Heiden gerade eingeschult. Seine Zeugnisse in der Mittelschule in Frankfurt am Main waren gut, nur seine Leistungen im Turnen und Schreiben kamen über ein «befriedigend» nicht hinaus. 1909 heiratete sein Vater noch einmal, doch auch seine zweite Frau verließ ihn nach weniger als zwei Jahren. Konrad lebte allein mit seinem Vater im dritten Stock eines Wohnhauses in der Ottostraße 16.
Mit acht Jahren kam Heiden auf das traditionsreiche städtische Lessing-Gymnasium in der Hansa-Allee in Frankfurt. Es residierte in einem 1902 eingeweihten prachtvollen Gebäude im wohlhabenden Frankfurter Westend. Die Schüler kamen vorwiegend aus gutem Hause, und der Unterricht galt als konservativ. Heiden lernte Latein, Griechisch und Französisch, auf seinem Stundenplan standen außerdem Erdkunde, Geometrie und Zeichnen. Bald gehörte er zu den besten Schülern seines Jahrgangs. In den Protokollen der Versetzungskonferenz vom März 1912 ist vermerkt, dass Konrad Heiden und sechs weitere Schüler mit einem Preis ausgezeichnet wurden.
«Zu dieser Zeit, im Frühsommer 1913, mietet ein junger Student der Technik aus Wien im Bahnhofsviertel in München ein Zimmer.» So beschrieb rund zwanzig Jahre später der Journalist Konrad Heiden das erste Auftauchen Adolf Hitlers in Deutschland. «Nach dem polizeilichen Melderegister hat Hitler Wien im Mai 1913 verlassen. Bis dahin hatte er in der österreichischen Hauptstadt immer noch vom Verkauf seiner Aquarelle gelebt, wenn auch kümmerlich. In München ging es ihm nicht viel besser; hier zeichnete er Plakatentwürfe für Firmen. Das Dasein ist äußerlich noch einsamer als in Wien, verkrochen und abseits, mitten im Geräusch einer schönen, heiteren Stadt. Hager, kränklich, unfrisch, unsportlich wirkt der 24jährige unter Gleichaltrigen.» Grau in grau habe ein kleines, langweiliges Leben vor ihm gelegen.
Dann, urplötzlich, wird die große Politik zur ganz persönlichen Schicksalsmacht. «Da greift der Himmel ein und läßt für ihn und für so viele andere ausweglose Existenzen den Weltkrieg ausbrechen», schreibt Heiden und zitiert aus Hitlers «Mein Kampf»:
«Der Kampf des Jahres 1914 wurde den Massen, wahrhaftiger Gott, nicht aufgezwungen, sondern vom gesamten Volke selbst begehrt. Mir selber kamen die damaligen Stunden wie eine Erlösung aus den ärgerlichen Empfindungen der Jugend vor. Ich schäme mich auch heute nicht, es zu sagen, daß ich, überwältigt von stürmischer Begeisterung, in die Knie sank und dem Himmel aus übervollem Herzen dankte …»
Konrad Heiden war zum selben Zeitpunkt keineswegs von der Aussicht auf den großen Krieg begeistert. Sein Onkel Oskar musste an die Front und schrieb ihm am 10. Oktober 1914 eine Feldpostkarte. «Lieber Konrad! Nach fast 15stündiger Bahnfahrt bin ich endlich heute nacht hier gelandet; aber es soll noch weitergehen. Hoffentlich geht es Dir gut, was auch bei mir der Fall ist. Ich hätte nicht gedacht, so weit ins Feindesland zu kommen. Viele herzliche Grüße, Oskar Bodenheimer.»
Schon im November 1914 geriet Konrad an seinem Gymnasium in Schwierigkeiten, weil Mitschüler ihn bei ihren Eltern angeschwärzt hatten. Sie berichteten dem Schuldirektor, dass Konrad mehrfach geäußert habe, es wäre am besten, wenn der Kaiser gefangen genommen würde; dann könnte mancherlei anders werden. Daraufhin wandte sich der Direktor brieflich an Konrad Heidens Vater, der sich, wie schon oftmals vorher, auf einer Kur befand.