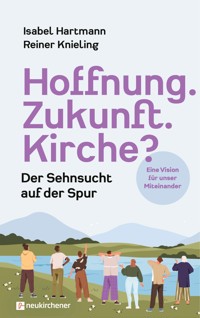
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neukirchener Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kirche hat Zukunft, wo Menschen mit ihren Erfahrungen, ihrer spirituellen Suche und ihrer Sehnsucht nach Verbundenheit und Orientierung ernstgenommen werden. Wo ein neues Miteinander entsteht. Wo Menschen in ihrer Kultur aufleben. Wo sie 'sich aufs Spiel setzt', statt sich um den eigenen Erhalt zu drehen. Isabel Hartmann und Reiner Knieling folgen auf ihrer Suche nach der Zukunft von Kirche der Spur der Sehnsucht. Sie identifizieren die Stärken von Kirche und die Räume, in denen sie wächst und geschätzt wird. Sie ermutigen, sich im Miteinander von Gott beschenken zu lassen. Und sie zeigen Schlüsselkompetenzen, Kraftquellen, Ideen und Tools für Wege in die Zukunft auf. Mit diesem Buch setzen sie Negativ-Schlagzeilen und Zukunftssorgen etwas entgegen: Ermutigungsgeschichten aus der Praxis, realistische Zukunftsvisionen sowie Entlastung und Inspirationen für Kopf, Herz und Hand. Für alle, die an der Zukunft von Kirche und Gemeinde arbeiten wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Hartmann und Reiner KnielingHoffnung. Zukunft. Kirche?
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG zu gewinnen, ist untersagt.
© 2024 Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Grafikbüro Sonnhüter, www.grafikbuero-sonnhueter.de, unter Verwendung eines Bildes © GoodStudio (shutterstock.com)
Lektorat: Hauke Burgarth, Pohlheim
DTP: dtp studio eckart | Jörg Eckart, Frankfurt am Main
Verwendete Schriften: FF Kievit, Heimat Sans
Gesamtherstellung: PPP Pre Print Partner GmbH & Co. KG
ISBN 978-3-7615-7003-6 E-Book
www.neukirchener-verlage.de
In Dankbarkeit gewidmet
den Gefährtinnen und Gefährten
im Netzwerk „Geist und Prozess“
Intro
Wir gehen auf Gutes in der Zukunft zu. Nicht nur auf Gutes. Aber auch. Das ist unsere Überzeugung. Weil wir die Anfänge schon sehen. Weil wir erleben, wie Gutes wächst. Wenn wir es aus dem Blick verlieren, rufen es Gottes Verheißungen wieder in uns hervor: Gutes erwartet uns in der Zukunft. Wir sehen es vor unserem inneren Auge. In diesem Buch erzählen wir davon. Und von den starken Gründen, die es dafür gibt. Wir malen Hoffnungsbilder, die uns inspirieren und Fantasie freisetzen dafür, wie es gehen könnte. Sie machen aufmerksam auf das, was es schon alles gibt. Sie machen neugierig auf das, was wachsen könnte. Und sie machen Mut, der Wirklichkeit in die Augen zu schauen und darin Gott zu suchen und zu finden.
Nicht alles wächst auf fruchtbarem Land. Nicht jeder Samen bringt Frucht. Aber die Verheißung ist: Am Ende wird es genügend fruchtbares Land geben. Und die Ernte wird größer sein als der übliche Ertrag. Das ist der Clou im Gleichnis vom Sämann bzw. vierfachen Ackerfeld (Markusevangelium 4,1–9). Vieles fällt beim Säen auf den Weg, unter die Dornen, auf die Felsen. Das ist im Sinne der Nachhaltigkeit nicht sehr schlau. Das Saatgut war auch vor 2.000 Jahren knapp. Warum wirft der Sämann den Samen scheinbar so wahllos auf ganz unterschiedliche Bodenqualitäten?
So erscheint sein Vorgehen sinnvoll: Noch ist nicht klar, was welcher Boden ist. Das wird sich erst zeigen. Jetzt ist großzügiges Ausstreuen gefragt. Vielleicht sogar ein bisschen Verschwendung. Wo Dornen und wo fruchtbares Land sein werden, wird sich erst erweisen. Bis dahin ist unsere Aufgabe: neugierig sein und aufmerksam hinschauen, wo was wächst. Wo fruchtbar ist, was andere vor uns ausgesät haben oder wir selbst vor einigen Jahren. Säen heißt: Hoffnung verbreiten, Vertrauen kultivieren – auch Gottvertrauen, sich ausrichten auf die Kräfte, die Versöhnung stiften. Das ist unsere Aufgabe. Und das Wissen wachhalten, dass die Liebe stark ist und neu entfacht werden kann. Sinne für das entwickeln, was der Welt guttut, Heil und Heilung wirkt und mit göttlicher Kraft verbindet.
Wir sind gespannt, was dort fruchtbar sein wird, wo wir es erwarten. Und dort, wo wir gar nicht damit rechnen. Wir legen uns nicht zu früh fest in unserem Urteil. Vorerst halten wir unsere „Annahmen in der Schwebe“ (Bohm, Der Dialog, 66). Wo etwas eine Zeit lang gut aufgeblüht ist, kann es auf einmal erstickt werden. Gute Kräfte werden gehindert und überwuchert. Das gilt auch umgekehrt: Wo gerade so viel Hartes ist, Dornen und Disteln, Böses und Feindseliges, auch dort kann sich Gottes Keimkraft irgendwann durchsetzen und Wunden heilen lassen, Feindschaften überwinden, Böses entmachten, Zerstörung verwandeln …
Noch etwas steckt in der Jesus-Geschichte von den unterschiedlichen Bodenarten: Der Ertrag wird 30- bis 100-fach sein, heißt es darin. Das liegt deutlich über dem, was damals zu erwarten war (nämlich 10- bis 30-fach). Aber es ist auch nicht das 10.000-Fache, womit einige für das Ende der Zeiten gerechnet haben. Die Botschaft ist schlicht: Es wird genug sein. Für die nächste Generation und die übernächste und die überübernächste.
In diesem Sinne sind die Hoffnungsbilder in diesem Buch gegenwärtig und zukünftig, realistisch und visionär zugleich, denn vieles wächst schon in der Gegenwart und geht auf die Fruchtbarkeit früherer Arbeit zurück. Anderes wird jetzt ausgesät und in Zukunft Frucht bringen. Wir schauen, wie es groß werden könnte, und lassen uns nicht vom Blick auf trockenen Boden, Gestrüpp und verhärtete Wirklichkeiten irritieren. Für diese Buchlänge halten wir Ausschau nach dem, was wachsen will und Früchte bringt. Wir beschreiben, wie der fruchtbare Boden beschaffen ist, auf dem es wachsen kann, auch wenn wir nicht wissen, wo er überall sein wird und wie die Früchte am Ende genau aussehen. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, sich mit Hoffnungsbildern zu nähren. Sonst geben wir den Befürchtungen zu viel Macht.
Manche Hoffnungsbilder werden Ihnen aus Ihrem eigenen Umfeld bekannt vorkommen: Ach ja, so etwas gibt es doch bei uns im Stadtteil auch. Oder in unserer Gemeinde. Wunderbar, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie in Ihrem Engagement bestärkt werden. Oder Sie werden erinnert, dass Sie in Ihrem Verein oder einer Initiative etwas Ähnliches erleben.
Das Buch lädt ein, neugierig zu sein für all das, was in eine gute Zukunft führt und was in der Verbundenheit mit anderen richtig kraftvoll ist. Lassen Sie sich locken, aufmerksam wahrzunehmen, wo überall Potenzial für ein gutes Miteinander drinsteckt, und die Kraftquellen wieder zu entdecken, aus denen wir alle leben. Das ist schon viel. Vielleicht haben Sie Lust, beim Lesen eigene Zukunftsbilder aufsteigen zu lassen, die Sie und andere beflügeln. „Auf der einen Seite ist schon mehr da, als man meint. Auf der anderen Seite ist mehr möglich, als sich jetzt abzeichnet“, so brachte ein Freund auf den Punkt, worum es uns geht.
Hoffnung ist lebendig, ansteckend, ermutigend. Sie ist aber auch gefährdet, wenn sie überstrapaziert wird. Wenn Menschen den Eindruck haben, sie würden wieder und wieder vertröstet. Auch die Hoffnung von Menschen kann von anderen missbraucht werden, um an den Zuständen nichts ändern zu müssen. Weil das so ist, braucht Hoffnung Schutz und eine Quelle, aus der sie schöpfen kann und erneuert wird. Für uns ist die Sehnsucht eine Brücke zur Quelle. Wenn wir uns auf die Sehnsuchtsspur begeben, nehmen wir auf, was viele bewegt, mit denen wir in den letzten Jahren unterwegs waren: Was sie im Herzen tragen, wonach sie sich ausstrecken, was sie sich so sehr wünschen. Sehnsucht weitet die Seele und öffnet für den Himmel. Manchmal aber tut sie auch weh. Weil wir spüren, was wir vermissen, zweifeln, ob das überhaupt möglich ist, was wir uns wünschen. Der Sehnsucht folgen, heißt den Schmerz nicht zu vermeiden. In der Regel wird er kleiner, wenn wir ihn zulassen. Und das andere taucht auf: Was werden könnte; womit ich beschenkt werden könnte, auch wenn es anders ist, als ich es mir im Moment vorstelle.
Wir setzen in diesem Buch voraus, dass die Sehnsucht eine eigene Kraft hat. Schon in der Sehnsucht ist Gott gegenwärtig, nicht erst in der Erfüllung. „Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?“, fragt Nelly Sachs in ihrem Gedicht „Alles beginnt mit der Sehnsucht“. So oft haben wir schon die Erfahrung gemacht, wenn sich Menschen in einem Gremium oder Team gegenseitig von der Sehnsucht im eigenen Engagement erzählen, wächst nicht nur die Verbundenheit, sondern auch die Offenheit für bisher nicht Gedachtes, für Ideen, die einfach geschenkt werden, für kreative Prozesse.
In den vergangenen Jahren haben wir viel erlebt mit Menschen in Entwicklungsprozessen in Gemeinden, Kirchen und Organisationen und viel Wertvolles von und mit ihnen gelernt. Ohne sie wäre dieses Buch nicht möglich, weil sie uns durch ihr Beispiel und ihre Begeisterung versichern: Es ist möglich, in komplexen Situationen in einem guten Geist voranzugehen und kraftvoll zu handeln. Sie teilen unsere Vision von einer guten Zukunft und wollen wie wir Teil der Lösung sein. Augen und Ohren, Herzen und Sinne offenhalten für das, was sich positiv entwickeln könnte, ist gesellschaftlich und kirchlich gleichermaßen wichtig. Und es führt immer wieder zu überraschenden Entdeckungen.
Wir selbst schreiben aus der Perspektive der evangelischen Kirche und wissen uns verbunden mit vielen aus der römisch-katholischen Kirche und aus Freikirchen, die ähnliche Hoffnungsbilder entwickeln.
Wer Lust hat, kann das Buch gerne gemeinsam mit anderen lesen oder diskutieren. Im Kirchenvorstand oder Presbyterium, im Pfarrgemeinderat oder Leitungsteam, im Gesprächskreis oder mit Freundinnen und Freunden. Wenn die Hoffnungsbilder und Sehnsuchtsimpulse in anregende Diskussionen führen und eigene Ideen für die Zukunft entstehen lassen, hat es seinen Sinn erfüllt. Die Impulse am Ende der einzelnen Kapitel sind auch dafür gedacht.
Emskirchen, Ostern 2024
Isabel Hartmann und Reiner Knieling
1. Hier ist es gut.Hier kann ich sein
Kirchen sind attraktiv, weil Menschen in ihrer Kultur aufleben. Das haben Menschen immer erlebt. Aber es gibt eben auch das andere: das Klebrige, die Anpassung, Harmoniedruck und Unfreiheit. Die Schlagzeilen vergangener Jahre haben den Finger in diese Kirchenwunde gelegt. Verantwortliche können nicht länger darüber hinwegsehen. Wahrhaftigkeit wächst. Natürlich nicht von heute auf morgen und natürlich nicht vollständig und überall. Aber die kirchlichen Orte, die Menschen aufrichten, kommen auch gesellschaftlich wieder neu in den Blick. Die Engagierten, Ehren- und Hauptamtliche aus den Kirchen werden freier, sich persönlich zu zeigen. Sie reden mutiger davon, was ihnen im Herzen wichtig ist und wofür sie stehen.
Für all das gilt, was wir im Intro beschrieben haben: Manchmal ist es keimhaft vorhanden, an anderen Stellen deutlich sichtbar, und wir vertrauen darauf, dass es wächst. Wir zeichnen Hoffnungsbilder: gegenwärtig und zukünftig, realistisch und visionär zugleich.
Konsequent von Menschen, ihrer Sehnsucht und ihren Ressourcen ausgehen
„Die Kirche ist um der Menschen willen gemacht und nicht die Menschen um der Kirche willen“, könnte man sagen. Frei nach dem Wort von Jesus: „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen.“ (Markusevangelium 2,27)
Ist das nicht selbstverständlich? Muss das ausdrücklich gesagt werden? Ist es nicht klar, dass die Kirche den Menschen dient? Natürlich ist das klar, aber es war irgendwie in Vergessenheit geraten. Manche Diskussionen, Entscheidungen und Priorisierungen haben den Eindruck erweckt, als ob es der Kirche vor allem um sich selbst ginge, um den eigenen Erhalt, um Überleben und Bestandssicherung. Das tut ihr genauso wenig gut wie anderen Institutionen, politischen Parteien, Gewerkschaften etc. In dieser Hinsicht teilen sie ihr Schicksal.
Warum sind wir eigentlich da? Und wozu? Diese Fragen werden immer dringlicher gestellt. Sie helfen, andere Blickwinkel einzunehmen, Dinge zu sehen, die aus dem Blick geraten waren, auszubrechen aus dem Kreisen um sich selbst: „Die Kirche ist um der Menschen willen gemacht und nicht die Menschen um der Kirche willen.“
Was ist, wenn wir konsequent von Menschen, ihrer Sehnsucht und ihren Ressourcen ausgehen? Diese Frage wird zu einer Leitfrage in Veränderungsprozessen, für die Kultur in Leitungsgremien, bei neu gewählten Kirchenvorständen und Presbyterien: Was brauchen die Menschen? Welche Kraft steckt in ihrer Sehnsucht? Was tut ihnen gut? Welche Ressourcen sind da? Welche schlummern im Verborgenen? Wie schaffen wir Orte, die Menschen guttun und sie aufrichten? Wo ihnen das begegnet, wonach sie sich in ihrem Engagement sehnen. Und wo sie sich weiterentwickeln können.
Verbunden damit ist die Einsicht: Wir können nur mit den Menschen arbeiten, die es tatsächlich gibt. Die Lust haben mitzumachen und die dabei sein wollen. Andere sind nicht da. Auch das ist eigentlich selbstverständlich. Warum wurde es nicht viel früher zum Kriterium gemacht? Dafür mag es viele Gründe geben. Einer ist, dass der eigene Anspruch hoch ist und die Idealbilder stark sind: „Wir müssen das, was wichtig ist, doch mit den 50 schaffen, die verblieben sind. Auch wenn wir vorher 100 waren. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir sollten doch zumindest versuchen, es auch mit weniger Geld und Menschen zu schaffen.“ Idealbilder haben eine große Kraft und helfen, Gutes in die Welt zu bringen. Ohne Idealismus würde es vieles nicht geben: Rettungsdienste und Hilfsorganisationen, bürgerschaftliches Engagement und Gemeindeleben. Dass Idealbilder eine Kehrseite haben, ist seit Jahrzehnten bekannt: Menschen lassen sich auslaugen, Helfer können hilflos werden. Das wird immer offensichtlicher. Erschöpfung und Krankenstand steigen. Das belastet diejenigen zusätzlich, die noch da sind. So fragen soziale Einrichtungen und Kirchen verstärkt: Wie können wir unser Miteinander, unsere Kultur so verändern, dass uns unsere Ideale am Ende nicht schwächen oder gar kaputt machen? Wie können wir das Gute darin schützen? Und die Lust und die Kraft stärken, sich dafür einzusetzen? Kurz, wie können wir mit den 50 das schaffen, was 50 Menschen gut schaffen können?
Wie entsteht eine positive Kultur, in der Menschen gesund bleiben?, ist zu einer der Hauptfragen geworden. Weil sich die Einsicht durchsetzt: Nur in einer guten Kultur werden Menschen gerne mitmachen. Wir brauchen eine gute Kultur, um das tun zu können, was uns wichtig ist.
Mit dem Gespür für die eigenen Idealbilder und ihre Schattenseiten ist noch eine Einsicht gewachsen: Wer vom Ideal ausgeht, spürt immer den Abstand zur Situation vor Ort.
Diese Lücke konnte schon in den Jahren mit gefüllten Kassen nicht geschlossen werden. Aber damals konnte man sich noch einreden, dass es gehen könnte. In Zeiten zurückgehender Zahlen (Mitarbeiter/-innen, Finanzen, Gebäude) wird die Lücke offensichtlich. Das schmerzt. Menschen fangen an, dies zu realisieren. Sie suchen Vertrauensräume und geschützte Gespräche, in denen der Schmerz Platz hat. Menschen erleben, wie sich so etwas wandeln kann und sich langsam der Weg zu etwas Neuem öffnet. Es entsteht die Freiheit, zu hohe Ansprüche loszulassen und sich auf das Mögliche zu konzentrieren. Die Ausstrahlung wächst wieder. Menschen bekommen mehr Lust, sich einzusetzen und werden entschiedener, was sie tun und was sie lassen, und Langzeiterkrankungen fangen an, wieder abzunehmen.
Vielen hilft, statt der Idealbilder ihre Sehnsucht zu kultivieren. Manche sagen, sie hätten einen Schalter von den Idealbildern hin zur Sehnsucht umgelegt. Für viele ist die Sehnsucht mehr mit dem eigenen Herzen und der eigenen Energie verbunden als mit Idealbildern. Dort wird natürlich auch spürbar, was noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Aber die Lücke fühlt sich anders an als bei Idealbildern. Manchmal ist der Schmerz sogar heftiger und unmittelbarer, aber so kann er sich lösen. Und Menschen finden in ihre Kraft. Im Rückblick sagte eine: „In meinem Herzen kann ich mir nicht so lange etwas vormachen. Da spüre ich schneller, wo meine Kraft wirklich hingeht oder ob ich mich von meinem Idealbild unter Druck setzen lasse.“ Impulse, wie Sie Ihrer Sehnsucht auf die Spur kommen und sie in Ihre Arbeit im Team und Gremium einfließen lassen können, finden Sie in Kapitel 6.
Hoffnungsorte
Die Kultur, die von Menschen, ihren Ressourcen und ihrer Sehnsucht genährt wird, wächst. Und die Aufmerksamkeit dafür steigt. Das bedeutet, dass andere Fragen mit einem neuen Vorzeichen diskutiert werden, zum Beispiel, wie die Formen aussehen können, in denen wir Kirche leben. Es geht nicht mehr um alte versus neue Lieder, nicht mehr um traditionelle versus moderne Gottesdienste, um präsentisch versus digital etc. Es geht um die Frage: Wie gestalten wir das, was wir machen, so, dass davon eine Kraft ausgeht? Dass Menschen erleben, wie ihre Sehnsucht Raum hat und ihre Hoffnung Nahrung bekommt, dass sie im Miteinander Kraft schöpfen für das, was im Alltag zu bewältigen ist, dass sie sich gegenseitig den Rücken stärken für ihr zivilgesellschaftliches Engagement, dass sie getröstet werden, wo es nötig ist und sie miteinander feiern, was gelungen ist.
Kirchengebäude sind Kraftorte: Menschen lassen in der Stille und im Gebet los, was sie bedrückt. Sie schöpfen neue Kraft in der Verbindung mit den vielen, die dort schon gebetet und sich auf das göttliche Geheimnis ausgerichtet haben. In Städten und an Pilgerwegen werden Kirchen als besondere Orte der Besinnung fernab vom Alltag genutzt und geschätzt.
Gottesdienste sind Hoffnungsorte. Sie finden in Kirchen und an vielen anderen Orten statt: in sozialen Einrichtungen wie Kliniken, Seniorenheimen, unter freiem Himmel, auf zentralen Plätzen und in der Natur. In traditionellen und modernen Formen. Was gibt Kraft?, ist zu einer wesentlichen Frage in der Gestaltung geworden. Was richtet auf? Was macht Mut, sich gesellschaftlich einzubringen, wie kann manchmal auch Energie entfacht werden für gewaltfreien Widerstand? Gemeinden sind dankbar, nicht mehr so viele Appelle, was zu tun ist, von den Kanzeln zu hören. Verkündiger/-innen auch, weil es ihnen selbst guttut, von dem zu reden, was uns versöhnt mit der begrenzten Kraft, die wir haben. Und dadurch empfänglich macht für alles, was geschenkt wird und Hoffnung und Zuversicht wachsen lässt.
Gemeinden entwickeln unterschiedliche Profile. Bei manchen stehen die Gottesdienste im Mittelpunkt. Menschen kommen und beten, singen und hören. Und die Gemeinschaft ist wichtig. Vorher da sein oder nachher noch zusammenstehen, mancherorts sogar miteinander essen. Gottesdienste werden von Ehren- und Hauptamtlichen gestaltet. Es ist ein gutes Miteinander gewachsen. Theologisches Denken, Menschenkenntnis, Gespür für Sorgen und Nöte, für Sehnsüchte und Hoffnungen, Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern spielen auf gute Weise zusammen. Und alle Beteiligten profitieren von dem Miteinander, auch weil klar ist, dass das, worum es eigentlich geht, nicht aus uns Menschen kommt. Es wird uns geschenkt; es geht um die Quelle, der wir uns verdanken. Wir lassen uns füllen mit einer Hoffnung, die wir nicht „machen“ können. Wir strecken uns aus nach Versöhnungskraft, die uns auch dann finden kann, wenn sich unser Herz verschlossen hat. Der trockene Boden in der eigenen Seele hat wieder Platz, kann sich ausstrecken nach Gott. Dessen Versprechen ist: „Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre.“ (Jesaja 44,3)
Andere Gemeinden sind mehr durch verschiedene Gruppen und Aktivitäten geprägt: Jugendarbeit, Kinder- und Familienarbeit, Männertreffs und Frauengruppen, Seniorentreffs, und generationenübergreifende Formen, zum Beispiel Senioren und Jugendliche gemeinsam.
Manchen ist die LGBTQ-Community ein besonderes Anliegen. Oder Menschen finden sich für bestimmte Aktivitäten, Sport, Ausflüge oder Reisen zusammen. Auch hier stellt sich immer häufiger die Frage: Was unterstützt uns auf unserer Lebensreise? Was lockt uns in die Zukunft? Wie werden wir durch die göttliche Quelle beschenkt? Wie kommt das in die Welt, was wir als gut erkannt haben?
Gottesdienste haben selbstverständlich ihren Platz in den unterschiedlichen Formen kirchlicher Arbeit gefunden: in Gemeinden, Einkehrzentren und Tagungshäusern, in sozialem Engagement und in der Bildungsarbeit. Schon längst geschieht nicht mehr alles an jedem Ort. Daran gewöhnen sich die meisten, weil sich neben dem Rückgang an Veranstaltungen auch klarer abzeichnet, welche Angebote wo zu finden sind. Das eine bei uns im Ort, das andere ein paar Kilometer weiter. Wieder anderes auf regionaler Ebene. Der Rückgang ist auch deshalb besser zu verschmerzen, weil der Mehrwert von Kirche wieder deutlicher ist. Mit der Profilierung der Angebote ist klar, wo ich eine gute Adresse für dieses oder jenes Anliegen finde. Und wenn Menschen Kirchen, Gruppen, Tagungen als Orte erleben, die der Seele und dem Herzen guttun, spricht sich das herum. Auch Menschen, die Kirche längst abgeschrieben hatten, wagen wieder, diese Gemeinschaft für Projekte, punktuelles Engagement oder Solidarität in den gesellschaftlichen Anliegen zu suchen. Und Menschen, die sich bisher nicht vorstellen konnten, dass etwas anderes als ihr vertrauter Gottesdienst gut sein könnte, lassen sich auf neue Formen ein. All das geschieht nicht von heute auf morgen und nicht als Massenbewegung, aber doch mit dem Gefühl: So kann es gehen. So wird weiter Gutes werden. Kraftvolles Miteinander hat Ausstrahlung.
Eine Kultur, die heilsame Potenziale zur Entfaltung bringt
„Die Kirche ist um der Menschen willen gemacht und nicht die Menschen um der Kirche willen.“ Das bedeutet auch, dass sie vom Engagement der Menschen lebt. Menschen spüren: Das ist gut so für mich und für andere. Es überfordert mich nicht, weil nicht Wenige alles machen. Das Engagement ist viel breiter geworden. „Wir geben, was wir können, und bitten um das, was wir brauchen“, ist ursprünglich ein Grundsatz für gute Gespräche in der Gruppe. Mehr und mehr wird es zur Haltung der Beteiligten und verbreitet sich. Weil Menschen erleben, wie gesund es ist, zu geben – und sich zu begrenzen.
Das, wofür Menschen sich einsetzen, wo sie mitmachen etc., das lebt. Anderes liegt auch mal brach. Wenn zum Beispiel gerade niemand für Jugendarbeit da ist, kann sie nicht gemacht werden. Sie geschieht an anderen Orten oder bei anderen Trägern. Und vielleicht finden sich irgendwann wieder Menschen, die sich dafür einsetzen. Das gilt auch für viele andere Bereiche. Die „Grundversorgung“, die Begleitung in wesentlichen Lebensveränderungen, die Kasualien werden weiterhin durch die Gesamtkirchen gewährleistet. Verschiedene Landeskirchen finden dafür unterschiedliche Wege.
Eine Kirche, die die Menschen ernst nimmt, lebt von deren Engagement, Einsatz und Bereitschaft. Menschen übernehmen Verantwortung. Für die gemeinsame Musik zum Beispiel im Chor oder Streichorchester, im Posaunenchor, in der Brassband oder im Lobpreisteam. Menschen haben Spaß am gemeinsamen Musizieren und das kommt rüber in ihrer Musik.
Menschen übernehmen Verantwortung für das, was ihnen wichtig ist: für das Mittagessen, das gelegentlich nach dem Gottesdienst angeboten und gerne angenommen wird. Für einen Treffpunkt im Stadtteil, um Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen.
An einem Ort starten zwei Menschen eine Renovierungstruppe für „das, was immer liegenbleibt“. Sie haben ihren guten Draht zu Jugendlichen genutzt, um sie dafür zu gewinnen. Sie renovieren bei Menschen, die sich keine Handwerker leisten können. Dabei gibt es viele Gespräche zu den 1.000 Fragen, die es auf dem Weg ins Erwachsensein gibt. Besonders beliebt ist das Feiern zum Abschluss jeder Aktion.
Bei all diesen Formen von Gemeindeleben arbeiten Kirchenmitglieder häufig mit anderen Menschen zusammen. Einfach, weil auch Ausgetretene oder Menschen, die nie Mitglied einer Kirche waren, solches Engagement schätzen. Das ist nicht nur in Kirchbauvereinen im Osten Deutschlands der Fall. Das geschieht genauso in der Flüchtlingshilfe, der örtlichen Tafel, der Hausaufgabenbetreuung. Und selbst bei Gottesdiensten sind manche nicht in Kirche verwurzelte Menschen bereit, mitzudenken und mitzutun. Weil sie neugierig sind auf christliche Rituale in ihrer spirituellen Suche. Manches haben sie schon gefunden. Anderes vermissen sie noch. Jemand aus dem Humanistischen Verband sagt: „Ich habe fast alles, was ihr habt, auch woanders erlebt. Manchmal viel konsequenter als bei euch. Aber eines finde ich besonders bei euch: die Wärme und den Trost.“ Auch geflüchtete Menschen machen mit, weil sie sagen: „Jetzt bin ich in einer christlichen Umgebung. Jetzt will ich auch genauer wissen, was das ist.“
Wo auch immer diese verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, profitieren alle. „Kirche mit anderen“ wird selbstverständlich gelebt, wobei es meistens nicht so bezeichnet wird. Christinnen und Christen sind selbstverständlich mit anderen im Austausch über ihre religiösen Erfahrungen oder ihre Sehnsucht, über ihre spirituellen Reisen und Suchbewegungen, auch über die Gründe für die Ablehnung verfasster Religion, ihre Zweifel an Gott … Christinnen und Christen teilen ihre Erfahrungen und werden durch andere bereichert. Das Miteinander derer, denen es um eine gute Kultur und um gute Lösungen für die Zukunft geht, ist wieder selbstverständlicher geworden.
Dabei wächst auch die Einsicht für das, was die westlichen Gesellschaften den christlichen Wurzeln verdanken, auch wenn es in der Zeit der Aufklärung gegen die damals vorhandenen kirchlichen Strukturen neu zur Geltung gebracht werden musste:





























