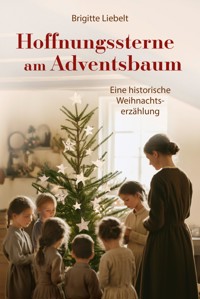
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Erzählung führt die Leser in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die 17-jährige Anna ist erst ein paar Wochen zur Ausbildung in der von Theodor Fliedner gegründeten Diakonissenanstalt Kaiserswerth, als dort eine neue Tradition eingeführt wird: der Adventsbaum. An jedem Tag der Adventszeit werden Verheißungen aus dem Alten Testament, die auf das Kommen eines Retters hinweisen, auf kleine Papiersterne geschrieben und – zusammen mit einer Kerze – in einen zunächst kahlen Baum gehängt. Dieser verwandelt sich auf diese Weise bis zum Weihnachtsfest in einen hell erleuchteten und fertig geschmückten Christbaum. Anna erlebt gemeinsam mit den Waisenkindern, die sie betreut, eine intensive Adventszeit und versteht zum ersten Mal in ihren Leben, was Weihnachten wirklich bedeutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Liebelt
Hoffnungssterne am Adventsbaum
Eine historische Weihnachtserzählung
Über die Autorin
Brigitte Liebelt ist ausgebildete Diplom-Bibliothekarin und Krankenschwester. Seit über 30 Jahren engagiert sich die sechsfache Mutter und Pastorenfrau ehrenamtlich in verschiedenen Arbeitszweigen ihrer Gemeinde und bei Frauenfrühstückstreffen. Sie lebt in Villingen-Schwenningen. Nach „Im Dienst der Hoffnung“ und „Die Vikarin“ ist „Hoffnungssterne am Adventsbaum“ das dritte Werk der Autorin.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Die zitierten Bibelverse sind folgender Bibelausgabe entnommen:
Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Copyright © 2025 Gerth Medien in der SCM Verlagsgruppe GmbH,
Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar
Erschienen im September 2025
ISBN 978-3-96122-719-8
Umschlaggestaltung: Hanni Plato
Umschlagmotiv: Gert Wagner unter Verwendung von bildgebenden Generatoren
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
www.gerth.de
Den Menschen gewidmet, die ihre Liebe, Kraft und Zeit in Kinder investieren!
Eigentlich war es die Kartoffelfäule, die im Sommer 1846 entscheidende Weichen in Annas Leben stellte. Schon in den letzten Jahren war die Ernte immer schlechter ausgefallen als erwartet, sodass ihre Mutter sich gezwungen sah, zusätzlich zur der kleinen Landwirtschaft Heimarbeit anzunehmen. Da Anna in diesem Jahr die Schule beendet hatte, war ihre Mithilfe dabei von vornherein eingeplant.
Während ihre Mutter sich nach der morgendlichen Stallarbeit an die Nähmaschine setzte, um mit ihrem Handrad endlose Nähte herunterzurattern, hastete Anna durch die notwendigste Hausarbeit. Anschließend widmete sie sich ihrem Anteil an der Arbeit. Dieser bestand aus unzähligen Kleinigkeiten, die mit der Hand genäht werden mussten. Der Stapel, der jeweils auf der Tischecke bereitlag, schien kaum kleiner zu werden. Sie hockte an dem kleinen Fenster, wo das meiste Licht hereinkam, und fasste Knopflöcher mit winzigen Stichen ein, bis ihre Augen tränten. Außerdem nähte sie Knöpfe an und säumte Meter für Meter.
Nebenher versuchte sie, die über den Tag anfallenden Arbeiten in Haus und Garten zu erledigen. Das gelang ihr mitunter so einigermaßen. Aber an den meisten Tagen war sie eben nicht fertig, wenn sie es hätte sein sollen – die Spätzle wurden zäh und hart oder sie kam mit der Wäsche nicht hinterher. Mutter schimpfte, bis Anna immun dagegen wurde, aber je ungeduldiger sie wurde, umso lockerer war ihr Handgelenk, und dem konnte Anna nicht aus dem Weg gehen.
Ihr Vater schlug sich von früh bis spät mit dem Boden herum, der doch die Ernte nicht geben wollte. Darüber hinaus arbeitete er für die Großbauern als Tagelöhner. Es war schon dunkel draußen, wenn er völlig erschöpft nach Hause kam, in verschwitzten, schmutzigen Kleidern, Erdklumpen unter den Stiefeln, hungrig, durstig und frustriert. Dass er dann nur noch seine Ruhe haben wollte, konnte Anna verstehen. Und auch sie hätte gerne etwas anderes gegessen als Spätzle und Gemüse, sieben Tage die Woche. Sie sah selbst, was alles liegen blieb: Die Fenster waren fast blind, der Herd ganz verrußt, und der Staub auf den Regalbrettern bildete eine schmierige Schicht. Es war kein gemütliches Heim.
Aber das war nicht das Schlimmste. Es war ein Haus, aus dem gute Worte, Lachen und Liebe verschwunden zu sein schienen, und sie hätte nicht einmal sagen können, seit wann. Hatte es das alles überhaupt jemals gegeben? Es verbitterte sie, dass ihre Eltern nicht erkannten, dass sie sich wirklich Mühe gab, alles zu schaffen. Rackerte sie sich nicht ebenso ab wie sie, vom Morgen bis zum Abend? Früher waren wenigstens ihre großen Geschwister noch da gewesen. Nun konnten sie ihr nicht mehr beistehen. Sie waren beide bereits verheiratet, wohnten seither im Nachbarort, hatten kleine Kinder und ihre eigenen Sorgen.
Es wäre nicht auszuhalten gewesen, wenn da nicht Paul gewesen wäre – Paul, der Nachbarsjunge, der ihr bester Freund war, solange sie denken konnte. Als sie klein waren, hatten sie zusammen im Sand gespielt. Sie hatten sich gezankt und wieder vertragen, waren jeden Morgen gemeinsam zur Schule gelaufen und waren an langen Sommerabenden mit den Nachbarskindern unterwegs gewesen. Anna hatte immer gewusst, dass sie Paul heiraten wollte, sobald sie groß genug waren. Letzten Sommer hatte er sie zum ersten Mal hinter dem Stall geküsst, als er sie nach dem Dorffest heimbrachte. Sie war außer sich gewesen vor Seligkeit. Dass er ausgerechnet sie wollte! Wenn sie in den Spiegel sah, konnte sie nur Durchschnitt erkennen: die Haare zwischen blond und braun und einfach nur langweilig glatt, graue Augen. Sie war weder groß gewachsen noch auffallend klein zu nennen, schmal, ein Mädchen, das jedermann leicht übersah. Anna hatte sich daran gewöhnt.
Aber Paul! Paul mit seinen braunen Locken, die ihm eigenwillig in die Stirn fielen, egal wie er sie zu kämmen versuchte, Paul mit den funkelnden dunklen Augen. Paul war etwas Besonderes. Und was Anna am meisten an ihm liebte: Mit Paul konnte sie reden. Er wusste so viel und dachte über alle möglichen Dinge nach. Wenn sie dagegen mit ihrem Vater reden wollte, brummte er nur und sagte, er habe den Kopf voll und sie solle lieber das Geschirr spülen.
Pauls Kindheit und Jugend waren alles andere als leicht gewesen: Er war ohne Vater aufgewachsen und seine Mutter, die sich als Dienstmagd bei den verschiedensten Höfen durchgeschlagen hatte, war schon vor einigen Jahren gestorben. Vielleicht war er deshalb so selbstständig, weil er immer gewusst hatte, dass er auf niemanden sonst zählen konnte.
Paul war es auch, der Anna erzählte, wie es zu der großen Not gekommen war. Schon vor 30 Jahren, als ihre Eltern selbst noch Kinder gewesen waren, hatte es dieses furchtbare Jahr ohne Sommer gegeben. Die Sonne zeigte sich nicht. Woche für Woche zogen schwere Unwetter über das Land. Es regnete und stürmte. Im Juli gab es auf der Schwäbischen Alb sogar Schnee. Die Ernte fiel fast vollständig aus: kein Obst, kein Getreide, kein Wein. Dabei waren die Menschen doch schon gebeutelt genug durch die Kriegswirren. Auch die letzten Ernten waren bereits weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Napoleons Kriege hatten das Land ausgelaugt. Die französischen Herrscher vor Ort hatten das Königreich Württemberg ebenso hemmungslos ausgebeutet wie das benachbarte Großherzogtum Baden.
Die Franzosen waren nun endlich fort, aber es gab keine Entspannung. Die Getreidepreise kletterten in schwindelerregende Höhen. Es gab mehr Todesfälle als Neugeborene. Das Vieh fand keine Nahrung mehr. Den Besitzern blieb keine andere Wahl als ihre kostbaren Tiere notzuschlachten, um wenigstens noch das Fleisch verbrauchen oder zu Geld machen zu können. Auch Vater hatte manchmal von Brot aus Stroh und Baumrinde gesprochen, wenn sie das widerliche Queckenbrot aßen, das Anna nur hinunterbekam, weil ihr Magen so knurrte.
Die Menschen hier auf dem Land suchten verzweifelt nach einer Erklärung für all die nicht endende Not. Es musste eine Strafe Gottes sein! Paul wusste es besser: Am anderen Ende der Welt war im Jahr zuvor, 1815, ein Vulkan ausgebrochen und hatte, zusammen mit seinem Gefolge von Feuer, Tsunami und Seuchen, fast 300 000 Menschen in diesem fernen Teil der Erde das Leben gekostet. Die Schwefelwolken zogen rings um den Erdball und ließen das Sonnenlicht nicht durch. Dadurch war das Wetter in vielen Ländern völlig aus den Fugen geraten. Folglich nahm die Teuerung in Württemberg immer mehr zu. Viele Menschen hatten all ihr Hab und Gut verloren. Die aussichtslose Lage schürte Hass und Gewalt. So kam es zu Plünderungen und Ausschreitungen gegen die „Kornjuden“, denen man vorwarf, das Getreide zu horten. Daneben bevölkerten Scharen von hungrigen Bettlern die Städte. Man erzählte sich von den Unruhen in den Großstädten, in Berlin und auch bei ihnen im Süden, in Stuttgart. Menschen sammelten sich und protestierten dagegen, dass die Lebensmittel, die ihnen auf dem Teller fehlten, für gutes Geld ins Ausland verkauft wurden. Und dass die doch ohnehin viel zu knappe Kartoffelernte in den Schnapsbrennereien landete anstatt in ihrem Keller.
Daneben gab es auch die Klugen, die nach tieferliegenden Ursachen forschten und eine politische Veränderung forderten. Nach dem Vorbild der Revolution in Paris gingen sie für Meinungs- und Pressefreiheit auf die Straßen. Auch von solchen Demonstrationen erzählte Paul Anna bei ihren abendlichen Spaziergängen durch die Felder, nachdem sie sich in der Dunkelheit heimlich aus dem Haus gestohlen hatte. Er sprach über die Freidenker mit Leidenschaft, ja mit Enthusiasmus.
„Es soll sogar Frauen geben, die mitmachen“, erzählte er Anna, „sie tragen Männerkleidung, rauchen Pfeife und trinken Bier in den Lokalen, in denen sie sich treffen. Und dann diskutieren sie wie die Männer.“
Anna ließ das hingegen völlig kalt. „Die haben Sorgen“, sagte sie verächtlich, „wenn es erst mal für das tägliche Brot reicht!“ Paul kratzte sich am Kopf. „Du musst weiter denken, Anna“, ermutigte er sie, und Anna dachte daran, dass er schon immer weiter gesehen hatte als sie, dass Vater ihn aber als Spinner und Tagträumer abtun würde. „Die da oben machen mit uns, was sie wollen. Wir schuften und schuften und bringen es ein Leben lang zu nichts. Wir müssen mitreden können, damit es besser für alle wird.“ Er machte eine weit ausholende Handbewegung, die alles um sie herum mit einschloss: die ärmlichen Gehöfte, die schmalen Äcker und sie selbst in ihren abgetragenen und geflickten Kleidern. Anna hatte überhaupt keine Lust, sich nach dem langen Arbeitstag noch mit Politik zu befassen. Ihre Augen brannten vor Müdigkeit und ihr Rücken fühlte sich an, als würde er gleich durchbrechen. Sie griff nach Pauls Hand und er legte den Arm um sie. Sie schmiegte sich an ihn. „So müsste es immer sein“, flüsterte sie, „nur wir beide.“ Sie hob ihr Gesicht und er küsste sie zärtlich. Doch dann drehte er sie plötzlich mit einem Ruck zu sich um, sodass sie erschrak.
„Anna! Wir können es tun. So viele Menschen versuchen ihr Glück in Amerika. Wir könnten auswandern, wir beide, nur du und ich. Wir bauen uns dort ein besseres Leben auf!“ Annas Herz schlug zum Zerspringen. Wir beide … Davon hatte sie geträumt. Das war es, was sie wollte. Aber … „Das ist nicht dein Ernst, Paul! Wie sollen wir denn dahin kommen?“ Er ließ sie los und schwang sich auf einen Zaun am Wegrand. Sie sah zu ihm auf. Sein Hemd war am Kragen zerrissen und seine Stiefel so schmutzig wie die ihres Vaters, aber seine Augen glänzten. Er reckte sein Kinn und hielt den Kopf erhoben – ein Mann, der sein Leben in die Hand nahm und nicht bereit war aufzugeben. Er wischte ihre Bedenken weg. „Wir schaffen das. Ich lege jede Woche Geld zur Seite, bis wir genug haben für die Postkutsche. Es gehen auch manche zu Fuß bis nach Bremerhaven! Mach dir keine Sorgen. Irgendwie kommen wir schon bis dorthin. Wir sind doch jung! Dort suchen wir uns Arbeit und wenn es für die Fahrkarte nach New York reicht, geht’s los.“ Anna schüttelte den Kopf. „Du sagst das, als sei das so einfach. Was ist mit der Auswandereragentur? Du bist noch militärpflichtig, Paul, das weißt du doch. Wie willst du an einen Reisepass kommen?“ „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir gehen einfach. Den Pass können wir in Bremerhaven beantragen, wenn wir dort gearbeitet haben.“ Er wandte ihr sein Gesicht zu und trotz der hereinbrechenden Dunkelheit konnte sie ihm ansehen, dass sein kühner Entschluss seit langem gereift war und feststand. Er würde sich nicht beirren lassen. „Und die Eltern? Mein Vater erlaubt mir das nie und nimmer.“ Paul ließ keine Einwände gelten. „Er wird. Er muss. Wenn ich das Geld zusammenhabe.“
Nach diesem Abend war die Auswanderung nach Amerika, ins gelobte Land, ihr gemeinsamer Traum. Gustav, ein alter Bekannter aus Vaihingen an der Enz und nur ein paar Jahre älter als Paul und sie, hatte es bereits geschafft. Er war ausgewandert und schickte seiner Familie in Abständen Briefe, in denen er von seiner Arbeit als Bäcker im Staat Illinois schrieb. Anscheinend fand sein deutsches Backwerk dort reißenden Absatz. Amerika war eben das Land der unbegrenzten Möglichkeiten! Man musste nur auf eines der Dampfschiffe in Bremerhaven kommen. Wer sich die Überfahrt auf dem Dampfschiff nicht leisten konnte, fand billiger einen Platz im Zwischendeck eines Seglers, der Fracht nach Europa gebracht hatte und auf dem Rückweg den freigewordenen Lagerraum mit Passagieren füllte. Egal. Irgendwie. Nur an Bord kommen.
Zuerst wuchs Pauls Sparstrumpf. Anna hatte keine Möglichkeit, ihrerseits auch etwas beizusteuern. Die Eltern kamen gerade so über die Runden. Eigenes Geld für ihre Arbeit? Mutter würde in die Luft gehen, wenn sie so etwas nur ansatzweise erwähnen würde. Nun ja. Sie würden die Eltern vor vollendete Tatsachen stellen, wenn es erst so weit war. So versuchte Anna sich jedenfalls Mut zu machen. Hauptsache, Paul und sie waren zusammen. Doch dann kam die Kartoffelfäule. Paul fand keine Arbeit mehr als Tagelöhner, um zu seinem schmalen Lohn etwas dazuzuverdienen. Es gab einfach nichts zu ernten. Die Preise für Roggen und Kartoffeln, fürs tägliche Leben, schossen in immer noch schwindelerregendere Höhen.
„Wir gehen jetzt“, verkündete er mit finsterer Miene, nachdem er Anna überraschend früh an einem Sonntagnachmittag abgeholt hatte, „ehe das, was ich angespart habe, auch noch weg ist. Nichts wie weg von hier. Jetzt oder nie.“ Anna fühlte einen Kloß im Hals. Schon in dem Moment, als er es aussprach, wusste sie, dass es nichts werden würde. Sie wusste es einfach. „Wir gehen zu deinem Vater. Jetzt.“
„Bist du verrückt geworden?“ Vater fragte es nicht, er brüllte es so laut, dass die Nachbarn es noch drei Häuser weiter hören mussten, kaum hatte Paul in aller Kürze sein Anliegen vorgetragen. „Glaubst du im Ernst, ich gebe meine Tochter einem Verrückten, einem Tagträumer? Sie werden dich erwischen, kapierst du nicht, dann bist du nichts weiter als ein Deserteur. Und glaubst du wirklich, ich lasse Anna in einer dieser vergammelten überfüllten Spelunken unterwegs verkommen, bis ihr auch nur an irgendeinem Hafen angekommen seid? Geh doch, wenn du so dumm bist, aber allein!“ Sein Gesicht war puterrot angelaufen. Er atmete schwer. Am Hals pochte eine Ader. Anna hatte ihn schon oft wütend gesehen, aber so noch nie. Es war schrecklich. Sie wich zurück und versteckte sich hinter Paul. Ihre Mutter erschien in der Küchentür, ein nasses Geschirrtuch in der Hand. Vater schnaubte. „Was hast du meiner Tochter in den Kopf gesetzt? Ich hätte dich schon längst fortjagen sollen! Nein! Das ist mein letztes Wort!“ Seine Hand schoss vor, ehe Paul oder Anna reagieren konnten. Er packte sie am Arm und zerrte sie mit einem solchen Ruck hinter Paul hervor, dass sie nach vorn stolperte und sich schmerzhaft an der Tischkante stieß. Vater baute sich zwischen ihr und Paul auf. Mit dem freien Arm wies er zur Tür. „Raus! Ich sage nichts weiter. Raus, und lass dich hier nie mehr blicken. Stürz dich in dein Unglück, du eingebildeter Narr, wenn du unbedingt willst, aber lass die Hände von meiner Tochter!“
Paul konnte sich nur noch durch einen Sprung in Sicherheit bringen, bevor die Haustür hinter ihm zuschlug, dass die Wände wackelten. Anna zitterte am ganzen Körper – vor Schreck, Angst und Wut. „Wie kannst du mir das antun!“, schrie sie schrill auf. Plötzlich war ihr vollkommen egal, wie ihr Vater reagieren würde. „Ich liebe ihn! Wir wollen heiraten!“ Die Tränen schossen ihr in die Augen. Zuerst dachte sie, ihr Vater würde sie schlagen. Der aber schüttelte nur langsam den Kopf und ließ sich schwer auf seinen Stuhl fallen. Alle Energie schien zusammen mit der Wut aus seinem Körper gewichen zu sein. Er stützte den Kopf auf die Hände, ohne sie anzusehen. „Nein, Anna“, sagte er mit einer veränderten Stimme. Es klang nicht mehr zornig. Sondern müde. Hoffnungslos. Aber endgültig. „Das ist mein letztes Wort.“ Anna rang nach Luft. Sie blieb vor ihm stehen und konnte es nicht glauben, was geschehen war. „Und wenn ich trotzdem gehe?“ Mit einem Satz war die Mutter bei ihr. Die Ohrfeige tat weh, aber Anna reagierte nicht darauf. „Du hast gehört, was dein Vater gesagt hat. Nichts als Dummheiten im Kopf! Hier! Du kannst die Nähte bügeln, damit wir morgen früh gleich weitermachen können. Dein Leben ist hier!“ „Heute ist Sonntag“, sagte Anna leise. Ein letztes Aufbegehren. Doch in ihrem Herzen wusste sie, dass sie verloren hatte.
Am nächsten Morgen lag der Brief auf dem Küchenfußboden. Paul musste ihn in der Nacht unter der Tür durchgeschoben haben. Er war sehr kurz. Vergib mir, Anna. Lebewohl. In Liebe, Paul.
Er war fort. Ohne Abschied, ohne noch einmal versucht zu haben, sie doch irgendwie mitzunehmen. Er hätte doch wissen können, dass sie sich schlaflos in der Kammer auf ihrem schmalen Bett wälzte. Er hätte es wenigstens versuchen können! Sie hatten doch nichts mehr zu verlieren. Der Brief enthielt kein Versprechen, sie irgendwann nachzuholen. Es war vorbei. Ihr Leben war vorbei. Dabei hatte es doch kaum begonnen.
Anna quälte sich durch die Tage und in der Nacht weinte sie in ihr Kissen. Zuerst schmiedete sie in ihrer Wut wilde Pläne, wie sie davonlaufen und Paul noch einholen würde, aber im nüchternen Licht des Tages musste sie sich die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens eingestehen. Das Leben hatte seine letzte Farbe verloren. Es gab nur noch Arbeit mit krummem Rücken, die Sorge um das tägliche Brot und die bange Frage, ob die einzige verbliebene Ziege den Winter überleben würde. Nach und nach wurde Anna klar, dass Paul niemals zurückkommen würde. Ein ganzes Jahr verging darüber. Die Not wurde immer schlimmer. Anna versuchte, ihre Träume zu begraben und einfach nur zu existieren.
Freude schien ein Fremdwort geworden zu sein. Inzwischen gab es auch einen anderen jungen Mann im Dorf, der sein Interesse an ihr signalisierte, aber sie hatte sich ganz und gar in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Kein Mann war wie Paul.
Und dann, eines Tages, brachte der Bote die Post. Ein reichlich zerknitterter Umschlag mit vielen Stempeln, an Vater adressiert. Pauls Handschrift war es nicht, das sah Anna mit einem raschen Blick, bevor der Vater danach griff. „Von der Sophie!“ Seine Stimme war weich. Sophie war Vaters älteste Schwester. Vor acht Jahren war sie einem Aufruf im Christenboten gefolgt, der Diakonissenanwärterinnen für die neue Diakonissenanstalt in dem kleinen Städtchen Kaiserswerth am Rhein suchte. Ein junger Pfarrer, Theodor Fliedner, bildete dort unverheiratete Frauen in der Krankenpflege und als Kleinkinderschullehrerinnen aus. Es war ein Versuch, der großen sozialen Not zu begegnen, die es auch dort weit fort im Rheinland gab.
Fliedner wollte den Frauen eine sinnvolle Berufstätigkeit ermöglichen, damit sie auf eigenen Beinen stehen konnten. Bislang waren die Aussichten für unverheiratete Frauen düster: Sie konnten sich lediglich als Dienstmädchen oder Tagelöhnerinnen verdingen oder sie wurden als fünftes Rad am Wagen im Haushalt ihrer verheirateten Geschwister mit durchgefüttert. Frauen aus dem Bürgertum stand noch der Beruf der Gouvernante offen, immer abhängig von den Launen ihrer Dienstherren. Dazu kam erschwerend, dass in den verheerenden Kriegen Napoleons zahllose junge Männer ihr Leben gelassen hatten. Allzu viele Frauen mussten ihren Traum von Ehe und Familie begraben.
Sophie Wagner fühlte sich ganz persönlich von Gott zu diesem Dienst berufen. Ihr war schnell klar: Sie würde nach Kaiserswerth gehen und Diakonisse werden. Sieben junge Frauen aus dem Schwabenland waren es insgesamt, die die anstrengende Reise ins preußische Rheinland gewagt hatten. Ein Jahr später war Sophie mit zwei weiteren Probeschwestern für fünf Jahre ins Diakonissenamt eingesegnet worden und wieder ein Jahr später hatte sie ihren Dienst angetreten, im neugegründeten Wilhelmshospital in Kirchheim unter Teck.
So hart die Arbeit an den Schwerkranken mit nur zwei Schwestern war, trotz eigener schwerer Krankheit – sie hatte monatelang mit Typhus darniedergelegen und man fürchtete um ihr Leben: Sophie hatte es nie versäumt, lange blumige Briefe an ihre Familie in der alten Heimat zu schreiben, in denen sie von Freud und Leid erzählte. In allem, was sie schrieb, leuchtete die Liebe zu ihrem Gott durch, für den allein sie ihren Dienst tat. Anna hatte sie zu selten gesehen, um ihre Tante wirklich zu kennen, aber ihre Hingabe und Frömmigkeit schienen echt zu sein, voll inniger Wärme und Gefühl. Das war etwas, was ihr zu Hause fremd geblieben war. Vater sprach manchmal von Großvater, der mit seinen Kindern gebetet hatte. Er hatte sie nicht nur in den Gottesdienst mitgenommen, sondern sein Anliegen war, dass sie alle eine echte Herzensbeziehung zu Gott aufbauen und „Jesus als ihren Heiland“ annehmen sollten.
Aber Annas Vater schien die Religion zusammen mit seiner Kindheit abgestreift zu haben. Vielleicht war da noch der Hauch eines warmen Gefühls, wenn er denn selten genug einmal daran zurückdachte. Er hatte mit Gott abgeschlossen. Im Elternhaus von Annas Mutter war weder gebetet noch Bibel gelesen worden. Mutter kannte nichts als Arbeit von Kindesbeinen an – tagaus, tagein. Vermutlich war sie deshalb so hart geworden.
Nach zwei Jahren gesegneter Arbeit in Kirchheim wurde das Krankenhaus von Kaiserswerth unabhängig. Sophie und die beiden Schwestern kehrten daher in ihr Mutterhaus an den Rhein zurück, wo neue Herausforderungen warteten. Friederike Fliedner, die Frau des Gründers, war nach einer zu frühen Entbindung gestorben. Ihr plötzlicher Tod riss eine große Lücke in das junge Werk, war sie doch unermüdlich als Vorsteherin der Schwesternschaft tätig gewesen. Sophie hatte sie in ihren Briefen stets als „Mutter“ bezeichnet, ihr völlig vertraut, ja, sie geradezu verehrt. Der Witwer mit seinen überlebenden drei Kindern heiratete im Jahr darauf erneut. Um seine zweite Frau Caroline, die nun auch Vorsteherin der Schwesternschaft wurde, zu entlasten, war Sophie in diesem Jahr mit dem verantwortungsvollen Amt der Hausmutter betraut worden. Sie hatte sich in ihrem Dienst als willensstarke, aber fähige Persönlichkeit bewährt.





























