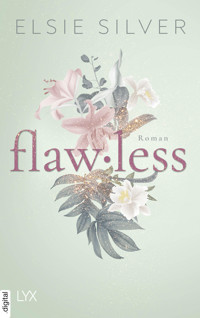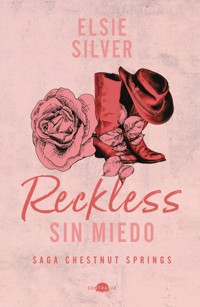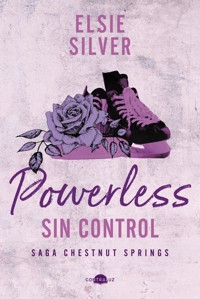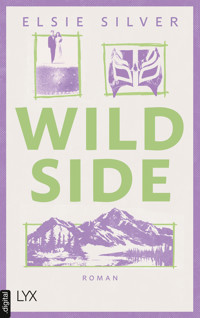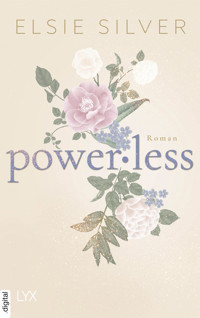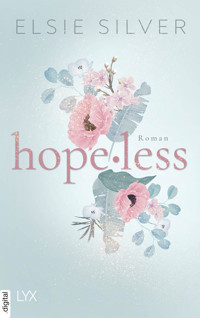
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Chestnut Springs
- Sprache: Deutsch
Es sollte ein simpler Deal sein - und ist doch so viel mehr
Seit Beau Eaton verletzt von einer gefährlichen Mission zurückgekehrt ist, wird er von seiner Familie nur noch mit Samthandschuhen angefasst. Und das, obwohl er einfach nur in Ruhe die schlimmen Ereignisse verarbeiten will. Da kommt ihm ein Deal mit der schüchternen Barkeeperin Bailey Jansen gerade recht: Als seine Fake-Verlobte soll sie die besorgten Fragen von ihm fernhalten, im Gegenzug wird sein Name ihr dabei helfen, den schlechten Ruf, den ihre Familie in Chestnut Springs hat, hinter sich zu lassen. Es gibt nur eine Regel: Sobald einer von ihnen sich in jemand anderen verliebt, ist es vorbei. Aber was, wenn zum Verlieben gar niemand anderes nötig ist?
»Wow, ich liebe dieses Buch! Eine dramatische und emotionale Geschichte über zwei verlorene Seelen, die mein Herz vom ersten Moment an gestohlen hat!« The Escapist Book Blog
Band 5 der CHESTNUT-SPRINGS-Serie von TIKTOK-Sensation Elsie Silver
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Anmerkung der Autorin
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Bücher von Elsie Silver bei LYX
Impressum
ELSIE SILVER
Hopeless
Roman
Ins Deutsche übertragen von Maike Hallmann
Zu diesem Buch
Beau Eaton wusste immer, wer er ist und was er vom Leben wollte. Doch seit er bei seinem letzten Einsatz verletzt wurde und seinen Dienst bei der kanadischen Spezialeinheit quittieren musste, hat er seinen Weg verloren. Zurück in Chestnut Springs sieht er sich umgeben von Menschen, die ihn auf einmal voller Mitleid anschauen. Selbst seine Familie fasst ihn nur noch mit Samthandschuhen an. Seine einzige Zuflucht ist der Pub Railspur und Bailey Janson, die hinter der Bar steht. Schon bald findet er sich jeden Tag an ihrer Theke ein und muss dabei beobachten, wie schlecht die Leute Bailey behandeln – und das nur wegen ihres Nachnamens. Als sich Beau und Bailey eines Nachts am Fluss treffen, schließen sie einen Deal: Sie täuschen eine Verlobung vor, die Beau die besorgten Fragen vom Leib hält und Bailey dabei helfen soll, den schlechten Ruf ihrer Familie hinter sich zu lassen und einen neuen Job zu finden. Es gibt nur eine Regel: Sobald einer von ihnen sich in jemand anderen verliebt, ist es vorbei. Doch schnell verwischen die Grenzen zwischen fake und echt, und die beiden merken, dass aus ihrem Deal mehr werden kann. Wäre da nur nicht der Altersunterschied zwischen ihnen und die Tatsache, dass Bailey gar nicht schnell genug aus Chestnut Springs herauskommen kann …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Anmerkung der Autorin und hier eine Contentwarnung.
Achtung: Diese enthalten Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Anmerkung der Autorin
In diesem Buch geht es auch um Alkoholismus, Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) und Hauttransplantationen/Verbrennungen. Ich hoffe, dass ich diese Themen mit der angemessenen Sorgfalt behandelt habe.
Für alle jene Leser:innen (und das sind viele), die eine Nachricht, eine E-Mail oder einen Kommentar geschrieben und mich angefleht haben, Beaus Geschichte zu erzählen.
Dieses Buch ist für euch.
1
Beau
Ich hatte geglaubt, ich würde etwas empfinden, wenn ich meinen Bruder so richtig auf die Palme bringe und dann einfach abhaue.
Aber das war ein Irrtum.
Selbst wenn ich mich wie ein Arschloch aufführe, obwohl ich eigentlich gerade einem Freund der Familie beim Einzug in sein neues Haus helfen soll, fühle ich mich … taub.
Während ich die Hauptstraße von Chestnut Springs entlanglaufe, krümme ich die Finger, grabe die Nägel in die Handflächen.
Auch das spüre ich nicht richtig.
Ich bin wahnsinnig müde, aber nicht müde genug, um zu schlafen.
Aus der Ferne ertönt das Signal eines vorbeifahrenden Zugs, und ich erstarre. Seit Jahren verberge ich nach Kräften, wie sehr mir laute Geräusche in Mark und Bein fahren, aber diesmal nicht.
Man würde erwarten, dass ich meinem Kampf-oder-Flucht-Impuls nachgebe und mich für eins von beidem entscheide, aber stattdessen stehe ich einfach nur da.
Reglos.
Warte darauf, dass sich irgendein Gefühl in mir regt. Angst, Sorge, Enttäuschung.
Aber ich fühle gar nichts.
Ich stehe an der Ecke Rosewood und Elm, drehe mich um und sehe zu, wie der Zug vorbeirauscht. Er fährt immer nur auf seinen Schienen hin und her. Von A nach B. Beladen. Entladen. Über Nacht warten. Wieder von vorn anfangen.
»Ich bin ein Zug«, murmle ich und starre die Räder an, die über die Schienen rollen.
Ich arbeite den ganzen Tag auf der Ranch, weil es von mir erwartet wird. Ich tue, was ich tun muss. Und ich hasse jede Sekunde.
Eine Frau schiebt einen Kinderwagen an mir vorbei und wirft mir einen verwirrten Blick zu. Dann erkennt sie mich, und Überraschung flackert in ihrem Gesicht auf. Vielleicht sind wir zusammen auf die Highschool gegangen … so wie alle in dieser Stadt, die nur ein paar Jahre auseinander sind.
»Oh, Beau! Tut mir leid, ich habe dich nicht gleich erkannt.«
Wahrscheinlich, weil ich mir seit Monaten nicht mehr die Haare habe schneiden lassen.
Ich erinnere mich nicht an ihren Namen, also setze ich ein nichtssagendes Lächeln auf. »Kein Ding. Ich blockiere den Weg, hm? Warte …« Ich drücke für sie auf den Knopf an der Ampel.
Die Frau, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere, schenkt mir ein dankbares Lächeln und rückt den Schulterriemen ihrer Tasche zurecht. Der Kinderwagen ist völlig überladen mit unnützem Zeug. »Danke! Schön, dich mal wieder draußen zu sehen. In den letzten Wochen hat sich ganz Chestnut Springs Sorgen um dich gemacht.«
Meine Wange zuckt vor Anstrengung, das Lächeln aufrechtzuerhalten. Ja, ich war bei der JTF2, Kanadas Elitetruppe für Spezialeinsätze. Ja, ich habe absichtlich unseren Rücktransport verpasst, um einen Kriegsgefangenen zu retten. Ja, ich galt wochenlang als vermisst und war in schlechter Verfassung, als man mich fand.
Ich bin immer noch in schlechter Verfassung.
Die Leute lieben es, darüber zu reden.
Du hast uns ganz schön erschreckt.
Sieh zu, dass du das nächste Mal nicht den Hubschrauber verpasst, ja?
Ich wette, du genießt die ganze Aufmerksamkeit.
Wenn sie denken, dass ich nicht zuhöre, sind die Kommentare allerdings weniger gutmütig.
Er sieht aus, als könnte er jeden Moment ausrasten.
Selbst der Therapeut konnte ihm nicht helfen.
Er nennt es vielleicht eine Heldentat, ich nenne es idiotisch.
Ich weiß, dass sie es auf ihre Weise nur gut meinen, aber dieses demonstrativ bekundete Interesse geht mir auf die Nerven. Als hätte mein Einsatz auf feindlichem Boden auch nur das Geringste mit ihnen zu tun. Als hätte ich irgendwen absichtlich in Angst versetzt. Als hätte ich einfach nur keine Lust gehabt, mich zu melden. Zivilisten können sich nicht vorstellen, was ich alles erlebt habe, welche Entscheidungen ich treffen musste.
Also lasse ich sie reden.
»Einfach toll, wie man sich in Kleinstädten noch gegenseitig unterstützt«, entgegne ich, weil ich nicht sagen kann, was ich wirklich denke. Wenn ich mein wahres Ich zeigen würde – mein neues Ich –, wüssten die Leute nicht, wie sie reagieren sollen.
»Ja, unser aller Unterstützung ist dir sicher.« Mit einem freundlichen Nicken dreht sie sich um und überquert die Straße.
Ich blinzle. In dieselbe Richtung gehen wie sie will ich nicht, weiß aber nicht, wohin dann. Vielleicht einfach in die entgegengesetzte Richtung.
Da fällt mein Blick auf The Railspur, die beste Bar in ganz Chestnut Springs.
Es spielt keine Rolle, dass es ein schöner Sommernachmittag ist, mit strahlend blauem Himmel. Es spielt keine Rolle, dass ich meinen Bruder Rhett verärgert habe. Es spielt keine Rolle, dass ein paar Blocks weiter ein Freund meine Hilfe beim Abladen von Möbeln bräuchte.
In diesem Moment kommt mir die Bar wie ein verdammt gutes Versteck vor.
Und ein Drink hört sich auch nicht übel an.
»Gary, wenn du nicht ein bisschen langsamer machst, nehme ich dir die Autoschlüssel ab.«
Gary ist ein älterer Typ mit gerötetem Gesicht und scheint sich über Baileys Warnung zu amüsieren. Ich setze mich ein gutes Stück von ihm entfernt an die Bar und stütze einen Ellbogen auf den Tresen, den Blick zur Tür. Das Railspur ist nur eine Kleinstadtbar, aber dank umfangreicher Modernisierung hat es eine angenehme Atmosphäre, die mir gefällt. Der Raum mit seinem Holzdielenboden ist im Western-Stil dekoriert, an der Decke hängen Lampen aus Wagenrädern, und lange Reihen von Mason-Vorratsgläsern sorgen für ein rustikales Ambiente.
»Seit wann bist du eigentlich so geschwätzig?«, brummt er und lässt sein Glas sinken. »Früher hast du kaum den Mund aufgemacht, und jetzt kommandierst du mich die ganze Zeit rum wie eine kleine Tyrannin.«
Das glänzende, fast schwarze Haar fällt Bailey Jansen über die gebräunten Schultern. Mit dem Rücken zu uns bückt sie sich und holt Gläser aus der kleinen Spülmaschine hinter der Bar. »Hab mich irgendwie dran gewöhnt, mehr zu reden. Und du kannst es gebrauchen, dass dich auch mal jemand rumkommandiert, alter Mann. Den ganzen Tag sitzt du in der Bar und schikanierst mich.«
»Mach ich doch gar nicht. Ich bin sehr nett zu dir. Einer der wenigen, die nett zu dir sind, will ich meinen.«
Sie dreht sich um, ein weißes Geschirrtuch in der Hand, und mustert ihren bisher einzigen Kunden in der ruhigen Bar. »Das stimmt. Und ich betrachte dich als Freund. Genau deshalb sage ich dir ja, dass du verdammt viel trinkst.«
Sie entdeckt mich, und ihre dunklen Augen weiten sich überrascht. Offenbar hat sie über der Country-Musik und dem Summen der Spülmaschine nicht gehört, wie ich hereingekommen bin.
»Wenn ich aufhöre zu trinken, hast du nix mehr zu tun. Und vielleicht auch gar keine Freunde mehr.« Gary redet weiter, als hätte er meine Anwesenheit nicht bemerkt.
Ohne den Blick von mir abzuwenden, antwortet sie ihm: »Damit kann ich leben, Gar.« Sie hält inne und leckt sich über die Lippen.
Üppige, schimmernde Lippen.
»Beau Eaton. Schön, dich zu sehen.«
Der Mann dreht sich um. »Ach du Scheiße, das ist ja wirklich Beau Eaton, was? Du bist ja echt ein Riesenkerl, was?« Garys Aussprache ist nicht mehr besonders deutlich, und Baileys freie Hand schießt nach vorne und schnappt sich seine Schlüssel von der Theke.
Gary schließt die Augen und stöhnt auf. »Jeden verdammten Tag dasselbe.«
»Ja. Jeden verdammten Tag.« Sie steckt die Schlüssel in ihre Hosentasche und wendet sich wieder der Spülmaschine zu. »Beau, was kann ich dir Gutes tun? Kommt noch jemand? Wahrscheinlich willst du auf deine Lieblingscouch, hm?«
Ich schlucke und betrachte das Sofa, auf dem meine Brüder, unsere Freunde und ich schon so manchen Abend verbracht haben. Es fühlt sich an, als hätte dort eine andere Version von mir gesessen. Der neue Beau sitzt hier an der Bar, mit dem jämmerlichen stadtbekannten Säufer, und betrachtet das schüchterne Nachbarsmädchen, das eine Levis mit Acid-Waschung trägt. Noch nie hat eine Hose jemandem so gut gestanden.
»Nein, heute bin ich allein hier. Ich nehme dasselbe wie Gary.«
»Ein Buddyz Best für den Helden der Stadt!« Gary schlägt krachend mit der flachen Hand auf die Theke, und ich zucke zusammen. Wegen dem Knall. Weil er »Held der Stadt« gesagt hat. Manchmal ist mir, als würde ich unter der Last der Blicke und Erwartungen zusammenbrechen. Sie sehen mich an, als würde ich auf eine Art Podest gehören. Alle beobachten mich ständig.
Ich starre seine wettergegerbte Hand an, die auf dem polierten Holz des Tresens liegt. Schließe für einen Moment die Augen und fahre mir mit der Zunge über die Zähne, um mich daran zu hindern, sie so fest zusammenzubeißen, dass es knirscht. Als ich mit gezwungener Lässigkeit aufsehe, schieben sich Baileys Augenbrauen zusammen, und der Blick ihrer dunklen Augen durchbohrt mich, als hätte sie mich durchschaut. Auch mein Lächeln scheint sie nicht zu täuschen. Bevor sie sich abwendet, um mir ein schäumendes Bier einzuschenken, schüttelt sie kaum merklich den Kopf, als wäre sie enttäuscht.
Mein Blick wandert über ihren Körper, und ich zermartere mir das Hirn in dem Versuch, mich an unsere letzte Begegnung zu erinnern. Die süße, schüchterne Bailey Jansen … die in die am wenigsten angesehene Familie der ganzen Stadt hineingeboren wurde. Ihr Vater und ihre Brüder haben allen möglichen Dreck am Stecken – Drogen, Gefängnis, Diebstahl –, und ihre Mutter ist schon vor Jahren abgehauen.
Leider grenzt ihr Land direkt an unseres. Von meinem Haus auf der Ranch aus kann ich es sehen, es beginnt gleich auf der anderen Seite des Flusses. Ich habe extra einen Stacheldrahtzaun aufgestellt, damit die Arschgeigen nicht vergessen, wo sie umkehren müssen.
Aber Bailey ist in meinen Augen ganz anders als der Rest ihrer Familie.
Sie hat mir stets leidgetan, und sie hat schon immer meinen Beschützerinstinkt geweckt. Die Blicke, das Geflüster … Ich stelle es mir verdammt brutal vor, in einer Kleinstadt zu leben, in der fast jeder Bewohner eine beschämende Geschichte über deine Familie auf Lager hat. Also bin ich nett zu ihr. Ich mag sie – ich habe keinen Grund, sie nicht zu mögen –, allerdings kenne ich sie kaum.
Sie arbeitet schon seit Ewigkeiten im Railspur … Ich habe keine Ahnung, wie lange genau. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob wirklich genug Jahre vergangen sind, dass mir jetzt auffallen darf, wie bei ihren Bewegungen das Tanktop hochrutscht und kurz den flachen Bauch aufblitzen lässt. Oder dass ich darüber nachdenke, wie gut ihre perfekt gerundeten Brüste in meine Hände passen würden.
»Wie lange arbeitest du schon hier, Bailey?«, frage ich und bemerke, wie sich ihre Schultern ein wenig anspannen.
Sie räuspert sich. »Etwas mehr als vier Jahre. Ich habe mit achtzehn angefangen.«
Zweiundzwanzig.
Verdammt. Ich bin fünfunddreißig, das heißt, ich war schon ein Teenager, als … Ich schüttle den Gedanken ab und senke den Blick, als sie einen Untersetzer vor mir auf den Tresen legt, gefolgt von einem Glas mit goldenem Lagerbier. Weißer Schaum schwappt über den Rand.
»Danke«, brumme ich und fahre mir durch die Haare.
Sie sagt nur: »Mmhmm.«
Bailey ist fast der einzige Mensch der ganzen Stadt, der mir seit meiner Heimkehr noch nicht eifrig erklärt hat, was für ein Held ich sei. Sie starrt mich nicht an wie ein seltenes Tier im Zoo.
Schweigend arbeitet sie weiter, und ich frage mich, weshalb sie jetzt so still ist. Ehe ich mich an die Bar gesetzt habe, hat sie munter geplaudert.
»Du warst also zwei Wochen lang im Einsatz verschollen, was?«, fragt Gary mich, und ich sehe, wie Bailey die Augen verdreht, während sie ein Bierglas auf Hochglanz poliert.
»Ja.«
»Und, wie war das so?«
Oh, super. Das ist offenbar das einzige Thema, über das die Leute mit mir noch reden wollen.
»Gary!« Mit schockierter Miene lässt Bailey die Hände sinken.
»Was denn?«
»Du kannst ihn doch so was nicht einfach so fragen.«
»Warum nicht?«
Ich kann nicht anders, ich muss lachen und beschließe, Bailey vor der Aufgabe zu erlösen, mir zur Seite zu springen. »Sehr warm. Bin ordentlich braun geworden.«
Er kneift die Augen zusammen, seine Bewegungen wirken ein bisschen unkoordiniert. Ich frage mich, wie lange er schon hier sitzt … Es ist erst kurz nach Mittag, aber er ist schon sichtlich betrunken. »Hab gehört, du hast dir böse Verbrennungen geholt. Nicht gerade die Art Bräune, auf die man hoffen würde.«
»Ga-ry.« Wie Bailey seinen Namen ausspricht, lässt klar erkennen, wie sehr seine Frage sie entsetzt.
Ich streiche mit der flachen Hand über die Theke, und sie sieht mich an. »Ist schon gut. Jeder weiß von den Verbrennungen.«
Sie blinzelt, ihre Augen wirken plötzlich ein wenig glasig.
»Wirklich … mir ist es lieber, die Leute sagen einfach frei heraus, was sie denken, als wenn sie mir in den Arsch kriechen oder mich wie ein rohes Ei behandeln. Was glaubst du, warum ich mich mitten am Tag hier verstecke?«
»Weil Bailey die beste Barkeeperin der Stadt ist!«
Sie schnaubt und schürzt die Lippen, dann poliert sie das nächste Glas. Ich versuche, mich zu entsinnen, ob ich sie jemals richtig habe lächeln sehen, würde es aber nicht beschwören. Sie versucht stets nach Kräften, mit dem Hintergrund zu verschmelzen, und ich bin normalerweise nur hier, wenn ordentlich was los ist. Ich weiß nicht mal, ob ich ihre Stimme je zuvor richtig gehört habe. Sie ist melodisch und von einer eigenartig beruhigenden Sanftheit.
So satt ich es gerade habe, dass die Leute mich vollquatschen … Bailey zuzuhören kommt mir auf einmal wie eine gar nicht so üble Idee vor.
Ich trinke den ersten Schluck Bier, es ist kalt und erfrischend. Ich seufze tief und spüre, wie mir hier in Gegenwart des stadtbekannten Säufers und der Außenseiterin eine Last von den Schultern fällt.
Mit einem Mal kommen sie mir vor wie Seelenverwandte. Sie gehören ebenso wenig dazu wie ich.
»Verbrennungen dritten Grades an den Füßen«, teile ich ihnen mit, denn offenbar ist radikale Offenheit das Gebot der Stunde. »Hauttransplantationen.«
»Keine Sorge. Du findest bestimmt ein Mädchen mit einem seltsamen Fußfetisch, das dich genau so lieben wird, wie du bist.«
Bailey stützt sich mit beiden Händen auf die Bar und senkt ächzend den Kopf. »Mein Gott, Gary. Kein Schnaps mehr für dich.«
»Solange dein Schwanz nichts abgekriegt hat …« Er deutet mit einem Handwedeln auf mich. »Das Gesicht ist ja in Ordnung, meinst du nicht auch, Bails? Das wird schon wieder, Kleiner. Du findest eine, die dich liebt.«
Obwohl er betrunken ist, hat Gary den Finger genau auf meinen wunden Punkt gelegt. Ich war nie eitel oder sonderlich um mein Aussehen bemüht, aber das hatte ich auch nie nötig … Gute Gene und ein Job, der mich fit hält, haben solche Gedanken einfach nie aufkommen lassen.
Wer hätte gedacht, dass vernarbte Füße mein Selbstvertrauen derart erschüttern würden? Es sind nur verdammte Füße. Als würden die eine große Rolle spielen. Es hätte so viel schlimmer sein können, und ich sollte dankbar sein. Aber …
Bailey betrachtet mich, und ich betrachte sie. Ihr dunkles Haar schimmert im gedämpften Licht wie Mahagoni. Es ist seidig und glatt, vorne kinnlang, ansonsten wallt es ihr lang und üppig über Schultern und Rücken. Es sieht nicht aus, als würde Bailey ihre Haare oft schneiden lassen. Die Wimpern sind so dicht und schwarz wie bei diesen uralten Puppen. Sie trägt kein Make-up und hat ein paar Sommersprossen auf der Nase.
»Ja«, sagt sie leise, errötet und wendet blinzelnd den Blick ab.
Ihre Augen, dieses eine kleine Wort – mein Herz schlägt mit einem Mal schneller.
Inmitten eines Meeres aus Taubheit regt sich eine Empfindung.
Meine Kehle zuckt, als ich trocken schlucke und versuche, die Gefühle so rasch wieder zu verdrängen, wie sie aufgekommen sind. Vielleicht bin ich doch noch nicht bereit, wieder etwas zu fühlen.
Ich trinke einen weiteren Schluck Bier und frage mich, ob ich heute Nacht vielleicht mehr Schlaf bekomme als nur ein paar Stunden, wenn ich noch ein paar Pints runterkippe. Noch ein Schluck, dann streiche ich mir über das stoppelige Kinn und drehe mich zu Gary um. »Liebe ist das Letzte, was ich gerade gebrauchen kann. Aber dieses Bier ist genau richtig. Danke, Gary.«
Mit ihm zu reden ist ungefährlich. Ungefährlicher jedenfalls als ein Gespräch mit Bailey Jansen, die mich mit ihren großen Rehaugen ein wenig zu aufmerksam ansieht.
2
Bailey
Es ist zwei Wochen her, dass Beau Eaton mitten am helllichten Tag in der Bar aufgetaucht ist.
Zwei Wochen, seit ich bei seinem Anblick fast ein Glas hätte fallen lassen. Er ist nicht zu übersehen mit seiner gut gebauten Statur, den breiten Schultern und den langen Beinen, zumal er einen Kopf größer ist als die meisten anderen Männer, die durch diese Tür kommen. Das hellbraune, etwas zu lange Haar fällt ihm in die Stirn und betont seine silbergrauen Augen. Er wirkt ein bisschen verwahrlost, aber trotzdem ist Beau Eaton verdammt heiß. So heiß, dass man Angst kriegen könnte.
Und dass er heiß ist, ist das eine … aber Beau ist obendrein auch nett. Und lustig.
Eine waschechte dreifache Bedrohung – oder zumindest war er das mal.
Er hat mich nie so angesehen wie viele andere – als wäre ich irgendwie besudelt durch meine Herkunft. Ich kenne ihn nur von unseren Begegnungen in der Bar, aber es gab keinen einzigen Moment, in dem es sich angefühlt hat, als würde er wegen des Rufs meiner Familie schlecht über mich denken. Er findet immer ein paar freundliche Worte für mich, berührt höflich dankend meinen Ellbogen und gibt mir ein großzügiges Trinkgeld, ehe er geht.
Aber trotzdem … er ist der Prinz der Stadt, und ich bin der Abschaum.
Er ist der Held, ich die Frau hinter der Bar.
Er ist ein Eaton, ich bin eine Jansen.
Und doch taucht er seit jenem Nachmittag, als er herkam und aussah wie ein gerade aus dem Käfig ausgebrochenes Tier, jeden Tag hier auf.
Jeden verdammten Tag trinkt er ein paar Bier mit dem verflixten Gary.
Am ersten Tag war es richtig schön. Wenn ich ehrlich bin, fand ich ihn hinreißend. Aber in den letzten zwei Wochen hat er sich langsam irgendwie verändert. Wie ein heller Himmel, der sich zuzieht, bis sich bedrohliche Gewitterwolken über einem türmen.
Seine bloße Gegenwart kann bewirken, dass alle ringsum nervös werden. In der Luft liegt Elektrizität, wie ein Blitz, der jede Sekunde einschlagen kann.
So allmählich habe ich genug von ihm. Er erinnert mich an meinen Vater und meine Brüder, und diese Art Toxizität kann ich nicht gebrauchen.
Er kommt stets am Nachmittag und trinkt ein Bier nach dem anderen. Ich kann richtig zusehen, wie seine unterdrückte Frustration immer heftiger in ihm brodelt. Manchmal umklammert er sein Glas so fest, dass die Knöchel weiß werden. Ich bin fast sicher, dass ihm eines Tages eines in der Hand zerspringen wird. Er ist zu groß, zu stark, zu wütend für etwas so Zerbrechliches.
Wenn jemand auf ihn einredet, fährt er sich mit der Zunge über die Zähne, als wollte er so vermeiden, dass er damit knirscht.
»Was hast du eigentlich gemacht in den zwei Wochen, in denen du in der Wüste festgesessen hast?«
Bei Garys Frage bleibt mir der Mund offen stehen. Ich weiß, dass er es gut meint, aber offenbar bekommt er nichts mit. Auch nicht, wie angespannt Beau ist … Vor einer halben Stunde ist donnernd ein Gewitter über uns hinweggezogen, und seitdem steht er unter Strom.
Ja, Beau sieht aus, als würde er heute Abend platzen, aber Gary merkt nichts.
»Ich habe versucht, am Leben zu bleiben«, sagt Beau. In seiner Stimme liegt ein leises Vibrieren. Es erinnert mich an einen knurrenden Hund. Eine Warnung, nicht näher zu kommen.
Aber Gary ist zu betrunken, um es zu bemerken.
»Es heißt, du hättest den Hubschrauber absichtlich verpasst, um diesen Journalisten zu retten. Ich glaub, du hast da einen waschechten Heldenkomplex.« Seine Stimme wird immer undeutlicher, bis man am Ende kaum noch versteht, was er sagt.
Beau starrt stumm in sein Bier, als würde er sich in seinen goldenen Tiefen verlieren. Es ist nicht das erste Mal, dass sie darüber reden, aber Alkohol führt nun mal dazu, dass Menschen sich wiederholen. Ich muss das wissen – ich bin quasi Expertin auf diesem Gebiet, nachdem ich jahrelang betrunkene Leute beobachtet habe.
»Stell dir vor, wie dein Leben jetzt aussähe, wenn du das nicht getan hättest.«
Meine Wimpern flattern, denn mein Gefühl sagt mir, dass Gary gerade über eine unsichtbare Grenze getrampelt ist.
Mitten in Feindesgebiet.
Beau holt mit seinem muskulösen Arm aus und wischt beide Gläser vom Tresen. Bier bespritzt die wenigen Gäste, die in der Nähe sitzen, und ohne die laute Musik wäre es jetzt im Railspur sicher totenstill. Alle starren ihn an.
Beau steht so ruckartig auf, dass sein Stuhl krachend umkippt. Entgeistert starrt Gary ihn an. »Stell du dir mal vor, wie dein Leben aussehen würde, wenn du nicht jeden verdammten Tag hier sitzen, trinken und dich zum Affen machen würdest, Gary. Schon mal darüber nachgedacht?« Seine Brust hebt und senkt sich heftig. Wo Bier auf seinem T-Shirt gelandet ist, klebt es an den wohldefinierten Brustmuskeln. Nur jemand, der in einer Familie wie der meinen aufgewachsen ist, kann in einem solchen Moment ruhig genug bleiben, um so kleine Details zu bemerken.
Beau ist nicht mein Vater. Vor meinem Vater habe ich Angst. Vor ihm nicht.
»Beau«, sage ich. Meine Stimme klingt fest, nicht das kleinste Beben ist darin zu hören.
»Jeden verdammten Tag hockst du hier allein rum und betrachtest eine junge Frau als deine beste Freundin. Kommt mir schon ein bisschen pervers vor …«
Ich hole kurz Luft. »Beau Eaton, halt den Mund und beweg deinen Arsch nach draußen.«
Er dreht sich zu mir um, mustert mich aus grauen Augen, als hätte er meine Anwesenheit gerade erst bemerkt. Als hätte er niemals erwartet, dass ausgerechnet die kleine Bailey Jansen ihn derart anblaffen würde.
Er richtet sich zu seiner vollen Größe auf. Aber mir ist egal, wie groß er ist.
Er macht mir keine Angst.
Nicht mal in dieser Situation.
Ich zeige auf die Hintertür, die in den Innenhof führt, und meine Hand zittert nicht im Geringsten. Ich bin nicht nervös. Ich bin stinksauer.
Steif dreht Beau sich um, geht um die Bar herum und geradewegs hinaus ins schwindende Tageslicht. Wenn ich nicht wüsste, wie viele Bier er bereits hatte, würde ich nicht mal bemerken, dass seine Schritte ein kleines bisschen weniger sicher sind als sonst und dass er die Tür mit ein wenig mehr Wucht aufstößt als nötig.
Bevor ich die kleine hölzerne Klappe der Theke öffne, um ihm zu folgen, werfe ich Gary noch einen raschen Blick zu.
»War ich drüber?«, fragt er und weicht meinem Blick aus.
Ich presse die Lippen aufeinander. »Ja, Gary. Du warst drüber.«
Er streicht sich durch das schüttere Haar und senkt den Kopf. Klopft mit der flachen Hand auf die Schlüssel, die er gleich beim Reinkommen auf den Tresen gelegt hat. »Ich rufe mir ein Taxi.«
Ich nicke ihm zu, bevor ich durch die Tür auf die Terrasse hinaustrete. Das Sommergewitter hat alle Gäste nach drinnen gescheucht, in ihren zurückgelassenen Gläsern steht Regenwasser.
Ich kann den Sturm immer noch riechen. Und Beau. Kiefer und Zitrone, vermischt mit etwas Tieferem, Sinnlicherem. Tabak vielleicht. Eine Zigarre?
Er lehnt an der Backsteinmauer des ehemaligen Bahnhofs, in dem sich die Bar befindet. Als ich näher komme, schiebt er die Hände in die Jeanstaschen. Er hat den Kopf gesenkt, das Kinn ruht fast auf der Brust. Er betrachtet seine Turnschuhe.
Diese Turnschuhe trägt er immer. Sie wirken falsch an ihm – zu weiß und glänzend, zu makellos.
»So einen Scheiß kannst du in meiner Bar nicht abziehen«, sage ich.
Er schnaubt und weigert sich immer noch, mir in die Augen zu sehen. »Deine Bar also, hm?«
»Ja, Beau. Meine Bar. Mein Laden. Der einzige Ort in dieser Stadt, an dem man mich nicht wie Scheiße behandelt. Ich reiße mir den Arsch auf, um hier zu arbeiten. Ich reiße mir den Arsch auf, damit die Kunden mich mögen. Hinter diesem Tresen ist mein persönlicher Zufluchtsort. Gary ist nicht pervers, er ist verdammt einsam. Und er ist einer der wenigen Menschen, die immer nett zu mir sind. Wenn du also glaubst, du könntest einfach in meine Bar spazieren, dich wie ein arrogantes Riesenarschloch aufführen und meine Stammgäste zusammenstauchen, hast du dich geschnitten.«
Jetzt sieht er mich doch an, die Augen zusammengekniffen. »Arrogantes Riesenarschloch?«
»Ja.« Ich verschränke die Arme vor der Brust, als könnte mich das vor ihm schützen. Er sieht heute ein bisschen wild aus, sogar gefährlich – nicht wie der fröhliche Typ, den wir alle vor seinen Militäreinsätzen gekannt haben. Oder zu kennen glaubten.
Silbriges Licht betont seine Züge, spielt auf der gebräunten Haut und spiegelt sich in seinen Augen. Sie scheinen fast zu glühen, als er mich ansieht. Nichts rührt sich, nur seine und meine Brust heben sich im gleichen Takt unter unseren schweren Atemzügen.
Aber ich wende den Blick nicht ab. Ich habe es so unendlich satt, dass Männer versuchen, mich einzuschüchtern. Und bei ihm fühlt es sich erst recht falsch an, also bleibe ich einfach stehen.
Der hitzige Moment wird langsam irgendwie peinlich, und schließlich spannt sich sein Kiefer an, und er wendet den Blick ab. »Habe ich mich zu sehr danebenbenommen?« Seine Stimme ist rau, und es fühlt sich an, als würde sie über meine Haut kitzeln.
»Das hast du. Aber zum Glück bist du ein Eaton, also werden dir alle verzeihen und dir sofort wieder die Füße küssen, sobald du reinkommst und ihnen ein Lächeln schenkst.«
»Bailey, was zum Teufel … Hast du das wirklich gerade zu mir gesagt?«
»Ja.« Ich lege den Kopf schräg. »Weil es wahr ist. Ich habe nichts weiter getan, als einfach nur in meine Familie hineingeboren zu werden, und das reicht, damit mich alle ständig schief ansehen und darauf warten, dass dieser Teil meiner Gene sein hässliches Gesicht zeigt. Als könnte ich mich jederzeit in einer Sekunde von einem fleißigen und freundlichen Menschen in eine Kriminelle verwandeln, nur weil mein Name Jansen ist.« Er hat die Stirn gerunzelt, und mit jedem meiner Worte graben sich die Falten tiefer. »Also, ja. Ich denke, du wirst klarkommen, auch wenn du dich gerade ordentlich danebenbenommen hast.«
»Das ist nicht wahr.«
»Was ist nicht wahr?«
»Dass die Leute so über dich denken.«
»Ha!« Ich lache auf, scharf und ohne einen Funken Humor. »Das ist hinreißend naiv«, sage ich und schüttle ungläubig den Kopf.
»Tja … ich jedenfalls sehe dich nicht so.«
Ich schlucke und wende den Blick ab. Es stimmt, dass Beau immer nett zu mir war – genauso nett, wie er früher immer zu allen Leuten war. Vielleicht macht mich ja deshalb dieser neue Beau so wütend. »Ich weiß.« Ich bringe ein dankbares Lächeln zustande. »Du bist einer von den Guten, Beau. Genau deshalb kannst du so nicht weitermachen.«
»Wie weitermachen?«
»Du kannst nicht jeden Nachmittag in meiner Bar hocken und dich bis zum völligen Stumpfsinn betrinken.«
Ein leises, klagendes Geräusch entweicht ihm. Er lehnt den Kopf gegen die Mauer, bewegt ihn hin und her, zieht die Hände aus den Taschen und reibt sich übers Gesicht. »Es hilft mir dabei, abends einzuschlafen.«
»Was?« Mein Herzschlag wummert mir in den Ohren. Irgendwie ist das nicht die Reaktion, die ich erwartet habe.
Es ist schmerzhaft ehrlich.
»Der Alkohol. Er hilft mir beim Einschlafen. Ich verlasse die Bar, gehe nach Hause auf die Ranch und schlafe ein. In letzter Zeit schlafe ich nicht besonders gut.«
Bei seinem Eingeständnis wird mir seltsam flau im Magen.
»Willst du mir etwa sagen, dass du in dem Zustand noch Auto fährst?« Ich zeige auf ihn – auf die Ausbeulung seiner Tasche, in der die Schlüssel sein müssen.
Mit weit aufgerissenen Augen sieht er mich flehend an. Verzweifelt. Ich komme mir richtig blöd vor, weil ich geglaubt habe, er sei anders als Gary, hätte sich ausreichend im Griff, um ein Taxi zu rufen, statt sich in diesem Zustand hinters Lenkrad zu setzen.
Ja, es war dumm von mir, auf die verdammte Fassade des gutmütigen Kerls reinzufallen, obwohl der Mann eindeutig am Absaufen ist. Auf einmal sehe ich ganz klar, dass er direkt vor meinen Augen untergeht. Und ich will nichts damit zu tun haben. Ich kann es mir nicht leisten, dass er mich mit in den Abgrund reißt.
»Beau.« Ich gehe auf ihn zu, baue mich direkt vor ihm auf. Er spannt sich an, aber ich bin zu wütend, um Rücksicht darauf zu nehmen.
Ich habe mich in seiner Nähe immer wohler gefühlt als bei den meisten anderen Menschen, und deshalb überlege ich auch nicht lange, sondern greife in seine Tasche und umklammere seine Schlüssel.
Vollkommen erstarrt steht er da. Seine Muskeln spannen sich, aber er macht keine Anstalten, mich wegzuschieben. Die Schlüssel klirren, und ich sehe ihm in die Augen und suche nach einem Hinweis darauf, ob ich wohl zu weit gehe.
Für einen Moment bin ich vollkommen in seinem Bann gefangen. Sehe nur diese von Mondlicht erfüllten Augen und seinen Kehlkopf, der wippt, als er schluckt.
»Ich mache dir einen Kamillentee«, breche ich das angespannte Schweigen. »Das hilft auch beim Einschlafen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder so eine Szene hinzulegen.«
Er nickt und senkt den Kopf. »Versprochen.«
Die Spannung zwischen uns löst sich auf, und er folgt mir zurück in die Bar. Neugierige Augen starren ihn an, als er stehen bleibt, leicht schwankend, und die zerbrochenen Gläser betrachtet, als wollte er sie wegräumen.
»Setz dich auf deinen Arsch, Eaton«, knurre ich und kümmere mich selbst darum. Sonst muss ich gleich nicht nur Bier wegwischen, sondern auch sein Blut, und das kann ich nicht gebrauchen.
Ich sehe ihm deutlich an, dass er sich schämt. Und dazu hat er auch allen Grund. Aber ich werde nicht darauf herumreiten, er macht sich schon genug Vorwürfe. Stattdessen mache ich ihm einen Becher Tee, wische das verschüttete Bier weg, fege die Spuren seines Ausbruchs in ein Kehrblech und mache dann weiter, als wäre er gar nicht da.
Stelle ihm den Tee hin.
Er trinkt ihn.
Wir reden nicht miteinander, aber er beobachtet mich und dreht den Becher in seinen großen, breiten Händen. Ich spüre seine Schlüssel, die ich in meine Gesäßtasche gesteckt habe.
Um zehn kommt Pete nach vorn, unser Koch. »Alles so weit klar hier, Bails? Die Küche ist dann jetzt geschlossen.«
Ich sehe mich um. Für einen Montagabend ist einiges los, aber es ist noch halbwegs überschaubar, und in zwei Stunden schließen wir. »Alles in Ordnung«, antworte ich und zeige ihm kurz den hochgereckten Daumen.
Lächelnd erwidert Pete die Geste und geht durch die Eingangstür hinaus. Er wohnt nicht hier draußen, sondern in der Stadt, was bedeutet, dass er mich nicht automatisch hasst. Dadurch ist die Arbeit mit ihm sehr entspannt.
Als ich wieder nach Beau und seinem Tee sehe, mustert er mich. »Er macht jetzt also Feierabend, und du bist den Rest der Nacht allein hier?«
Ich zucke mit den Schultern und schnappe mir seinen leeren Becher, um ihn nachzufüllen. »Ja. Ich kümmere mich mittlerweile ums Personal. Wenn mehr los wäre, hätte ich eine Kellnerin hierbehalten, aber so habe ich sie schon nach Hause geschickt.«
Er stützt die Ellbogen auf die Theke und legt die Finger zusammen, als bräuchte er etwas, um seine Hände zu beschäftigen. »Das heißt, du bist allein? Du bist die Letzte, die geht, und du schließt den Laden?«
Dampf steigt auf, als ich heißes Wasser aus dem Zapfhahn in seinen Becher sprudeln lasse. »Richtig.« Während ich ihm den Becher über die Theke zuschiebe, überlege ich, wie oft ich schon nachgefüllt habe, ohne einen neuen Beutel zu nehmen … Der Tee sieht ziemlich dünn aus.
Ich hocke mich hin und krame im unteren Regal in der Teeschachtel herum. Das Railspur ist in Sachen Tee nicht besonders gut ausgestattet, aber ich finde noch einen weiteren Beutel Kamille, werfe ihn in den Becher und nehme mir vor, unserem Geschäftsführer Jake zu sagen, dass er mehr bestellen soll.
Während ich die Schnur am Henkel festbinde, hat Beau die Hände um den Becher geschlungen, als wollte er verzweifelt die Wärme aufsaugen.
»Weiß der Geschäftsführer davon?«
»Jake? Vermutlich. Er schreibt ja den Dienstplan. Die neuen Besitzer habe ich nie kennengelernt, das sind irgendwelche Investoren. Solange der Laden Geld einbringt, ist ihnen alles andere egal.«
Er runzelt die Stirn. »Das ist nicht sicher für dich. Was, wenn etwas passiert?«
Als ich einen Knoten mache, streife ich versehentlich seine Hand. Ich hebe eine Augenbraue und sehe zu ihm hoch. »Was denn zum Beispiel? Dass irgendein Typ ausrastet und überall Bier verschüttet?«
Er starrt mich an, und ich versuche, ein Grinsen zu unterdrücken.
Mit einem lässigen Achselzucken beantworte ich seine Frage: »Ich komme gut klar.« So wie ich es immer getan habe. Seit ich denken kann, passe ich selbst auf mich auf. Und inzwischen fühlt es sich auch nicht mehr schlimm an – es ist einfach, wie es ist.
Beau sagt nichts darauf. Er sieht mich nur an und gibt ein leises Grunzen von sich.
Aber er geht nicht. Er bleibt bis zum Ende an der Bar sitzen und trinkt. Zwei Stunden lang hält er Wache. Selbst als ich um Mitternacht alle rausschmeiße und den Laden dichtmache, bleibt er noch da wie ein stummer Wächter, und als ich gehe, folgt er mir über den dunklen Parkplatz und begleitet mich zu meinem Auto.
»Bist du nüchtern?«, frage ich.
»Ich trinke seit zwei Stunden literweise verdammten Kamillentee. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so nüchtern und gut hydriert.«
Ich atme tief durch, ziehe seine Schlüssel aus der Hosentasche und halte sie ihm auf der flachen Hand hin. »Mach so einen Scheiß nie wieder, Beau.«
Ich sehe seinen Kehlkopf zucken. Er schnappt sich die Schlüssel. »Du bist anders, als ich dich in Erinnerung habe, Bailey.«
Ich muss schmunzeln. Wir alle verändern uns. Und ich konnte ja nicht ewig das vor Angst wie erstarrte kleine Mädchen bleiben.
Ich wollte mich ändern.
»Du bist auch nicht mehr so, wie ich dich in Erinnerung habe, Beau.«
Forschend wandert sein Blick zwischen meinen Augen hin und her. »An welchen Tagen arbeitest du?«
Ich schnaube und krame meine eigenen Schlüssel aus der Handtasche. »Frag lieber, an welchen Tagen ich nicht arbeite.«
»Okay. Wann arbeitest du bis tief in die Nacht allein?«
»Sonntag bis Dienstag.« Ich schließe meine Tasche.
»Okay«, sagt Beau mit einem knappen Nicken, bevor er sich auf dem Absatz umdreht. Ich schaue ihm hinterher. Er sieht eindeutig nach Militär aus, den Kopf hoch erhoben, die Schultern gerade ausgerichtet.
Wie ein seltsamer Ritter in glänzender Rüstung.
Ein Ritter, der offenbar vorhat, sich ab jetzt von Sonntag bis Dienstag auf einen Hocker zu setzen und bis Mitternacht Kamillentee zu trinken, damit ich nicht allein schließen muss.
3
Beau
Cade: Du kommst doch zur Hochzeit, oder?
Beau: Es ist die Hochzeit meines kleinen Bruders. Natürlich komme ich.
Cade: Du bist in letzter Zeit nicht gerade verlässlich. Du lässt dich kaum blicken, und wenn du doch mal auftauchst, führst du dich auf wie ein miesepetriger Arsch.
Beau: Ich gebe einfach mein Bestes, um so zu sein wie du.
Cade: Ich bin aber nicht mehr miesepetrig. Nur noch ein Arsch. Und genau deshalb wurde bei der Abstimmung beschlossen, dass ich dir diese Nachricht schicken muss.
Beau: Bei der Abstimmung? Wie demokratisch.
Cade: Willa sagt, du sollst dich bei Winter entschuldigen. Sie ist bei der Hochzeitsfeier auch dabei.
Beau: Willa ist nicht mein Boss.
Cade: Du musst neu hier sein. Willa ist unser aller neuer Boss.
Aus den Lautsprechern ertönt ein Lied, das ich nicht kenne, aber ich tanze trotzdem dazu … einen Two-Step. Mein Anzug sitzt schlecht, und die Schuhe drücken an den Stellen meine Füße, wo Haut transplantiert wurde. Winter Hamiltons Hand liegt auf meiner Schulter; die Nase hat sie hoch erhoben und starrt über meine Schulter hinweg. Oder vielleicht auch auf mein Ohr. Ich bin nicht ganz sicher.
Mit Winter zu tanzen ist unangenehmer als das Drücken meiner Schuhe. Und das will was heißen.
Einen ganzen Song lang tanzen wir wie steife Holzklötze miteinander und geben dabei unser Bestes, einander zu ignorieren. Rhett und Summer tanzen ebenfalls, sie sehen so verdammt glücklich aus, dass es wehtut, sie anzusehen, aber ich weiß nicht, wohin ich den Blick sonst richten soll. Es scheint, als würden alle anderen mich beobachten. Ich achte sehr darauf, dass meine Hände keinen Millimeter verrutschen, damit sie weder zu tief noch zu hoch auf Winters Brustkorb landen. Strenge Flugverbotszonen. So wie Theo, der Vater ihres Babys, uns anstarrt, ist ihr ganzer Körper eine einzige Flugverbotszone für mich.
Die Musik wechselt zu einem langsameren Lied, und Winter murmelt mir zu: »Danke. Das war quasi der krasse Junior-High-Tanz aus der Vergangenheit, von dem ich immer geträumt habe.«
»Lieber Himmel, Winter.« Meine Finger krümmen sich. »Noch ein Tanz.«
»Warum?« Sie neigt den Kopf und mustert mich aus blauen Augen. Ich fühle mich, als wäre ich wieder in Therapie. Etwas Kaputtes, das repariert werden muss. Ein Irgendwas, an dem Mediziner herumstochern und es analysieren. Mit meinen Verbrennungen, meinem verdrehten Gehirn und der Schlaflosigkeit bin ich der feuchte Traum eines jeden Psychiaters.
Ich hasse dieses Gefühl. Als wäre ich ein großer, dummer Goldfisch in einem Glas.
»Weil ich mich bei dir entschuldigen muss.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Nein, musst du nicht.«
»Ich habe dich beim Familienessen angebrüllt.«
Damals hatte ich gerade sämtliche Arzttermine geschmissen und konnte nicht mehr schlafen. Ich war wund und müde und wollte mich einfach ein bisschen ausruhen. Als ich Winter mit in den Flur geschleift und sie nach rezeptpflichtigen Schlaftabletten gefragt hatte – die frei verkäuflichen halfen nicht mehr –, hatte sie mich sofort durchschaut. Ihr wissender Blick und die Art, wie sie die Arme vor der Brust verschränkt und ganz ruhig einfach nur »Nein« gesagt hatte … Da war ich ihr quasi ins Gesicht gesprungen.
Das hatte sie nicht verdient. Alle haben es gehört.
Winters Mundwinkel wandern nach oben. »Hast du das? Ich erinnere mich an nichts.«
»Winter«, sage ich, verärgert, dass sie es mir so schwermacht.
»Beau«, entgegnet sie nur. Wir gleiten weiter über den Holzboden der Tanzfläche. Über ihre Schulter hinweg entdecke ich Bailey. Ihr Haar schimmert wie ein Fluss im hellen Licht. Sie ist nicht als Gast hier, sondern kümmert sich um die Bar, aber mir reicht es, dass sie da ist.
»Das hätte ich nicht tun sollen.« Mein Blick bleibt auf Bailey gerichtet, während ich mit Winter spreche. Mich auf sie zu konzentrieren hilft mir. Sie ist zu einem ruhigen Pol geworden im Chaos meines gequälten Daseins.
»Nein, wahrscheinlich nicht. Aber weißt du was, Beau?«
Jetzt sehe ich sie doch an. »Was denn?«
»Wir Menschen machen alle mal Fehler. Vor allem, wenn wir gerade schwer zu kämpfen haben.«
»Ich habe nicht schwer zu kämpfen.«
Sie schnaubt und zwinkert mir dann übertrieben zu. »Cool. Ich auch nicht.«
Ich beiße die Zähne zusammen und sehe wieder zu Bailey hinüber. »Na schön. Vielleicht ein bisschen.«
Aber ich entspanne mich, wenn ich sie ansehe.
»Kannst du inzwischen wieder besser schlafen?«
Ich presse die Lippen zusammen und überlege, ob ich sie anlügen soll. Aber Winter ist so nüchtern und sachlich, dass es mir bei ihr leichter fällt als meiner restlichen Familie gegenüber, ehrlich zu sein. »Nein. Aber inzwischen habe ich mir einen Zeitplan gemacht, und das scheint ein wenig zu helfen.« Ich sage ihr nicht, dass ich mit Zeitplan meine, dass ich die Woche so plane, dass ich regelmäßig in Baileys Bar sitze und Kamillentee trinke. Aber tatsächlich gibt mir das viel Struktur, und das fühlt sich gut an.
»Hast du dir Hilfe gesucht?«
»Bei einem Arzt?«
Sie nickt.
»Nein.«
»Warum auch zu einem Fachmann gehen, wenn man sich doch prima selbst diagnostizieren kann, hm?«
Ich lächle, sage aber nichts.
»Ich zum Beispiel habe nach einer von Vernachlässigung geprägten Kindheit gelernt, mich auf niemanden zu verlassen«, sagt sie. »Bämm. Diagnose gestellt, Hunderte von Dollar gespart. Jetzt du.«
Ich ziehe eine Braue hoch und denke kurz nach. »PTBS.«
»Ja.« Das Lied nähert sich dem Ende, und sie rümpft die Nase. »So banal. Ich kann verstehen, weshalb du nicht mit einem Profi drüber reden willst.«
»Winter, machst du dich etwa über mich lustig? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen.«
Sie klopft mir auf die Schulter. »Du bist groß und gut aussehend, Beau. Manche Leute halten dich deswegen für ein bisschen beschränkt. Ich hingegen glaube, du lässt das die Leute gern glauben, weil es so einfacher ist.«
»Wow. Danke. Ich bin unermesslich geschmeichelt, Dr. Hamilton.«
»Ich weiß es halt besser. Und du weißt es auch besser. Wir wissen beide, dass eine Therapie gut wäre, aber wir beide wollen nicht zum Therapeuten. Also machen wir einfach das Beste daraus.«
»Was soll das heißen?« Ich runzle die Stirn. Das Lied endet, und sie tritt einen Schritt zurück.
»Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon eine Menge Champagner intus, um diese Familienfeierlichkeit besser zu ertragen. Hast du ihn probiert? Er ist köstlich. Auf jeden Fall … nichts für ungut. Schnee von gestern, wie man so schön sagt. Falls du mal was brauchst, du hast ja meine Nummer.«
Wir schütteln einander die Hand, dann dreht sie sich um und geht zu Theo, der sie beäugt, als wäre sie eine Art Dessert auf Beinen. Auch das will ich gerade nicht sehen, also gehe ich zu jemandem, dessen Anblick mir kein Unbehagen bereitet.
Ich steuere durchs Gewühl auf Bailey zu, als würde mich ein unsichtbarer Magnet in ihre Richtung ziehen. Vielleicht bin ich auch einfach nur der neueste unglückliche Stammgast, der auf einem Hocker sitzt und darauf wartet, dass sie mit der Arbeit fertig ist. Wie ein trauriger Hundewelpe.
Aber sie redet mit mir wie niemand sonst. Über völlig nichtigen Kram. Und manchmal schweigen wir einfach nur gemeinsam, und es ist ein angenehmes Schweigen.
Als ich mich an die Theke lehne, sieht sie kaum auf. Aber das ist auch nicht nötig. Ich weiß, dass sie mich bemerkt hat.
»Ich habe keinen Kamillentee dabei. Aber du siehst aus, als könntest du einen kleinen Muntermacher gebrauchen.« Sie schiebt mir ein Glas Coca-Cola vor die Nase, ohne zu ahnen, dass sie mein eigentlicher Muntermacher ist.
»Danke«, sage ich, setze mich auf einen Barhocker und schicke mich an, unseren typischen Abend im Railspur zu imitieren. Ich habe meiner Familie versprochen, dass ich bei der Hochzeit dabei sein werde, und ich bin hier. Aber um ehrlich zu sein, fühle ich mich ziemlich überfordert. Es ist heiß, laut und unglaublich wuselig in dieser zu einem Veranstaltungsraum umfunktionierten Scheune, und das gefällt mir überhaupt nicht.
»Wie geht’s, Soldat?«, fragt Bailey, lehnt sich mit der Hüfte gegen den Kühlschrank und sieht mich an. Verschränkt die Arme vor der Brust und mustert mich ein wenig zu genau, als würde sie spüren, dass etwas nicht stimmt.
Ich sehe sie an und frage mich, wie viele Sommersprossen sie wohl auf der Nase hat. Und ob sie nur im Sommer da sind oder auch im Winter. Ich habe nie darauf geachtet. Direkt über ihrer Lippe entdecke ich eine Sommersprosse, von der ich ziemlich sicher bin, dass sie das ganze Jahr über da ist.
Ich wende den Blick ab und sehe zur Tanzfläche rüber. Meine ganze Familie ist dort. Es ist schön, sie alle so fröhlich zu sehen, nachdem sie so viel durchgemacht haben.
Ich trinke einen großen Schluck Cola, sehe Bailey an und sage: »Ich habe sehr zu kämpfen.«
Sie nickt. »Vertrau deinem Hirn, Beau.«
»Was meinst du damit?«
»Solange wir zu kämpfen haben, sind wir in Bewegung. Auf dem Weg zu etwas Besserem. Das sage ich mir jedenfalls immer wieder.«
Meine Brust schmerzt. Ich will nicht, dass Bailey auch kämpfen muss.
Ich bin in dieser Lage, weil ich mich aus freien Stücken für den Weg entschieden habe, der mich hierhergeführt hat. Sie hingegen wurde in ihre Situation hineingeboren. Das kommt mir zutiefst ungerecht vor.
Trotzdem proste ich ihr zu. »Darauf trinke ich. Auf unsere gemeinsamen Kämpfe.«
Sie lacht leise und holt ihr Getränk hinter der Bar hervor, um mit mir anzustoßen. »Immerhin kämpfen wir nicht allein.«
Schlichte Worte. Für den Durchschnittsmenschen ist das hier wahrscheinlich nichts Besonderes … zwei Menschen, denen es schlecht geht und die sich gegenseitig trösten.
Aber bei dem Gedanken, dass ich etwas mit Bailey gemeinsam habe, ist mir gleich viel leichter ums Herz.
Ich wünschte, ich hätte mit ihr getanzt statt mit Winter.
Viele Menschen würden den blauen Himmel und das Vogelgezwitscher sicherlich bezaubernd finden. Den Geruch nach frischer Bergluft und all das. Vielleicht bin ich undankbar – das ist durchaus möglich –, aber an mich ist diese Idylle völlig verschwendet.
»Beau?«
Die Stimme meines älteren Bruders reißt mich aus meinen Gedanken. Ich sitze auf dem Pferderücken und blicke über den Kamm hinweg auf ein Tal voller Rinder. Sie sehen alle gleich aus, fressen jeden Tag dasselbe und laufen einander fast blindlings hinterher.
Ein unglaublich einfaches Leben. Langweilig sogar.
Und doch scheinen sie glücklich zu sein.
Ich wünschte, ich wäre ein Rind. Ich wünschte, ich könnte wenigstens ein bisschen Freude an der Monotonie des Ranchlebens finden. Stattdessen bin ich rastlos, gefangen unter der Oberfläche der perfekten Fassade, die ich für die anderen aufrechtzuerhalten versuche.
Sie wollen, dass es mir gut geht. Aber es geht mir nicht gut. Nicht wirklich. Ich will, dass sie es denken, aber derzeit bekomme ich es kaum hin, meine Tarnung zu wahren.
»Beau!« Cades Stimme klingt jetzt wütend. Wäre ich sein Sohn Luke, würde ich in meinen Stiefeln schlottern.
Aber ich bin nicht Luke.
Langsam wende ich den Kopf und mustere meinen Bruder. »Du siehst aus wie ein Emo-Cowboy. Warum trägst du an einem so heißen Tag schwarze Klamotten?«
Er schüttelt ungläubig den Kopf. »Hast du nicht gehört, dass ich mit dir gesprochen habe?«
Ich habe meinen Namen gehört, mehr nicht.
»Tut mir leid, ich habe einfach nur die Aussicht genossen. Der blaue Himmel, die zwitschernden Vögel …« Mit dem Arm hole ich weit aus. »Schön hier.«
Mein Bruder blinzelt mich an und weiß offenbar nicht, was er sagen soll. Seine Wimpern sind so lang, dass er mich fast an eins seiner Rinder erinnert, als er langsam blinzelt.
»Hey, warum haben Rinder so lange Wimpern?«, wechsle ich abrupt das Thema.
Unter der Hutkrempe runzelt er die Stirn. »Was?«
»Ihre Wimpern. Sie sind einfach so verdammt lang. Welchen Sinn hat das?«
Was hat das überhaupt alles für einen Sinn?
Die Worte zucken durch mein Hirn, aber gleich darauf fällt mir ein, was Bailey letztes Wochenende gesagt hat, und ich spüre, wie sich meine Mundwinkel leicht heben.
Vertrau deinem Hirn.
Also tu ich es. Ich vertraue darauf, dass es einen guten Grund gibt, weshalb ich etwas über Kuhwimpern wissen muss.
Cade räuspert sich. Ich verwirre ihn eindeutig. Und dann tut er, was die Mitglieder meiner Familie immer tun: Er geht auf mich ein. Egal, wie blödsinnig ich mich gerade aufführe, immer schleichen sie auf Zehenspitzen um mich herum, als würde es mir helfen, wenn sie auf jede meiner Launen Rücksicht nehmen.
Nicht so wie Bailey, die mir ständig Zunder gibt.
»Die langen Wimpern schützen die Augen vor Staub, Regen, Insekten und so weiter.«
»Hm.« Ich stütze die Hände auf das Sattelhorn und blicke auf die riesige dumme Herde runter. »Jetzt, wo du es sagst … Hätte ich mir eigentlich denken können.«
Er schenkt mir ein gezwungenes Lächeln, und ich unterdrücke ein Grinsen. Es ist einfach albern, wenn Cade sich sensibel gibt. Ich wünschte, er würde stattdessen einen blöden Witz reißen oder drohen, mir in den Arsch zu treten … sich einfach normal verhalten. Dann würde ich mich viel besser fühlen.
»Also … bereit?«
Bereit.
Ich starre ins Tal hinunter. Die Frage, ob ich bereit bin, löst ein Echo in mir aus. Ich habe sie schon so oft gehört, und doch ist diesmal alles ganz anders. Kein Adrenalin, kein Nervenkitzel, keine Frage von Leben und Tod.
»Oh, Scheiße, warte mal.« Ich greife in meine Gesäßtasche, ziehe das Handy heraus und blicke aufs Display, als würde ich nachsehen, wer da gerade anruft. In Wirklichkeit ist da nichts bis auf das Hintergrundbild – Luke, der von einem Ohr zum anderen grinst, nachdem wir Wassermelonen aus dem Fenster meines Umzugswagens geworfen haben. Die Erinnerung daran, wie wir eine Straße entlanggerast und die Melonen auf dem Asphalt geplatzt sind, Lukes entzücktes Quietschen … Jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich lächeln.
Vor allem, weil Cade es uns verboten hatte.
»Jasper ruft gerade an. Eine Sekunde.«
Cade verdreht die Augen. »Komm einfach nach«, murmelt er, bevor er seine Stute antreibt und den Pfad ins Tal hinunterreitet.
»Hey Mann!«
Schweigen antwortet mir … Natürlich, denn es gibt keinen Anruf.
»Aha.« Als Cade sich im Sattel nach mir umblickt, zeige ich ihm den nach oben gereckten Daumen. »Genau. Oh, Scheiße. Das klingt wirklich wichtig.«
Cade verschwindet hinter einer Hügelkuppe, aber ich rede trotzdem weiter. »Bist du sicher, dass Sloane dir dabei nicht helfen kann?«
Pause.
»Oh, in der Stadt, ja? Okay, ich sehe mal, was ich tun kann.« Ich warte noch einige Sekunden, bevor ich hinzufüge: »Alles klar, bis dann.« Mit einem leisen Schnalzen treibe ich mein Pferd näher an den Rand des Kamms und sehe Cade, der auf die Jungs zureitet, die für ihn arbeiten und unten im Tal auf ihn warten. Schuldgefühle wallen in mir auf, weil ich mich nicht einfach zusammenreiße und den Job erledige.
Ich muss aufhören, alle im Stich zu lassen, das weiß ich. Ich habe versprochen, Cade auf der Ranch unserer Familie zu helfen.
Aber ich kann nicht. Ich … kann einfach nicht.
Trotzdem fühle ich mich beschissen, als ich ihm hinterherrufe: »Hey Cade!«
Er bleibt stehen und dreht sich im Sattel um. Starrt mich finster an. Es ist, als wüsste er, was jetzt kommt.
»Jasper braucht meine Hilfe. Ich mache mich schnell auf den Weg und versuche, rechtzeitig zurück zu sein, um euch dann zu helfen.«
Er nickt nur stumm. Er weiß, dass ich nicht zurückkommen werde.
Ich erwidere sein Nicken, ehe ich das Pferd wende, in die entgegengesetzte Richtung davonreite und meine Beschämung niederkämpfe.
Sobald ich außer Hörweite bin, rufe ich Jasper an. Er geht nach dem vierten Klingeln dran.
»Na, arbeitest du gerade wie wild? Oder drückst du dich wie wild vor der Arbeit?«
Ich kann mich immer darauf verlassen, dass Jasper mich ein bisschen aufzieht. Er hat mich noch kein einziges Mal seit meiner Rückkehr unter Druck gesetzt. Eher wartet er in Ruhe ab, bis ich bereit bin und von mir aus zu ihm komme. Jasper kennt sich mit Traumata aus. Er weiß, wann man drängen und wann man sich zurückhalten muss. Und er weiß, wie es ist, wenn dich alle anstarren und darauf warten, dass etwas passiert, als wärst du ein Laborexperiment.
Ich verstehe ihn heute besser als je zuvor.
»Woher weißt du das nur?« Das Donnern der Hufe auf dem trockenen Boden lässt meinen Körper vibrieren, und mit jedem Meter, der zwischen mir und den Jungs liegt, entspanne ich mich mehr.
»Nun, Beau, das einzig Zuverlässige an dir ist derzeit, wie unzuverlässig du bist.«
»Nicht nett.«
Er schnaubt. »Aber wahr. Du bist ein großer Junge, du kannst das ab.«
»That’s what she said.«
Er lacht, und ich kann mir seinen Blick gerade gut vorstellen – belustigt, aber dennoch hellwach. Wir kennen einander, seit wir fünfzehn sind, und waren damals, als er zu uns gezogen ist, praktisch unzertrennlich. Momentan bekomme ich ihn aber nur selten zu Gesicht.
»Du musst mir einen Gefallen tun.«
Er zögert keine Sekunde. »Schieß los.«
»Wenn Cade fragt, musst du bestätigen, was ich ihm gerade erzählt habe … dass du mich von der Arbeit weggerufen hast, weil du Hilfe brauchtest.«
»Wobei denn?«
»Das habe ich nicht gesagt. Such dir was aus.«
»Okay. Ich sage ihm, dass ich Sloane vermisse und du mir angeboten hast, herzukommen und mir eine kleine Ballett-Vorführung abzuliefern, damit ich mich besser fühle.«
»Wenn du das gern möchtest, mach ich das«, sage ich trocken.
Er lacht. »Ich weiß.«
»Sagen wir einfach, deine Autobatterie war leer, und du brauchtest Starthilfe.«
»Meine Batterien werden nicht alt genug, um den Geist aufzugeben.«
Das ist allerdings wahr.
»Aber das weiß Cade nicht.«
Er grunzt zustimmend. »Es ist, als wären wir wieder Teenager und würden Cade gegenüber so tun, als könnten wir kein Wässerchen trüben.«
Ich lache leise. »Wie in der guten alten Zeit.«
Mein Freund schweigt einen Takt zu lange. »Es werden wieder gute Tage kommen, Beau.«
»Natürlich, das weiß ich.« Ich seufze. Ich muss dieses Gespräch beenden, bevor es eine Richtung nimmt, auf die ich nicht vorbereitet bin.
»Gibt es einen Grund dafür, dass wir Cade anschwindeln? Hast du vor, mir zu sagen, was du vorhast, wenn du nicht für mich tanzt oder meinem Auto Starthilfe gibst?«
»Danke, Mann. Wir reden später«, sage ich schnell und lege auf.
Und dann gehe ich dorthin, wo sich der beste Teil meines Tages abspielt.
Dorthin, wo ich momentan Frieden finde und einen Sinn in meinem Leben.
Zu dem Hocker an Bailey Jansens Bar.
4
Beau
Rhett: Danke, dass du zur Hochzeit gekommen bist.
Beau: Na klar. Wo hätte ich sonst sein sollen?
Rhett: Gute Frage. Keiner weiß mehr, wo du dich rumtreibst. Nur, dass du ständig verschwindest und mit keinem mehr redest.
Beau: Ich rede schon noch mit Leuten.
Rhett: Du kannst auch mit mir reden. Das weißt du, oder?
Beau: Ja, natürlich weiß ich das. Glückwunsch, die Hochzeit war wunderschön. Ich freue mich sehr für dich und Summer.
Rhett: Danke. Ich liebe dich, Beau-Beau. Geht es dir gut? Also, ganz ehrlich?
Beau: Ja, mir geht es gut.
»Hattest du schon mal Analsex?«, übertönt Baileys zuckersüße Stimme die laute Musik im Railspur, und mir sprüht Tee aus dem Mund. Ich versuche noch, die Hand davorzuschlagen, aber es ist zu spät; heiß rinnt der Tee an meinem Unterarm runter in meinen Schoß. Ein Wunder, dass meine Augen nicht direkt aus ihren Höhlen auf den hölzernen Tresen gefallen sind, der mich von der süßen, stillen kleinen Bailey Jansen trennt.
Der süßen, stillen kleinen Bailey Jansen, mit der ich jetzt drei, manchmal sogar vier Abende pro Woche verbringe.
Dieselbe süße, stille kleine Bailey Jansen, die mir gerade in einem Tonfall eine Frage über Analsex gestellt hat, als wollte sie wissen, ob ich gern Milch in meinen Kaffee hätte.
Sie wirft einen Lappen auf den Tresen. »Mach das sauber.«
Nur Bailey würde mir sagen, dass ich meinen Scheiß aufwischen soll, statt es selbst zu tun. Das weiß ich inzwischen nach all den Abenden, an denen ich an ihrer Bar gesessen habe.
Es gefällt mir.
Sie ist kein Arschkriecher, sie lässt sich nicht herumschubsen, und sie behandelt mich nicht wie ein rohes Ei.
Vielleicht ist sie auch gar nicht so lieb und still, wie ich immer dachte.
Die Welt kommt mir so schrecklich langweilig und banal vor, aber Bailey Jansen ist unglaublich interessant.
Deshalb komme ich immer wieder her. Nicht nur wegen meiner Sorge, wenn sie allein im Laden ist.
»Warum fragst du mich nach Analsex?«, brumme ich, während ich die Theke abwische und mir den Arm abtupfe. »Und dann auch noch so laut. Was sollen die Leute denken?« Prüfend sehe ich mich um, als würde ich mich fragen, ob es noch jemand gehört hat.
Ihre Mundwinkel zucken. Sie steht mit einem Bierglas am Zapfhahn und sieht mich unter langen Wimpern aus schokoladenfarbenen Augen an. »Die Leute denken von mir doch sowieso schon, was sie wollen, Beau.« Sie wendet sich ab und geht zu dem rothaarigen Mann, der am anderen Ende der Bar sitzt und den Blick auf das Handy in seiner Hand gesenkt hat. »Bitte sehr, Earl«, sagt Bailey, wirft ihm einen Untersetzer hin und stellt das Bier darauf.
Er schaut sie kurz an, bedankt sich aber nicht. Das ärgert mich.
Mit missbilligend verzogenen Lippen dreht sie sich zu mir um und kommt mit schwingenden Hüften wieder auf mich zu, sieht mir ins Gesicht.
In den letzten Wochen haben sie und ich einen angenehmen gemeinsamen Rhythmus gefunden. Unterhalten uns ganz entspannt, ohne dass ich mir anmerken lasse, wie verdammt schön ich sie finde … aus Angst, wie ein seltsamer alter Widerling zu wirken, der nur ihretwegen den ganzen Abend hier sitzt.
Verschwörerisch grinsend stützt sie sich mit den Unterarmen direkt vor mir auf die Theke. Ich versuche, nicht auf ihre Brüste zu starren, die sich unter dem dünnen Stoff ihres schulterfreien Rüschen-Oberteils wölben. Aber ihre leuchtenden Augen und schimmernden Lippen machen es auch nicht besser.
»Earl kommt nur selten her«, sagt sie und blickt über die Schulter in seine Richtung, ihre Zähne blitzen auf. »Aber wenn er da ist, sieht er sich immer Pornos auf seinem Handy an. Und es ist immer Analsex. Ich habe mich nur gefragt, wie verbreitet das ist, verstehst du?«
»Er tut was?« In meinem Kopf schrillen Alarmglocken. Keine Ahnung, wie sie über dieses Arschloch Witze reißen kann.
»Du hast mich gehört.« Sie beißt sich auf die Lippe, als wollte sie sich ein Lachen verkneifen, und ich starre ihren Mund an.
»Das ist nicht lustig, Bailey. Er sieht Pornos und glotzt dich dabei an. In der Öffentlichkeit.«
Sie verdreht die Augen. »Privat wäre das also besser?«
»Er sieht dich dabei an.« Meine Rückenmuskeln spannen sich an. »Er denkt dabei an dich.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Wahrscheinlich.«
»Wie kannst du das auf die leichte Schulter nehmen?«
»Ich frage doch auch niemanden um Erlaubnis, bevor ich beim Masturbieren an ihn denke.«
Ich starre sie an und versuche zu verbergen, wie schockiert ich bin.
Bailey seufzt und richtet sich auf. »Hör zu … ich sage ja nicht, dass ich damit einverstanden bin. Aber es ist schon irgendwie lustig. Zumindest versuche ich, es lustig zu finden. Ich kann ja schließlich nicht immer, wenn mir irgendwas nicht gefällt, gleich einen Tobsuchtsanfall kriegen.« Sie klopft auf die Theke. »Willkommen im Leben von Bailey Jansen. Niemanden kümmert es, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Und wenn ich mal laut werde, bin ich genau wie meine Brüder.«
Sie lächelt mich an, und dieses Lächeln sagt deutlich: Dubistwirklichnaiv. Ich werde wütend. Wütend um ihretwillen. Wütend auf eine Stadt, die zu mir und meiner Familie immer so gut war, aber diese Frau, die nie um die Karten gebeten hat, die ihr ausgeteilt wurden, so unglaublich schäbig behandelt.
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Earl aufsieht und Baileys Hintern mustert.
Und das wird wohl der Grund dafür sein, dass ich aufstehe.
Die Bar entlanggehe.
Direkt auf Earl zu.
Er ist so in seine Fantasien vertieft, dass er nicht mal bemerkt, dass ich auf einmal hinter ihm stehe. Ich sehe Bailey nicht an, weil ich weiß, dass sie mich mit einem stummen Blick anflehen wird, es nicht zu tun.