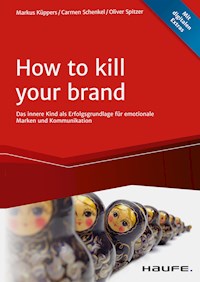
43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Marketingkampagnen dienen dazu, Konsumenten emotional mitzureißen. Unser inneres Kind ist der emotionale Entscheider für und gegen Marken und damit das wichtigste Erfolgskriterium aus Marketingsicht. Anbieter, die das innere Kind abholen, sind erfolgreicher: die Autoren zeigen, wie Coca-Cola, Nestlé, Fisherman's Friend, Bosch, Commerzbank, u.v.m. das tun - oder auch nicht tun! Die Matroschka versinnbildlicht eine ideale Sichtweise auf den Menschen: Die kleine Figur repräsentiert das innere Kind, und die äußere Schicht unsere Benutzeroberfläche. Zwischen beiden kommt es immer wieder zu Konflikten, die Marken mit der richtigen Botschaft lösen können. Dieses Buch zeigt, wie Emotionsforschung dem Marketing eine Entscheidungsgrundlage bieten kann, um das innere Kind nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch optimal anzusprechen und bietet fundierte Grundlagen für die vielen enthaltenen Praxisbeispiele. Einen tieferen Einblick bietet auch der Blogartikel: neuromarketing-wissen.de/artikel/die-unterschatzte-rolle-der-tiefenpsychologischen-forschung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumGeleitwortVorwort1 Fehler Nr. 1: Huldige dem Homo oeconomicus1.1 Die Abkehr vom Menschenbild des Homo oeconomicus1.2 Das überholte Prinzip der Transparenz1.3 Ohne Customer Centricity geht es nicht2 Fehler Nr. 2: Ignoriere das innere Kind in Deinen Kunden2.1 Einführung in die Dualität des Menschen2.2 Die verborgene Seite des Kunden2.3 Die Psyche als Schichtenmodell2.4 Eine neue Definition von Consumer Insights2.5 Das Me-und-I-Markenmodell3 Fehler Nr. 3: Höre nur auf Dein Bauchgefühl3.1 Der Preis der Ignoranz: Das New-Coke-Beispiel3.2 Intuition, Dein falscher Freund3.3 Alles beginnt mit den richtigen Fragen4 Fehler Nr. 4: Unterschätze die Rolle tiefenpsychologischer Forschung4.1 Psychologische Repräsentativität4.2 Marktforschung: Sichtflug statt Blindflug4.3 Die Auswertung von Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews5 Fehler Nr. 5: Ignoriere moderne Marktforschungsmethoden5.1 Verbraucher ticken nach uralten Regeln5.2 Emotionen sind fest mit dem Körper verdrahtet5.3 Emotionen sind messbar5.4 Kontextbasierte Vermessung des Unbewussten5.5 Art und Messpunkte der Biosignale5.6 Die sieben emotionalen KPI5.7 Die Aufbereitung der emotionalen KPI6 Fehler Nr. 6: Fokussiere Dich auf nur eine Sache6.1 Die tiefenpsychologische Analyse ergänzt die emotionalen KPI6.2 Emotionsmessung ist nicht gleich Emotionsforschung7 Fehler Nr. 7: Mache jede Erfahrung selbst7.1 Mut zur Empfehlung: Verbale Stimuli richtig evaluieren7.2 Die Macht der inneren Bilder7.3 Die Entdeckung der emotionalen Innenwelt bei B2B-Zielgruppen7.4 Imagewerbung im internationalen Umfeld7.5 Projektion in Werbespots7.6 Der Impact der Medien auf die Wirkung der InhalteAusblick: Die richtigen Fragen stellenAbbildungsverzeichnisLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisDie Autorinnen und AutorenArbeitshilfen OnlineHinweis zum Urheberrecht
Haufe Lexware GmbH & Co KG
[6]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-14311-7
Bestell-Nr. 10565-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-14315-5
Bestell-Nr. 10565-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-14316-2
Bestell-Nr. 10565-0150
Markus Küppers / Carmen Schenkel / Oliver Spitzer
How to kill your brand
1. Auflage, Februar 2021
© 2021 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Bildnachweis (Cover): © kosoff, Adobe Stock
Produktmanagement: Judith Banse
Lektorat: Peter Böke
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
[9]Geleitwort
von Tor Nørretranders
You are the only one that does not know you
Many years ago, I was struck by a huge surprise when watching myself hosting a monthly science series on Danish television (DR): »Look how incredibly affected I behave when talking on TV – constantly waving my hands, raising my eyebrows, looking stunned,« I said to my friends. »But you’re like that all the time,« they responded.
It dawned on me that I was the only person in my circle of acquaintances that did not have a clue as to how I appear from the outside. All I knew was what the world and all the other people in it looked from my inside. I only knew of my own outside from looking into a mirror – and what you see there is a person who is not engaging in social interactions, a kind of mummy-like mask. I realized that I knew less about me than everyone else did.
Trying to understand all of this led to the book »The User Illusion«/»Spüre die Welt« with its theory of the I and the Me: One is not conscious of most of what is going on inside oneself. The conscious I is a somewhat pompous comical CEO, not well-informed about the real state of affairs in the company. The Me, the real operation going on, mostly ignores the self-important I.
You could call that a chilling fact, somewhat disturbing. Or you could call it a very liberating fact.
Years later it also led to the formulation of »Nørretranders’ Law of Symmetrical Relief« published on the leading American science website Edge.org: »If you find that most other people, upon closer inspection, seem tobe somewhat comical or ludicrous, it is highly probable that most other people find that you are in fact comical or ludicrous. So you don’t have to hide it, they already know.«
They all know your inner child. Stop hiding it. Set it free and enjoy.
How to kill your brand will show you how unleashing the inner child will also make sense in your professional life.
[11]Vorwort
»Haufe hat angerufen, wir schreiben das Buch.« Auf diese gute Nachricht folgten Monate des Diskutierens, Skizzierens und Wiederverwerfens. Daneben Marktforschungsprojekte für Kunden, Meetings und, so gut es geht, Privatleben. Dann, nach dem Sommerurlaub, der sich Corona-bedingt nicht wie Urlaub anfühlte, stand schlagartig die natürlich längst bekannte Deadline im Raum, und uns wurde klar: Ein Buch schreibt sich leider nicht dadurch, dass man ganz oft darüber spricht. Dabei gibt es viel zu sagen: Das innere Kind ist die zentrale Leitfigur dieses Buches. In den Jahren unserer Arbeit bei september Strategie & Forschung haben wir gelernt, dass Menschen nicht einfach nur Entscheidungen treffen. Zu einem Produkt oder einer Marke zu greifen, ist das Ergebnis eines spannungsvollen, auch kreativen Prozesses im Inneren der Psyche. Diesen zu verstehen und sichtbar zu machen und in praktische Empfehlungen zu übersetzen, ist unsere Mission. Ob durch tiefenpsychologische Methoden, repräsentative Studien oder psychophysiologische Verfahren: das Ziel ist das gleiche – zu verstehen, was Menschen umtreibt und wie sie wahrnehmen.
Das erfordert allerdings auch Einblicke in das eigene Selbstverständnis. Wer kann Verbraucher verstehen, ohne sich selbst zu verstehen? Oft gleicht unsere Arbeit einer Mischung aus Goldschürfen, Beichte und Zahnarztbesuch. Erkenne Dich selbst: das ist bei uns kein Sprichwort, sondern gelebtes Handwerk und übrigens Einstellungskriterium. Dieses Buch soll daher nicht nur die Essenz unserer Erfahrung widerspiegeln, sondern durch die Anekdoten und Geschichten auch den Spaß und die Leidenschaft reflektieren, die wir für unsere Arbeit mitbringen und erleben. Obwohl Fachbuch, ist dieses Buch sowohl Erlebnisbericht unserer Geschichte als september als auch der Anfang einer spannenden Entwicklung, wo auch immer sie uns hinführt. Let’s go.
[13]1Fehler Nr. 1: Huldige dem Homo oeconomicus
1.1Die Abkehr vom Menschenbild des Homo oeconomicus
Die drei Kränkungen der Menschheit
Die Menschheit hatte es nie besonders leicht. Nicht nur diverse umweltbedingte Einflüsse wie Eiszeiten, Dürren, Vulkanausbrüche und vieles mehr machten das Fortkommen und die Entwicklung hin zu dem, was wir heute sind, äußerst mühsam. Aber da gab und gibt es eine Erschwernis, die im großen Rahmen der menschlichen Evolution gerne übersehen wird: Der Mensch stand sich ganz oft selbst im Weg, und zwar in Form seines übergroßen Egos. Bahnbrechende Erkenntnisse im Laufe der Zeit wollte die Menschheit einfach nicht wahrhaben, und oft zog sie die arrogante Sicherheit dem Dunkel der unheimlichen Unkenntnis vor. Und so sprach Sigmund Freud in einem Aufsatz von 1917 von den drei Kränkungen der Menschheit, die trotz ihrer offensichtlichen wissenschaftlichen Beweislage den menschlichen Stolz so stark verletzt haben, dass man sie lange nicht wahrhaben wollte – und häufig bis heute nicht wahrhaben will.
Die ersten zwei Kränkungen sind schnell erzählt. Die kopernikanische Erkenntnis, dass die Erde nicht Mittelpunkt des Universums ist, war der Menschheit lange Zeit ein Dorn im Auge. Die zweite Kränkung betrifft die Abstammung des Menschen vom Tier, die Darwin 1899 in seinem Werk »Die Entstehung der Arten« dargelegt hat. Der Zoologe Oskar Heinroth legte hier noch eine Extrakränkung drauf: Nicht nur unser Körperbau stammt vom Affen ab, sondern auch unser Verhalten! Es fällt uns also schwer zu begreifen, dass wir (in Freuds Worten) »nicht Herr im eigenen Haus« sind. Dementsprechend feindselig wurden die neuen Entdeckungen auch aufgenommen.
Die dritte Kränkung ist die, um die es in diesem Buch im Wesentlichen geht: die psychologische Kränkung durch das Unbewusste. Die Konfrontation mit etwas in uns, das Entscheidungen über unseren Kopf hinweg trifft und uns zu »Marionetten unseres Unbewussten« macht, wie es oft heißt. Die Erkenntnis, dass der Mensch nicht aus der Ratio und in voller Kenntnis seiner Beweggründe heraus Entscheidungen trifft, sondern gesteuert von »dunklen Kräften«, die in ihm selbst liegen, ist auch heute noch den meisten nicht ganz geheuer. Vor dem Hintergrund der Aufklärung, die in alles Licht und Transparenz bringen und so erklärbar machen wollte, kam die Behauptung einer wie auch immer gelagerten inneren Autorität nicht so gut an – eine Autorität, die einen eigenen Willen zu besitzen schien und die unseren Verstand einfach übertölpeln kann. Das durfte nicht sein! Zumal da nicht nur eine unkontrollierbare Instanz war, sondern [14]gleich zwei: Freuds Es und Über-Ich. Insbesondere seine Ausführungen zu Libido und Destrudo, dem Lust- und Todestrieb, strapazierten das souveräne Ego seiner Zeitgenossen so stark, dass seine Erkenntnisse äußerst polarisierend wirkten. Bis heute.1
Wie der Homo oeconomicus vor Starbucks kapituliert
Marketing, und damit Markforschung, ist ein Spiegel der Entwicklung von Akzeptanz und Reaktanz der gängigen Menschenbilder. Der amerikanische Marketing-Papst Philip Kotler und sein verlängerter akademischer Arm in Deutschland, Heribert Meffert, definierten Marketing als Wissenschaft, in der allenfalls die experimentelle Psychologie einen Platz hatte und in der stets von »Bedürfniserfüllung« die Rede war. Diese Sichtweise geht einher mit der volkswirtschaftlichen Betrachtung des Menschen als Homo oeconomicus. Spötter erzählen sich, die Überreste des Homo oeconomicus seien beim Bau des ersten Kasinos in Las Vegas gefunden worden. In Wahrheit ist der Homo oeconomicus ein Erklärungsmodell für menschliches Entscheidungsverhalten. Er ist ein Konstrukt, das Menschen und insbesondere Verbraucher als Wesen versteht, die Bedürfnisse präzise erkennen und sie dann möglichst effizient und effektiv erfüllen. Dem Preis als Marketingmaßnahme (eines der vier »P« in Kotlers Marketingmix aus Price, Promotion, Product und Place) kommt im Rahmen dieses Menschenbildes ein besonderer Stellenwert zu, ist er doch für den Homo oeconomicus eine relevante Stellschraube in der zielstrebigen Erfüllung seiner Bedürfnisse. Was die Volkswirtschaftslehre nach und nach mit dem Zweig der Behavioral Economics beschrieb (um das Irrationale im Menschen zu erklären), fand in der Betriebswirtschaftslehre und im Marketing Berücksichtigung unter dem Schlagwort »emotional Need«. Der Homo oeconomicus würde bei Starbucks angesichts des Preises für einen Venti Latte wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch erleiden.
Der »emotional need« bezeichnet also alles, was Menschen an komischen Bedürfnissen verspüren, die über Durst, Hunger etc. hinausgehen. Das emotionale Bedürfnis ist so etwas wie die »bad bank« des Marketings. Hier findet alles Platz, was nicht rational erklärt werden kann.
In Briefingformularen an Agenturen hat der »emotional need« (oder »emotional insight«) seinen festen Platz, gleich neben dem »functional need«.2 Die Trennung zwi[15]schen rational/funktional und emotional ist der etablierte Versuch, der Hybris des Konsumenten habhaft zu werden. Irgendwie muss das irrationale Element mit aufgenommen werden! Die Auffassung der Ratio/Emotio-Dualität hält sich hartnäckig, z. B. in Bildern wie rechte/linke Gehirnhälfte, Kopf/Bauch u. v. m. Diese Sichtweise ist auch heute noch sehr populär, erklärt aber nicht, nach welchen Kriterien oder Prozessen Ratio und Emotio bei Entscheidungen zusammenkommen. Welche Instanz ist relevanter und hat bei Entscheidungen die Oberhand? Woraus bestehen Konflikte zwischen Kopf und Bauch? Sind rationale und emotionale Bedürfnisse immer konträr? Es gibt viele offene Fragen. Und so stehen »emotional need« und »functional need« in Briefings nebeneinander wie Geschwister, die bei der Geburt getrennt wurden.
1.2Das überholte Prinzip der Transparenz
»Um Emotionen kümmert sich meine Frau, ich verkaufe Schrauben.«
Emotionale Verbraucherbedürfnisse wurden lange Zeit geleugnet, und noch heute tun sich insbesondere in technischen oder B2B-Bereichen Entscheider schwer, emotionale Bedürfnisse überhaupt anzuerkennen. Daher rührt auch das Zitat eines baden-württembergischen Schraubenherstellers. Ihre Existenz und auch Notwendigkeit hat sich zwar mittlerweile im Marketingumfeld vieler Anbieter herumgesprochen (und die »big spender« gehen ganz selbstverständlich damit um), aber das heißt noch lange nicht, dass alle darunter das Gleiche verstehen. »Emotional needs« erfahren in der Marketingpraxis eine oft unerträgliche Vereinfachung. Wo kommt diese Vereinfachung her und was ist damit genau gemeint?
Die Vereinfachung von emotionalen Bedürfnissen leitet sich ab aus der fatalen Verwechslung von Emotionen und Gefühlen. Emotionen, so wird jeder Mensch bestätigen, sind bewusst erlebbar, auch wenn tatsächlich Gefühle gemeint sind. Und Gefühle sind, nun ja, fühlbar. Wer lacht, weint, trauert oder eifersüchtig ist, der erkennt das auch. Der amerikanische Wissenschaftsautor Malcolm Gladwell diskutiert dies in seinem Buch »Talking to Strangers« unter dem Stichwort »Transparency«: Transparenz ist ein (u. a. durch ihn erneut widerlegter) Glaube, dass Menschen das, was sie fühlen, durch ihr Verhalten und ihre Mimik nach außen verständlich transportieren und für jedermann lesbar machen. Schuldige Menschen sehen schuldig aus, unschuldige eben unschuldig, voilà. Das passt hervorragend zum Menschenbild des vorhersehbaren, transparenten Homo oeconomicus.
Abb. 1: Der amerikanische Wissenschaftsautor Malcolm Gladwell (Quelle: Flickr, Foto: Kris Krüg)
Denn wenn der Mensch schon Emotionen hat, dann versteht man sie auch. Daher sind diejenigen Emotionen, die man Verbrauchern unterstellt, denkbar simpel. Beispielsweise wurde in unzähligen Produktkonzepten der vergangenen Jahre und Jahrzehnte Verbrauchern »Freude«, »Neugier« oder das Bedürfnis nach »Abwechslung« und »Lifestyle« unterstellt – abgesehen davon, dass es sich bei diesen Dingen oftmals gar nicht um Gefühle oder gar Emotionen handelt, sondern allenfalls um »emotionale Zustände«, die ein Neuprodukt bedienen soll. Kann ein Brotaufstrich das Bedürfnis nach Freude erfüllen, oder handelt es sich um etwas anderes? Und, wenn ja, ist das nicht ein wenig zu hoch gegriffen? Und wenn wieder ja, machen das andere Brotaufstriche nicht auch? Die Überdramatisierung und Generalisierung völlig basaler emotionaler Bedürfnisse, die ein Produkt oder eine Marke angeblich bewirkt, führt in Marktforschungsuntersuchungen zuverlässig zu Abstoßungsreaktionen (Reaktanz) durch Verbraucher, die das Ganze als Marketing-Sprech demaskieren.3 Erschwerend kommt hinzu, dass das Prinzip der (zurecht) von Gladwell in Frage gestellten Transparenz immer noch allzu häufig das »guiding principle« der Marktforschung ist. Menschen wird die Fähigkeit zugesprochen, fundiert über ihre emotionalen Bedürfnisse zu sprechen. Das treibt seltsame Blüten, wenn z. B. Verbraucher in Gruppendiskussionen behaup[17]ten, stets die Rückseite von neuen Lebensmittelprodukten durchzulesen oder immer mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zu kaufen. Marketing-Entscheider reagieren auf diese Aussagen schon mal mit Erleichterung, weil die inhärente Logik solcher Konsumentenprozesse so nachvollziehbar, so transparent klingt. Der Verbraucher ist also doch kein Rätsel! Aber wie der amerikanische Journalist Henry Louis Mencken formulierte: »There is always a well-known solution to every human problem — neat, plausible, and wrong.« Der Geist des Homo oeconomicus, er ist noch nicht ganz ausgetrieben.
Plädoyer für Menschenbilder
Unter den prominenten Fürsprechern des aufgeklärten Menschenbilds des Homo oeconomicus ist der Australier Byron Sharp, der den rational gesteuerten Menschen zum neuen (alten) Ideal erhebt. Seine Argumentation findet in der Marketingszene breites Gehör, polarisiert aber auch. Seine Ausführungen zum »evidence-based Marketing« beinhalten die offene Kritik am Konstrukt des emotionalen Benefits von Marken und Produkten. Er verwendet in Vorträgen den Begriff der »Psycho Babble«, des psychologischen Gewäschs in Gruppendiskussionen: Psycho Babble ist nach Sharp das, was Verbraucher in Gruppendiskussionen mit esoterischen Worten als ihr seelisches Innenleben beschreiben, wenn sie an Marke X denken. Der spöttische Unterton kommt daher, dass er offenbar glaubt, dass diese allzu blumige Verbrauchersprache eher dem eigenen Antrieb entspringt, sich selbst reden zu hören, als der authentischen Wiedergabe von empfundenen Markenbedürfnissen. Und damit liegt er manchmal gar nicht so falsch.
»Psycho Babble« ist mit Sicherheit ein Problem, das wir im Methodenteil in den Kapiteln 4 und 5 aufgreifen. Festzuhalten ist aber dies: Nur weil es inkompetente psychologische Moderatoren und Analystinnen gibt, kann man nicht die Existenz seelischer Bedürfnisse als Ganzes in Abrede stellen.
Nun kann man Sharp für sein Menschenbild kritisieren. Aber man muss ihm zugutehalten, dass er überhaupt eines hat und sich wenigstens eine Vorstellung davon macht, wie der Konsument tickt. Die gängige Unschärfe, was »emotional needs« sind und wie Menschen Produkte und Marken wahrnehmen, führt im Zweifel zu generischen oder irrelevanten Produkten und oberflächlicher Kommunikation. Denn gar kein Menschenbild zu haben, macht Marketing zu einem Blindflug voller Überraschungen, da Entscheider nicht wissen, wie die qualitativen und quantitativen Informationen aus Research-Projekten zu interpretieren sind. Die Ergebnisse mögen spannend sein, aber eben äußerst willkürlich.
»Wenn man ein Hammer ist, sieht alles aus wie ein Nagel.«
Dieser Werbespruch zierte vor Jahren die Website eines Hamburger Marktforschungsinstituts. Er sollte als plakativer Beleg dienen für die Engstirnigkeit, die sich aus der [18]Festlegung auf ein Menschenbild ergibt. Und es stimmt: Wer sich auf ein Menschenbild festlegt, schließt damit andere Menschenbilder aus. Aber die Festlegung darauf, wie Menschen grundsätzlich »ticken«, ermöglicht eine fokussierte Herangehensweise an Positionierungen und Botschaften. Wie soll man beispielsweise aus den Wortprotokollen von 50 tiefenpsychologisch befragten Marktforschungsteilnehmerinnen und -teilnehmern (das sind etwa 700 DIN-A4-Seiten) schlau werden, wenn man nicht weiß, worauf es bei der Auswertung ankommt – getreu dem Goethe-Zitat »Man sieht nur, was man weiß«. Und das, was man findet, muss man dann erst einmal einordnen und priorisieren – eine Aufgabe, die ohne Menschenbild nicht funktioniert. Wenn das Marketing Entscheidungen auf einer bestimmten Annahme darüber fällt, wie Menschen ticken, ist es ratsam, diese Annahmen transparent zu machen und sich für ein Menschenbild zu entscheiden.
1.3Ohne Customer Centricity geht es nicht
Good mothers have dirty floors
Wir befinden uns auf einem Marketing-Workshop an einem heißen Sommertag im Juli. Der Brand-Manager eines deutschen Herstellers von Reinigungstools klagt, während er sich den Schweiß von der Stirn wischt, dass man ja tolle Produktideen mit den faszinierendsten Mechanismen in der Schublade habe, aber dass die Benefits dieser Produkte immer gleich klingen. So habe man also über die Zeit nahezu identische Produktkonzepte produziert, die sich lediglich in der Produktbeschreibung unterscheiden. Stets geht es in der Beschreibung des Insights und des Benefits um Zeitersparnis, Bequemlichkeit oder ein besseres Putzergebnis. Mit Produkt X kann man die gleiche Arbeit entweder besser machen bzw. schneller oder sie weniger aufwendig erledigen. Die Konzepte würden austauschbarer, und in Tests reagierten die Konsumenten auch immer weniger positiv. Das Marketing wolle »emotional differenzierendere« Konzepte schreiben, um die Produkte »uniquer« zu positionieren. Dazu fehle es den Produktmanagern aber an Fantasie.
Was ist hier das Problem, das der Brand-Manager beklagt? Liegt es daran, dass dem Hersteller die Produktideen ausgehen? Oder dass Verbraucher einfach nur diese drei Bedürfnisse haben? Nein und nein. Das Spektrum der Bedürfnisse, die neue Reinigungsprodukte erfüllen, ist zu eng gefasst. Die »emotional needs« bzw. Insights sind in der bisherigen Denke unterrepräsentiert. Zeitersparnis und Arbeitserleichterung sind streng genommen nicht besonders emotional und, wo wir schon dabei sind, auch nicht universal. Manche Menschen putzen z. B. gerne und investieren Zeit, weil sie sich dann endlich mal auf eine Sache konzentrieren können. Sie wollen sich am Putzen »abarbeiten«. Dann geht es um Psychohygiene, dann darf die Arbeit nicht leicht von der Hand gehen. Mindestens ebenso relevant sind die Konflikte, die sich aus dem Versprechen von Zeitersparnis und Arbeitserleichterung an neuer Stelle ergeben. Viele [19]haben kraft ihrer Sozialisation immer noch das Problem, dass sie ihren Selbstwert ein Stück weit über die geleistete Putzarbeit definieren.4 Geht es zu schnell und einfach, empfinden das bestimmte Zielgruppen als unzulässige Abkürzung: So kann das Ergebnis ja nicht gut werden, und was für eine Hausfrau, was für ein Hausmann bin ich dann? Wieder andere Konsumentinnen und Konsumenten wollen nur so schnell wie möglich fertig werden, weil sie entweder vielbeschäftigt sind oder einfach nur das Putzen hassen. Diese Menschen akzeptieren Abkürzungen, solange das Reinigungsergebnis mit Duft und Glanz das implizite schlechte Gewissen, nicht ordentlich geputzt zu haben, kompensiert. Das Beispiel zeigt: Selbst dem äußerlich so trivialen Umfeld wie dem Putzen wohnt eine emotionale Dramaturgie inne, die nicht nur eine differenzierte Betrachtung unterschiedlicher Gruppen erforderlich macht, sondern das lineare Denken vom Bedürfnis zum Benefit schwer macht, weil Verbraucher Konflikte haben. Sie möchten das eine und gleichzeitig das andere. Sie möchten z. B. ein sauberes Ergebnis, aber gleichzeitig ein gutes Gewissen, auch wenn sie eigentlich eine Abkürzung suchen. Andere brauchen das Gefühl, am Ende des Putzens ausgepowert zu sein – für sie wäre eine Abkürzung völlig kontraproduktiv!
Was der Hersteller von Reinigungstools eigentlich beklagt, ist zum Ersten das Fehlen eines Menschenbildes: Nach welchen psychologischen Algorithmen funktioniert der Verbraucher? Worauf ist bei der Produktpositionierung zu achten? Zum Zweiten hat man (als Konsequenz aus dem fehlenden Menschenbild) in der Vergangenheit nicht die richtigen Fragen gestellt. Wenn in Forschungsprojekten Verbraucher befragt wurden, was an spezifischen Reinigungsprodukten relevant und attraktiv ist (und was nicht), hat man bei den Antworten »Zeitersparnis«, »Arbeitserleichterung« und »besseres Ergebnis« offenbar Halt gemacht – viel zu früh, wie sich herausstellt. Man ist dem Paradigma der Transparenz gefolgt: Was Menschen als Bedürfnis formulieren, das empfinden sie auch. Mehr zu fragen würde heißen, sie unsachgemäß zu beeinflussen.
Aus der kleinen Geschichte ergeben sich zwei wichtige Konsequenzen:
Zum Ersten brauchen Markenverantwortliche ein Menschenbild, und möglichst eines, das nicht Homo oeconomicus heißt . Zum Zweiten müssen sie wissen, wie sie an die »emotional needs« herankommen und die richtigen Fragen stellen, weil der Mensch sich nun mal nicht transparent verhält.
[20]Schlaflose Nächte
Die dritte Konsequenz versteckt sich etwas zwischen den Zeilen und gehört streng genommen in ein eigenes Buch. Das (falsche) Paradigma der Transparenz, das sich aus dem Menschenbild des Homo oeconomicus ergibt, hat eine tagtägliche negative Konsequenz für die Marketingarbeit. Wie zuvor schon erwähnt, ist es üblich, für neue Produkt- oder Kommunikationsideen ein Verbalkonzept zu schreiben, das im ersten Abschnitt einen Insight oder Customer Insight aufführt. In vielen Marketingabteilungen, insbesondere denen, die sich »Customer Centricity« auf die Fahnen schreiben (oft FMCG-Branchen5), soll dieser Insight ein emotionales, möglichst unbewusstes – und damit überraschendes – Motiv widerspiegeln. Der zweite Abschnitt, der Benefit, soll diesen Insight dann bedienen. Dahinter steckt die Annahme, dass unbewusste Insights umso mächtigere Verhaltenstrigger sind, als sie sich der verstandesmäßigen Kontrolle entziehen. Und hier tut sich ein großes Paradoxon auf: Würde man einem Konsumenten oder einer Konsumentin einen wahren unbewussten Insight präsentieren, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass diesem Insight in einem Konzepttest energisch widersprochen wird. Aber warum? Wer kann sich dem Reiz des Unbewussten schon entziehen?
Die Antwort liegt auf der Hand: Dinge sind unbewusst, weil die Psyche sie sich nicht bewusst machen will. Es hat einen Grund, warum Motive verdrängt werden. Meistens dann, wenn sie dem Ego abträglich sind, d. h. dass man sie sich nicht eingestehen möchte. So würde die Mutter eines Säuglings beispielsweise alles für ihr Kind tun – das ist eine Binsenweisheit. Sie möchte aber auch einmal durchschlafen. Denn Mutter zu sein, ist auch mit Schlaf schon schwer, aber ohne Schlaf fast nicht zu schaffen.6 Eine Pampers-Windel, die das Baby möglichst lange schlafen lässt, auch wenn sie voll ist, müsste demnach ein Erfolg sein (ist sie auch). Aber trug das ursprüngliche Konzept, das die Produktidee beschreibt, den Insight, dass man als Mutter einfach mal schlafen möchte? Procter & Gamble fand heraus, dass dies zwar ein Bomben-Insight ist, man ihn den Müttern aber um Himmelswillen nicht unter die Nase reiben darf. Denn die meisten Mütter verbieten es sich, egoistische Bedürfnisse anzuerkennen, wenn sie dabei nicht das Bild der perfekten Mutter abgeben oder dies irgendwie zu Lasten des Babys gehen könnte. Und so darf es nicht sein, dass die Windel eines Babys nachts nicht sofort gewechselt wird, wenn sie voll ist, weil das Baby sich dann unwohl fühlen könnte, die Babyhaut gereizt wird usw. Der »offizielle« Insight betonte daher die Nachtruhe des Kindes und die Frage, wie wichtig Schlaf für die Entwicklung ist. Kein Wort vom Vorteil für die Mutter. Aber die Psyche ist schlau: Das Unterbewusstsein der Mütter liest aus dem Benefit der Durchschlaf-Windel Ego-Vorteile heraus, auch wenn sie nur indirekt angedeutet sind.
[21]Und so wurde die Kommunikation auf einen zweischichtigen Insight gestellt: der »offizielle« emotionale, sehr bewusste Insight des Kindeswohls, dem keine Mutter widerspricht. Und der versteckte, aber umso mächtigere Ego-Insight für die Mutter, der dringend benötigter Schlaf fehlt.
Ein unbewusster Insight kann daher extrem wirksam sein, er darf aber nicht das Licht der Welt erblicken, getreu dem Motto: Unbewusstes muss unbewusst bleiben. Das Wichtige ist, dass der Benefit des Produkts einen mächtigen unbewussten Insight triggert und dieser Insight nicht thematisiert wird. Da aber das Insight-Feld im Konzeptformular ausgefüllt werden muss, mühen sich Scharen von Produktmanagern seit Jahrzehnten ab, Insights zu finden, die sie nachvollziehen können (also bewusst sind) und die einigermaßen auf den Benefit des Produkts passen. Die Folge: generische, relativ erwartbare Insights – genau das, was der Brand-Manager des Herstellers von Reinigungstools beklagte.
Traumhafte Insights
Als Sigmund Freud 1899 seine »Traumdeutung« veröffentlichte, legte er darin die Blaupause fest, wie ca. 120 Jahre später unbewusste Insights für Produktkonzepte wirken. Laut Freud befasst sich das Unbewusste im Traum mit verborgenen, auch verbotenen, Sehnsüchten und Wünschen. Ein Traum ist in diesem Sinne eine bis zur Unkenntlichkeit codierte Wunscherfüllung. Der manifeste Trauminhalt, also das, was man beim Aufwachen erinnert (und was so selten Sinn ergibt), ist, so Freud, eine verfremdende Übersetzung des latenten Trauminhalts, also der Geschichte vom unbewussten Wunsch.
Abb. 2: Sigmund Freud (Quelle: Wikimedia, Foto: Max Halberstadt, 1921)
Geträumte Bilder und latente Trauminhalte sind in dieser Hinsicht zwei Darstellungen der gleichen Sache; die eine bewusst akzeptabel, die andere verboten und verdrängt. Der gute Kinderschlaf auf der offensichtlichen Traumbild-Seite und das dringende, aber moralisch schwierige Ego-Motiv der Mutter auf der Sehnsuchtsseite: Es scheint, als hätte Freud die Herausforderungen des Marketings im 21. Jahrhundert vorhergesehen. Egal, ob Träume die Funktion der Wunscherfüllung oder (wie viele Psychologen mittlerweile glauben) auch die Funktion der Konfliktbewältigung erfüllen: Die Dualität des Traumes ist eine nützliche Herangehensweise an die Entwicklung von Kommunikation, sofern man sich mit der Macht des Unbewussten beschäftigt.
Und schon sind wir mitten drin in einem Menschenbild, das dem Homo oeconomicus komplett zuwiderläuft.
[23]Summary zu Kapitel 1
In der Marketingarbeit ist es wichtig, ein Menschenbild zu haben, um das Verbraucherverhalten besser einzuordnen und zu verstehen. Das Menschenbild des Homo oeconomicus eignet sich nicht, da es die Irrationalität von Verbrauchern nicht erklären kann, denn der Mensch gehorcht emotionalen Bedürfnissen, die sich mit dem utilitaristisch geprägten Verstand allein nicht nachvollziehen lassen. Unter dem Namen »Emotional Needs« oder »Emotional Insights« haben diese Bedürfnisse im Marketing zwar ihren Platz, aber sie werden in der betrieblichen Praxis häufig unzulässig vereinfacht und verallgemeinert dargestellt. Denn es wird zu oft davon ausgegangen, dass Emotionen – wie Gefühle – nachvollziehbar sind und sich bewusst erfassen lassen. Deshalb tut sich das Marketing immer noch schwer, Motive zu identifizieren, die sich dem Bewusstsein der Verbraucher entziehen. Die Folge sind häufig triviale, generische Produkt- und Kommunikationskonzepte. Dabei sind unbewusste Insights mächtige Erfolgstreiber, solange sie (analog zu den latenten Trauminhalten Freuds) unterhalb der bewussten Wahrnehmungsschwelle gespielt werden.
1 Sascha Lobo postulierte anlässlich der Enthüllungen durch Edward Snowden die vierte, digitale, Kränkung.
2 Procter & Gamble wird die »Erfindung« der häufig verwendeten Briefing- und Konzeptstruktur »Insight«, »Benefit« und »Reason-to-believe« oder auch »Reason Why« zugesprochen. Das darin zugrunde liegende Narrativ folgt der Logik, dass der Benefit (= Vorteil, Mehrwert) des Produkts auf ein entsprechendes Bedürfnis antworten muss. Als letzter Baustein gibt der Reason-to-believe die Antwort darauf, wie glaubwürdig oder transparent dieser Mehrwert zustande kommt. Marketer und Agenturen folgen dieser bewährten Struktur seit Jahrzehnten – zu Recht, da sie den Entscheider zwingt, präzise zu formulieren, welche Daseinsberechtigung das Produkt im Kopf bzw. Leben des Verbrauchers hat. Das heißt aber nicht, dass sie nicht verbesserbar wäre.
3 Es ist heute ein übliches Problem, dass das Testen von Produktkonzepten zu falschen Entscheidungen führt, was multiple Ursachen hat. Die häufigste Ursache ist die Verwechslung von Konzeptablehnung mit Produktidee-Ablehnung. Befragte Verbraucher können eine gute Idee nicht akzeptieren, wenn sie schlecht formuliert ist. Umgekehrt passiert es seltener: Eine schlechte Idee kann auch durch eine gute Formulierung nicht begeistern.
4 In vielen Produktbereichen werden Werte und Normen von Generation zu Generation weitergereicht. Der Anspruch an unbedingte Sauberkeit wurde in der Vergangenheit besonders typisch von der Mutter auf die Tochter übertragen, verbunden mit der Verknüpfung von gelebter Sauberkeit und Selbstwert als Hausfrau. Das öffnete im Laufe der Nachkriegsgeschichte die Schere zwischen Ansprüchen und Realität, da die Bereitschaft, sich für die Haushaltshygiene »aufzuopfern«, zunehmend nachgelassen hat bzw. vehement abgelehnt wird. Entsprechend populär in solchen Haushalten sind heute affirmative Schilder mit dem entlastenden Spruch: Good mothers have dirty floors … and happy kids.
5 Fast Moving Consumer Goods (FMCG).
6 Es soll angeblich Babys geben, die durchschlafen.
[25]2Fehler Nr. 2: Ignoriere das innere Kind in Deinen Kunden
2.1Einführung in die Dualität des Menschen
Peter Fox und das zweite Gesicht
Daniel Levitin, amerikanisch-kanadischer Neuropsychologe und Musiker, erzählte in der New York Times von seiner denkwürdigen Erinnerung an einen Personenaufzug. Beim Betreten fiel ihm auf, dass alle Etagenknöpfe leuchteten – als ob ein Kind Spaß daran gehabt hätte, wahllos auf alle Knöpfe zu drücken. In diesem Moment erinnerte sich Levitin sehr deutlich daran, dass er das als Kind auch getan hatte, und wunderte sich: »Meine Erinnerung daran, zehn Jahre alt zu sein, ist klarer als die Erinnerung an Dinge vor zehn Tagen.« Und das, obwohl seine Kindheit viele Jahrzehnte zurück liegt.
Abb. 3: Die Fahrstuhlknöpfe leuchten, als hätte ein Kind wahllos auf alle Knöpfe gedrückt (Quelle: Unsplash, Foto: Arisa Chattasa)
Wir tragen die Erkenntnis mit uns herum, dass Erinnerungen mit der Zeit nun mal verblassen. Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass kindliche Erfahrungen mit dem Alter verschwimmen und verschwinden. Aber es gibt ganz andere Einflüsse auf die Lebendigkeit der Erinnerungen. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse widerlegen schon längst die Theorie des Alterns der Erinnerungen. Und ganz persönliche [26]Erfahrungen auch: Wenn Dinge dem Vergessen zum Opfer fallen, weil man altert, dann dürfte es nicht sein, dass ältere Menschen sich an Dinge aus ihrer Kindheit erinnern, die viele Jahrzehnte in ihrem Kopf »verschollen« waren. Kindheitserinnerungen altern nicht, sondern sie werden verdrängt, überlagert.
Konkret wird die Erinnerung an unsere Kindheit häufig durch Düfte und Melodien getriggert. Wer hat nicht schon einmal ein vergessen geglaubtes Lied wiedererkannt, verbunden mit der präzisen Erinnerung an das Wo und Wann dieses Erlebnisses in der Kindheit? Einer unserer Studienteilnehmer berichtete lebhaft von einer Erinnerung in der Lobby eines Moskauer Hotels, in dem der gleiche Song gespielt wurde wie in den 80er Jahren (»Halleluja« von Milk & Honey) im Tanagra-Theater des Phantasialands bei Köln, des besten Vergnügungsparks aller Zeiten. Die Erinnerung an sich sei schon überraschend gewesen, hatte er doch das Lied und überhaupt das ganze Tanagra-Theater komplett vergessen. Aber das plötzliche Zurückversetztsein in die Kindheit fühlte sich völlig real an – einschließlich der kindlichen Faszination und den Emotionen – und ein bisschen gruselig, weil (wie der Teilnehmer berichtete) er in diesem Moment seinen Emotionen völlig ausgeliefert war.
Was die beleuchteten Etagenknöpfe in Levitins Aufzug betrifft, so bleibt ungewiss, ob ein Kind oder tatsächlich ein Erwachsener alle Knöpfe gedrückt hatte. Erwachsene ertappen sich nicht selten bei kindlichen (dann oft kindischen) Handlungen, vor allem wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Die Liste der kindlichen Handlungen, derer man sich als Erwachsener vielleicht schämen würde, ist lang: Lauthals einen Radiosong im Auto mitsingen, sich vor Spinnen erschrecken, mit den Händen essen (obwohl es Besteck gibt), Kekse in Kaffee aufweichen, den Teddybär von damals im Bett haben, über ganz dumme Witze lachen – eine Aufzählung wäre endlos. Aber es gibt auch eine andere, eine dunkle Seite. Da sind nämlich auch unzählige literarische und sprachliche Referenzen (das sogenannte Doppelgängermotiv, vermutlich zurückgehend auf Dostojewskis Klassiker »Der Doppelgänger«) auf ein abgründiges Wesen in uns, eine zweite dunkle Natur, die unser Verstand nicht kontrolliert und deshalb fürchtet: Stevensons »Dr. Jekyll und Mr. Hyde«, Wildes »Das Bildnis des Dorian Gray«, Gogols »Die Nase« bis hin zu Peter Fox‹ Song »Das zweite Gesicht« zeigen den Einfluss dieses Sujets auf die Literatur und den gesellschaftlichen Kontext.
Abb. 4: Dr. Jekyll und Mr. Hyde (Quelle: National Printing & Engraving Company, Chicago)
Die unbewusste Macht, ob sie sich nun von ihrer kindlichen oder abgründigen Seite zeigt oder beides, scheint eine eigene Agenda zu haben – und diese Agenda muss von unserem Verstand häufig kontrolliert und gezähmt werden, damit wir lebens- und alltagsfähig sind. Der Mensch steht, wortwörtlich, unter Spannung. Konflikte zwischen der unbewussten Kraft und dem bewussten Verstand sind offensichtlich Stoff für zahlreiche Geschichten. Würde es weiterer Belege bedürfen, ließen sich psychiatrische Krankheitsbilder anführen wie z. B. »multiple Persönlichkeiten«, »Schizophrenie« bzw. »Borderline«, die eindrücklich zeigen, dass der Mensch ein konfliktgeladenes Wesen ist und diese Konflikte sogar krank machen können.





























