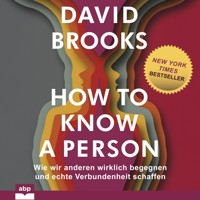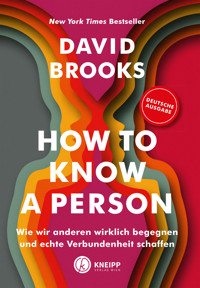
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kneipp-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Glück in jeder zwischenmenschlichen Beziehung speist sich aus der Fähigkeit, Menschen wirklich zu sehen. Aber in unserer hektischen Gesellschaft fühlen wir uns oft unsichtbar und missverstanden. Mit großer Neugier und dem Willen, als Mensch über sich selbst hinauszuwachsen, begibt sich David Brooks auf eine Reise, um herauszufinden, wie wir uns und anderen die Aufmerksamkeit schenken können, die wir verdienen und brauchen. Gemeinsam lernen wir, wahre Verbundenheit zu schaffen: mit den richtigen Fragen und einem tiefen Verständnis für uns selbst und andere. So bekommen wir die Chance, uns wirklich zu sehen und die Risse in unserer Gesellschaft zu überwinden. Mitreißend, einfühlsam und ehrlich: Das Buch für alle, die sich nach tiefer Verbundenheit sehnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Brooks
How to Know a Person
Wie wir anderen wirklich begegnen und echte Verbundenheit schaffen
Aus dem Englischen von Annika Tschöpe
Inhalt
TEIL 1: ICH SEHE DICH
Kapitel 1: Die Macht des Gesehenwerdens
Kapitel 2: Blind für andere
Kapitel 3: Erleuchtung
Kapitel 4: Begleitung
Kapitel 5: Was ist ein Mensch?
Kapitel 6: Gute Gespräche
Kapitel 7: Die richtigen Fragen
TEIL 2: ICH SEHE DICH IN DEINER NOT
Kapitel 8: Die Epidemie der Blindheit
Kapitel 9: Schwierige Gespräche
Kapitel 10: Wie steht man Verzweifelten bei?
Kapitel 11: Die Kunst der Empathie
Kapitel 12: Wie prägt uns unser Leid?
Teil 3: ICH SEHE DICH MIT DEINEN STÄRKEN
Kapitel 13: Persönlichkeit: Welche Energie strahlen wir aus?
Kapitel 14: Lebensaufgaben
Kapitel 15: Lebensgeschichten
Kapitel 16: Wie prägen unsere Vorfahren unser Leben?
Kapitel 17: Was ist Weisheit?
Dank
Anmerkungen
Personenindex
Impressum
Für Peter Marks
Teil 1— ICH SEHE DICH
EINS Die Macht des Gesehenwerdens
Kennen Sie den Filmklassiker Anatevka? Dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie herzlich und emotional es in jüdischen Familien zugehen kann. Alle fallen einander ständig in die Arme, singen, tanzen, lachen und weinen gemeinsam.
Ich stamme aus einer jüdischen Familie der anderen Art.
In meiner Kindheit galt die Devise: „Jiddisch denken, britisch handeln.“ Wir waren reservierte Leute, die ihre Gefühle stets unter Kontrolle hielten. Das soll nicht heißen, dass meine Kindheit nicht schön war – ganz im Gegenteil, ich empfand mein Zuhause als äußerst anregend. Bei Familienfesten wurden die Geschichte viktorianischer Grabmäler und die evolutionären Hintergründe der Laktoseintoleranz diskutiert (das stimmt wirklich!). Bei uns gab es Liebe. Wir haben sie nur nicht deutlich gezeigt.
Es mag daher nicht sonderlich überraschen, dass ich ein wenig distanziert war. Als ich vier Jahre alt war, sagte die Erzieherin im Kindergarten angeblich zu meinen Eltern: „David spielt oft nicht mit den anderen Kindern, sondern hält sich abseits und beobachtet sie.“ Ob angeboren oder anerzogen, eine gewisse Unnahbarkeit wurde Teil meiner Persönlichkeit. Auf der Highschool hatte ich mich dann endgültig in mich selbst zurückgezogen. Am lebendigsten fühlte ich mich, wenn ich mich der einsamen Tätigkeit des Schreibens widmen konnte. Mit etwa sechzehn Jahren hätte ich mich gerne mit einer jungen Frau namens Bernice verabredet, doch meine Erkundungen brachten zutage, dass sie sich für einen anderen Kerl interessierte. Ich war entsetzt. Noch heute weiß ich, dass ich damals dachte: „Was fällt ihr nur ein? Ich kann viel besser schreiben als dieser Typ!“ Gut möglich, dass ich nicht ganz durchschaute, was anderen in zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig war.
Als ich achtzehn war, kamen die Zulassungsstellen der Universitäten Columbia, Wesleyan und Brown zu dem Schluss, dass ich besser an der University of Chicago studieren sollte. Ich liebe meine Alma Mater und seit meinem Studium hat sich sehr viel verändert, aber eine gefühlsbetonte Atmosphäre, die meine emotionale Eiszeit zum Tauen gebracht hätte, war an diesem Ort damals nicht gerade zu spüren. Mein Lieblingsspruch über die University of Chicago lautet: Eine baptistische Lehranstalt, an der atheistische Professoren jüdischen Studierenden die Lehren des heiligen Thomas von Aquin vermitteln. Dort trägt man immer noch T-Shirts mit der Aufschrift: „In der Praxis funktioniert es zwar, aber auch in der Theorie?“ In dieser verkopften Welt fand ich mich also wieder … und, ob man es glaubt oder nicht, ich passte perfekt hinein!
Wenn Sie mich zehn Jahre nach dem Studium kennengelernt hätten, hätte ich vermutlich ganz nett und fröhlich, aber etwas gehemmt gewirkt – nicht wie jemand, zu dem man leicht Zugang findet oder dem es leichtfällt, andere kennenzulernen. In Wirklichkeit war ich ein Entfesselungskünstler. Wenn sich Menschen mir gegenüber öffneten, nahm ich gekonnt bedeutungsvollen Blickkontakt zu den Schuhen meines Gegenübers auf und entschuldigte mich dann schnell, weil ich leider einen dringenden Termin in der Reinigung wahrnehmen musste. Dass diese Lebensweise nicht ideal war, spürte ich selbst. Situationen, in denen andere Menschen mit mir in Kontakt treten wollten, waren mir schmerzhaft unangenehm. Tief in meinem Inneren wollte ich eine Verbindung herstellen. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen sollte.
Ich unterdrückte meine Gefühle in allen Lebenslagen. Das war mein Standardmodus, der vermutlich die üblichen Ursachen hatte: Scheu vor Intimität, die vage Ahnung, dass mir das, was ans Tageslicht käme, wenn ich meinen Gefühlen freien Lauf ließe, nicht gefallen würde, gepaart mit der Angst vor Verletzlichkeit und einer allgemeinen sozialen Inkompetenz. Wie unsicher ich war, zeigt sich für mich ganz deutlich in einer scheinbar belanglosen Situation: Ich bin ein großer Baseball-Fan und habe zwar schon Hunderte von Spielen besucht, aber noch nie einen Ball auf der Tribüne gefangen. Vor etwa fünfzehn Jahren war ich bei einem Spiel in Baltimore, als der Schläger des Schlagmanns zerbrach und bis auf den Griff in hohem Bogen auf die Tribüne flog, wo er direkt vor meinen Füßen landete. Ich bückte mich und schnappte ihn mir. Ein Schläger war tausendmal besser als ein Ball! Ich hätte vor Freude in die Luft springen, meine Beute stolz präsentieren und mich mit anderen abklatschen sollen, während mein Jubel auf der Großleinwand übertragen wurde. Stattdessen legte ich den Schläger einfach neben mich und saß mit ausdrucksloser Miene da, während mich alle anstarrten. Im Rückblick würde ich mich selbst am liebsten kräftig durchschütteln und anschreien: „Zeig ein bisschen Freude!“ Aber was spontane Gefühlsausbrüche betraf, war ich etwa so emotional wie ein Kohlkopf.
Allerdings macht uns das Leben mit der Zeit oft weicher. Dass ich Vater wurde, war natürlich eine emotionale Revolution. Später erlebte auch ich viele jener Schicksalsschläge, die alle Erwachsenen treffen: gescheiterte Beziehungen, öffentliche Misserfolge, die Verletzlichkeit, die mit dem Älterwerden einhergeht. Das Gefühl der eigenen Zerbrechlichkeit, das daraus entstand, tat mir gut, denn so lernte ich tieferliegende, verdrängte Teile meines Selbst kennen.
Ein weiteres, scheinbar unbedeutendes Ereignis markiert für mich den Beginn meiner Reise zur vollen Entfaltung meines menschlichen Wesens. Als Kommentator und Experte werde ich manchmal zu Podiumsdiskussionen eingeladen. Üblicherweise finden diese in Think-Tanks in Washington statt und sind emotional so aufgeladen, wie man es von Diskussionen über Steuerpolitik erwarten würde. (Die Journalistin Meg Greenfield machte einmal die Bemerkung, wonach sich in Washington nicht etwa die ungezogenen Kinder tummelten, die Katzen in Wäschetrockner stecken, sondern diejenigen, die petzen, wenn andere die Katze in den Trockner gesteckt haben.) An jenem Tag, um den es hier geht, sollte ich jedoch an einer Podiumsdiskussion im Public Theater in New York teilnehmen – dort, wo das Musical Hamilton uraufgeführt wurde. Ich glaube, es ging um die Rolle der Kunst im öffentlichen Leben. Die Schauspielerin Anne Hathaway saß mit in der Runde, dazu ein witziger, intellektuell anspruchsvoller Clown namens Bill Irwin sowie einige andere. Die Regeln der Washingtoner Think-Tanks galten bei dieser Veranstaltung nicht. Ehe es losging, sprachen sich hinter der Bühne alle gegenseitig Mut zu. Wir kamen zu einer großen Gruppenumarmung zusammen und marschierten dann voller Kameradschaftsgeist und Sendungsbewusstsein ins Theater. Hathaway sang ein bewegendes Lied. Auf der Bühne lagen Taschentücher bereit, falls jemandem die Tränen kommen sollten. Die anderen Teilnehmenden brachten ihre Gefühle zum Ausdruck. Sie berichteten von magischen Momenten, in denen sie ein Kunstwerk oder ein Theaterstück zutiefst berührt, in andere Sphären versetzt oder verwandelt hatte. Sogar ich fing an zu weinen! Mein großes Idol Samuel Johnson hätte vermutlich gesagt, es sei gewesen, als würde man ein Walross beim Eiskunstlauf beobachten – nicht schön, aber ein eindrucksvolles Erlebnis. Nach der Diskussion feierten wir dann mit einer weiteren Gruppenumarmung. Ich dachte: „Das ist großartig! Ich sollte öfter mit Theaterleuten zusammen sein!“ Und ich schwor mir, mein Leben zu ändern.
Ja, ich gebe zu, eine Podiumsdiskussion hat mein Leben verändert!
Na gut, in Wirklichkeit ging es ein klein wenig langsamer vonstatten. Aber im Laufe der Jahre wurde mir klar, dass ein Leben auf Distanz im Grunde ein Rückzug aus dem Leben ist, eine Entfremdung nicht nur von anderen Menschen, sondern auch von sich selbst. Also habe ich mich auf eine Reise begeben. Wir Schriftsteller arbeiten das, was uns beschäftigt, natürlich öffentlich auf, also schrieb ich Bücher über Gefühle, moralisches Handeln und spirituelles Wachstum. Und irgendwie funktionierte es. Im Laufe der Jahre änderte ich mein Leben. Ich ließ mehr Verletzlichkeit im Umgang mit anderen zu und zeigte in der Öffentlichkeit mehr Emotionen. Ich versuchte, eine Person zu werden, der sich andere gerne anvertrauen – um mit ihr über Scheidungen, ihre Trauer nach dem Tod eines Ehepartners, ihre Sorgen um die Kinder zu sprechen. Mit der Zeit änderte sich etwas in mir. Ich spürte Dinge, die ich noch nie erlebt hatte: „Was kribbelt denn da in meiner Brust? Oh, das sind Gefühle!“ An einem Tag tanze ich bei einem Konzert: „Gefühle sind toll!“ Am nächsten Tag bin ich traurig, weil meine Frau verreist ist: „Gefühle sind doof!“ Auch meine Lebensziele veränderten sich. In jungen Jahren hatte ich nach Wissen gestrebt, doch je älter ich wurde, desto mehr strebte ich nach Weisheit. Weise Menschen haben nicht nur Informationen, sondern auch mitfühlendes Verständnis für andere. Sie kennen sich mit dem Leben aus.
Ich bin kein außergewöhnlicher Mensch, aber ich versuche zu wachsen. Es gelingt mir, meine Schwächen zu erkennen und daran zu arbeiten, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Nach und nach habe ich Fortschritte gemacht. Das kann ich sogar beweisen! Zweimal in meinem Leben hatte ich die Ehre, in der Sendung Super Soul Sunday von Oprah Winfrey aufzutreten, einmal 2015 und einmal 2019. Nach der Aufzeichnung des zweiten Interviews kam Oprah zu mir und sagte: „Ich habe selten erlebt, dass sich ein Mensch so verändert. Beim ersten Mal waren Sie so gehemmt.“ Das machte mich unglaublich stolz. Denn sie muss es schließlich wissen – sie ist Oprah!
Im Laufe dieser Entwicklung habe ich etwas Grundlegendes gelernt. Ein offenes Herz ist die Voraussetzung dafür, dass man ein erfüllter, freundlicher und weiser Mensch ist, aber es reicht nicht aus. Wir brauchen soziale Fähigkeiten. Oft genug wird die Bedeutung von „Beziehungen“, „Gemeinschaft“, „Freundschaft“ oder „Verbundenheit“ betont, doch diese Begriffe sind zu abstrakt. Um beispielsweise eine Freundschaft oder eine Gemeinschaft aufzubauen, muss man eine ganze Reihe kleiner, konkreter sozialer Handlungen beherrschen: Meinungsverschiedenheiten austragen, ohne eine Beziehung zu vergiften, in angemessenem Rahmen Verletzlichkeit zeigen, gut zuhören, ein Gespräch taktvoll beenden, Verzeihung erbitten und anbieten, andere enttäuschen, ohne sie dabei zu verletzen, anderen in ihrem Leid beistehen, Treffen veranstalten, bei denen sich alle angenommen fühlen, und Dinge aus der Sicht anderer Menschen betrachten können.
Diese Fähigkeiten gehören zu den wichtigsten, die ein Mensch beherrschen kann, doch in der Schule werden sie nicht gelehrt. Manchmal scheint es, als hätten wir absichtlich eine Gesellschaft geschaffen, die bei den wichtigsten Dingen des Lebens nur wenig Unterstützung bietet. Das führt dazu, dass viele von uns einsam sind und keine tiefgehenden Freundschaften haben. Dabei liegt es nicht daran, dass wir uns diese Dinge nicht wünschen. Kaum ein menschliches Bedürfnis ist so groß wie die Sehnsucht, von einem anderen Menschen liebevollen Respekt und Akzeptanz zu erfahren. Nein, es mangelt uns an praktischem Wissen darüber, wie wir einander die wohltuende Aufmerksamkeit schenken können, die wir uns wünschen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der westlichen Welt jemals gut vermittelt wurde, doch vor allem in den vergangenen Jahrzehnten haben wir viel an moralischem Wissen verloren. Unsere Schulen und anderen Institutionen konzentrieren sich mehr und mehr darauf, uns auf die berufliche Laufbahn vorzubereiten, vermitteln jedoch nicht, wie man auf seine Mitmenschen Rücksicht nimmt. Die Geisteswissenschaften, die uns lehren, was in den Köpfen anderer vor sich geht, wurden ins Abseits gedrängt. Und ein Leben in den sozialen Medien trägt nicht gerade dazu bei, dass man diese Fähigkeiten erwirbt. In den sozialen Medien gibt es die Illusion sozialer Kontakte, ohne die Gesten ausführen zu müssen, die dafür sorgen, dass tatsächlich Vertrauen, Fürsorge und Zuneigung entstehen. Social Media ersetzt Intimität durch Stimulation. Jede Menge Urteile, nirgends Verständnis.
In unserer Ära der schleichenden Entmenschlichung sind mir soziale Fähigkeiten wichtiger denn je: Wie schaffen wir es, andere Menschen rücksichtsvoller zu behandeln, wie gelingt es uns, unsere Mitmenschen besser zu verstehen? Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Qualität unseres Lebens und die Gesundheit unserer Gesellschaft zu einem großen Teil davon abhängen, wie gut wir in den kleinen Begegnungen des Alltags miteinander umgehen.
All diese verschiedenen Fähigkeiten gehen auf eine grundlegende Fähigkeit zurück: die Fähigkeit, zu verstehen, was ein anderer Mensch erlebt. Es ist eine ganz bestimmte Fähigkeit, die das Herzstück aller gesunden Menschen, Familien, Schulen, Gemeinschaften oder Gesellschaften bildet: die Fähigkeit, einen anderen Menschen wirklich zu sehen und ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er gesehen wird – einen anderen Menschen grundlegend zu erkennen und ihm das Gefühl zu vermitteln, wertgeschätzt, gehört und verstanden zu werden.
Genau das bildet den Kern eines guten Menschen und ist gleichzeitig das größte Geschenk, das man anderen und sich selbst machen kann.
—
Der Mensch braucht Anerkennung so dringend wie Nahrung und Wasser. Jemanden nicht zu sehen, ihn klein oder unsichtbar zu machen, ist die grausamste Strafe überhaupt. „Das größte Übel, das wir unseren Mitmenschen antun können, ist nicht, sie zu hassen“, schrieb George Bernard Shaw, „sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein: Das ist absolute Unmenschlichkeit.“ Wer das tut, sagt: Du bist nicht wichtig. Du existierst nicht.
Auf der anderen Seite ist kaum etwas so erfüllend wie das Gefühl, gesehen und verstanden zu werden. Ich bitte andere Menschen oft, mir von Situationen zu erzählen, in denen sie sich gesehen fühlten, und sie berichten mir dann mit leuchtenden Augen von entscheidenden Momenten in ihrem Leben. Ich erfahre, wie jemand ein Talent erkannte, von dem die Betroffenen selbst nichts ahnten, oder wie jemand genau wusste, was in einem Moment der Schwäche nötig war – und exakt das Richtige tat, um für Entlastung zu sorgen.
In den vergangenen vier Jahren habe ich mich gezielt bemüht, jene Fähigkeiten zu erlernen, die man braucht, um andere zu sehen, zu verstehen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, respektiert, geschätzt und sicher zu sein. Anfangs wollte ich diese Fähigkeiten aus praktischen Gründen verstehen und erlernen. Große Lebensentscheidungen lassen sich besser treffen, wenn man andere richtig versteht. Ehe man einen Menschen heiratet, sollte man nicht nur sein Aussehen, seine Interessen und seine berufliche Perspektive kennen, sondern auch wissen, wie sich Leid aus der Kindheit im Erwachsenenalter bemerkbar macht und ob die tiefsten Wünsche dieses Menschen mit den eigenen übereinstimmen. Wenn Sie eine Stelle besetzen möchten, reicht es nicht, die im Lebenslauf genannten Qualifikationen zu registrieren, sondern Sie müssen auch subjektive Aspekte im Bewusstsein eines Menschen erkennen, die sich auf die Leistungsbereitschaft und den Umgang mit Ungewissheit auswirken und darüber entscheiden, ob jemand in Krisensituationen Ruhe bewahrt oder den Kolleg:innen gegenüber großmütig ist. Wenn Sie Beschäftigte im Unternehmen halten wollen, müssen Sie wissen, wie Sie diesen Personen Wertschätzung vermitteln können. In einer Studie aus dem Jahr 2021 fand das Meinungsforschungsinstitut McKinsey Folgendes heraus: Die meisten Führungskräfte glauben, dass Angestellte den Arbeitsplatz wechseln, um woanders mehr zu verdienen, während die Beschäftigten selbst eine Kündigung in erster Linie mit zwischenmenschlichen Faktoren begründen. Sie gehen, wenn sie sich von ihren Vorgesetzten und im Unternehmen nicht anerkannt und wertgeschätzt fühlen – wenn sie sich nicht gesehen fühlen.
Diese Fähigkeit, andere wirklich zu sehen, ist nicht nur bei Eheschließungen, bei einer Stellenbesetzung oder zur Mitarbeiterbindung wichtig, sondern auch für Lehrkräfte, die Schüler:innen unterrichten, für Ärzt:innen bei der Untersuchung ihrer Patient:innen, für Gastgeber:innen, die vorausahnen wollen, was ihre Gäste wünschen, für Freund:innen, die Zeit miteinander verbringen, für Eltern im Umgang mit ihren Kindern, für Eheleute beim abendlichen Zubettgehen. Das Leben läuft viel besser, wenn man die Dinge nicht nur aus dem eigenen Blickwinkel, sondern auch aus dem eines anderen Menschen sehen kann. Künstliche Intelligenz wird uns in den kommenden Jahrzehnten vieles abnehmen und den Menschen bei vielen Aufgaben ersetzen, aber es wird ihr niemals gelingen, zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen. Um im Zeitalter der KI Erfolg zu haben, müssen Sie außergewöhnlich gut darin werden, mit anderen in Verbindung zu treten.
Zweitens wollte ich diese Fähigkeit aus einem Grund erlernen, der für mich spiritueller Natur ist. Andere richtig zu sehen, birgt ungeheure Schaffenskraft. Wir können unsere eigene Schönheit und unsere eigenen Stärken nur umfassend erkennen, wenn diese durch den Geist eines anderen Menschen gespiegelt werden. Das Gesehenwerden lässt uns wachsen. Wenn jemand das Licht seiner Aufmerksamkeit auf mich richtet, blühe ich auf. Wenn jemand in mir großes Potenzial sieht, werde ich höchstwahrscheinlich ebenfalls großes Potenzial in mir sehen. Wenn jemand meine Schwächen versteht und Mitgefühl zeigt, wenn das Leben es nicht gut mit mir meint, dann habe ich wahrscheinlich eher die Kraft, den Stürmen des Lebens zu trotzen. „Die Wurzeln der Resilienz“, schreibt die Psychologin Diana Fosha, „sind in dem Gefühl zu suchen, von Geist und Herz eines liebevollen, eingestimmten und selbstbeherrschten Anderen verstanden zu werden und darin geborgen zu sein.“ In der Art und Weise, wie du mich siehst, lerne ich, mich selbst zu sehen.
Und drittens wollte ich diese Fähigkeit aus Gründen erlernen, die man wohl als Basis für das nationale Überleben bezeichnen könnte. Im Laufe der Evolution lebte der Mensch meist in kleinen Gruppen mit anderen, die ihm mehr oder weniger ähnlich waren. Heutzutage jedoch sind viele von uns in wunderbar pluralistischen Gesellschaften zu Hause. In Amerika, Europa, Indien und vielen anderen Ländern versuchen wir, multikulturelle Massendemokratien zu errichten, Gesellschaften, in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ethnie mit unterschiedlichen Ideologien und Hintergründen leben können. Damit eine pluralistische Gesellschaft überlebt, braucht sie Bürger:innen, die über die Unterschiede hinwegsehen und jene Art von Verständnis zeigen, die eine Voraussetzung für Vertrauen bildet – Menschen, die zumindest sagen können: „Ich verstehe dich allmählich. Sicher werde ich die Welt nie ganz so sehen, wie sie sich für dich darstellt, aber ich nehme sie langsam ein Stück weit mit deinen Augen wahr.“
Gegenwärtig reichen unsere sozialen Fähigkeiten für die pluralistischen Gesellschaften, in denen wir leben, nicht aus. Als Journalist habe ich oft mit Menschen zu tun, die mir sagen, dass sie sich nicht gesehen und nicht respektiert fühlen: Schwarze Menschen, die das Gefühl haben, dass Weiße die systemische Ungerechtigkeit nicht verstehen, der sie tagtäglich ausgesetzt sind; Menschen aus ländlichen Regionen, die sich von den Eliten in den Städten nicht gesehen fühlen; Menschen, die politisch Andersdenkenden mit wütendem Unverständnis begegnen; deprimierte junge Leute, die sich von ihren Eltern und allen anderen unverstanden fühlen; Privilegierte, die all jene in ihrem Umfeld, die ihre Häuser putzen und ihnen sämtliche Bedürfnisse erfüllen, nicht wahrnehmen; Eheleute in zerrütteten Beziehungen, denen klar wird, dass der Mensch, der sie eigentlich am besten kennen sollte, im Grunde keine Ahnung von ihnen hat. Viele unserer großen nationalen Probleme ergeben sich aus dem Zerfall unseres sozialen Gefüges. Wenn wir die großen nationalen Risse kitten wollen, müssen wir lernen, im Kleinen richtig zu handeln.
—
In jeder Gruppe gibt es zwei Arten von Menschen – Diminisher (also Leute, die andere kleinmachen) und Illuminatoren (die andere erleuchten). Diminisher vermitteln anderen das Gefühl, klein und ungesehen zu sein. Sie betrachten ihre Mitmenschen als Dinge, die sie benutzen, und nicht als Personen, mit denen sie sich anfreunden können. Sie sind ignorant und ordnen Menschen in Schubladen ein. Und sie sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie andere einfach nicht wahrnehmen.
Illuminatoren dagegen zeigen stets großes Interesse an ihren Mitmenschen. Sie haben gelernt – oder sich selbst beigebracht –, andere zu verstehen. Sie wissen, worauf sie achten müssen und wie sie die richtigen Fragen zum passenden Zeitpunkt stellen. Sie lassen das Licht ihrer Fürsorge auf ihre Mitmenschen strahlen, sodass diese sich größer, bedeutsamer, respektiert und erleuchtet fühlen.
Sicher haben Sie so etwas schon einmal erlebt: Sie begegnen einer Person, die sich offenbar uneingeschränkt für Sie interessiert, die Sie versteht, die Ihnen hilft, Dinge zu benennen und an sich zu erkennen, die Sie vielleicht noch gar nie in Worte gefasst haben, sodass Sie sich persönlich weiterentwickeln.
Über den Schriftsteller E. M. Forster schrieb ein Biograf: „Wer mit ihm sprach, wurde von einem umgekehrten Charisma verführt, dem Gefühl, mit einer solchen Intensität gehört zu werden, dass man sein ehrlichstes, intelligentestes und bestes Selbst sein musste.“ Stellen Sie sich vor, wie schön es wäre, selbst so wie Forster zu sein.
Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Jennie Jerome, der späteren Mutter von Winston Churchill. In ihrer Jugend soll sie einst mit dem britischen Staatsmann William Gladstone gespeist und ihn anschließend für den klügsten Menschen Englands gehalten haben. Danach speiste sie mit Gladstones großem Rivalen Benjamin Disraeli, und nach diesem Abend hielt sie sich selbst für den klügsten Menschen Englands. Es ist schön, wenn man wie Gladstone ist, aber es ist besser, wie Disraeli zu sein.
Oder denken Sie an eine Geschichte aus den Forschungslabors Bell Labs. Vor vielen Jahren stellten die Verantwortlichen dort fest, dass einige der Beschäftigten viel produktiver forschten und es zu viel mehr Patenten brachten als andere. Woran konnte das liegen? Die Geschäftsführung nahm sämtliche möglichen Erklärungen für die Erfolge dieser Personen unter die Lupe – Bildungshintergrund, Position im Unternehmen –, jedoch ohne Ergebnis. Dann jedoch fiel eine Besonderheit auf. Am produktivsten waren diejenigen, die ihre Frühstücks- oder Mittagspause üblicherweise mit einem Elektroingenieur namens Harry Nyquist verbrachten. Nyquist leistete nicht nur wichtige Beiträge zur Kommunikationstheorie, sondern, so berichteten seine Kolleg:innen, hörte aufmerksam zu, wenn andere von Problemstellungen berichteten, versetzte sich in ihre Lage, stellte intelligente Fragen und verhalf ihnen so zu Bestleistungen. Mit anderen Worten: Nyquist war ein Illuminator.
Was sind Sie selbst üblicherweise, Diminisher oder Illuminator? Wie gut können Sie andere Menschen lesen?
Wir beide kennen uns zwar nicht persönlich, aber dennoch würde ich vermuten: Sie sind nicht so gut, wie Sie glauben. Wir alle gehen voller sozialer Ignoranz durchs Leben. Der Wissenschaftler William Ickes befasst sich mit der Frage, wie genau man wahrnehmen kann, was andere denken. Laut ihm schätzen sich Fremde, die zum ersten Mal miteinander sprechen, nur in rund 20 Prozent der Fälle gegenseitig richtig ein, während das engen Freund:innen und Angehörigen nur in 35 Prozent der Fälle gelingt. Ickes bewertet die „Empathiegenauigkeit“ seiner Testpersonen auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent und erkennt große Unterschiede zwischen den einzelnen Personen. Bei manchen liegt der Wert bei null. Wenn diese Personen sich zum ersten Mal mit jemandem unterhalten, haben sie keine Ahnung, was ihr Gegenüber tatsächlich denkt. Manche hingegen können andere Menschen ziemlich gut einschätzen und erreichen etwa 55 Prozent. (Problematisch dabei ist, dass diejenigen, die andere schlecht einschätzen können, sich für genauso gut halten wie diejenigen, denen das ziemlich gut gelingt.) Interessanterweise stellt Ickes fest, dass sich Ehepaare gegenseitig immer schlechter lesen können, je länger sie verheiratet sind. Sie haben eine frühe Version ihres Partners oder ihrer Partnerin verinnerlicht, an der sie auch nach vielen Jahren noch festhalten, obwohl der Mensch sich verändert hat. Das hat zur Folge, dass sie immer weniger Bescheid wissen, was im Herzen und im Kopf des anderen tatsächlich vor sich geht.
Man braucht keine wissenschaftliche Studie, um zu erkennen, dass das stimmt. Wie oft hatten Sie schon das Gefühl, dass man Sie in eine bestimmte Schublade steckt? Wie oft haben Sie sich vorverurteilt, unsichtbar, missverstanden oder falsch wahrgenommen gefühlt? Glauben Sie wirklich, dass Sie nicht tagtäglich genau dasselbe mit anderen machen?
—
Dieses Buch soll dazu beitragen, dass es uns besser gelingt, andere zu sehen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, gesehen, gehört und verstanden zu werden. Zu Beginn meiner Recherchen zu diesem Thema hatte ich keine Ahnung, welche Fähigkeiten dazu nötig sind. Aber ich wusste, dass sich außergewöhnliche Menschen in vielen Fachbereichen diese Fähigkeiten selbst beigebracht hatten. Psycholog:innen sind darin geschult, jene Mechanismen zu erkennen, mit denen sich Menschen vor ihren tiefsten Ängsten schützen. Schauspieler:innen können die wesentlichen Eigenschaften einer Figur erfassen und sich beibringen, wie sie diese Rolle verkörpern. Biograf:innen können die Widersprüche in einer Person wahrnehmen und dennoch ihr Leben als Ganzes betrachten. Lehrer:innen können Potenziale entdecken. Erfahrene Talkshow- und Podcast-Moderator:innen wissen, wie sie ihre Gäste dazu bringen, sich zu öffnen und ihr wahres Ich zu zeigen. Es gibt so viele Berufe, in denen es wichtig ist, Menschen zu sehen, sie zu erfassen und zu verstehen: in der Pflege, in der Seelsorge, im Management, in der Sozialarbeit, im Marketing, im Journalismus, in Redaktionen, im Personalwesen und in vielen anderen Bereichen. Mein Ziel war es, das Wissen, das über diese verschiedenen Berufe verstreut ist, zu sammeln und zu einem einzigen praktischen Ansatz zu bündeln.
Also habe ich mich auf eine Reise zu mehr Verständnis begeben, eine Reise, auf der noch ein langer, langer Weg vor mir liegt. Mit der Zeit wurde mir klar, dass man nicht nur bestimmte Techniken beherrschen muss, um andere tiefgehend zu kennen und zu verstehen, sondern dass es sich dabei um eine Lebenseinstellung handelt. Es ist vergleichbar mit der Schauspielerei: Wenn Darstellende auf der Bühne stehen, denken sie nicht an die Techniken, die sie auf der Schauspielschule gelernt haben, sie haben diese Techniken vielmehr so sehr verinnerlicht, dass sie ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sind. Ich hoffe, dass dieses Buch Ihnen dabei helfen wird, Ihren Mitmenschen gegenüber anders aufzutreten, anders mit ihnen umzugehen, anders wichtige Gespräche zu führen. Auf diese Art zu leben kann sehr befriedigend sein.
Vor nicht allzu langer Zeit saß ich im Esszimmer und las ein langweiliges Buch, als ich bemerkte, dass meine Frau in der Eingangstür zu unserem Haus stand. Die Tür war offen, das spätnachmittägliche Licht strömte herein. Meine Frau war mit den Gedanken ganz woanders, doch ihr Blick ruhte auf einer weißen Orchidee, die in einem Topf auf einem Tisch neben der Tür wächst.
Ich unterbrach die Lektüre und sah meine Frau aufmerksam an – da überkam mich eine seltsame, wunderbare Erkenntnis. „Ich kenne sie“, dachte ich. „Ich kenne sie wirklich, durch und durch.“
Was genau ich über meine Frau wusste, hätte ich in diesem Moment kaum auf den Punkt bringen können. Es war keine Ansammlung von Fakten oder ihre Lebensgeschichte oder gar etwas, das sich in den Worten ausdrücken ließe, mit denen ich Fremden gegenüber über sie spreche. Es war der ganze Fluss ihres Wesens – ihr strahlendes Lächeln, die darunter verborgenen Unsicherheiten, die nur selten aufblitzende Ungestümheit, ihr lebendiger Geist. Es waren die Modulationen und Harmonien ihrer Musik.
Ich sah keine Einzelheiten und hatte keine bestimmten Erinnerungen. Das, was ich sah (oder zu sehen glaubte), war ihr gesamtes Wesen. Wie ihr Bewusstsein ihre Realität schafft. Das kann geschehen, wenn man mit einem Menschen schon eine Weile zusammen ist, wenn man Freud und Leid geteilt hat und allmählich ein intuitives Gespür dafür entwickelt, wie der andere fühlt und reagiert. Man könnte sogar sagen, dass ich für einen magischen Moment nicht meine Frau sah, sondern aus ihr heraus. Vielleicht kann man einen anderen Menschen nur dann wirklich kennen, wenn man eine Ahnung davon hat, wie er oder sie die Welt wahrnimmt. Sie kennen eine andere Person nur dann richtig, wenn Sie wissen, auf welche Weise diese Person Sie kennt.
Das einzige Wort, mit dem ich das, was in diesem Augenblick in mir vorging, zum Ausdruck bringen kann, wäre „bewundern“. Meine Frau stand in der Tür, hinter ihr fiel das Licht herein, und ich bewunderte sie. Oft heißt es, dass kein Mensch gewöhnlich ist. Wenn man jemanden bewundert, sieht man den Reichtum dieses besonderen menschlichen Bewusstseins, die komplette Symphonie – wie dieses Wesen sein Leben wahrnimmt und gestaltet.
Ich muss Ihnen nicht sagen, wie erfüllend dieser Moment war – warm, intim, innig. Ich erlebte die Glückseligkeit der menschlichen Verbindung. „Viele brillante Schriftsteller und Denker haben kein Gespür dafür, wie der Mensch funktioniert“, vertraute mir die Therapeutin und Autorin Mary Pipher einmal an. „Die Fähigkeit, andere zu verstehen und für sie in ihrem Erleben präsent zu sein – das ist das Wichtigste auf der Welt.“
ZWEI Blind für andere
Vor ein paar Jahren saß ich in einer Bar in der Nähe meiner Wohnung in Washington, D.C. Wenn Sie mich an diesem Abend gesehen hätten, hätten Sie vielleicht gedacht: „Ein bemitleidenswerter Kerl, der allein trinkt.“ Ich selbst hätte mich dagegen als „fleißiger Gelehrter, der sich über den Zustand der Menschheit informiert“ bezeichnet. Während ich meinen Bourbon trank, beobachtete ich die Leute um mich herum. Da sich die Bar in Washington befand, saßen am Tisch hinter mir drei Männer, die sich über die Wahlen und Swing States unterhielten. Der Typ mit dem Laptop am Nebentisch sah aus wie ein junger IT-Fachmann, der für ein Rüstungsunternehmen arbeitete und gekleidet war wie der typische Nerd. Weiter hinten an der Bar saß ein Pärchen, das in seine Handys vertieft war, direkt neben mir ein weiteres, offenbar beim ersten Date. Der Mann redete ununterbrochen über sich selbst, während er einen Punkt an der Wand fast zwei Meter über dem Kopf seiner Begleitung fixierte. Als sein Monolog in die zehnte Minute ging, spürte ich, dass die junge Frau am liebsten spontan in Flammen aufgegangen wäre, wenn damit nur endlich dieses Date ein Ende genommen hätte. Ich hatte den starken Drang, den Kerl an der Nase zu packen und zu schreien: „Herrgott noch mal – stell ihr doch wenigstens einmal eine Frage!“ Dieser Impuls hatte durchaus seine Berechtigung, aber stolz bin ich darauf nicht.
Kurz gesagt: Obwohl alle Anwesenden die Augen offen hatten, schien niemand seine Mitmenschen zu sehen. Auf unterschiedlichste Weise waren wir alle Diminisher. Und ich muss zugeben, dass ich selbst der Schlimmste von allen war, denn ich tat, was ich immer tue: Ich fällte Urteile. Das machen wir immer, wenn wir jemanden zum ersten Mal sehen: Wir registrieren die äußere Erscheinung und bilden uns sofort eine Meinung. Aus den chinesischen Schriftzeichen, mit denen die Barkeeperin tätowiert war, zog ich Schlüsse über ihre Vorliebe für schwermütigen Indie-Rock. Früher hatte ich mit so etwas meinen Lebensunterhalt verdient. Vor gut zwei Jahrzehnten habe ich ein Buch mit dem Titel Die Bobos geschrieben. Während meiner Recherchen dafür trieb ich mich in alternativen Geschäften wie dem Bekleidungs- und Einrichtungshaus Anthropologie herum und beobachtete, wie dort grob gewebte peruanische Schals befingert wurden. Ich studierte die Küchen fremder Leute und besichtigte die gewaltigen Herde, die an vernickelte Atomreaktoren erinnerten, direkt neben den massigen Sub-Zero-Kühlschränken (denn offenbar war null Grad schon nicht mehr kalt genug). Daraus zog ich dann ein paar verallgemeinernde Schlüsse und ließ mich daraufhin über die aktuellen kulturellen Trends aus.
Auf dieses Buch bin ich nach wie vor stolz, doch mittlerweile habe ich Größeres im Blick. Verallgemeinerungen zu bestimmten Personengruppen langweilen mich. Ich möchte die Menschen umfassender sehen, und zwar ganz individuell. Man könnte meinen, das sei ganz simpel – man öffnet die Augen, schaut jemanden an und sieht diese Person. Allerdings haben wir meist verschiedene angeborene Eigenschaften, die uns daran hindern, andere wirklich wahrzunehmen. Dabei ist die Tendenz, sich auf der Stelle ein Urteil zu bilden, nur ein Merkmal der Diminisher. Es gibt noch ein paar andere:
EGOISMUS. Wenn wir andere nicht sehen, liegt das in den meisten Fällen daran, dass wir zu egozentrisch sind und es gar nicht erst versuchen. Ich kann dich nicht sehen, weil ich nur mit mir selbst beschäftigt bin. Ich will dir meine Meinung sagen. Ich will dich mit einer Geschichte über mich unterhalten. Viele Menschen sind nicht in der Lage, über ihren eigenen Tellerrand hinauszusehen. Sie interessieren sich einfach nicht für andere.
ANGST. Wenn in unserem eigenen Kopf zu viel Lärm herrscht, können wir ebenfalls nicht wahrnehmen, was in anderen vor sich geht. Wie komme ich an? Ich glaube, mein Gegenüber mag mich irgendwie nicht. Was sage ich jetzt am besten, damit ich besonders schlau wirke? Angst ist der Feind einer offenen Kommunikation.
NAIVER REALISMUS. Damit ist gemeint, dass Sie Ihre Sichtweise auf die Welt als objektive Wahrnehmung betrachten und deshalb davon ausgehen, dass alle dieselbe Realität sehen wie Sie. Wer dem naiven Realismus verfallen ist, bleibt auf die eigene Perspektive fixiert und kann nicht erkennen, dass andere Menschen ganz andere Betrachtungsweisen haben. Vielleicht kennen Sie die alte Geschichte von einem Mann, der an einem Fluss steht. Vom gegenüberliegenden Ufer ruft ihm eine Frau zu: „Wie komme ich auf die andere Seite?“ Und der Mann erwidert: „Sie sind doch auf der anderen Seite!“
DAS PROBLEM DER GEISTIGEN UNTERLEGENHEIT. Der Psychologe Nicholas Epley von der University of Chicago weist darauf hin, dass wir tagtäglich all die vielen Gedanken wahrnehmen, die uns selbst durch den Kopf gehen, während wir von den Gedanken in den Köpfen anderer Menschen nur einen winzigen Bruchteil mitbekommen, nämlich nur jene, die sie laut aussprechen. Dadurch gewinnen wir den Eindruck, dass wir selbst viel komplexer sind als die anderen – tiefgründiger, interessanter, subtiler und intellektuell überlegen. Um dieses Phänomen zu veranschaulichen, fragte Epley seine Studierenden an der Wirtschaftshochschule, warum sie diese Studienrichtung gewählt hatten. Die häufigste Antwort lautete: „Es ist mir wichtig, etwas Sinnvolles zu tun.“ Auf die Frage, weshalb ihre Kommiliton:innen sich für Wirtschaft entschieden haben könnten, vermuteten die meisten: „Wegen des Geldes.“ Alle anderen haben also niedrige Beweggründe … und sind geistig unterlegen.
OBJEKTIVISMUS. Diese Methode wenden die Markt- und Meinungsforschung sowie die Sozialwissenschaft an, indem sie Verhaltensweisen beobachten, Umfragen entwickeln und Daten über Menschen zusammentragen. So kann man zwar Trends in der Bevölkerung verstehen, aber unmöglich einzelne Personen wahrnehmen. Die einzigartige Subjektivität eines Menschen, seine wichtigsten Aspekte – Fantasie, Gefühle, Wünsche, Kreativität, Intuitionen, Glaube, Emotionen und Bindungen, also all das, was die innere Welt dieser unverwechselbaren Person prägt –, bleiben bei dieser distanzierten, leidenschaftslosen und objektiven Betrachtungsweise außen vor.
Im Laufe meines Lebens habe ich Hunderte von Büchern mit wissenschaftlichen Studien gelesen, die der menschlichen Natur auf den Grund gehen wollten, und enorm viel gelernt. Ich habe auch Hunderte von Lebenserinnerungen gelesen und mit Tausenden von Menschen über ihr eigenes, einzigartiges Leben gesprochen. Ich kann Ihnen deshalb versichern, dass jedes einzelne Leben viel erstaunlicher und unvorhersehbarer ist als sämtliche verallgemeinernden Aussagen, die Sozialwissenschaftler:innen und andere kluge Köpfe über bestimmte Personengruppen treffen. Wenn man die Menschheit verstehen will, muss man sich auf die Gedanken und Gefühle der Einzelnen stützen, nicht nur auf Daten über Gruppen.
ESSENZIALISMUS. Jeder Mensch gehört bestimmten Gruppen an, und wir alle haben von Natur aus die Neigung, verallgemeinernde Aussagen über andere zu treffen: Deutsche sind ordnungsliebend, Menschen aus Kalifornien sind locker. Solche Verallgemeinerungen haben manchmal einen wahren Kern, sie sind jedoch alle bis zu einem bestimmten Grad falsch und in gewisser Weise verletzend. Essenzialismus bedeutet, dass man das nicht erkennt, sondern große Teile seine Mitmenschen aufgrund von Stereotypen vorschnell in eine bestimmte Schublade steckt. Essenzialismus ist die Überzeugung, dass eine bestimmte Gruppe tatsächlich eine „essenzielle“ und unveränderliche Eigenschaft hat. Wer zu dieser Denkweise neigt, geht davon aus, dass sich die Angehörigen einer Gruppe ähnlicher sind, als es tatsächlich der Fall ist, und stellt sich vor, dass sich die Menschen in anderen Gruppen stärker von „uns“ unterscheiden, als es der Wirklichkeit entspricht. Essenzialist:innen neigen zum „Stacking“ – damit ist gemeint, dass sie aus einer Information über einen Menschen verschiedene weitere Annahmen über diese Person ableiten. Wer Donald Trump unterstützt hat, muss zwangsläufig so, so, so und so sein.
STATISCHE DENKWEISE. Manche Menschen haben ein bestimmtes Bild von Ihnen, das zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht sogar weitgehend zutreffend war. Allerdings haben Sie sich mittlerweile weiterentwickelt und sich entscheidend verändert. Diese Menschen haben jedoch ihr Bild von Ihnen niemals aktualisiert und sehen Sie deshalb nicht so, wie Sie wirklich sind. Wenn Sie als Erwachsener zu Ihren Eltern kommen und dort immer noch wie das Kind behandelt werden, das Sie gar nicht mehr sind, wissen Sie genau, was ich meine.
—
Ich habe diese verschiedenen Eigenarten der Diminisher so genau aufgeschlüsselt, weil ich ganz deutlich machen will, dass es das Schwierigste überhaupt ist, einen anderen Menschen wirklich zu sehen. Jeder Mensch ist ein unergründliches Geheimnis, und man sieht andere stets nur von außen. Außerdem möchte ich betonen, dass der ungeschulte Blick nicht ausreicht. Sie würden nie auf die Idee kommen, ein Flugzeug zu steuern, ohne eine Flugschule besucht zu haben – und einen anderen Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen ist sogar noch schwieriger als Fliegen. Wenn wir nicht lernen, wie wir richtig miteinander umgehen, wird es uns nicht gelingen, einander umfassend zu sehen. Wir werden in sozialer Ignoranz leben, verstrickt in Beziehungen, die von gegenseitigem Desinteresse geprägt sind. Wir werden emotional leiden, wie so viele Millionen andere: Eheleute, die sich nicht richtig sehen, Eltern und Kinder, die sich nicht richtig kennen, Arbeitskolleg:innen, die genauso gut in unterschiedlichen Galaxien leben könnten.
Verstörend schnell geschieht es, dass wir selbst die Menschen nicht wahrnehmen, mit denen wir unmittelbar zu tun haben. Im Laufe der Lektüre dieses Buches werden Sie feststellen, dass ich gerne mit Beispielen arbeite, und auch hier möchte ich an einem konkreten Fall deutlich machen, dass wir jemanden, der uns vermeintlich sehr vertraut ist, unter Umständen gar nicht richtig kennen. Das Beispiel stammt aus Vivian Gornicks bekanntem biografischem Roman Ich und meine Mutter aus dem Jahr 1987. Gornick war dreizehn, als ihr Vater an einem Herzinfarkt starb, ihre Mutter Bess war damals sechsundvierzig. Bess hatte es immer genossen, dass sie in ihrem Arbeiterwohnhaus in der Bronx offenbar die einzige Frau war, die eine glückliche, liebevolle Ehe führte. Der Tod ihres Mannes warf sie aus der Bahn. Im Bestattungsinstitut versuchte sie, zu ihm in den Sarg zu klettern, auf dem Friedhof wollte sie sich in das offene Grab werfen. Noch jahrelang überkam sie anfallartig heftige Trauer, sodass sie sich unvermittelt auf dem Boden wälzte, schweißüberströmt und mit pulsierender Halsschlagader.
„Die Trauer meiner Mutter war brachial und allumfassend: Sie saugte den letzten Rest Sauerstoff aus der Luft“, schreibt Gornick in ihren Erinnerungen. Das Leid ihrer Mutter verschlang das Leid aller anderen, zog die Aufmerksamkeit der Welt auf sie und verwies ihre Kinder auf eine Statistenrolle in ihrem Drama. Weil sie Angst davor hatte, allein zu schlafen, zog Bess Vivian an sich, aber Vivian, der das zuwider war, lag dann wie erstarrt in dieser Intimität ohne Zweisamkeit, die ein Leben lang andauern sollte. „Sie zwang mich, ein ganzes Jahr bei ihr zu schlafen, und noch zwanzig Jahre später konnte ich die Hand einer Frau auf meiner Haut nicht ertragen.“
Eine Zeit lang hatte es den Anschein, als würde sich Bess zu Tode trauern, doch stattdessen bestimmte die Trauer ihr Leben. „Die Witwenschaft lieferte Mama den Vorwand für eine höhere Form des Seins“, schrieb Gornick. „Indem sie sich weigerte, vom Tod meines Vaters zu genesen, entdeckte sie, dass ihr Leben mit einer Ernsthaftigkeit ausgestattet war, die die Jahre in der Küche ihr vorenthalten hatten … Um Papa zu trauern wurde ihre Berufung, ihre Identität, ihre Persona.“
Als Erwachsene versuchte Vivian jahrelang, ein gewisses Maß an Unabhängigkeit von dieser dominanten, schwierigen und durch und durch faszinierenden Mutter zu gewinnen. Dennoch zog es sie immer wieder zu ihr zurück. Die beiden Gornick-Frauen machten lange Spaziergänge durch New York City. Beide waren äußerst kritisch, ungestüm, herablassend – Meisterinnen der typischen New Yorker Verbalattitüde. Sie waren Intimfeindinnen und sie waren beide sehr wütend. „Die Beziehung zu meiner Mutter ist nicht besonders, und während unser Leben voranschreitet, scheint sie sich häufig noch zu verschlimmern“, schreibt Vivian. „Wir sind gefangen in einem engen Schacht von Vertrautheit, Anspannung und Verpflichtung.“ In Vivians Buch ist das, was die beiden trennt, zum Teil persönlicher Natur – und resultiert aus der Geschichte der Verletzungen, die sie sich gegenseitig zugefügt haben. „Ich weiß, dass sie vor Wut kocht, und lasse sie schmoren. Warum auch nicht? Ich koche ja selbst.“
Allerdings ist es auch eine Generationenfrage. Bess stammt aus der städtischen Arbeiterklasse der 1940er und 1950er Jahre und sieht die Welt durch diese Linse. Vivian gehört der liberalen akademischen Welt der 1960er und 1970er Jahre an, die ihre Sicht auf die Welt prägt. Vivian ist der Ansicht, Bess und die Frauen ihrer Generation hätten den Sexismus, der sie umgab, stärker bekämpfen müssen. Bess hingegen meint, Vivians Generation habe dem Leben die Würde genommen.
Eines Tages stößt Bess bei einem Spaziergang hervor: „Die Welt ist voller Wahnsinniger. Überall Scheidungen … Was seid ihr bloß für eine Generation!“
Vivian schießt zurück: „Fang bloß nicht damit an, Ma. Ich will diesen Mist nicht schon wieder hören.“
„Mist hin, Mist her, es ist trotzdem wahr. Egal, was wir angestellt haben, wir haben uns jedenfalls nicht wie ihr auf der Straße eine Blöße gegeben. Wir hatten Ordnung, Ruhe, Würde. Die Familien hielten zusammen, und man führte ein anständiges Leben.“
„Das ist absoluter Schwachsinn“, antwortet Vivian. „Ihr habt kein anständiges Leben geführt, ihr habt nur so getan.“
Letztlich einigen die beiden sich darauf, dass die Menschen in beiden Generationen gleich unglücklich waren, doch Bess fügt hinzu: „Das Unglück ist heutzutage so lebendig.“ Beide erschrecken kurz und freuen sich dann über diese Beobachtung. Für einen kurzen Moment ist Vivian stolz darauf, dass ihre Mutter etwas Kluges gesagt hat, und empfindet beinahe Liebe zu ihr.
Dennoch kämpft Vivian um Anerkennung, um eine Mutter, die versteht, wie sehr sie ihre eigene Tochter prägt. „Sie hat keine Ahnung, wie persönlich ich ihre Ängste nehme, wie sehr ihre Depression mir zusetzt. Wie könnte sie auch? Sie bekommt ja nicht einmal mit, dass ich da bin. Würde ich ihr erzählen, wie zerstörerisch es für mich ist, dass sie das nicht einmal zur Kenntnis nimmt, würde mich dieses junge Mädchen von siebenundsiebzig mit trostloser Verzweiflung in den Augen anschauen und mich zornig beschimpfen: ‚Du verstehst das nicht! Du hast es noch nie verstanden!‘“
Als Bess achtzig Jahre alt ist, wird der Tonfall in ihrer Beziehung milder, da beide zu ahnen scheinen, dass der Tod näher rückt. Bess zeigt sogar eine gewisse Selbsterkenntnis: „Ich hatte nur die Liebe deines Vaters. Das war das einzig Schöne in meinem Leben. Und deshalb liebte ich seine Liebe. Was hätte ich sonst machen sollen?“
Vivian ist wütend. Sie führt ihrer Mutter vor Augen, dass sie erst sechsundvierzig war, als ihr Mann starb. Sie hätte ein neues Leben anfangen können.
„Warum gehst du nicht schon?“, fährt Bess sie an. „Warum lässt du mich nicht allein mit meinem Leben? Ich halte dich nicht zurück.“
Aber ihre Bindung ist unzerstörbar. Das Buch endet mit Vivians Erwiderung darauf: „Das weiß ich, Ma.“
Ich und meine Mutter beschreibt hervorragend, wie man einen anderen Menschen sieht, ohne ihn richtig zu sehen. Das Buch handelt von zwei klugen, dynamischen, wortgewandten Frauen, die ein Leben lang miteinander kommunizieren und einander nie ganz verstehen. Gornicks autobiografischer Roman ist deshalb so gut, weil er deutlich macht, dass wir einen Menschen unter Umständen selbst dann nicht sehen, wenn wir alles für ihn tun und viel über ihn wissen. Es kann sein, dass jemand Sie liebt, Sie aber dennoch nicht kennt.
Die Gornicks können einander nicht wirklich sehen, was zum Teil daran liegt, dass sie nur darauf achten, wie die jeweils andere sie beeinflusst. Vivian und Bess sind kampflustig und streiten unablässig darüber, wer die Schuld trägt. Bess ist dabei ein Teil des Problems. Sie ist so sehr in ihrem eigenen Drama gefangen, dass sie nie die Perspektive ihrer Tochter einnimmt und gar nicht bemerkt, wie sie auf diese wirkt. Doch auch die Tochter trägt ihren Teil dazu bei. Mit Ich und meine Mutter wollte Vivian eine Figur schaffen, die ihrer Mutter endlich die Stirn bieten konnte, und einen Weg finden, sich von ihr zu lösen. Aber sie konzentriert sich so sehr darauf, sich zu befreien, dass sie nie wirklich fragt: Wer ist meine Mutter, abgesehen von ihrer Beziehung zu mir? Wie war ihre Kindheit, wer waren ihre Eltern? Wir erfahren nie, wie Bess die Welt erlebt, wer sie außerhalb ihrer Beziehung zu ihrer Tochter sein könnte. Im Grunde sind Mutter und Tochter so sehr damit beschäftigt, ihren eigenen Standpunkt zu vertreten, dass sie sich nicht in die Lage der jeweils anderen versetzen können.
Ein Satz, den Vivian in dem Buch sagt, lässt mir keine Ruhe: „Sie bekommt ja nicht einmal mit, dass ich da bin.“ Ihre eigene Mutter bekommt nicht mit, dass sie da ist. Wie viele Menschen leiden unter diesem Gefühl?
—
Dass man als Illuminator andere Menschen in all ihren Facetten wahrnimmt, gelingt nicht von selbst. Es ist vielmehr eine Kunst, eine besondere Fähigkeit, eine Lebensweise. In anderen Kulturen gibt es eigene Begriffe für diese Art des Seins. In Korea spricht man von nunchi, der Fähigkeit, für Stimmungen und Gedanken anderer Menschen empfänglich zu sein. Im Deutschen kommt dem der Begriff Herzensbildung am nächsten – das Herz wird darauf geschult, andere in ihrem vollen Menschsein zu erfassen.
Was genau ist mit diesen Fähigkeiten gemeint? Das wollen wir nun Schritt für Schritt erkunden.
DREI Erleuchtung
Vor einigen Jahren war ich in Waco, Texas, um sogenannte „Weavers“ zu interviewen, also Menschen, die in Ortschaften und Stadtteilen für Zusammenhalt sorgen und sich für die Gemeinschaft einsetzen. Solche Personen sind leicht ausfindig zu machen. Halten Sie einfach in einem Ort an und fragen Leute auf der Straße: „Wem vertraut man hier? Wer sorgt dafür, dass es hier läuft?“ Dann wird man Ihnen sagen, wen die Leute bewundern, wer die Gemeinschaft aufrechterhält und sich für das Gemeinwohl engagiert.
In Waco nannten mir etliche Leute eine dreiundneunzigjährige Schwarze namens LaRue Dorsey. Ich meldete mich bei ihr und wir verabredeten uns zum Frühstück in einem Diner. Mrs. Dorsey hatte früher in erster Linie als Lehrerin gearbeitet, und ich fragte sie nach ihrem Leben und den Gruppen, denen sie in Waco angehörte.
Jeder Journalist und jede Journalistin hat einen ganz eigenen Interviewstil. Manche setzen auf Verführung und entlocken ihren Gesprächspartner:innen Informationen, indem sie sie mit Nähe und Zustimmung überschütten. Andere gehen eher geschäftsmäßig vor und betrachten Interviews als Handel: Wenn ich bestimmte Informationen bekomme, verrate ich im Gegenzug etwas anderes. Wieder andere sind einfach angenehme, geradezu faszinierende Persönlichkeiten. (Meiner Theorie nach schreibt mein Freund Michael Lewis so viele großartige Bücher, weil er einfach so verdammt sympathisch ist, dass die Leute bereitwillig alles ausplaudern, nur um noch eine Weile seine Gesellschaft genießen zu dürfen.) Ich selbst trete eher auf wie ein Student. Ich bin ernsthaft, respektvoll und nicht besonders vertraulich. Ich bitte andere, mir etwas zu erklären, und werde normalerweise nicht allzu persönlich.
An jenem Morgen beim Frühstück präsentierte sich Mrs. Dorsey als militärisch strenge Person, die deutlich zeigen wollte, dass sie sehr zäh war, dass sie Prinzipien hatte, dass sie die Regeln machte. „Ich habe meine Schüler so geliebt, dass ich sie bestraft habe“, berichtete sie mir. Ich war ein wenig eingeschüchtert von ihr.
Während des Essens kam ein gemeinsamer Freund namens Jimmy Dorrell in das Diner. Jimmy ist ein Kerl wie ein Teddybär, ein großer Weißer Mitte sechzig, der unter einer Autobahnbrücke eine Kirche für Obdachlose eingerichtet hat, neben seinem Haus eine Obdachlosenunterkunft betreut und den Armen dient. Im Laufe der Jahre hat er im Rahmen verschiedener Gemeindeprojekte mit Mrs. Dorsey zusammengearbeitet.
Als er meine Gesprächspartnerin aus der Ferne sah, lächelte er so breit, wie ein Mensch nur lächeln kann, und kam zu unserem Tisch. Dann packte er sie an den Schultern und schüttelte sie viel kräftiger, als man eine Dreiundneunzigjährige jemals schütteln sollte. Er beugte sich zu ihr hinunter und brüllte ihr aus nächster Nähe mit Donnerstimme ins Gesicht: „Mrs. Dorsey! Mrs. Dorsey! Sie sind die Beste! Sie sind die Beste! Ich liebe Sie! Ich liebe Sie!“
Nie zuvor hatte ich erlebt, dass sich das gesamte Auftreten eines Menschen so abrupt veränderte. Die strenge Miene einer hochdisziplinierten alten Frau, die sie mir gezeigt hatte, verschwand schlagartig, stattdessen kam eine fröhliche, begeisterte Neunjährige zum Vorschein. Indem Jimmy Mrs. Dorsey eine andere Art von Aufmerksamkeit schenkte, entlockte er ihr eine andere Version ihrer selbst. Jimmy ist ein Illuminator.
In diesem Augenblick wurde mir klar, wie groß die Macht der Aufmerksamkeit ist. Jeder von uns hat eine ganz bestimmte Weise, sich der Welt zu präsentieren, eine körperliche und geistige Präsenz, mit der wir die Weichen dafür stellen, wie andere mit uns in Kontakt treten. Manche Menschen betreten einen Raum mit warmer, offener Miene, andere wirken kühl und verschlossen. Manche Menschen schenken anderen auf Anhieb einen großzügigen, liebevollen Blick, andere wiederum betrachten Gesprächspartner:innen förmlich und distanziert.
Dieser Blick, dieses erste Anschauen, signalisiert eine Haltung gegenüber der Welt. Wer nach Schönheit sucht, wird wahrscheinlich etwas Wunderbares finden, während man sicherlich Gefahr entdeckt, wenn man nach Bedrohungen Ausschau hält. Eine Person, die Wärme ausstrahlt, bringt die leuchtende Seite ihrer Mitmenschen zum Vorschein, während eine andere die gleichen Menschen möglicherweise als steif und distanziert empfindet, weil sie selbst sehr förmlich auftritt. „Aufmerksamkeit“, so schreibt der Psychiater Iain McGilchrist, „ist ein moralischer Akt: Sie lässt etwas entstehen, bringt bestimmte Aspekte einer Sache zum Vorschein.“ Die Art der Aufmerksamkeit, die Sie der Welt zeigen, hat maßgeblichen Einfluss auf Ihr Leben.
Die Moral meiner Waco-Geschichte lautet also, dass man auf andere Menschen eher so zugehen sollte wie Jimmy und eher nicht so wie ich.
Nun könnten Sie einwenden, dass der Vergleich ein wenig unfair ist. Jimmy kannte Mrs. Dorsey seit Jahren. Natürlich war er mit ihr vertrauter als ich. Jimmy hat eine ungehemmte, ungestüme Art. Wenn ich jemanden so begrüßen würde, wie Jimmy es tut, würde das gekünstelt wirken. So bin ich einfach nicht.