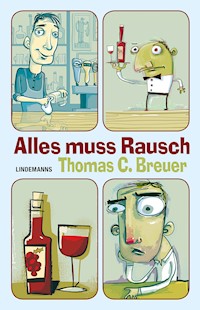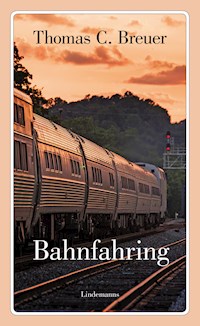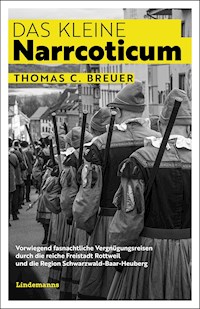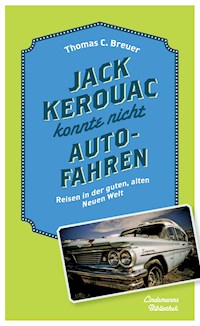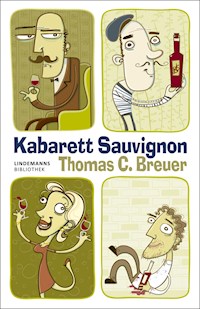3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der Exilrumäne Nicolae ist mit seinem nagelneuen LKW und einer Fracht hochkomplizierter Computer unterwegs von Stuttgart nach Berlin. Beim letzten Parkplatz vor der Grenze, im oberfränkischen Dreiländereck, gönnt er sich eine Pause im Wohnmobil der karibischen Schönheit Luzie. Bald darauf findet die Polizei den LKW ausgebrannt im Wald, von Fahrer und Ladung fehlt jede Spur … (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Ähnliche
Thomas C. Breuer
Huren, Hänger und Hanutas
Kriminalroman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für C., Thommie, Jone, Paulinchen und all die anderen
Die Arbeit an diesem Buch erfuhr freundliche Förderung durch den Förderkreis deutscher Schriftsteller in Stuttgart
Das Leben ist nichts wert
Wenn ein Todesschrei ertönt
Der mein verlöschendes Herz
Nicht zu erreichen mag.
Das Leben ist nichts wert
Wenn der Mörder ohne mein Wissen
Einen anderen Weg genommen hat
Und mir eine neue Falle stellt.
Das Leben ist nichts wert
Wenn ich das, was mich umgibt
Nicht verändern kann, weil es alles ist
Was ich habe und was mich beschützt.
Und deshalb ist für mich
Das Leben nichts wert.
Pablo Milanes
La vida no vale nada
1
I
Nicht zu fassen! Dieses Trumm schluckte nur fünfunddreißig Liter! Fünfunddreißig Literchen auf hundert Kilometern – praktisch nichts also. Fünfunddreißig, zischelte Nicolae Brandt anerkennend durch seine Zahnlücken. Und das bei sage und schreibe 275PS. Er schlug mit der flachen Hand auf das Lenkrad. 275PS kann man auf dieser Strecke auch wahrhaftig gut brauchen, dachte er.
Ab Nürnberg nahm der Verkehr zwar ab, aber dafür wurde es steiler. Gerade ging es ein gutes Stück bergauf. Nicolae Brandt warf einen Blick in den Spiegel und strich seinen Schnauz gerade. Wie mit der Firma, sinnierte er: es geht bergauf. Alles würde von jetzt an besser werden. Die Fahrten nach Berlin beispielsweise: würden sich glattweg um gute eineinhalb Stunden verkürzen. Er konnte enorme Zeiten herausfahren, somit mehr Aufträge annehmen und dabei den Kredit noch schneller abzahlen. Und das alles bei nur fünfunddreißig Litern.
Sicher, an das Zehn-Gang-Getriebe mußte er sich erst noch gewöhnen. Für die lächerlichen vier Tage machte er allerdings seine Sache schon sehr gut. Und eigentlich schaltete es butterweich, als stecke man eine Gabel in Kartoffelpüree. Bald könnten sie sich womöglich schon einen zweiten Truck anschaffen, natürlich dann wieder einen Scania, und dann hätte Mircea nichts mehr zu maulen. Dann wäre er quasi gleichberechtigt. Kleine Brüder müssen sich eben immer etwas gedulden.
Die fünfzehn Jahre im Westen hatten sie weiß Gott nicht verschlafen. Sie hatten ihre Chance genutzt, etwas aus ihrem Leben gemacht.
Gerade überholte er einen stinkenden DDR-Laster, der in seinem eigenen Nebel beinahe verschwand. Mein Gott – wie lange war er auf diese Weise in dem alterschwachen MAN über die Autobahnen gekrebst? Er konnte ein triumphierendes Lächeln nicht unterdrücken. Mußte er auch nicht. Diese elenden Zeiten waren ein für allemal vorbei. Jetzt könnte er es allen zeigen, den Birkarts, Hoyers, Dietrichs, Hamachers, Wohlfahrts, Schachingers, Emons’, Betz’, Schenkers – gerade den Schenkers! – und wie sie alle hießen. Mit Nicolae Brandt war von jetzt an zu rechnen!
Es konnte doch wirklich kaum besser laufen. Damals, in Rumänien, war alles viel schwieriger gewesen. Und jetzt konnte er so oft durch den Sozialismus brausen wie er wollte – und hatte nichts mehr zu befürchten. Er mochte die Strecke nach Berlin zwar nicht besonders, vor allem wegen der volkseigenen Betonpiste, aber die Gewißheit, abends wieder im freien Westen zu sein, war schon was. Und jetzt, mit dieser Containergeschichte, hatte er kaum mehr Arbeit, da blieb eigentlich nur das Fahren, und selbst das ging von nun an wie von selbst.
Morgens die Fracht nach Stuttgart. Normal wäre er ja in so einem Fall gleich wieder nach Kehl zurückgefahren, schließlich war Samstag, aber dann hatte ihn Armbruster über Eurosignal angepiepst, ihre Premiere mit dem Ding, und so hatte er die Fracht nach Berlin abstauben können. Wunderbare Geschichte. Ein glatter Stich.
EIC-Computer. Von Computern verstand er nichts. Er hatte nur letztes Jahr seinem Sohn so ein kleines Teil zu Weihnachten geschenkt. War teuer genug gewesen. Ab und zu hatte er dann dem Buben über die Schulter geplinzt. Aber verstehen konnte er dadurch auch nichts. Es war nur ganz witzig anzusehen, was man damit alles machen konnte. Natürlich hatten sie auch welche im Betrieb, kam man ja heutzutage nicht mehr aus ohne, aber das war Armbrusters Ressort. Er konnte sich schließlich nicht um alles kümmern.
Die Autobahn teilte sich eben, umarmte einen Berg – was, so weit war er schon? Nicht zu fassen! Und dabei ein Wetterchen, um Helden zu zeugen. Die Rasensprenganlagen auf den Äckern warfen mit Regenbogen nur so um sich. Es war Hochsommer.
Heute war die Landschaft richtig schön. Nicht so trist und verlassen wie sonst. Hier hat der liebe Gott für die DDR geübt, hatte er seinem Bruder einmal erklärt. Überall Holzschuppen mit rostigen Wellblechdächern, blinde Plastikplanen mit alten Autoreifen auf den Feldern, modrige Fischteiche mit brackigem Wasser und ab und zu ein Autowrack. Alles in blassen Farbtönen, als hätte man die Gegend zu oft gewaschen. Und was die in diesem Teil Deutschlands als Raststätten durchgehen ließen, hätte es in Südbaden nicht mal zur Imbißbude gebracht.
Es war heiß. Über der Piste waberte die Asphalthitze wie im Amerika-Kalender seiner Tankstelle. Er nahm eine Cola aus dem Dosenhalter. Dosenhalter – nicht mal unwichtig. Eine ausgelaufene Coladose hatte ihm im alten Truck schon mal einen ganzen Satz Straßenkarten ruiniert. Überhaupt, Nicolae Brandt hatte es an nichts fehlen lassen. Wenn schon, denn schon. Bugschürze, Dachspoiler, Sonnenblende, Nebellampen, Lufthörner, Flipper, Eurosignal und selbstverständlich CB, mit einer Original-Firestick-II-Antenne an der Dachrinne. Die Kabine war mit züngelnden Flammen bemalt, weswegen er schon überlegt hatte, ob er den Wagen vielleicht »Dragon One« nennen sollte. Ein guter Name war nämlich wichtig.
Ein simpler Knopfdruck. Nicolae Brandt schickte den Zeiger des Tachos auf die Reise: Das Radio sprang an. Der halbe Wagen ließ sich gewissermaßen per Knopfdruck regieren. Country-Music. Auf der ganzen Strecke bis hoch nach Hof war man diesen leidigen Country-Attacken von Bayern 3 ausgesetzt. Trucker zu sein hieß ja nicht automatisch, nur Dolly Parton oder Willie Nelson zu hören. Mit Dolly Parton hätte er lieber ganz andere Dinge angefangen. Nein, Country mochte er nicht. Seine Magnum-Mütze und die Fliegerbrille waren auch nur Tarnung. Sein T-Shirt klassifizierte ihn zwar als Marlboro-Raucher, aber auch das war eine falsche Fährte. Meistens steckte eine Schachtel Overstolz im Ärmel, wenn er nur weit genug war – viel Platz zwischen Haut und Stoff ließen seine Muskeln nämlich nicht. Nicolae Brandt war sehr muskulös, von Natur aus braungebrannt – Café Melange –, untersetzt, kompakt wie eine Telefonzelle, aber nur halb so groß. Er hatte ein breites Gesicht, das Koteletten ein wenig in die Länge ziehen sollten, was ihnen nicht sonderlich glückte, buschige Augenbrauen, zirka 98 % Breschnew, dichtes schwarzes Haar und einen dicken Schnurrbart, auf dessen Spitzen er herumzukauen pflegte. Seine Augen zeigte er nicht gerne, weil sie mit ihren dünnen, roten Äderchen von seinem ungetrübten Verhältnis zum Alkohol zeugten.
Bayern 3 brachte tatsächlich Country. Ihm war dieser Sender zu breitarschig, er liebte es flotter, aber hier gab es nun mal nichts anderes, außer AFN. Und der brachte keine Verkehrsdurchsagen. Zu Hause hatte er es wesentlich besser, da ging es im Radio locker-flockig zu. Mit der kompletten Belegschaft, alle sechse, mit Ausnahme von Fräulin Fiebig, die sich für solche Spielereien zu alt fühlte, hatten sie sich einmal bei SWF3, an einem Hörer-Wunschkonzert beteiligt. Er hatte sogar selbst mit dem Moderator telefoniert, live! Seitdem hatte er dem Sender ewige Treue geschworen.
Er knipste das Radio wieder aus. Nicht mehr lange bis zum RIAS, wenigstens was. Der Tacho zeigte 95. Er bremste ab. Etwa hundert Meter vor ihm fuhr der Streifenwagen. Eine Kontrolle mußte ja nun nicht gerade sein. Irgendwas fanden die ja immer. Aber, Mist, jetzt war halt der ganze Schwung weg, die Steigung hätte er sonst wie nix genommen. Rasch überholte er noch einen klapprigen 2CV und einen Mercedes mit polnischer Nummer – die wurden auch immer frecher, fuhren jetzt schon im Benz durch die Gegend! – und scherte auf die rechte Spur zurück.
Parken 500 Meter. Ein Päuschen konnte jetzt nichts schaden. Er lag ja blendend im Rennen.
Gleich nächste Woche würde der Schriftzug auf die Planen kommen: zweimal die Woche Kehl–Berlin. Seine Hausstrecke. Noch 200 Meter. Und an den Aufkleber LONG VEHICLE mußte er auch noch denken, den hatte er sich jetzt endlich verdient: Noch 100 Meter. Vor ihm schlich ein Bus. Winkende Kinder mit Kopfhörern auf den Ohren, im Angriff auf Berlin. Aufgeräumt, wie er war, winkte er zurück, bevor er den Truck abbremste. Die würde er noch vor Leipzig wieder eingeholt haben. Mindestens.
Nicolae Brandt konnte nicht wissen, daß er die Abfahrt Leipzig nicht mehr erreichen würde. Als er den Blinker setzte und langsam herunterschaltete, bestand sein ganzes Leben aus kaum mehr als einer Dreiviertelstunde.
II
Auf den ersten Blick unterschied sich der Parkplatz in nichts von anderen Parkplätzen entlang der Autobahn. Drei, vier Mülleimer, zwei steinerne Sitzgruppen, einige Foltergeräte für Bewegungssüchtige, dazu Menschen: Dackelinhaber, Picknicker, Kleinwagenfahrer. Ein adrettes Wäldchen drumherum, in dem man Zeitungspapier, Papiertaschentücher oder echtes Dreilagiges verstecken konnte.
Zum Wald führte kurz vor der Ausfahrt zur Autobahn ein Feldweg durch den wilden Hafer, mit dem Schild »Durchfahrt verboten« versehen, wobei die Angehörigen des BAB-Betriebsdienstes natürlich ausgenommen waren. Und es gab nicht nur wilden Hafer dort: ein paar Hanfpflanzen hatten sich – Südhang – zu erstaunlicher Größe emporgeschwungen, jedenfalls für hiesige Verhältnisse. Luzies Hausplantage.
Luzie versah ihren BAB-Betriebsdienst auf ihre Weise. Ihr Wohnmobil, ein ausrangierter 308er Postwagen, stand inmitten einer kleinen Lichtung und war vom Parkplatz aus kaum zu sehen. Luzie war es, die den Parkplatz bei Kilometer 257.0 kurz hinter dem Autobahndreieck Hof zu etwas ganz Besonderem machte.
Das »Durchfahrt verboten«-Schild war der Wegweiser zu ihrem Knusperhäuschen, und wie alle Geheimtips hatte sich ihr mobiles Etablissement mit Lichtgeschwindigkeit in Fachkreisen herumgesprochen. Fachkreise, das waren neben den Vertretern natürlich die Fernfahrer, die fern der Heimat nichts anbrennen lassen wollten.
Durchfahrt verboten. Ein Markenzeichen. Ein paar Schritte. Ein Näschen frische Luft. Die eine oder andere Sünde. Sogar einen Kühlschrank gab es, mit Getränken drin, gegen Aufpreis.
Heute, Samstag, war es eher ruhig. Die Vertreter und Trucker auf dem Weg zu Muttern. Luzie saß in einem zerschlissenen Campingstuhl vor der offenen Wagentür und fächelte sich mit einer alten Fernsehzeitschrift Luft zu. Es war heiß. Zu heiß für Begierden. Nicht, daß ihr die Hitze etwas ausgemacht hätte, im Gegenteil. Den Freiern sicher, aber ihr nicht. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr war Hitze ihr ständiger Begleiter gewesen und hatte ihr tägliches Brot ausgetrocknet. Luzie kam keineswegs aus Franken, sondern aus der Karibik, und sie hieß auch nicht Luzie, sondern Erzulie. Ein Name, den sie ihren Freiern nie beibringen konnte, bis sie schließlich einer von ihnen kurzerhand Luzie genannt hatte, nach ihrer Heimatinsel St. Lucia, auch wenn er nicht annähernd wußte, wo das lag. Und sie, des ewigen Buchstabierens müde, hatte den Namen einfach übernommen.
Luzie langweilte sich. Es gab nichts zu tun. Der Sommer weckte Sehnsüchte, die Gerüche, die Hitze, auch wenn das Rauschen der Brandung und die pausenlosen Nachrichtenübertragungen der Zikaden fehlten. Der Ti Punch, den sie sich eben gemixt hatte, verstärkte ihre Sehnsucht.
Ihre Beine verließen die Shorts frühzeitig und reckten sich der Sonne entgegen. Nicht, daß sie braun werden wollten. Braun war Luzie schon am ganzen Körper, schogettenbraun.
Über ihren Shorts trug sie ein Sonnentop, das nie den Nabel erreichen würde und Mühe hatte, ihre Brüste, die eine Spur zu üppig geraten waren, im Zaum zu halten. Alles an Luzie war eine Spur zu üppig: das ausladende Kinn, der großzügig geschwungene Mund, der einem Breitmaulfrosch Ehre gemacht hätte und perlweiße, knabberfreudige Zähne verbarg und aus dem es immer frisch nach Kaugummi roch. Das Gebiß war übrigens lange vor der Erfindung der Zahnspange entstanden.
Die Augen. An Sonnentagen natürlich hinter einer riesigen Sonnenbrille verborgen, so daß sich der Spott darin nicht gleich jedem Besucher mitteilte. Kleine Smaragde unter einem dichten Wimperndschungel, keine reinen Smaragde, sondern mit rostroten Sprenkeln durchsetzt. Ungeübte Betrachter glaubten nicht selten Goldfische darin schwimmen zu sehen. Die Augäpfel waren durch und durch karibisch, der Rum hatte seine roten Kreise auf ihnen gezogen. Ein gelegentlicher Schlafzimmerblick war nichts weiter als Kurzsichtigkeit. Die Krähenfüße in den Augenwinkeln waren eher Rallyestreifen, weil das Leben so rasch vorbeiging. Sie versuchte, der Schnellebigkeit mit einer gewissen Trägheit ihrer Bewegungen gegenzusteuern. Manch einem unterlief dabei der Trugschluß, ihr Gehirn arbeite ähnlich langsam.
Ihr Haar trug sie europäisch entkraust und gelockt und kostete sie einen Haufen Geld. Auch ihr Schminketat war beträchtlich. Ihre Handtasche glich in Spitzenzeiten einem Altglascontainer.
Gelegentlich stand sie auf, um sich einen neuen Drink zu mixen, und wenn sie ging, war jede Handbreit Boden ein Stück Laufsteg für sie. Sie bewegte sich geschmeidig, aber eben schleppend, was viele Männer als lasziv empfanden.
Diese Frau konnte man sich unmöglich in einem gewöhnlichen Nachthemd vorstellen.
Ein Blick in den Kühlschrank hatte ihr gesagt, daß ihr Limettenvorrat langsam zur Neige ging. Und Rohrzucker war auch nur noch eine halbe Flasche da. Wurde Zeit, daß Yves wieder hier aufkreuzte. Yves aus Marseille war ihr Hoflieferant, was das Zubehör für den Alkohol anbelangte, und er ließ sich gerne in Naturalien ausbezahlen.
Üppigkeit hatte auch das Wohnmobil befallen, eine Art Dampfkochtopf mit einem sehr persönlich gestalteten subtropischen Kleinklima. Ein Papageienkäfig mit Papagei, eine Fototapete, die stark an eine Bounty-Reklame erinnerte. Der Kühlschrank neben der Nirostaspüle war mit einer Folie »tropisches Zierholz« überzogen, DC-fix gegen Fernweh. Den größten Raum nahm selbstverständlich das Bett ein, bedeckt mit einer bunten Decke aus Madras-Stoff, an der Kopf- und Wandseite von einer Ablage umrandet, die ebenfalls mit Dritte-Welt-Folie beklebt war. Darauf jede Menge Gegenstände, die keinesfalls in die Hände Jugendlicher gehörten: alles, was nicht unbedingt das Herz, sondern eher die Region unterhalb des Nabels begehrte. Und auf dem Beistelltischchen sah es nicht anders aus. Dort lagerten einige Voodoo-Reliquien wie beispielsweise die ehemalige Schnapsflasche mit den 35 eingelegten Schlangenpenissen oder Amulette und Knochen unbekannter Herkunft. Als weltlicher Kontrapunkt sozusagen die obligatorische Kleenexpackung. Dazu ein paar Artikelchen aus einem diskreten Postversand. Zur Vervollständigung des Idylls fehlte eigentlich nur ein gerahmtes Zertifikat an der Wand: AIDS-freier Bestand.
Auf einem mickrigen Rattanhocker stand eine traurige Zimmerpalme. In einer prallen, motorradhelmgroßen Melone auf dem Tisch neben dem Eingang steckte der Griff eines Messers. Es mußte ein sehr langes Messer sein.
Diese Wochenenden. Alle Kreuzworträtsel gelöst. Keine Lust zum Stricken. Die Nägel hatte sie sich schon lackiert. Sie war eine der Frauen, denen der Nagellack nie richtig trocken wurde.
Sie ging im Wohnwagen auf und ab, soweit die Räumlichkeit das zuließ. Es war eng, und ihre Hüften waren so breit oder so schmal wie ein Teewagen, je nachdem. Sie bückte sich und zog die Besteckschublade auf. Der Revolver war noch da. Er war nicht wesentlich größer als der Dosenöffner. Jeden Tag nahm sie ihn auseinander, reinigte ihn, betrachtete ihn: Eines Tages sollte er ihr helfen, von hier wegzukommen. Vom Parkplatz beim Kilometer 257,0, von diesem verdammten Karren und von diesem dreimal verfluchten Kerl. Es würde Ärger geben, das war ihr klar. Deshalb hatte sie sich ja den kleinen Freund angeschafft, über die Marseille-Connection, gegen ein einjähriges Frei-Abo … Eine Patrone verschwand unter ihrem Fingernagel. Sie seufzte. Ein bißchen wenig Blei für so eine Masse von Körper. Würde höchstens aus nächster Nähe wirken, wenn überhaupt. Aber das würde sich leicht ergeben, denn wenn er kam, war er immer in nächster Nähe. Näher ging nicht. Und das war es hauptsächlich, was Luzie störte.
Sie mußte jedenfalls auf der Hut sein.
Langsam glitt die Kugel in die Trommel zurück. Der Papagei kannte das Klickgeräusch auswendig, schaffte es aber nie, es gut genug nachzuahmen. Der Revolver war einfach besser.
III
Die Beine ragten aus dem Fenster, die Füße baumelten gelegentlich gegen die Leitplanke. Es gab ein kurzes, spitzes Geräusch, denn vorne waren die Stiefel mit Eisen beschlagen. Die Füße gehörten dem Mann im Wagen, der gerade gelangweilt am Drehknopf seines Funkgerätes herumspielte und nebenbei einen Teil seiner Maniküre mit den Zähnen erledigte. Er schwitzte unablässig, die Innentemperatur mochte trotz des geöffneten Fensters wohl an die 40 Grad betragen.
Sein Gesicht war klein, fand in der Kinnpartie seine größte Ausdehnung und lief nach oben hin spitz zu wie ein Warndreieck. Er besaß Schweinsäuglein mit hellen Wimpern darüber und angewachsene Ohrläppchen. Unter den kurzgeschorenen, rotblonden Haaren trug er einen messerscharfen Verstand. Er war über und über mit Sommersprossen besprenkelt.
»Sehr warm«, sagte er. Seine Stimme klang ein bißchen nach Megaphon, quäkend, knatternd und laut. Seine Augen riß er beim Reden eine Spalt breit auf.
Neben seinen schwingenden Füßen stand der zweite Mann. Er beugte sich übers Geländer, die Ellenbogen auf die Balustrade gestützt.
Er war nicht sonderlich groß, was er jedoch mit Korpulenz wettmachte. Sein Kopf mit den farblosen Haaren aus Putzwolle ruhte auf den Händen: ein schwammiges Etwas mit rosigem Teint wie Wackelpeter und einer roten Frucht als Nase. Darauf ruhte sich eine Hornbrille aus. Er war zu dick und sah viel zu gesund aus und – ganz anders als der Mann im Wagen, der nicht nur Fliegen etwas zuleide tun konnte – zu gutmütig, wie ein abgeschminkter Zirkusclown.
Sein Blick war auf die beiden Betonpisten geheftet, die nur durch einen Streifen schmalen Grüns voneinander getrennt waren und auf denen nur wenige Autos dahinrollten. Er nagte gedankenlos an einem Schokoladenriegel herum.
»Nichts los«, meldete er dem Mann im Wagen, denn er hatte schließlich den Überblick. Der Verkehr war kaum spärlich zu nennen, vor allem Trucks machten sich an diesem Tag besonders rar. Wenn dann doch mal einer seinen Hochsitz passierte, schickte er ihm einen aus Enttäuschung und Wehmut gemischten Blick hinterher: wieder nix. Schade. Er wandte sich um. »Magst einen Schokoriegel?« fragte er. Er sprach durch die Nase, halb Dünkel, halb Polypen.
Der andere schüttelte angeekelt seinen Kopf. »Ich frag mich, wie du das schaffst, Münzel, dieses ganze klebrige Zeugs bei dem Wetter. Speiübel würde mir davon werden. Sapperlot.«
»Du hast ja auch deine Fingernägel, Werbinek. Noch keine Nachricht von deinem Mädchen?«
»Absolute Funkstille«, sagte Werbinek aus dem Auto heraus.
»Und nicht mal Bundesliga im Radio. Ein Scheiß-Sommer ist das. Kein Fußball, keine Kundschaft, kein gar nix.«
Beide schwiegen eine Runde.
Dann sagte Münzel: »Ich finde, dein Mädel läßt nach. Stücker zwanzig LKW sind hier schon vorbei. Du könntest die Zügel mal wieder anziehen.«
Pling, sagte der Schuh zum Geländer.
»Laß das mal meine Sorge sein. Die Leute aus den Tropen sind zwar von Natur aus faul, aber wo nix is, kann auch nix werden. Ein Schmarrn.«
IV
Sie wollte weg. Immer, wenn sie nichts zu tun hatte, kreisten ihre Gedanken nur um das eine: weg von hier. und wenn sie zu tun hatte, war es kaum anders. Am schlimmsten war es, wenn er da war. Das Schwein. Nun, gut, er hatte sie aus Berlin rausgeholt. Aber war es jetzt vielleicht besser? Seine Heldentat – pah. Hier hielt er sie als Sklavin. Woher nahm er sich das Recht? Selbst auf St. Lucia war die Sklaverei längst abgeschafft.
Trotzdem war es damals richtig gewesen, die Insel zu verlassen. Auf St. Lucia war sie immer auf dem Sprung gewesen, die gepackte Reisetasche bei Fuß. Sie hatte sich nicht einmal einen festen Freund geleistet. Sie war schwarz. Über ihr gab es die Braunen und ein paar Weiße, die die Engländer übriggelassen hatten. Die hielten die Fäden in der Hand. Unter ihr gab es nichts mehr. Ihre gelegentlich schwarzen Liebhaber verdienten zu wenig, um sie aushalten zu können. Die Braunen ließen sich nur selten mit ihr ein, die blieben lieber unter sich. Die Weißen hatten ihre eigenen Frauen, vertrieben sich höchstens mal die Zeit mit ihr und trauten sich nicht mit ihr zusammen auf die Straße. Was sollte da aus einem Mädchen mit nur mangelhafter Schulbildung werden?
Da war dann diese Heiratsvermittlung gewesen, und sie war aus einem Katalog heraus nach Berlin bestellt worden. Ihr neues Heim war mit Bordell noch vorteilhaft umschrieben, und von dort hatte sie Werbinek mit zwei Flaschen Martinique Rum ins Frankenland gelockt. Und mit Versprechungen. Ihren Kerl hatte er übel reingeritten. Richtig gemein konnte Werbinek sein. Vielleicht war ihr Berliner Loddel auch ganz froh. Mit einem Thai-Mädchen würde er weniger Schwierigkeiten haben.
Aber nun saß sie hier fest. Werbinek pflegte ihr gerne ausgiebig zu erklären, was er mit ihr anstellen würde, wenn sie ihn verließe.
Ihr blieben nur zwei Möglichkeiten. Entweder mußte sie etwas finden, womit sie ihn unter Druck setzen konnte, oder sie mußte ihn umbringen. Dann gab es zwar noch den anderen, das Leckermaul, aber den nahm sie nicht ernst, den konnte sie notfalls mit einer Tafel Schokolade in Schach halten.
Aber Werbinek, der war gefährlich. Ein Blick wie ein Fangseil. Mächtige Pranken, die hin und wieder gerne hinlangten. Sie könnte ihn auch verpfeifen, aber dann wäre sie bis zu den Ohren mit drin. Er war immerhin die beste Versicherung, die sie kriegen konnte. Und bei welchem Schlamassel auch immer: wer würde einer Frau Glauben schenken, die erstens Prostituierte und zweitens obendrein auch noch schwarz war?
Sie konnte warten. Auf den richtigen Moment. Sie hatte sich sogar schon überlegt, was sie danach machen würde: anschaffen ohne Zuhälter, bis es für eine Bar auf St. Lucia reichen würde. Luzie wußte alles genau, die Zukunft hatte sie gewissermaßen im Griff. Nur mit der Gegenwart haperte es noch ein bißchen.
Sie schnitt eine Scheibe aus der Melone heraus und starrte mit siegessicherem Lächeln auf Roger Moore, der als Poster über ihrem Kühlschrank hing.
V
Der Alte Bahnhof war zwar alt, aber schon lange kein Bahnhof mehr. Er teilte das Schickal vieler öffentlicher Gebäude, die sich – für ihre ursprünglichen Aufgaben zu klein oder zu marod geworden –, je nach Blickwinkel, zu Kulturzentren empor- oder heruntergewirtschaftet hatten.
Werner Hölzerfeind nagte an der Verschlußkappe seines Filzschreibers. Er brütete über einem Text, der nicht nur etwas mit dem hochattraktiven Thema Rehabilitation, sondern auch noch etwas mit dem Frankenland zu tun haben mußte. Oh, Gott. Wie diese beiden Dinge unter einen Hut bringen, wenn man sich weder für das eine noch für das andere interessierte? Nur war Werner Hölzerfeind leider als Stadtschreiber engagiert, und als solcher hatte er sich mit derartigen Themen zu befassen. Nicht mal hier in Hof im Alten Bahnhof, einem der wenigen Orte, den er in dieser unsäglichen Gegend überhaupt ertragen konnte, sondern etwa fünfzehn Kilometer weiter östlich in Hirschau, einer Kleinstadt, die außer einem riesigen Reha-Zentrum nichts von Bedeutung aufwies. Deshalb, und um gelegentlich in den Feuilletons überregionaler Blätter in einer Dreizeilenmeldung erwähnt zu werden, vergab man dort Stipendien an versehrte Künstler.
Werner Hölzerfeind war ein versehrter Künstler. Auf seinem Weg zur Toilette oder zur Theke konnte jeder sehen, daß er das linke Bein nachzog. Der Fuß war nach außen weggeknickt. Kinderlähmung. Immerhin, und das hatte er frühzeitig zu schätzen gelernt, bescherte ihm dieses Manko ein gewisses Maß an Narrenfreiheit und hatte ihn vor unangenehmen Verrichtungen wie Turnen oder Militärdienst bewahrt. Gerade Turnen: seinen Mitschülern hatte der ehemalige Gauturnwart Fasold immer Staffelhölzer ins Kreuz geschmissen, unter infernalischem Gebrüll. In dieser Beziehung war er fein raus gewesen.
Schon vom Zuschauen war ihm übel geworden. Er konnte sich allgemein meistens nur aufs Zuschauen beschränken, und übel wurde ihm noch in ganz anderen Situationen. Er hatte eine gute Beobachtungsgabe, die er im Laufe der Jahre verfeinert hatte. Und irgendwann hatte er angefangen, seine Beobachtungen zu Papier zu bringen. Er schrieb damals ausgezeichnete Aufsätze und später ausgezeichnete Artikel für die Schülerzeitung VOILA!, und er fand natürlich schnell heraus, daß das Schreiben ein ausgezeichnetes Überdruckventil war, wenn man die Mädels nicht mit Schlagballweitwurf oder Letkiss beeindrucken konnte. Und außerdem war Schreiben Beschäftigungstherapie, Stärkungsmittel und Schutzschild gegen übermütige Bemerkungen wie »Na, Knickebein?!« oder »Ungültiger Versuch. Fußfehler!« gewesen.
Er hatte sich annähernd alles von der Seele geschrieben, hatte die Geduld seines Papiers und seiner Mitschüler strapaziert und war dann während seiner Studienzeit damit ins Radio reingerutscht. Jetzt, nach Jahren erfolgreichen Ketzertums, schien ihn endlich die gerechte Strafe ereilt zu haben: Stadtschreiber in Hirschau. Ein ganzes Jahr lang. Eine Strafexpedition. Warum zum Teufel hatte er sich darauf eingelassen?
Wahrscheinlich wegen der Kohle.
Er fing in gewohnter Manier gleich an, in der Chronik der Stadt herumzustochern, einem sicheren Weg zu unsterblichem Ruhm und großer Beliebtheit. Jeder Punkt, auf den er seine Finger legte, schien wund. Schon bald boten ihm die Honoratioren der Stadt und auch die bedeutenden Persönlichkeiten des Landkreises ihre Feindschaft an.
Allein auf weiter Flur. Und die Dichte psychischer Tankstellen war eher gering. Wären nicht der alte Bahnhof und Luzie gewesen, die er hier kennen- und mögengelernt hatte, es wäre die finsterste Zeit seines Lebens geworden.
LUCY stand auch in großen Lettern auf dem sonst blanken Blatt Papier. Die kleinen Fenster des Schankraumes ließen den Sommer außen vor. Kalter Rauch und der Duft abgestandenen Bieres machten die Luft zeitlos. Auch der saure Schweiß vom Vorabend hatte noch keine Zeit und vor allem keine Öffnung gefunden, abzuziehen.
Lucy, ein verwaister Name auf einem Blatt Papier. Die Tischplatte drum herum war gezeichnet durch die Beanspruchung mehrerer Jahrhunderte, mindestens zweier, wo immer sie vorher gestanden haben mochte, und Vornamen waren das weitaus beliebteste Motiv der eifrigen Schnitzer gewesen. Weibliche Vornamen.
Lucy. Der Minderheitenbonus hatte sie zusammengebracht. Und vielleicht die Tatsache, daß er ihr nicht auf die üblich dumme Tour gekommen war. Es war nach einem Salsa-Konzert gewesen – Salsa, ausgerechnet in Hof. Eine echte Salsa-Gruppe aus Berlin West. Aber mittlerweile war ja alles überall möglich, sogar Salsa in Hof. Mireille Mathieu hatte ihr »Akropolis Adieu« auch schon in der Oper von Manaus geschmettert.
Sicher war es nicht körperliche Faszination, die sie beide zusammengebracht hatte, zumindest nicht bei ihr. Von seiner Frisur, die mehr an einen politischen Gefangenen erinnerte, seinem gerupften Bart, dem viel zu weiten Fischerhemd, den speckigen Cordhosen und den blinden Holzpantinen ging nur wenig Faszination aus, genau gesagt: gar keine. Werner Hölzerfeind sah aus, als wäre er soeben aus einem sozialkritischen Film ausgerissen. Höchstens seine Augen, an jenem Abend in stillem Einverständnis mit der Musik, hätten sie faszinieren können. Werner Hölzerfeind mochte Salsa vor allem aus Wiedergutmachungsgründen gegenüber der Dritten Welt, und möglicherweise mochte er Lucy aus dem gleichen Grund. Natürlich war sie ihm gleich aufgefallen, denn – trotz gelegentlicher Farbtupfer der amerikanischen Armee – in diesen Landstrich paßte sie in etwa wie eine Schlumpfmaske zum Karneval von Venedig.
Ein schöner Vergleich, hatte er gedacht. Muß ich mir notieren, kann ich vielleicht mal irgendwo verwenden. Werner Hölzerfeind ließ nichts umkommen.
Es war allerdings auch ihr Körper, der ihm gefiel. Inoffiziell, er ließ sich nichts anmerken, er war kein schlechter Schauspieler. Jedenfalls hatte er sie an besagtem Abend als wohl einziger nicht mit hervorquellenden Augen und hechelnder Zunge angestarrt. Und Fernweh brachte sie miteinander ins Gespräch. Natürlich zufällig.
Sie hatten sich angefreundet. Platonische Liebe, wenn man so will. Offiziell. Jedenfalls behielt Werner Hölzerfeind seine Zunge auch weiterhin im Mund und seine Hände hielten nach wie vor wenig anderes als Gläser und Schreibutensilien.
Eine einfache Rechnung. Sie wollte weg. Er wollte weg. Und gemeinsam konnten sie ein wenig durch den Himmel rauschen. Und seltsamerweise hatte Werbinek, dem die keusche Annäherung nicht verborgen blieb, obwohl er sich aus verständlichen Gründen nie mit Luzie in der Öffentlichkeit zeigte, nichts dagegen. Er hatte ja alles unter Kontrolle. Von einem Krüppel ging nichts Bedrohliches aus.