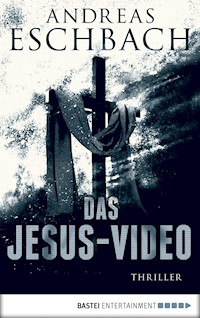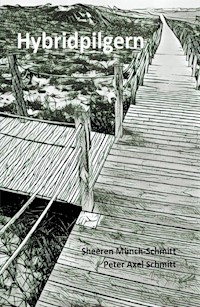
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Zwei Suchende auf dem Weg: Ein getaufter Christ aus Westdeutschland, der mal Pfarrer werden wollte, nach dem Studium von Religionsphilosophie aber aus der Kirche ausgetreten ist, und seine in der DDR geborene ungetaufte, aber an Gott glaubende deutlich jüngere Ehefrau auf dem Caminho Português von Porto nach Santiago de Compostela: er teilweise per Auto, sie komplett per pedes - kann das gehen? Kann das gutgehen? Wie dieser "hybride" - nämlich höchst unterschiedliche und ungewöhnliche - Pilgerweg ablief, beschreibt dieses faktenreiche, gedankenanregende und gleichwohl selbstironisch-amüsante Buch in über 30 Kapiteln. Die Gedanken der beiden grundverschiedenen, aber einander liebenden Autoren auf dem Weg und über den Weg führen uns über Berg und Tal, Schuld und Sühne, Himmel und Hölle, Tod und Teufel immer wieder zur letzten Frage: GOTT? Wer den Caminho oder Camino bereits kennt, wird vielleicht neue Perspektiven sehen, wer ihn noch nicht gegangen ist, wird durch dieses Buch vielleicht etwas besser vorbereitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hybridpilgern – Gedanken zum und auf dem Jakobsweg.
© 2021 Sheeren Münch-Schmitt / Peter A. Schmitt
Autor: Sheeren Münch-Schmitt / Peter A. Schmitt
Umschlaggestaltung, Illustration: Peter A. Schmitt
Fotos: Sheeren Münch-Schmitt / Peter A. Schmitt
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
978-3-347-37560-4 (Paperback)
978-3-347-37561-1 (Hardcover)
978-3-347-37562-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Zum Titel
Ein Jahr vorher
Mythos
Motivation
Erwartungen
1. Etappe: Porto – Perafita
Trennung
2. Etappe: Perafita – Vila do Conde
Versuchung
3. Etappe: Vila do Conde – Esposende
Serenidade
4. Etappe: Esposende – Viana do Castelo
Kruzifix
5. Etappe: Viana do Castelo – Vila Praia de Âncora
Exkursion
6. Etappe: Vila Praia de Âncora – Vila Nova de Cerveira
Visionen
7. Etappe: Vila Nova de Cerveira – Valença
Sünde
8. Etappe: Valença – O Porriño
Töten
Befreiung
9. Etappe: O Porriño – Redondela
Tod
Himmel
Hölle
10. Etappe: Redondela – Pontevedra
Gott
11. Etappe: Pontevedra – Caldas de Reis
Teufel
12. Etappe: Caldas de Reis – Padrón
Leiden
13. Etappe: Padrón – Milladoiro
Kommerz
14. Etappe: Milladoiro – Santiago de Compostela
Der Tag danach
Universum
Epilog
Stichwortverzeichnis
Für meine Familie.
Für meine Eltern,
die mir in schwierigen Nachkriegsjahren eine glückliche Kindheit beschert und einen Glauben an den Lieben Gott vermittelt haben, der mir über viele Jahre Sicherheit gegeben hat.
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Antonio Machado
Wanderer, nur deine Spuren sind der Weg sonst nichts;
Wanderer, es gibt keinen Weg,
der Weg entsteht beim Gehen.
Beim Gehen entsteht der Weg,
und schaust du zurück,
siehst du den Pfad, den du
nie wieder betreten wirst.
Übersetzung: PAS
Zum Titel
Wieso „hybrid“? Was kann denn beim Pilgern „hybrid“ sein? Als hybrid bezeichnet man ja eine Mischung aus (meist zwei) verschiedenen Komponenten. (Wir kennen das von Pflanzen und in letzter Zeit vor allem durch die Hybridmodelle von Autos.) In diesem Sinne war unser gemeinsamer Jakobsweg zweifellos hybrid.
Zum einen sind wir ein auffallend unterschiedliches Ehepaar. Schon alters- und gewichtsmäßig. Zum andern ist die Art und Weise, wie wir nach Santiago de Compostela gepilgert sind, eine Mischform, die ziemlich selten sein dürfte. Um das gleich vorauszuschicken: Einer von uns hat die gesamte Strecke von Porto aus, also rund 260 Kilometer, mit vollem Gepäck zu Fuß zurückgelegt. Die andere (dickere und ältere) Person war nur rund 110 Kilometer pilgermäßig per pedes unterwegs, die übrige Strecke mit einem Mietwagen. Man ahnt schon, wer wer war. Jedenfalls waren sowohl die Planung als auch die Durchführung interessant genug, um auf den Gedanken zu kommen, dass man darüber in einem kleinen Büchlein berichten könnte.
Die Idee, nach dem Pilgern ein Buch darüber zu schreiben, ist leider nicht originell. Man hat den Eindruck, dass sämtliche Jakobswegpilger – das sind meist Pilgerinnen – nach ihrer Rückkehr geradezu zwanghaft ein Buch publizieren müssen. Gut, das ist übertrieben. Aber gehen Sie mal auf die Amazon-Website, wählen Sie im Suchfeld die Kategorie „Bücher“ und geben Sie als Suchwort „Jakobsweg“ ein. Das liefert über 4000 Buchtitel. Viertausend! Braucht es dazu noch ein weiteres Buch? Dieses hier?
Aber egal, wir haben dieses Büchlein nun mal verfasst, Sie haben schon begonnen, es zu lesen – da können wir ja auch gleich weitermachen. Immerhin gibt es bisher nur dieses eine Buch mit dem seltsamen Titel Hybridpilgern. Und vielleicht motiviert es manche Leser dazu, sich ebenfalls in der von uns beschriebenen ungewöhnlichen Form auf den Weg zu machen. Das Titelbild symbolisiert das: Einer von uns pilgert den direkten Jakobsweg, der andere weicht gelegentlich davon ab.
Übrigens: Wir sind beide Linguisten und mit der sprachlichen Seite der Genderdebatte gut vertraut. Nicht trotzdem, sondern deswegen verwenden wir in diesem Buch das sogenannte generische Maskulinum. Das heißt, wenn wir speziell weibliche Pilger meinen, sagen wir Pilgerinnen, ansonsten sind mit Pilger alle denkbaren Erscheinungsformen gemeint.
Halt – noch etwas: Wie Sie gleich bemerken werden, haben wir die meisten Teile dieses Buchs getrennt geschrieben, einige gemeinsam. Wer jeweils „ich“ ist, dürfte kein Rätsel sein.
Ein Jahr vorher
Natürlich kannten wir „Ich bin dann mal weg…“ schon lange – wie inzwischen fast jeder, seit Pilgern (wieder) in die Mode gekommen ist. Aber bisher war das für uns nicht mehr als nette Unterhaltung im Abendprogramm. Das änderte sich im Frühjahr 2018. Doch wie war es zu diesem Gesinnungswandel gekommen?
In der Zwischenzeit war mein Opa gestorben und kurz danach mussten wir auch noch unseren krebskranken 13-jährigen Hund einschläfern lassen, der für uns wie ein Familienmitglied war. Hinzu kamen gleich mehrere Todesfälle im Kollegen- und Bekanntenkreis meines Mannes – alle etwa in seinem Alter. Das Thema „Tod“ war plötzlich omnipräsent – und ich hatte so meine Probleme damit.
Kennen Sie den Spruch „Du siehst die Sonne untergehen und erschrickst doch, wenn es plötzlich dunkel ist“? Genau so ging es mir. Ich litt immer mehr unter Verlustängsten und machte mir zudem Vorwürfe, weil ich mich nicht von meinem Opi verabschiedet hatte.
Auch nach etlichen Monaten ließ die Trauer nicht nach und ich befand mich weiterhin in einer Endlosschleife aus Grübeleien und Ängsten, die mir schlaflose Nächte und Herzrasen bescherten. Eins war klar: Diese emotionale Abwärtsspirale musste gestoppt werden. Und dann sahen wir eines Abends zufällig den Film „Dein Weg“, in dem ein Mann für seinen verstorbenen Sohn den Jakobsweg (fertig)geht. Bei diesem Abenteuer kommt er nicht nur seinem Sohn (wieder) näher, sondern denkt auch über sein eigenes Leben nach und verarbeitet dabei den schmerzlichen Verlust.
Pilgern war bei uns nie ein Thema, aber plötzlich stand die Idee im Raum, mich auch auf „den Weg“ zu machen – zur Trauerbewältigung und – buchstäblich damit einhergehend – um wieder ruhiger, ausgeglichener und selbstbewusster zu werden.
Beschlossen und verkündet: Als ich meinem Mann von meinem überraschenden Bedürfnis erzählte, den Jakobsweg gehen zu wollen (zu diesem Zeitpunkt war mir noch gar nicht klar, dass es nicht nur EINEN Jakobsweg gibt), war er zunächst völlig perplex und eher wenig begeistert. Er kannte bisher nur die Pilgerkolonnen entlang der Nationalstraßen in Spanien, den Trubel in Lourdes und Fatima und hielt nichts von diesem „religiös verbrämten Rummel“. Nach einigenRecherchen und der Feststellung, dass es auch einen portugiesischen Jakobsweg (Caminho Português) gibt, der für Einsteiger ideal ist, fand er den Vorschlag, gemeinsam diesen Weg zu gehen, aber doch gut. Dabei spielte auch eine Rolle, dass wir seinerzeit unsere Flitterwochen auf einer Portugal-Rundfahrt verbracht hatten.
In der Facebook-Gruppe „Jakobsweg-Caminho Português (Das Original(!) seit 2012)“ fanden wir nützliche Hinweise und Etappenvorschläge. Die beste Reisezeit ist der Mai, weil das Wetter dann schon sommerlich schön ist, aber noch nicht zu heiß (weniger schweißtreibend und geringere Waldbrandgefahr), und weil das genau zwischen Oster- und Sommerferien liegt, sodass nicht ganz so viel los ist.
Darüber, dass wir nicht jeden Tag auf gut Glück in öffentlichen Pilgerherbergen um ein Bett im großen gemischten Schlafsaal mit Gemeinschaftsbad bitten wollen, waren wir uns sofort einig. Wir wollten doch eine gewisse Sicherheit und gleich Nägel mit Köpfen machen. Also buchten wir Flüge für den kommenden Mai, in dem auch in unserem Kalender noch keine festen Termine eingetragen waren, und suchten uns via Booking.com kleine private Pilgerunterkünfte an unserer geplanten Jakobswegroute. Wir hatten uns für eine Mischvariante entschieden: Der erste Teil sollte von Porto bis Caminha entlang der Küste gehen (Caminho Português da Costa). Dann wollten wir entlang des Flusses Minho zur Grenzbrücke zwischen Valença und Tui und von dort aus den zentralen Weg durch Spanien fortsetzen.
Nachdem das alles so schön geplant war und wir im Kopf schon im Pilgermodus waren, wären wir am liebsten gleich losgegangen. Leider bekam Peter dann starke Fußschmerzen und der Orthopäde stellte einen Fersensporn fest. Die verschriebene Stoßwellentherapie brachte keine Linderung. Da bereits alles fest gebucht war, musste ein Plan B her. Vorsichtig schlug ich vor, dass ich doch trotzdem gehen könne (mir war inzwischen klar, dass ich das unbedingt brauche), während Peter mit einem Mietwagen quasi nebenherfahren oder andere Ausflüge unternehmen könnte.
Einerseits natürlich schade, wollten wir doch den Weg gemeinsam gehen. Auβerdem war mir die Vorstellung, als Frau alleine unterwegs zu sein, nicht ganz geheuer. Andererseits befürchtete ich aber inzwischen auch, dass ich mich beim gemeinsamen Pilgern womöglich nicht ausreichend auf meine „innere Reise“ konzentrieren könne. Es war ein Wechselbad der Gefühle, aber die Fakten sprachen einfach für meinen Vorschlag. Mir zuliebe stimmte Peter zu, auch wenn er von diesem Plan B noch nicht wirklich überzeugt war und die Hoffnung hegte, mich doch noch zu Fuß begleiten zu können. Immerhin war der Mietwagen – anders als die Flüge und etliche der Unterkünfte – bis 24 Stunden vor der geplanten Übernahme kostenlos stornierbar.
Zwar wurden Peters Schmerzen durch den Fersensporn im Alltag immer weniger, die Befürchtung, es könne bei der ungewohnten Anstrengung plötzlich irgendwo auf der 260-Kilometer-Strecke wieder schlimmer werden, blieb jedoch. Eine Option wäre, nur imFalle des Falles vor Ort einen Mietwagen zu nehmen, sodass er von da ab mit dem Auto fahren könnte, während ich alleine weiterpilgere, und wir dann ab Santiago de Compostela gemeinsam mit diesem Auto zurück nach Porto fahren würden, statt, wie eigentlich geplant, mit der Bahn.
Also googelten wir nach Mietwagenstationen auf dem Weg – kein Problem. Als wir recherchierten, ob man mit einem in Spanien gemieteten Auto – also ab der zweiten Hälfte des Caminho – über die Grenze nach Portugal zurück zum Flughafen Porto fahren und die dortige Mietwagenstation als Rückgabeort auswählen kann, stellte sich heraus, dass das unmöglich oder wahnsinnig teuer ist. Also entschieden wir, dass wir den Mietwagen auf alle Fälle gleich ab Porto nehmen, um dann je nach Kondition flexibel unsere jeweiligen Tagesetappen separat oder gemeinsam zu absolvieren. So kam es, dass wir letztendlich zu unser beider Zufriedenheit eine ganz exklusive (man könnte auch sagen: verrückte) Mischform realisierten, die wir „Hybridpilgern“ tauften.
Motivation
Dass Menschen sich aus den unterschiedlichsten Beweggründen auf diesen Weg machen, ist eigentlich nicht der Erwähnung wert. Und dass sich diese – buchstäblichen – Be-weggründe über die Jahrhunderte geändert haben, ist ebenfalls zu erwarten. Überraschend ist allenfalls – falls man das nicht bereits anderswo gelesen hat –, dass im Mittelalter verurteilte Straftäter, wie etwa Mörder, sich von der Todesstrafe befreien konnten, indem sie – belegt durch abgestempelte Dokumente – nach Santiago de Compostela pilgerten und dann (Monate und Jahre später) nach Hause zurückkehrten. Falls sie die Strapazen überlebten.
Uns hat überrascht, dass es heute, im modernen Spanien, bei der Arbeitssuche ein Bewerbungsvorteil ist, wenn man den Bewerbungsunterlagen die Compostela-Urkunde beilegen kann, also den Nachweis, dass man mindestens die letzten 100 Kilometer zu Fuß (oder 200 Kilometer per Fahrrad) bis zur Kathedrale von Santiago de Compostela gepilgert ist. „Gepilgert“ sollte man in Anführungszeichen setzen, denn faktisch sieht das so aus: Ziemlich genau 100 Kilometer vor Santiago tauchen auf dem Camino plötzlich auffallend viele junge Männer auf (tatsächlich, wir haben dabei keine Frauen gesehen, obgleich auf dem Camino überwiegend Frauen unterwegs sind). Auffallend ist diese Pilgerkategorie deswegen, weil diese jungen Männer keine Rucksäcke tragen, sehr sportlich gekleidet und entsprechend flott unterwegs sind, oft in Gruppen.
Bei meiner Frau und mir ist die Pilgermotivation ebenfalls seltsam, wenngleich aus anderen Gründen: Wir sind beide keine Kirchgänger, geschweige denn Wallfahrer, noch nicht einmal Kirchenmitglieder. Würde man uns beiden die sogenannte Gretchenfrage stellen (Sie erinnern sich: In Goethes Faust, Vers 3415, in der Szene in Marthens Garten wird Faust von Margarete gefragt): „Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ – dann könnten wir entweder wie Faust ausweichend antworten („Lass das, mein Kind!“), oder wir müssten allzu Privates preisgeben.
Zum Wesen der Pilger-Erlebnisberichte gehört freilich allem Anschein nach auch Autobiographisches. Was ja plausibel ist, denn dann können die etwaigen Leser die Schilderungen des auf dem Weg physisch Erlebten und psychisch Empfundenen besser einschätzen. Daher also etwas Persönliches zu uns (wenn Sie das langweilt, können Sie es ja überspringen):
Meine Frau gehört in ihrem Jahrgang zu den rund 95% der in der DDR Geborenen, die nicht getauft sind. Insofern gehört sie keiner Religionsgemeinschaft an, ist also keine Christin. Eine Heide. Man würde wohl kaum erwarten, dass so jemand das Bedürfnis hat, 260 Kilometer weit zu Fuß zu einem katholischen Wallfahrtsort zu gehen.
Gestützt auf die vielen Jahre unseres glücklichen ehelichen Zusammenlebens kann ich allerdings sagen, dass meine Frau ihrem ganzen Wesen nach eine Christin ist – was sie freilich niemals von sich selbst behaupten würde. Sie ist Christin nicht auf dem Papier, nicht in Worten, sondern in Taten. Durch Menschenliebe, echt empfundene und praktizierte Empathie, durch Streben nach Harmonie und Friedfertigkeit. Sie ist definitiv mehr Christin als Zeitgenossen, die ihre Gläubigkeit oder Pseudoreligiosität wie eine Monstranz vor sich hertragen, aber im konkreten Leben unchristlich handeln. Oder die nur noch aus Bequemlichkeit oder Opportunität dem Etikett nach „Christen“ sind, damit sie bei Bedarf – etwa bei Taufe, Hochzeit und Begräbnis – die Kirche, ihre Einrichtungen und Vertreter als Bühne und Entertainer nutzen können. Und die kirchliche Feiertage gedankenlos hinnehmen, ohne sich um deren Bedeutung zu scheren.
Bei mir liegt die Sache nahezu komplett anders. Ich bin christlich getauft und als Protestant konfirmiert. Die längste Zeit meiner Jugend lebte ich in einem Wohnblock unmittelbar neben einer katholischen Kirche. Deren Geläut – soweit ich mich erinnere im Viertelstundentakt – wurde keineswegs als störend oder gar als Lärmbelästigung empfunden, sondern war ein Halt und Takt gebender Teil unseres Lebens.
Meine Mutter sprach mit mir vor dem Einschlafen stets ein Nachtgebet; noch heute klingt mir eines im Ohr:
Ich bin klein,
mein Herz ist rein,
soll niemand drin wohnen
als Jesus allein.
Amen.
Und ich erinnere mich, wie beruhigend das war, obwohl ich die Bedeutung dieser Worte und des Ganzen gewiss nicht verstanden habe.
Bis in meine Teenie-Jahre war es eine Selbstverständlichkeit, mit meinem Vater sonntags zum Morgengottesdienst zu gehen. (Dass uns meine Mutter niemals begleitete, hat mich als Kind gewundert; den Grund erfuhr ich erst viel später: Sie hatte es Gott nie verziehen, dass er es zuließ, dass ihr zweites Kind im Alter von vier Jahren an Scharlach starb.) In der Vorbereitung auf die Konfirmation lernte ich nicht nur den Evangelischen Katechismus, sondern auch etwas über das Eigentliche des Christentums, denn der Pfarrer unserer Paul-Gerhard-Gemeinde war der überzeugendste Kirchenvertreter, dem ich je begegnet bin. Er hieß Wilhelm Rau. Erst als Erwachsener fiel mir auf: Er trug den gleichen Namen wie mein damals bereits verstorbener Großvater.
Nach der Konfirmation hatte ich meinen ersten Berufswunsch: Pfarrer. Ich wünschte mir, Menschen zum christlichen Verhalten zu motivieren und damit zum Weltfrieden beizutragen wie unser Pfarrer Rau.
Dass mich seine Botschaft damals so berührt hat, lag wohl auch am äußeren Rahmen: Unsere Gemeinde hatte gerade erst eine eigene, neugebaute Kirche erhalten, und ihr Gebäude war radikal anders als alle Kirchen, die ich bis dato kannte, insbesondere anders als die katholischen Kirchen, die ich wegen unserer fast ausschließlich katholischen Verwandtschaft schon kennengelernt hatte. Nicht nur keinerlei Prunk, Gold und Dekor, kein in grausamem Realismus am Kreuz hängender, ausgemergelter, geschundener und blutender Jesus Christus, sondern ein nahezu leerer quaderförmiger Raum. Drei hohe fensterlose Außenwände, die Seite zum Innenhof voll verglast, die durch eine sichtbare Gitterstruktur gestützte Flachdachdecke, innen dunkelblau mit einigen Punktleuchten, an der Wand oben rechts – also außerhalb des Blickfelds – die Orgel, an der Rückwand ein großformatiger moderner Bildteppich. Im Blickfeld vorne ein maximal schlichter Altar, an der Wand darüber ein ebenso schlichtes, aber riesiges und von hinten indirekt beleuchtetes Kreuz. Ich erinnere mich, dass fast alle Leute die Kirche entsetzlich fanden. Ich fand sie wunderbar. Obwohl ich erst Jahre später mit dem Gedanken spielte, Architekt zu werden.
Durch die geschlossenen Außenwände war unsere Kirche eine Oase der Stille inmitten der Großstadt. Die riesige Klarglas-Fensterfläche der linken Seite flutete den großen Raum mit Licht, sodass er nicht die erdrückende, oft bedrückende und gewiss auch beindruckend gemeinte Stimmung der meisten alten Kirchen erzeugte. Die hohe dunkelblaue Decke bewirkte, vor allem wenn es draußen dunkel war, die Illusion, in einem oben offenen Raum zu sitzen, seitlich umgeben und geschützt, aber quasi unmittelbar unter dem Himmel. Hier war nichts, was das Auge und die Sinne ablenken würde, nichts zum Betrachten. Hier konnte man in sich gehen, lauschen und auf innere Stimmen hören. So kann man sich Gottesnähe vorstellen.
Seither war ich jahrelang davon überzeugt, dass ich innerlich mit Gott reden konnte. Nicht mit formelhaftem Beten, sondern dialogisch. Mit dem gebotenem Respekt, versteht sich, aber durchaus locker, geradezu freundschaftlich, wie man eben mit jemandem reden würde, dem man einerseits zutraut, das gesamte Universum geschaffen zu haben, der also ganz klar allmächtig ist, den man aber andererseits für den „lieben Gott“ hält, also jemanden, der es gut meint, mit einem selbst und mit der Welt.
Wenn ich damals erste Anwandlungen von Zweifel hatte, wie etwa, ob sich Gott angesichts der Unendlichkeit des Universums, der Vielzahl von Galaxien und Planeten tatsächlich um die absolute Winzigkeit der menschlichen Spezies und deren einzelne Wimmelexemplare kümmern könne, so hörte ich eine Stimme in mir, die mich zurückstutzte, etwa: „Du Wicht, du meinst beurteilen zu können, was ich alles kann? Du verstehst ja offenbar noch nicht einmal, was das Wort allmächtig bedeutet!“. Worauf ich mich stets entschuldigte, etwa „Sorry, klar, Du weißt ja, das ist für mich halt nicht zu begreifen“, und ich hatte nicht den Eindruck, dass Gott nachhaltig sauer auf mich war.
Irgendwann dachte ich mir, dass das meiste Unheil durch mangelnde Kommunikation verursacht wird, durch Missverständnisse, durch Unkenntnis anderer Kulturen, und dass man zum Frieden auf Erden nicht nur durch die christliche Botschaft der Nächstenliebe beitragen kann (was ja theoretisch eine gute Idee war, faktisch aber bis heute nicht wirklich funktioniert). Daher wurde ich letztlich nicht Pfarrer, sondern Übersetzer. Immerhin waren ja unter anderem auch der Heilige Hieronymus und Martin Luther Übersetzer.
Das Übersetzen – besonders, aber nicht nur, das von heiligen Schriften – ist (wie fast alles) bei näherer Betrachtung eine spannende Sache, deshalb haben sich auch die meisten Philosophen damit befasst, und einige waren selbst Übersetzer, wie etwa Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schleiermacher, Wilhelm von Humboldt und Arthur Schopenhauer. Im Rahmen des Studiums belegte ich auch Philosophie, speziell Religionsphilosophie, und hier konzentrierte ich mich auf Kant und Kierkegaard. Das Resultat war, dass ich aus der Kirche austrat. Nicht, weil ich nun an der guten Absicht von Jesus Christus oder Mohammed zweifelte, sondern weil ich seither davon überzeugt bin, dass das, was die Kirche als Institution (und da vor allem die katholische Kirche) aus dem christlichen Grundgedanken gemacht hat, der Menschheit letzten Endes nicht gutgetan hat.
Man denkt da vielleicht spontan an Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Inquisition und entsetzliche Foltermethoden, aber man muss da weder die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche noch die ferne Vergangenheit bemühen: Das jahrelange Blutvergießen wegen der protestantischen und katholischen Bevölkerungsteile in Nordirland, der nicht enden wollende Konflikt im Nahen Osten, die Angriffe auf Kirchen in islamischen Ländern, die weltweiten Terroranschläge der selbsternannten heiligen Krieger des Islams – alles sind Resultate von bis zur Unkenntlichkeit pervertierten Religionen und ihren fanatischen Anhängern.
Wenn wir heute beim Security Check am Flughafen endlos Schlange stehen müssen (dass es auf der Fast Lane letztlich oft nicht schneller geht, ist ein anderes Thema), dann ist das im Grunde ebenfalls eine Folge der Konflikte zwischen Religionen. Der naheliegende Einwand, dass diese Konflikte nahezu ausschließlich von nur einer der drei Weltreligionen ausgehen, und heutzutage nicht vom Christentum, das ändert nichts an der Tatsache, dass es all dieses Unheil ohne diese Religionen nicht gäbe.
Außerdem: Sofern man überhaupt Kirchen und Gottesdienste besucht, wird man in die Situation oder auch Verlegenheit kommen, dass die Gemeinde gemeinsam und laut sprechend ihren christlichen Glauben bekennt. Zur Erinnerung, hier ist das sogenannte Apostolische Glaubensbekenntnis, das Credo, das seit Jahrhunderten von Christen gesprochen wird:
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
Wer das irgendwann auswendig gelernt hat, kann das zeitlebens vor sich hinmurmeln – ohne sich wirklich zu fragen, ob man diese Aussagen tatsächlich glaubt. Feministinnen stören sich vielleicht bereits an der Vorstellung von Gott als „Vater“, also ein männliches Wesen. Das äußert sich beispielsweise in dem vor allem von Frauen geliebten Spruch „Als Gott den Mann erschuf, hat sie nur geübt“.
Die Empfängnis durch den Heiligen Geist, also die Zeugung von Jesus Christus durch einen (den) Heiligen Geist ist rational nicht vermittelbar. Erst recht nicht die Geburt Jesu durch eine Jungfrau. Nicht ohne Grund ist das unter Ungläubigen und Spöttern eine nie versiegende Quelle von Witzeleien. Wenn man zudem zu wissen meint, dass der Mythos der Jungfrauengeburt und damit der gesamte Marienkult bloß auf einem Übersetzungsfehler beruht (nämlich der Übersetzung von Hebräisch alma mit „Jungfrau“ – obwohl es auch „junge Frau“ bedeuten kann, was im Kontext einer Geburt normalerweise plausibler wäre), dann kann man beim besten Willen nicht laut sagen, dass man diesem Punkt des Credos zustimmt.
Wir wollen jetzt nicht Punkt für Punkt durchgehen, doch spätestens bei der Auferstehung von den Toten und beim Glauben an das ewige Leben könnten erneut Zweifel aufkeimen. Aber kann man einer Gemeinschaft angehören, wenn man deren Grundsätze nicht in vollem Umfang teilt? Ich hatte seinerzeit mit Pfarrern gesprochen, und die sagten mir klipp und klar, dass man in diesem Fall eben die Gemeinschaft verlassen müsse, also aus der Kirche austreten.
Meine geheimen inneren Dialoge mit Gott fanden aber weiterhin statt. Daraus könnte man schließen, dass er (oder sie) meinen Kirchenaustritt nicht krummgenommen hat. Aber wer weiß.
Erwartungen
Man braucht nur das Wort Camino (oder die anderen sprachlichen Varianten) zu hören oder zu lesen, und schon hat man eine Szene im Kopf. Die prototypische Vorstellung bezieht sich auf den Camino Francés und besteht dann entweder aus einer wilden Pyrenäenszenerie oder aus einer grünen Idylle mit Pilgerin, Blüten, Bienchen und Bächlein. Weniger typisch, weil bisher weniger bekannt, ist der Caminho Português, aber wenn man an den denkt, dann hat man zuerst die charakteristischen Holzbohlenwege vor Augen, die einen großen Teil des Küstenwegs ausmachen. Deshalb ist dies auch das Titelbild unseres Buches. Ohne sie alle gesehen zu haben: Auch die anderen viertausend Bücher zum Jakobsweg zeigen auf dem Titel wohl eher keine Raffinerie oder Pilgerkolonnen neben Leitplanken.
Frustration tritt bekanntlich ein, wenn man enttäuscht ist, weil Erwartungen nicht erfüllt wurden. Wer sich von Porto aus auf den Pilgerweg macht, sollte daher nicht nur im Kopf haben, dass Porto – vor allem, wie überall üblich, die Altstadt – eine atemberaubend schöne Stadt ist und vielleicht noch bezaubernder als Lissabon, sondern auch eine relativ große Stadt: Porto ist nach Lissabon die zweitgrößte Stadt Portugals. Porto hat zwar nur rund 240.000 Einwohner (also etwa so viel wie Magdeburg – in China würde man das als Dorf bezeichnen), erstreckt sich aber über eine Fläche von immerhin rund 40 Quadratkilometern, und von der Kathedrale in der Stadtmitte bis zum Stadtrand bei Perafita sind es auf dem kürzesten Weg rund 12 Kilometer. Der führt mitten durch die Stadt und ist ähnlich euphorisierend, wie wenn man in irgendeiner anderen Großstadt durch das Stadtgebiet bis in die Vorstädte läuft. Ein Bild dieses Teils des Caminho würde man eher nicht auf einen Buchtitel setzen.
Sehr viel schöner ist es, wenn man einen kleinen Umweg macht und anstatt sich durch die Stadt zu quälen, gleich ab Porto den Küstenweg geht: Auch der ist ab der Kathedrale mit gelben Pfeilen markiert. Dann kann man unten am rechten Ufer des Douro entlanggehen (oder wie wir mit der historischen Tram fahren), bis zu dessen Mündung (Foz do Douro), und von dort aus direkt am Meer entlang nach Norden gehen.
Dann sind es rund 15 Kilometer bis nach Perafita. Also eine kurze Tagesetappe, wenn man es am ersten Tag ruhig angeht.
Linker Hand hat man dann fast ununterbrochen erst den Douro und dann den Atlantik, rechts hingegen durchgehende Bebauung. Davon sind die letzten zwei Kilometer eine Raffinerie, fast direkt an der Küste. Zwar nicht annähernd so lang wie der sechs Kilometer lange Chemiewerkskomplex der BASF in Ludwigshafen am Rhein, aber wenn man zwischen Leça da Palmeira und Perafita zu Fuß an der Raffinerie entlang geht, kommt einem das endlos vor. Zum Glück kommt der Wind meist vom Meer her, und deshalb war die Raffinerie zwar zu sehen, aber nicht zu riechen. Trotzdem – diese erste Etappe ist keineswegs schlimm, im Gegenteil. Selbst der Teil, wo man noch im Stadtgebiet von Porto auf der riesigen Atlantikpromenade unterwegs ist, ist zwar keine Naturidylle, aber dennoch unvergesslich schön.
Jedenfalls, wenn man wie wir Glück hat mit dem Mai-Wetter: Einerseits warm bis heiß (rund 35 °C), andererseits ständig gekühlt von einer duftenden Meeresbrise. (Um realistisch zu sein: Auf der unendlichen Steinfläche der Promenade hat das einen gewissen Backofeneffekt – Unterhitze mit Umluft.)
Dazu kristallklare Sicht, tiefblauer Himmel, links das Meer in sämtlichen Blautönen, davor ein meist breiter Sandstrand mit Sonnenbadenden. Das Ganze akustisch untermalt von Meeresrauschen, Brandungsdonnern und Möwenkreischen. Alle paar hundert Meter die einladenden Sonnenschirme einer Strandbar oder eines schattigen Cafés. Herrlich. Es gibt speziell auf diesem ersten Abschnitt viele Verlockungen oder Versuchungen, vom rechten Weg abzukommen.
1. Etappe: Porto – Perafita
29.700 Schritte, 17 km
Mai 2019 – endlich geht es los. In den vergangenen zweieinhalb Tagen haben wir uns bereits Porto angesehen, einen Fado-Abend erlebt, ein Orgelkonzert in der Igreja dos Clérigos angehört und vom Torre dos Clérigos die Stadt von oben bewundert. Bei der Stadtbesichtigung kamen immerhin auch schon jeweils 15.000 Schritte am Tag zusammen – bei den Höhenmetern, die dabei zu überwinden sind, durchaus ein guter Einstieg. Außerdem waren wir einmal bei Freunden zum Essen eingeladen, wo wir eine besonders leckere Variante des portugiesischen Nationalgerichts Bacalhau genießen konnten.
Übrigens, mein Peter meint, „besonders leckere Variante“ vermittle einen völlig falschen Eindruck. Vielmehr sei der Bacalhau bei unseren Freunden der einzige tatsächlich leckere Bacalhau, den er je gegessen habe, und er ist nun schon zum siebten Mal in Portugal. Er kann die „Bacalhau-Obsession“ der Portugiesen, wie er das nennt, nicht nachvollziehen. Nichts gegen Kabeljau als Fischsorte (und das ist bacalhau), aber in Restaurants ist mit „bacalhau“ in der Regel Stockfisch gemeint. Also ein Kabeljau, der mal Frischfisch war, dann gesalzen und im Freien auf Stöcke aufgespießt, in der Sonne komplett getrocknet (und dadurch haltbar gemacht) wurde, und den man zum Verzehr erst wieder – wie das Pulver in einer Tütensuppe – mit heißem Wasser aufquellen lassen muss, um ihn essbar zu machen (Peter achtet darauf, dass ich hier zwischen „essbar“ und „genießbar“ unterscheide). Man sieht, das ist ein Verfahren aus der Zeit der Seefahrer, lange vor Erfindung der Kühlschränke. Man stelle sich also vor, man ist heute in diesem Land direkt am Meer, wo es überall fantastischen frischen Fisch und köstliches Essen gibt – und da isst man freiwillig reanimierten trocken-fasrigen Stockfisch?
Apropos fantastischer frischer Fisch: Wir waren gestern Abend sogar schon zum Fisch essen in Matosinhos (wo wir eigentlich erst heute durchpilgern werden) – ein fangfrischer kompletter Robalo (so heißt auch das von außen ganz unauffällige kleine Restaurant) direkt vom Grill, für vier Personen – himmlisch! Die Idee mit dem Mietwagen erweist sich schon jetzt als genial.
Jetzt aber wirklich! Ich kann es kaum erwarten, endlich zu starten. Nach einem kleinen, aber feinen Frühstück, das uns in unsere Unterkunft – im Altstadtviertel Ribeira am Hang direkt neben der berühmten Fachwerkbrücke Ponte Luíz I – geliefert wird, machen wir uns beide zu Fuß mit unseren Rucksäcken auf den Weg. Das Auto lassen wir auf dem öffentlichen Parkplatz bei der Kathedrale stehen.
Die Kathedrale ist in Luftlinie nur rund 200 Meter von unserer Unterkunft entfernt, allerdings viel weiter oben am Hang. Die ersten Stempel haben wir uns dort schon gestern abgeholt. Penibel, wie wir manchmal sind, haben wir die Kathedrale trotzdem zu unserem „offiziellen Startpunkt“ erklärt, also gehen wir jetzt erstmal in voller Pilgermontur die endlos lange Treppe und dann immer weiter den Hang hoch bis zur Kathedrale (wohl wissend, dass wir von dort gleich wieder hinunter müssen). Wat mutt dat mutt.
An einem Mäuerchen gegenüber gibt es zwei Pfeile: Einen blauen Richtung Fatima im Süden und darüber den berühmten gelben Caminho-Pfeil. Das ist unser Wegweiser für die nächsten zwei Wochen. Nun geht's im Zickzack durch die engen Gassen des pittoresken Ribeira-Viertels (Unesco- Weltkulturerbe!) und gefühlt tausend Stufen hinunter bis zur Endhaltestelle Infante der historischen Tram Linha 1. Mit der wollen wir ein paar Kilometer am rechten Douro-Ufer entlang bis zur anderen Endhaltestelle fahren, zum Terminus Passeio Allegre, wo der Douro in den Atlantik mündet. Voller Motivation und Tatendrang gehe ich voran.
Unten sehen wir bereits die Bahn stehen, die aber erst noch Pause macht. Die meisten Wartenden an der Haltestelle sind allem Anschein nach „normale“ Touristen, aber einige sind klar als Pilger erkennbar, vor allem, wenn sie die typische Pilger-Muschel tragen, als Anhänger, Aufkleber oder Aufnäher.
Leider gibt es keine geordnete Warteschlange und einige Vordrängler. Ich habe nicht die Geduld und Gelassenheit, Leute vorzulassen, die erst nach mir hierangekommen sind. Das verträgt mein Gerechtigkeitssinn nicht. Aber vielleicht werde ich in zwei Wochen diese Toleranz gegenüber Rüpeln haben, wenn ich durch das Pilgern spirituell geläutert bin. Zunächst müssen wir uns jedenfalls ganz unspirituell mit dieser Menschentraube in die winzige Tram drängen und ergattern immerhin zwei Stehplätze im nun nicht genutzten alternativen Führerstand ganz hinten. Von hier aus haben wir nicht nur freien Ausblick nach draußen, sondern können auch die archaische Technik der in beide Richtungen fahrbaren Straßenbahn betrachten – viel Holz und Messing, alles massiv, schwer und offenbar unkaputtbar.
Das rund 100 Jahre alte Vehikel ächzt, rattert und rumpelt gemächlich die malerische Uferstraße entlang und nach etwa einer halben Stunde ist schon Endstation. Alles aussteigen! Rechts liegt der alte Stadtteil Foz mit seinen engen Gassen, den wir schon gestern gesehen hatten, links sieht man am Ende der Mole mitten im Douro den kleinen eckigen Leuchtturm Farol doPontão. (Der ist grün-weiß gestreift, weil er vom Meer aus gesehen bei der Einfahrt in den Douro rechts – auf der grünen Steuerbordseite – liegen muss; gegenüber am rechten Flussufer steht sein rot-weiß gestreiftes Pendant.)
Hach, schön. Herrlicher Sonnenschein! Ab jetzt geht es zwei Wochen lang nach Norden, für mich alles per pedes, 260 Kilometer. Wir sind ja schon viel gewandert, aber so etwas hatten wir noch nie vor. Ich bin aufgeregt und freue mich unendlich.
Zunächst gehen wir auf der Avenida de Dom Carlos I an der Festung Forte de São João Baptista vorbei, und dann sehen wir am Praia do Carneiro die erste Strand-promenade dieses Tages vor uns, mit einer traumhaften Palmenallee. Was für ein Einstieg in unser Abenteuer! Peter ist momentan mehr im Paparazzi- als Pilger-Modus und macht Fotos von seiner Pilgerin in der schönen Szenerie.
Schon nach ein paar hundert Metern merken wir: Die Strandpromenade ist wunderschön, aber es gibt kaum oder keinen Schatten und inzwischen brennt die Sonne unbarmherzig. Meine Güte, und wir haben Maiund nicht Juli oder August… Zum Glück ist der berühmte Strand Praia dos Ingleses nicht weit entfernt, und da legen wir schon relativ früh die erste Pause in einem der vielen einladenden Strandcafés ein. Unter einem bunten Sonnenschirm sitzen wir auf mit Kissen bedeckten Palettenmöbeln, essen Tosta Mista mit Schinken und Käse und trinken einen Galão, wie der spezielle Milchkaffee in Portugal heißt.
Ohne schlechtes Gewissen genießen wir einfach das Hier und Jetzt, da wir wissen, dass alle unsere geplanten Etappen auch mit reichlich Pausen zu schaffen sind und wir uns insbesondere nicht gleich am ersten Tag verausgaben wollen. Immerhin hatte auch ich vor wenigen Tagen noch schmerzende Schienbeine, nachdem ich eine vorbereitende Wanderung in heimischer Umgebung unternommen und dabei wohl etwas übertrieben hatte. Zum Glück konnte mir meine Physiotherapeutin kurz vor der Abreise noch die schmerzenden Beine tapen und mir genau erklären, wie ich das entlastende Tape später erneuern kann. Trotz meiner Motivation, jetzt zügig voranzukommen, möchte ich es keinesfalls riskieren, wegen Überlastung bereits nach wenigen Tagen abbrechen zu müssen, was man in den entsprechenden Foren doch öfter mal liest.
Nach der Erholungspause geht es vorbei am Forte de São Francisco Xavier, danach passieren wir den Verkehrskreisel Rotunda de Anémonia mit dem riesigen Kunstobjekt Anemónia – das bedeutet eigentlich Seeanemone, sieht aber, finde ich, eher aus wie eine in der Luft schwebende, im Wind wallende Qualle aus Stoffbahnen – die inzwischen allerdings durch Sonneund Seewind ziemlich gelitten hat. Danach geht es durch Matosinhos, wo wir gestern Abend mit unseren Freunden waren. Leider ist jetzt nicht die richtige Zeit, um dort noch einmal so leckeren Fisch zu essen. Also ziehen wir weiter. Links liegt jetzt der Praia Matosinhos, wieder ein riesiger, flacher Sandstrand, der durch ein kleines Mäuerchen von der ebenfalls riesigen, breiten und gepflasterten Strandpromenade getrennt ist. Es ist noch nicht Mittag und die Hitze ist schon unerträglich. Der breite Sandstrand ist fast menschenleer, nur nah am Wasser sind ein paar Badegäste. Peter ist, wie oft, zu (meist peinlichen) Albernheiten aufgelegt, und möchte, dass ich Fotos von ihm mache, wie er sich wie ein Verdurstender in der Wüste durch den endlosen Sand schleppt. Na gut – ein bisschen Spaß muss zwischendurch auch sein.
Bald darauf ein Stimmungswechsel: Am Ende des hier rund 200 Meter breiten Strands, kurz vor der Tourismusinformation, steht ein bedrückendes Denkmal: Das Monumento Tragédia no Mar. Es stellt mehrere wehklagende Frauen dar, die ihre Männer auf dem Meer verloren haben. In einer Seefahrernation wie Portugal ist das ein trauriges Thema, das hier bestimmt besonders viele Menschen berührt.
Nachdem wir uns in der klimatisierten Tourismusinfo einen Stempel geholt und uns ein wenig abgekühlt haben, geht es weiter zur Ponte móvel de Leça. Einerseits ist es schade, dass wir nicht erleben, wie sich die moderne Klappbrücke öffnet, andererseits kennen wir das von anderen Orten (besonders schön in Chicago und Sankt Petersburg) und wir müssen nicht in der Hitze herumstehen und warten.
Drüben biegen wir nach links in eine Seitenstraße ab, immer dem gelben Pfeil folgend. Die Luft steht förmlich zwischen den Häusern. Doch dann gibt es ein kleinesCafé mit schattigem Freisitz. Nicht sehr idyllisch, direkt neben parkenden Autos. Aber wir sind trotzdem froh darüber, der Sonne für einen Moment zu entkommen, und genießen zwei kleine gekühlte Säfte. Auf dem leuchtenden grünen Apothekenkreuz nebenan wird die aktuelle Temperatur angezeigt: 33 Grad Celsius – im Schatten wohlgemerkt.
Auf der gefühlt endlos langen und unglaublich breiten Promenade der Avenida da Libertade gehen wir wie im Backofen am Praia de Leça entlang und auf den fast 50 Meter hohen und weithin sichtbaren weißen Leuchtturm Farol de Leça zu. Wegen des benachbarten Ortsteils heißt er auch Farol de Boa Nova und ist der zweithöchste Leuchtturm Portugals. Da ist sogar ein Museum drin, aber wir sind ja Pilger und keine Touristen.