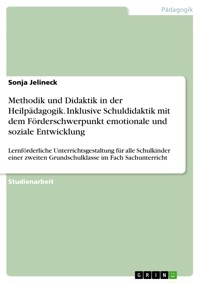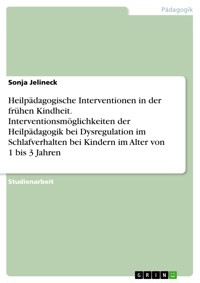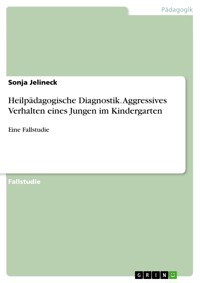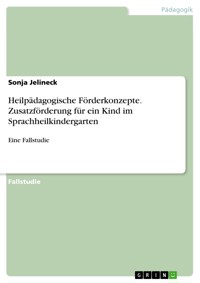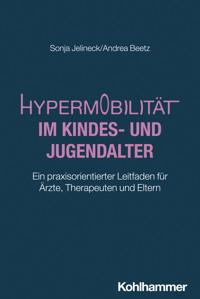
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieser interdisziplinäre Leitfaden gibt einen umfassenden Überblick über symptomatische Hypermobilität im Kindes- und Jugendalter. Thematisiert werden u.a. Prävalenz, Diagnostik und mögliche Ursachenzusammenhänge der Überbeweglichkeit der Gelenke, physische und psychische Begleiterkrankungen sowie Erfahrungen betroffener Kinder, Jugendlicher und deren Eltern. Evidenzbasiert und praxisnah wird aufgezeigt, wie relevante Fachdisziplinen und Eltern die Betroffenen unterstützen können und welche Maßnahmen diese selbst ergreifen können, um im Alltag und in der Schule/im Kindergarten zurechtzukommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Eine multisystemische chronische Erkrankung
1.2 »Zebras« – ein oft langwieriger diagnostischer Prozess
1.3 Aktuelle Diagnoserahmen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
1.4 Nach der Diagnose: Multiprofessionelles Team und Behandlungsoptionen
1.5 Zielsetzung und Aufbau des Buches
2 Hypermobilität im Überblick
2.1 Prävalenz
2.2 Diagnostik
2.2.1 Allgemeine Hinweise auf symptomatische Hypermobilität
2.2.2 Hinweise auf behandlungsbedürftige Hypermobilität bei Säuglingen und Kleinkindern
2.2.3 Hinweise auf symptomatische Hypermobilität bei Kindern und Jugendlichen
2.2.4 Das Beighton-Scoring-System
2.2.5 Diagnosekriterien für Kinder und Jugendliche
2.2.6 Wie es weitergehen könnte: Diagnosekriterien für Erwachsene
2.2.7 Ein potenzieller Biomarker für hEDS und HSD
2.2.8 Bedeutung von Früherkennung und präventivem Management
2.3 HSD: Eine multisystemische Spektrum-Erkrankung
2.4 Haut- und Gewebeauffälligkeiten
2.5 Muskuloskelettale Krankheitszeichen und Symptome
2.6 Komorbiditäten (Begleiterkrankungen)
2.6.1 Gesicherte Komorbiditäten bei Kindern und Jugendlichen
2.6.2 Sich abzeichnende Komorbiditäten
2.7 Prognose im Lebensverlauf
2.8 Erfahrungen und Perspektiven von Betroffenen
3 Notwendigkeit multiprofessioneller Teams für das Management von Hypermobilität
4 Mögliche Ursachen und Zusammenhänge von Hypermobilität und Begleiterkrankungen
4.1 Die Rolle des Bindegewebes
4.2 Schmerz, Wahrnehmungsveränderungen und psychische Symptome
4.3 Triade, Quartett oder Pentade? Hypermobilität, POTS, Mastzellenaktivierungs-Syndrom, gastrointestinale Dysmotilität und Autoimmunität
4.4 Exkurs: Maxwells Pentade-Super-Syndrom im Detail
4.5 Mögliche Ansatzpunkte für Interventionen
5 Evidenzbasierte therapeutische und pädagogische Interventionen bei Hypermobilität
6 Hypermobilität im Kindergarten- und Schulalter
6.1 Wie kann die Kinder- und Jugendmedizin unterstützen?
6.1.1 Was sagt die Evidenz?
6.1.2 Was sagen Fachkräfte?
6.1.3 Kernbotschaften für die Praxis
6.2 Wie kann die Physiotherapie unterstützen?
6.2.1 Was sagt die Evidenz?
6.2.2 Was sagen Fachkräfte?
6.2.3 Kernbotschaften für die Praxis
6.2.4 Weiterführende Ressourcen
6.3 Wie kann die Ergotherapie unterstützen?
6.3.1 Was sagt die Evidenz?
6.3.2 Was sagen Fachkräfte?
6.3.3 Kernbotschaften für die Praxis
6.3.4 Weiterführende Ressourcen
6.4 Wie kann die Psychotherapie unterstützen?
6.4.1 Was sagt die Evidenz?
6.4.2 Was sagen Fachkräfte?
6.4.3 Kernbotschaften für die Praxis
6.5 Wie kann die Pädagogik unterstützen?
6.5.1 Was sagt die Evidenz?
6.5.2 Was sagen Fachkräfte?
6.5.3 Kernbotschaften für die Praxis
6.6 Was können Betroffene und ihre Erziehungsberechtigten und Angehörigen tun?
6.6.1 Was sagt die Evidenz?
6.6.2 Was sagen Fachkräfte?
6.6.3 Wie mache ich das meiste aus meinem multiprofessionellen Team?
6.6.4 Kernbotschaften für Betroffene und Erziehungsberechtigte
6.6.5 Weiterführende Ressourcen
6.7 Weiterführende Ressourcen für alle Fachgebiete und Betroffene
6.7.1 EDS ECHO
6.7.2 Hypermobilitäts-»Hacks« von Bendybodiespodcast.com
6.7.3 Hypermobility 101 Series
6.7.4 Dokumentationen zu HSD, hEDS und EDS
7 Nützliche Anlaufstellen
7.1 Selbsthilfeorganisationen
7.1.1 Selbsthilfeorganisationen für Hypermobilität im deutschsprachigen Raum
7.1.2 Selbsthilfeorganisationen für Hypermobilität im Ausland
7.1.3 Selbsthilfeorganisationen für Begleiterkrankungen im deutschsprachigen Raum
7.2 Ärztliche und therapeutische Fachkräfte
7.3 Facebook-Gruppen
7.3.1 Deutschsprachige Facebook-Gruppen ab ca. 300 Mitgliedern
7.3.2 Größere englischsprachige Spezialgruppen auf Facebook
8 Fazit
Literatur
Glossar
Sachwortverzeichnis
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Die Autorinnen
Sonja Jelineck ist u. a. Osteopathin und Heilpädagogin. Sie lebt und arbeitet in München.
Andrea Beetz, Prof. Dr. phil. habil., ist Diplom-Psychologin in Erlangen und hat eine Professur für Heilpädagogik und Inklusionspädagogik an der IU Internationalen Hochschule.
Sonja JelineckAndrea Beetz
Hypermobilität im Kindes- und Jugendalter
Ein praxisorientierter Leitfaden für Ärzte, Therapeuten und Eltern
Verlag W. Kohlhammer
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-045539-9
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-045540-5epub: ISBN 978-3-17-045541-2
Abkürzungsverzeichnis
ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ANS Autonomes Nervensystem
ASS Autismus-Spektrum-Störung
BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BMG Bundesministerium für Gesundheit
DEDI Deutsche Ehlers-Danlos Initiative e. V.
DEGAM Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EDS Ehlers-Danlos-Syndrome
EU Europäische Union
GfH Deutsche Gesellschaft für Humangenetik
GM German Modifikation (deutsche Modifikation)
hEDS Hypermobiles Ehlers-Danlos-Syndrom
HMS Hypermobilitäts-Syndrom
HMSA The Hypermobility Syndromes Association
HSD Hypermobility Spectrum Disorder/Hypermobilitäts-Spektrum-Erkrankung
HSS Hypermobilitäts-Spektrum-Störung
ICD International Classification of Diseases and Related Health Problems (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme)
MCAS Mastzellenaktivierungssyndrom
NHLBI National Heart, Lung and Blood Institute
NHS National Health Service
PEM Post-Exertionelle Malaise
POTS Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom
RCT(s) Randomisierte kontrollierte Studie(n)
SNS Sympathisches Nervensystem
TEDS The Ehlers-Danlos Society
TEDS UK The Ehlers-Danlos Support UK
TENS Transkutane elektrische Nervenstimulation
UK United Kingdom (Großbritannien)
US United States (Vereinigte Staaten)
ZNS Zentrales Nervensystem
Vorwort
Sonja Jelineck
Hypermobilität entwickelte sich über viele Jahre zu einem Herzensthema in meiner osteopathischen Praxis. Während meines Studiums an einer englischen Universität spielte sie nur eine Nebenrolle. Wer als »double-jointed« galt, wie man die hypermobile Veranlagung dort oft nannte, sollte bei bestimmten Techniken besonders auf die eigenen Finger achten. Waren die zu Behandelnden hypermobil, sollte man beispielsweise Manipulationstechniken modifizieren. Viel mehr wurde nicht erwähnt.
Nach dem Studium traf ich in der Praxis immer wieder auf Patientinnen – seltener auch Patienten –, für die es im Englischen den treffenden Ausdruck »heart-sink patients« gibt, also Patientinnen, die Behandelnde ratlos machen. Diese Frauen, meist jungen bis mittleren Alters und oft beruflich stark engagiert, brachten eine Vielzahl an Beschwerden mit: Muskuloskelettale Probleme im gesamten Körper, Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen und manchmal auch Autoimmunerkrankungen. Nach einer Weile fiel mir auf, dass sich alle unter meinen Händen ähnlich anfühlten: Die Haut war weich und recht dehnbar, sodass ich mühelos die gesamte Muskulatur unterhalb des Schulterblattes behandeln konnte – was bei vielen anderen kaum möglich ist. Die Gelenke waren überbeweglich, obwohl sich die Patientinnen selbst oft als unbeweglich empfanden. Ich erinnere mich an eine Patientin, die sich im Sitzen mühelos das Bein hinter den Kopf legte und dennoch meinte: »Beweglich? Ich? In meiner Familie bin ich die Steifste!«
Einige der Frauen berichteten von schweren Erschöpfungszuständen, die oft als psychosomatisch diagnostiziert worden waren. Diese Begegnungen waren mein erster Kontakt mit chronischer Fatigue. Ich begann, die damals noch spärlichen Studien zu Zusammenhängen zwischen chronischer Fatigue und Autoimmunerkrankungen oder latenten Infektionen zu lesen. Leider fanden sich kaum konkrete Behandlungsansätze. Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie dachte ich sofort, dass dies zu mehr Fatigue-Fällen führen und das Forschungsinteresse sowie die Anerkennung Betroffener steigern könnte.
Anfang 2022 stieß ich auf einen Artikel von Gavrilova et al. (2022), der einen neuen klinischen Phänotyp des Post-COVID-Syndroms beschrieb: Sie schlugen vor, dass Bindegewebsschädigungen durch COVID-19 bei hypermobilen Betroffenen Fibromyalgie verursachen könnten. Ich begann zu ahnen, dass es eventuell kein Zufall war, dass meine Patientinnen sich ähnlich anfühlten. Wie bei einem Dominoeffekt zeigten sich immer mehr Verbindungen zwischen Hypermobilität und anderen Beschwerden, insbesondere jenen, bei denen Autoimmunität ebenfalls eine (Teil-)Rolle spielt: Migräne, Raynaud-Syndrom, Arthritis und Mastzellensyndrom, um nur einige zu nennen. Noch verblüffter war ich, als ich mit Sharp et al. (2021) Verbindungen zu psychischen Erkrankungen und Neurodiversität entdeckte. Mittlerweile testete ich komplexe Patientinnen und Patienten routinemäßig mithilfe des Beighton-Scoring-Systems (vgl. ▸ Kap. 2.2.4) auf Hypermobilität. Viele erzielten hohe Werte, ohne je von Hypermobilität gehört zu haben.
»Herzensthemen« können inspirieren und motivieren – doch bergen sie die Gefahr, auf Abwege zu geraten oder die Bodenhaftung zu verlieren. Deshalb habe ich im Rahmen eines berufsbegleitenden Heilpädagogikstudiums die Gelegenheit genutzt, mich intensiv evidenzbasiert mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dabei wurde deutlich, dass es im deutschsprachigen Raum bisher nur wenige Ressourcen gibt, um sich fundiert zu diesem Thema zu informieren. Fachkräfte aus den medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Bereichen und Betroffene müssen sich oft mühsam Hintergrundwissen und Behandlungsmöglichkeiten aus verschiedenen Quellen zusammenstellen. Gerade für hypermobile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist die Informationslage noch dünner. Dieses Buch soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Ich wünsche Ihnen eine bereichernde und spannende Lektüre!
Andrea Beetz
Hypermobilität – dieser Begriff war mir nicht bekannt. Bis eine unserer Studierenden der Heilpädagogik mit dem Wunsch auf mich zukam, sie zu diesem Thema bei ihrer Bachelorarbeit zu betreuen. Da ich mich sehr auch für medizinisch relevante Themen und Bezüge zur Psyche interessiere, sagte ich zu. Denn als promovierte Psychologin mit einer Habilitation in der Sonderpädagogik und einer Professur in der Heil- und Inklusionspädagogik habe ich schon immer interdisziplinär geforscht und mich immer auch für noch unbekannte, neue Themen interessiert.
Beim Lesen der Arbeit fielen mir immer wieder Personen ein, denen ich begegnet war, die Hypermobilität und teils auch die beschriebenen Komorbiditäten und Symptome zeigten. Zu einem gewissen Ausmaß war ich in Kindheit und Jugend sicher auch in einigen Gelenken hypermobil. Die Bachelorarbeit war dann inhaltlich so herausragend, und enthielt so viele relevante Informationen, dass ich den Vorschlag machte, auf Basis der recherchierten Studien, Fachartikel und der Praxiserfahrung von Sonja Jelineck, ein Buch zu verfassen. Wir hoffen, damit für Betroffene und Fachkräfte verschiedener Disziplinen ein Grundlagenwerk zum Thema Hypermobilität mit wichtigen Informationen zu bieten und darüber Betroffenen zu einer zeitnäheren Diagnose und umfassenderen Unterstützung zu verhelfen. Als Psychologin betrachte ich nun auch Symptome einiger meiner Patienten unter dem Blickwinkel einer möglichen Hypermobilität, schließe diese entweder aus oder verweise an relevante Informationen. Denn oft ist es überaus entlastend, wenn Klienten eben nicht von Ärzten oder Psychologen gesagt bekommen, ihre Beschwerden seien psychosomatischer Natur, sondern es eine körperliche, nachvollziehbare Erklärung für ihre verschiedenen Symptome gibt.
Da dieses Buch für einen weiten Personenkreis geschrieben wurde – Betroffene, ihre Angehörigen und Fachkräfte verschiedener Disziplinen – enthält dieses Buch hinten ein Glossar, in dem einige medizinische Fachbegriffe kurz erklärt werden.
1 Einleitung
Viele von uns erinnern sich vielleicht aus der Schulzeit an zwei oder drei »Schlangenmenschen«, die mühelos ihren Unterschenkel hinter den Kopf legten oder ihren Daumen so weit bogen, dass er den Unterarm berührte. In teils weniger extremen Ausprägungen ist Hypermobilität der Gelenke kein besonders seltenes Phänomen: 10 – 20 % der Gesamtbevölkerung gelten als überbeweglich (Hakim & Grahame, 2003). Bei Kindern und Jugendlichen ist es sogar ein Drittel, wobei Mädchen häufiger betroffen sind als Jungen (Sobhani-Eraghi et al., 2020).
Für viele der »Schlangenmenschen« handelt es sich bei Hypermobilität lediglich um eine kuriose Fußnote ihrer Lebensgeschichte. Jenseits der Beweglichkeit entwickeln sie keine weiteren Symptome. Einige nutzen ihre Hypermobilität sogar aktiv im Sport, in der Musik und den darstellenden Künsten.
Abb. 1.1:Piet van Brechts, ein Schlangenmensch der 1950er JahreQuelle: Noord-Hollands Archief/Fotoburo de Boer
Dieses Buch konzentriert sich auf diejenigen Betroffenen, bei denen die Beweglichkeit zur Belastung wird. Schätzungen zu symptomatischer Hypermobilität variieren, werden aber zunehmend nach oben korrigiert: Vermutlich sind mindestens 2 – 3 % der Gesamtbevölkerung betroffen (Hakim & Grahame, 2014; Tinkle et al., 2017). Bei Kindern und Jugendlichen liegt die Rate wahrscheinlich noch höher, da beispielsweise zwischen 30 und bis zu knapp 70 % der hypermobilen Kinder und Jugendlichen von chronischem Schmerz berichten (Clinch et al., 2011; Pacey et al., 2015).
Die Hauptursache symptomatischer Hypermobilität liegt in einer meist angeborenen Erkrankung des Bindegewebes, die unter anderem zu einer erhöhten Beweglichkeit der Gelenke führt. Die vermutlich am häufigsten vererbbaren Bindegewebserkrankungen sind die Ehlers-Danlos-Syndrome (EDS) (Castori et al., 2017). Weitere bekannte erbliche Erkrankungen sind das Marfan-Syndrom und Osteogenesis imperfecta. Bindegewebe ist jedoch nicht nur im Bereich der Gelenke vorhanden, sondern im gesamten Körper: In der Haut, in Knochen, Sehnen, Muskeln, in allen Organen und im Nervensystem (Kamrani et al., 2024). Faszien bestehen sogar ausschließlich aus Bindegewebe. Bindegewebe macht knapp fünf Prozent der Körpermasse aus. Daher können sich Bindegewebserkrankungen im gesamten Körper auswirken und Symptome verursachen.
1.1 Eine multisystemische chronische Erkrankung
Symptomatische Hypermobilität ist bei medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Fachkräften und in der allgemeinen Bevölkerung relativ unbekannt und gilt als stark unterdiagnostiziert. Betroffene zeigen eine auf den ersten Blick verblüffende Palette an Symptomen, die nicht nur physischer Natur sind, wie zum Beispiel Schmerz, chronische Erschöpfung, Schwindel und Störungen des Verdauungs- und Harntrakts, sondern auch die Psyche betreffen, beispielsweise in Form von Angsterkrankungen (Castori, 2012). In symptomatischen Fällen wird Hypermobilität mittlerweile als ein zentraler Aspekt einer multisystemischen chronischen Erkrankung gesehen.
Fallbeispiel
Eine amerikanische Teenagerin beschreibt im Buch »Disjointed«, wie sie diese multisystemische Erkrankung im Alltag erlebt:»Subluxationen [unvollständige Ausrenkungen von Gelenken] tun sehr, sehr weh, ein wirklich intensiver Schmerz, bei dem man schreien möchte. Aber sie passierten ständig, also habe ich einfach aufgehört, darüber zu reden. [...] In der Schule haben sich meine Gelenke beim Hinauf- und Hinuntergehen der Treppen verschoben, die Stühle verursachten Rückenschmerzen, nach dem Mittagessen tat mir der Magen weh wie verrückt, und dann hatte ich einen Gehirnnebel und konnte mich an nichts mehr erinnern. Und an den meisten Tagen wurde mir schwindelig und ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Ich kämpfte nur darum, mich in dem Gebäude zurechtzufinden und den Tag zu überleben. [...] Fehlende Propriozeption [d. h. Wahrnehmung der Lage und Bewegung des eigenen Körpers im Raum] ist wie in einem Virtual-Reality-Videospiel, in dem es keinen Boden gibt. Man weiß, dass es ihn gibt, aber man hat keinen Anhaltspunkt, wo er sich befindet. [...] Ich wusste nicht, wie sich erholsamer Schlaf anfühlt, bis ich fünfzehn war. Egal wie lange ich schlief, ich wachte immer erschöpft auf.«(Jovin, 2020a, Übersetzung der Autorinnen)
Symptomatische Hypermobilität kann das Leben der Betroffenen erheblich beeinflussen, wie ausführlicher in ▸ Kap. 2.8 beschrieben wird. Betroffene berichten neben gesundheitlichen Belastungen u. a. von einer eingeschränkten Berufswahl, mangelnder sozialer Teilhabe, Abhängigkeit von Anderen und Folgen für die Familienplanung. Es stellen sich z. B. Fragen wie: Ist eine Schwangerschaft gesundheitlich möglich? Werden meine Kinder hypermobil sein (Bennett et al., 2019; Gurley‐Green, 2001)?
1.2 »Zebras« – ein oft langwieriger diagnostischer Prozess
Früherkennung und frühzeitiges gutes (auch präventives) Management der Hypermobilität und damit verbundener Symptome sind essenziell, um Spätfolgen symptomatischer Hypermobilität hinauszuzögern und weitestmöglich abzumildern (Romeo et al., 2016). Leider gestaltet sich der Diagnoseprozess oft außerordentlich langwierig (vgl. auch ▸ Kap. 2.2).
Fallbeispiel – Fortsetzung
Dies berichtet die Mutter der oben genannten amerikanischen Teenagerin über den diagnostischen Prozess:»Meine Tochter verbrachte ihre gesamte Kindheit mit Fehldiagnosen. Ihre Kindheit war geprägt von Schmerzen und seltsamen Symptomen, die in ärztlichen Praxen als Angstzustände abgetan wurden. Viel ›Hmmm ... das ist seltsam‹. Die Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit waren verheerend. Sie ist jetzt 17 Jahre alt und wurde mit EDS, MCAS [Mastzellenaktivierungssyndrom], POTS [posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom, eine Form von Dysautonomie] und Skoliose diagnostiziert. Jetzt, da wir wissen, woran sie leidet, können wir feststellen, dass sie diese Symptome seit ihrer frühen Kindheit hat. Kürzlich sind wir alte Krankenakten durchgegangen und haben gesehen, dass sie mit sieben Jahren zum ersten Mal wegen Schmerzen in den Hüften und Beinen zum Arzt gegangen ist. Sie leidet unter Angstzuständen, und während ihrer gesamten Kindheit führten verschiedene ärztliche Praxen ihre Schmerzen und seltsamen gesundheitlichen Probleme auf ihre Angstzustände zurück. Vier Therapierende und viele Jahre Therapie brachten keinerlei Verbesserung ihrer körperlichen Symptome und verschlimmerten in der Regel ihre Angstzustände. Mit 15 Jahren wurde ihr POTS so schlimm, dass es schließlich diagnostiziert wurde, was in der Folge zu EDS, MCAS und anderen Diagnosen führte. Die richtige Diagnose war das Beste für die psychische Gesundheit meines Mädchens. Nachdem sie ein Leben lang das Gefühl hatte, dass ihr Gehirn für all ihre gesundheitlichen Probleme verantwortlich war und dass es ihr besser gehen würde, wenn sie nur besser therapieren würde, war es für sie eine unglaubliche Bestätigung und Ermutigung zu verstehen, welche Dinge wirklich eine körperliche Grundlage haben (in ihrem Fall fast alle).«(Jovin, 2020a, Übersetzung der Autorinnen)
Auf dem Weg zur Diagnose werden Symptome manchmal belächelt, übersehen oder voreilig als psychosomatisch klassifiziert; bei Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) wird ein möglicher Zusammenhang mit Hypermobilität von fachärztlichem Personal, das oft nur ein Körpersystem isoliert in Betracht zieht, teils nicht erkannt (Jovin, 2020a). Kindern und Jugendlichen werden dadurch sinnvolle Interventionen vorenthalten, was sich negativ auf ihre Gesundheit und ihre Teilhabe (im Sinne einer aktiven und gleichberechtigen Teilnahme am sozialen, kulturellen und beruflichen Leben) auswirken kann (Bennett et al., 2019).
Erschwerend kommt hinzu, dass einige Betroffene sich minderwertig oder stigmatisiert fühlen und versuchen, ihre Symptome zu verbergen. Verletzungsneigungen, blaue Flecken, Müdigkeit oder lang anhaltendes Einnässen führen dabei manchmal zu falschen Verdächtigungen von Missbrauch oder sogar zum Verdacht auf ein Münchhausen- bzw. Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom (Sulli et al., 2018). Beim Münchhausen-Syndrom führen die Betroffenen selbst Symptome bzw. Krankheiten herbei, z. B. durch Einnahme von Drogen, Medikamenten oder Selbstverletzung. Sie verschweigen dies, wenn sie sich in Behandlung begeben, und wollen vor allem die Aufmerksamkeit und Fürsorge des medizinischen Fachpersonals sowie ihres sozialen Umfeldes aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte. Beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ruft jemand (oft ein Elternteil) Symptome bzw. Erkrankungen bei einer nahestehenden Person (oft beim Kind) hervor, ebenfalls um Aufmerksamkeit und Fürsorge zu erhalten.
Negative Gefühle und falsche Verdächtigungen können zu Desorientierung und Stress bei symptomatischen Betroffenen und Erziehungsberechtigten führen. Aufgrund der diagnostischen Schwierigkeiten bezeichnen Betroffene sich oft als »Zebras« (TEDS, 2025e). Der Hintergrund ist, dass Medizinstudierende vielfach den Rat bekommen, mit einem Pferd, statt mit einem Zebra zu rechnen, wenn sie hinter sich Hufgeräusche hören. Sie sollen zunächst häufige und naheliegende Erklärungen für Symptome berücksichtigen, bevor sie seltenere Diagnosen in Betracht ziehen. Manchmal steckt hinter Symptomen aber eben doch ein Zebra, also eine seltenere oder weniger bekannte Krankheit oder Störung.
1.3 Aktuelle Diagnoserahmen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
Für die Diagnose Erwachsener gilt aktuell die internationale Klassifikation von 2017 für die Ehlers-Danlos-Syndrome (EDS). Sie benennt 13 Subtypen von EDS (Malfait et al., 2017). Für zwölf der Subtypen wurden genetische Mutationen identifiziert; die Ausnahme bildet das hypermobile EDS (hEDS), das bisher ausschließlich aufgrund des klinischen Bildes diagnostiziert wird; es wird weiter nach genetischen Grundlagen für hEDS gesucht.
Um die Lücke zwischen asymptomatischer Hypermobilität und hEDS zu schließen, haben Castori et al. (2017) die diagnostische Einheit »Hypermobilitäts-Spektrum-Erkrankung« (abgekürzt teils HSS, häufiger und hier im Folgenden HSD von »hypermobility spectrum disorder«) vorgeschlagen. Dabei liegen Symptome vor, ohne dass alle klinischen Kriterien für hEDS erfüllt werden (vgl. ▸ Kap. 2.3).
Der Begriff Hypermobilitäts-Syndrom (HMS) wird zwar noch anstelle von HSD verwendet (s. a. M35.7 der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10-GM) (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), 2023), gilt aber seit 2017 als veraltet (TEDS, 2025a).
Eine Übertragung der Klassifikation von 2017 auf Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist problematisch (Tofts et al., 2023). Kinder und Jugendliche sind tendenziell beweglicher als Erwachsene. Viele Personen, die in der Kindheit hypermobil waren, wachsen mit der Zeit aus der Hypermobilität heraus. Hautmerkmale (ein Bestandteil der Kriterien von 2017) bilden sich häufig erst im längeren Lebensverlauf heraus und muskuloskelettale Symptome sowie andere Begleiterkrankungen können auch bei Kindern und Jugendlichen unabhängig von Hypermobilität auftreten.
Daher haben Tofts et al. (2023) im Rahmen des International Consortium on the Ehlers-Danlos Syndromes (EDS) and Hypermobility Spectrum Disorders (HSD) den ersten pädiatrischen Diagnoserahmen entwickelt. Neu, neben der Einbeziehung neuer Komorbiditäten im Vergleich zum Rahmen von 2017 ist, dass Kinder und Jugendliche höchstens mit verschiedenen Formen von HSD diagnostiziert werden können. Die Diagnose hEDS soll biologisch reifen Heranwachsenden bzw. Jugendlichen ab 18 Jahren vorbehalten sein und unter Verwendung der Kriterien von 2017 erfolgen, bis diese überarbeitet werden. Die einzelnen pädiatrischen Subdiagnosen reichen von asymptomatischer pädiatrischer generalisierter Gelenkhypermobilität bis zu pädiatrischer HSD des systemischen Subtyps und werden in ▸ Kap. 2.2.5 vorgestellt. Die Übergänge sind fließend und Reklassifizierungen im Entwicklungsverlauf sind möglich. Mit diesem Rahmen und der verzögerten hEDS-Diagnose soll erreicht werden, dass Grundlagen für angemessene Behandlungen und Unterstützung gelegt werden, aber noch keine lebenslange Diagnose erfolgt, die gegebenenfalls zu Übermedikalisierung und damit verbundenen Nachteilen führen könnte.
Der Schwerpunkt des Buches liegt auf HSD und hEDS. Es beleuchtet zudem, wie bei Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägter, jedoch asymptomatischer Hypermobilität präventiv gearbeitet werden kann. Der Begriff »Hypermobilität« dient hier als Oberbegriff für HSD und hEDS; die anderen zwölf Subtypen von EDS werden nicht behandelt.
Der pädiatrische Diagnoserahmen von Tofts et al. (2023) verdeutlicht, wie rasant die Forschung zur Hypermobilität, besonders im englischsprachigen Raum, in den letzten Jahren vorangeschritten ist. Dazu gehört auch, dass mehr Komorbiditäten anerkannt wurden und weitere aktuell evaluiert werden. Derzeit arbeitet ein Fachausschuss des International Consortium on the Ehlers-Danlos Syndromes and Hypermobility Spectrum Disorders im Rahmen des Projekts »Der Weg bis 2026« an einer Aktualisierung der internationalen Klassifikation für hEDS und HSD bei Erwachsenen (TEDS, 2025c). Bislang werden bei der Diagnose von Erwachsenen als Begleiterkrankungen lediglich chronische Schmerzen sowie Haut- und Gewebeauffälligkeiten und Prolapse (Organvorfälle) und Hernien (Eingeweidebrüche) berücksichtigt (vgl. auch ▸ Kap. 2.2.6). Es wird jedoch erwartet, dass im Zuge der Überarbeitung, in Anlehnung an den pädiatrischen Diagnoserahmen von Tofts et al. (2023), weitere Komorbiditäten hinzugefügt werden. Bis Ende 2026 sollen die Ergebnisse vorliegen, einschließlich eines klinisch getesteten Diagnosepfads. Parallel wird aktuell im deutschsprachigen Raum unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik (GfH) eine S2k-Leitlinie für die Ehlers-Danlos-Syndrome entwickelt (Ehlers-Danlos Organisation e. V., 2024). Insgesamt sind 16 weitere Fachgesellschaften in den Prozess eingebunden. Die Leitlinie soll flächendeckend die Diagnostik und Therapie der verschiedenen Ehlers-Danlos-Subtypen verbessern und im April 2026 vorgelegt werden.
1.4 Nach der Diagnose: Multiprofessionelles Team und Behandlungsoptionen
Leider garantiert eine angemessene Diagnose keine optimale Behandlung: Betroffene und ihre Familien erfahren nach der Diagnose oft Frustrationen bei der Suche nach kompetentem Fachpersonal (Bennett et al., 2019; Terry et al., 2015). Unbestritten ist, dass bei komplexer systemischer Hypermobilität die Zusammenstellung eines multiprofessionellen Teams empfehlenswert ist (C. Smith, 2017, mehr dazu in ▸ Kap. 3). Während die Diagnosekriterien sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt haben, gibt es weltweit noch keine hochwertigen klinischen Leitlinien zur Behandlung Betroffener (Sulli et al., 2018). Auch dies wird im oben genannten Projekt »Der Weg bis 2026« des International Consortium on the Ehlers-Danlos Syndromes and Hypermobility Spectrum Disorders adressiert: Erstmalig sollen auch Behandlungsleitlinien für hEDS, HSD und ihre Begleiterkrankungen formuliert werden. Auch die oben erwähnte S2k-Leitlinie wird Therapieempfehlungen beinhalten. Bis Behandlungsleitlinien vorliegen, empfiehlt sich mit Blick auf Behandlungsoptionen, sowohl den aktuellen Stand der Evidenz zu berücksichtigen als auch das Wissen von Fachkräften relevanter Disziplinen einzubeziehen. Dies möchte ▸ Kap. 6 dieses Buches für die Kinder- und Jugendmedizin, die Physio-, Ergo- und Psychotherapie, die Pädagogik und Optionen des Selbstmanagements für Betroffene und ihre Erziehungsberechtigten leisten.
1.5 Zielsetzung und Aufbau des Buches
Dieses Buch soll die wenig bekannten Beschwerdebilder von HSD und hEDS verständlicher machen, mögliche Zusammenhänge zwischen den vielfältigen Symptomen aufzeigen und praxisnahe Ansätze für medizinische, therapeutische und pädagogische Unterstützung sowie präventive Maßnahmen bei asymptomatischer Hypermobilität im Kinder-, Jugend- und jungen Erwachsenenalter bieten. Es richtet sich an Fachkräfte in der Kinder- und Jugendmedizin, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, Pädagogik sowie an Betroffene und deren Angehörige.
▸ Kap. 2 bietet einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zur Prävalenz, Diagnostik, HSD als multisystemische Spektrum-Erkrankung, zu Haut- und Gewebeauffälligkeiten, muskuloskelettalen Krankheitszeichen und Symptomen, Begleiterkrankungen, zur Prognose im Lebensverlauf sowie zu den Erfahrungen Betroffener. ▸ Kap. 3 beleuchtet die Bedeutung multiprofessioneller Teams für das effektive Management von Hypermobilität. In ▸ Kap. 4 werden aktuelle Theorien vorgestellt, die mögliche Zusammenhänge zwischen Gelenkhypermobilität und den zahlreichen Begleiterkrankungen erklären. Zudem wird erläutert, welche Interventionsmöglichkeiten sich hypothetisch daraus ergeben könnten. ▸ Kap. 5 kontrastiert dies mit den aktuellen evidenzbasierten therapeutischen und pädagogischen Interventionsmöglichkeiten. ▸ Kap. 6 basiert auf Evidenz und Fachwissen und vermittelt praxisorientierte Strategien, wie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte hypermobile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützen können. Zudem zeigt es Maßnahmen auf, die Betroffene selbst ergreifen können. Betroffene und ihre Angehörigen, die insbesondere an Behandlungsoptionen interessiert sind, sollten zur Orientierung zunächst den Abschnitt »Überblick zu Behandlungsoptionen mithilfe von Informationen in diesem Buch« in ▸ Kap. 6.6.2 konsultieren. ▸ Kap. 7 nennt nützliche Anlaufstellen.
2 Hypermobilität im Überblick
Im Folgenden wird ein Überblick über den aktuellen Wissensstand zu generalisierter Gelenkhypermobilität, HSD und hEDS gegeben. Dabei wird auf Prävalenz, Diagnostik, die Einordnung von HSD als Spektrum-Erkrankung, Haut- und Gewebeauffälligkeiten, muskuloskelettale Krankheitszeichen und Symptome, Begleiterkrankungen sowie die Prognose im Lebensverlauf eingegangen. Zudem werden Erfahrungen und Perspektiven Betroffener vorgestellt.
2.1 Prävalenz
Hypermobilität der Gelenke ist ein relativ häufiges Phänomen: Sie betrifft etwa 10 – 20 % der gesamten Bevölkerung (Hakim & Grahame, 2003). In den meisten Fällen zieht sie keine weiteren Symptome nach sich. Kinder und Jugendliche sowie Menschen inuitischer, asiatischer und afrikanischer Herkunft zählen zu den Bevölkerungsgruppen mit erhöhter Prävalenz (Morlino & Castori, 2023). Mädchen sind stärker betroffen als Jungen. Gemäß einer Metaanalyse von Sobhani-Eraghi et al. (2020) beträgt die Prävalenz in der Altersgruppe der 3- bis 19-Jährigen 34,1 %. Nur ein Teil der einbezogenen Studien differenziert nach Geschlechtern: In der Metaanalyse wird für Mädchen eine Prävalenz von 32,5 % und für Jungen von 18,1 % festgestellt. Die Prävalenzen variieren jedoch je nach Studie stark. Generell nimmt die Prävalenz mit zunehmendem Alter der Jugendlichen ab. In einer populationsbasierten Studie in Großbritannien (2011) weisen 14-jährige Mädchen zu 27,5 % und Jungen zu 10.6 % Hypermobilität auf, wobei ein verhältnismäßig geringer Beighton-Score von ≥ 4 (zum Beighton-Score vgl. ▸ Kap. 2.2.4) herangezogen wird (Clinch et al., 2011).
Merke
Hypermobilität ist weit verbreitet und meist asymptomatisch. Hypermobilität kommt bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere Mädchen, und Bevölkerungsgruppen inuitischer, asiatischer und afrikanischer Herkunft besonders häufig vor.
Auch in Bezug auf symptomatische Hypermobilität ist die geschätzte Spannbreite groß: Die minimale Prävalenz liegt bei 0,2 % (Hakim et al., 2021). In den USA wird sie auf 0,75 bis 2 % der Bevölkerung geschätzt, ca. 80 – 90 % davon werden dem Subtyp hEDS zugerechnet. Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer (Tinkle et al., 2017). Hakim und Grahame (2014) kalkulieren auf Basis einer Studie von Mulvey et al. (2013) eine mögliche Prävalenz in der Bevölkerung Großbritanniens von sogar 3,4 %. Viele Forschende halten symptomatische Hypermobilität für die häufigste systemische vererbte Bindegewebserkrankung (C. Smith, 2017; Tinkle et al., 2017). Bei Kindern und Jugendlichen ergeben Studien, dass zwischen 30 % und bis zu 67 % der Kinder mit generalisierter Gelenkhypermobilität Schmerzen haben, wobei unklar ist, ob die Gelenkhypermobilität die Schmerzursache darstellt (Clinch et al., 2011; Pacey et al., 2015).
Merke
Symptomatische Hypermobilität ist vermutlich die häufigste systemische vererbte Bindegewebserkrankung. Die Prävalenz liegt bei 2 % der Gesamtbevölkerung oder höher, bei Kindern und Jugendlichen wird sie sogar deutlich höher eingeschätzt.
2.2 Diagnostik
Der Diagnoseprozess ist häufig außerordentlich langwierig. In einer europäischen Studie von 2009 zu 16 seltenen Erkrankungen werden bei EDS die längsten diagnostischen Verzögerungen festgestellt: Für 50 % der Befragten dauert es im Schnitt 14 Jahre bis zur Diagnose, bezieht man ein weiteres Viertel mit ein (75 %), dauert es 28 Jahre (Kole & Faurisson, 2009).
Merke
Betroffene warten oft viele Jahre, teils Jahrzehnte, auf eine Diagnose.
Fallbeispiel
[Der Kanadier] Mark [...] hatte jahrzehntelang fachärztliche Praxen wegen einer Vielzahl von Symptomen aufgesucht, darunter Gelenkschmerzen und tägliche Kopfschmerzen, von denen ihm immer gesagt wurde, sie seien normal.Erst vor kurzem erhielt [er], 57, die Diagnose Ehlers-Danlos-Syndrome (EDS) [...].»Die ursprüngliche Diagnose wurde von meiner Krankenschwester gestellt«, sagt er. »Es war ein langer Weg zu dieser Diagnose, da ich mich schon mein ganzes Leben damit herumplage.«[Er] sagt, er habe seit seiner Kindheit hyperbewegliche Gelenke.»Meine Mutter konnte mich nicht richtig anziehen, weil meine Finger wie Gummi waren«, sagt er. »Sie sagte, der Versuch, meine Hände in Handschuhe zu stecken, sei so, als ob man versuchen würde, eine Qualle in einen Handschuh zu stecken.«(Vancouver Island Mental Health Society, 2024, Übersetzung der Autorinnen)
2.2.1 Allgemeine Hinweise auf symptomatische Hypermobilität
Typisch für symptomatische Hypermobilität sind eine Vielzahl von Symptomen in verschiedenen Organsystemen, die zunächst zusammenhanglos wirken. Erst der Gedanke an Bindegewebe als roten Faden vereint die einzelnen Aspekte zu einem sinnvollen Muster. »If you can't connect the tissues, think connective tissues« (»Wenn du die Gewebe nicht verbinden kannst, denke an Bindegewebe«), heißt es im englischsprachigen Raum. Der Ursprung dieses Satzes ist unbekannt, aber er wurde u. a. 2014 auf einer EDS-Konferenz in den USA von Dr. Heidi Collins aufgegriffen und hat sich seitdem weiter verbreitet (Collins, 2014).
Merke
»If you can't connect the tissues, think connective tissues.«
(»Wenn du die Gewebe nicht verbinden kannst, denke an Bindegewebe«).
Für einen ersten Zugang zu Hypermobilität empfiehlt die Selbsthilfeorganisation The Ehlers-Danlos Support UK (TEDS UK) das englische Akronym »Just GAPE« (»Staune nur«). Es steht für:
»Just GAPE« (»Staune nur«) als erster diagnostischer Zugang
Joints and (U)/other Soft Tissues (Gelenke und Weichteile)
Gut (Darm)
Allergy/atopy/auto-immune (Allergie, Atopie, Autoimmunität)
Postural Symptoms (posturale Symptome, insbesondere posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS))
Exhaustion (Erschöpfung)
Insbesondere in Verbindung mit Hypermobilität in der Familienanamnese sollte bei Symptomen aus mehreren dieser Bereiche an Hypermobilität gedacht werden.
Fallbeispiel – Erwachsene
Eine 50-jährige Gastwirtin leidet seit der Pubertät an Migräne und schmerzhaften und verstärkten Monatsblutungen. Nach einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus mit Anfang 20 entwickelt sie chronische Fatigue und in der Folge Fibromyalgie, die zunächst als Depression fehldiagnostiziert werden. Auch die Diagnose einer Schilddrüsenunterfunktion fällt in diese Zeit. Ab Mitte 30 kommen vermehrt muskuloskelettale Beschwerden hinzu (wiederkehrende Entzündungen der Faszien der Fußsohle, Schmerzen im vorderen rechten Hüftbereich und Diagnose einer Kiefergelenkdysfunktion). Später stellt sich heraus, dass die Hüftschmerzen durch einen okkulten Leistenbruch verursacht werden. Mit 49 Jahren werden eine Magenschleimhautentzündung und ein Vitamin-B12-Mangel diagnostiziert. Ein Jahr später, nach über 35 Jahren mit sich anhäufenden Diagnosen, wird die Diagnose hEDS gestellt. Die Bindegewebserkrankung ist das Bindeglied der verschiedenen Beschwerden.
2.2.2 Hinweise auf behandlungsbedürftige Hypermobilität bei Säuglingen und Kleinkindern
Säuglinge und Kleinkinder sind viel beweglicher als Erwachsene, und aufgrund mangelnder Knochenreife wird eine offizielle Hypermobilitäts-Diagnose erst ab dem fünften Lebensjahr empfohlen (vgl. ▸ Kap. 2.2.5). Lamari und Beighton (2023) empfehlen dennoch, auch bei Säuglingen und Kleinkindern auf Zeichen übermäßiger Hypermobilität zu achten. Dies gilt besonders, wenn es bereits Hypermobilität in der Familie gibt. In den ersten Lebensjahren äußert sich Hypermobilität meist in Problemen in der motorischen Entwicklung, die in aller Regel nur vorübergehend sind. Dennoch ist es empfehlenswert, sie nach bzw. parallel zur Abklärung relevanter Differenzialdiagnosen frühzeitig mithilfe von Physiotherapie und ggf. Ergotherapie sowie Logopädie zu adressieren, um Folgeprobleme zu minimieren.
Auffällig sind nach Lamari und Beighton (2023) oft:
Sehr weiche, teils dehnbare Haut
Schlechtes Saugen und häufiges Verschlucken
Hypotonie (reduzierte Muskelspannung) und verzögerte motorische Entwicklung, insbesondere:
-
Fähigkeit, den Kopf und den Rumpf zu stabilisieren
-
Nach vorn gebeugtes Sitzen mit Rundrücken und nach vorne gezogenen Schultern oder in extremen Positionen wie dem Spagat. Zum Sitzen im sogenannten »W-Sitz« vgl. Exkurs in ▸ Kap. 2.5
-
Armstütz in Bauchlage mit durchgedrücktem Ellbogengelenk
-
»Poporutschen« statt Krabbeln oder anderweitig atypisches Krabbeln
-
Teils verzögertes Laufen
-
Erziehungsberechtigte berichten manchmal, ihr Baby sei »bewegungsfaul« oder »sehr ruhig« und zudem »ungeschickt« oder »tollpatschig«
Höheres Risiko für vorgeburtliche Schädeldeformationen sowie lagerungsbedingten Plagio-/Brachyzephalus durch mangelnde neuromuskuläre Impulse bzw. mangelnde Kraft
Subluxationen und Dislokationen
Hernien
Fallbeispiel – Säugling
Die Amerikanerin Katherine Goss beschreibt, wie ihre Mutter sie als Säugling erlebte:»Ich war ein »schlaffes Baby«. Meine Mutter beschreibt, dass es so war, als würde man eine nasse Nudel in der Hand halten. Ich konnte meinen Kopf nicht in die Höhe halten, als ich es sollte, und war bei einigen Meilensteinen ziemlich verspätet. Ich wurde zur Untersuchung an einen Neurologen überwiesen, aber niemand hatte eine Antwort. Der Neurologe sagte meiner Mutter, er habe noch nie erlebt, dass ein Säugling so schlaff gewesen sei und dann bei den Meilensteinen aufgeholt habe, aber genau das habe ich getan.«(Goss, 2021, Übersetzung der Autorinnen)
2.2.3 Hinweise auf symptomatische Hypermobilität bei Kindern und Jugendlichen
Wie bei Erwachsenen können auch bei Kindern und Jugendlichen systemübergreifende Symptome ein Hinweis auf Hypermobilität sein (vgl. ▸ Kap. 2.2.1). Sie stellen sich vor der Pubertät in kinderärztlichen Praxen besonders häufig mit den folgenden Symptomen vor (TEDS UK, 2025):
Gestörte Blutdruckregulation
Magen-Darm-Blasen-Symptome
Sogenannte »Wachstumsschmerzen« (vgl. ▸ Kap. 2.5)