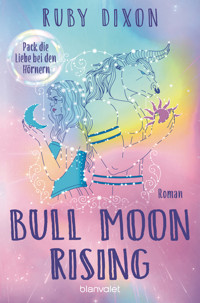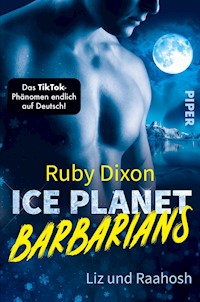2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit einer Weile leben die entführten Frauen nun schon friedlich auf dem Eisplaneten der Sa-Khui. Harlow hat bisher noch keinen Partner gefunden. Doch dann erwacht sie eines Tages in einer Höhle, offensichtlich entführt von Rukh, einem nicht zum Stamm gehörigen Sa-Khui. Ausgerechnet auf ihn spricht ihr Symbiont an – ist er ihr auserwählter Gefährte? Rukh ist ein wirklicher Barbar und hat lange vom Stamm entfernt gelebt. Wie soll man zu so jemandem eine Beziehung aufbauen? Beide müssen lernen, einander zu verstehen, wenn sie eine gemeinsame Zukunft haben wollen. Dies ist der 4. Band der Ice Planet Barbarians. Weitere Bände der Reihe: Ice Planet Barbarians – Georgie und Vektal (Band 1) Ice Planet Barbarians – Liz und Raahosh (Band 2) Ice Planet Barbarians – Kira und Aehako (Band 3) Ice Planet Barbarians – Harlow und Rukh (Band 4) Ice Planet Barbarians – Tiffany und Salukh (Band 5)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Ice Planet Barbarians« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Michaela Link
© Ruby Dixon 2015
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Barbarian Mine«, Selbstpubliziert von der Autorin 2015
Published in agreement with the author,
c/o Baror International, Inc., Armonk, New York, USA
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Covermotiv: Guter Punkt, München, Sarah Borchart unter Verwendung von Motiven von iStock/Getty Images Plus
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Triggerwarnungshinweis
TEIL 1
Harlow
Rukh
Harlow
TEIL 2
Rukh
Harlow
Rukh
TEIL 3
Harlow
Eine Woche später
Rukh
TEIL 4
Harlow
Rukh
Harlow
Rukh
Harlow
TEIL 5
Rukh
TEIL 6 – Ein Jahr später
Harlow
Rukh
TEIL 7
Harlow
Rukh
Harlow
Rukh
Rukh
TEIL 8
Harlow
Rukh
TEIL 9
Rukh
Harlow
TEIL 10
Rukh
Harlow
TEIL 11
Harlow
Rukh
Epilog – Einen Mond später
Harlow
Nachwort
Inhaltswarnung
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Liebe Leser*innen,
Ice Planet Barbarians – Harlow und Rukh enthält Themen, die triggern können. Deshalb findet ihr am Buchende eine Inhaltswarnung[1].
Achtung:
Diese beinhaltet Spoiler für die gesamte Geschichte. Wir wünschen euch allen ein bestmögliches Leseerlebnis.
Euer Piper-Fantasy-Team
TEIL 1
Harlow
Ich brauche zwei Stangen für eine Transportschleife. Kein Problem. Dahinten muss es Bäume geben, und ich bin stark und gesund.
Okay, gut. Ich schaffe das.
Immer wieder hallen mir Aehakos Anweisungen durch den Kopf. Wir müssen eine Schlepptrage bauen und Haeden zurück zur Heilerin bringen. Das Herz klopft mir bis zum Hals, als ich durch den Schnee renne und nach den biegsamen rosafarbenen Bäumen dieses Planeten Ausschau halte. Kira ist verschwunden, und die beiden Außerirdischen sind verwundet. Ich kann sie nicht im Stich lassen, denn sie brauchen meine Hilfe. Allerdings verstehe ich nicht, warum sie nicht wieder auf das außerirdische Raumschiff gehen und sich heilen lassen. Sie trauen ihm nicht, und das kann ich sogar verstehen. Ich bin an Technologie gewöhnt, aber sogar mir macht die kalte, emotionslose Stimme des Computers Angst.
Außerdem weiß ich, wie es ist, Angst vorm Arzt zu haben.
Meine Füße versinken bei jedem Schritt im Schnee, und meine Lederstiefel sind bald durchnässt. Es bleibt keine Zeit, etwas dagegen zu tun oder sie mit warmem Dvisti-Fell auszustopfen. Die Zeit drängt. Tapfer stapfe ich weiter über einen von Schneewehen bedeckten Hügel, als ich in der Ferne die biegsamen rosafarbenen Wimpern der Bäume sehe, und laufe schneller.
Jetzt bin ich fast da.
Ich habe Haedens Messer, da er zu schwer verletzt ist, um es zu benutzen. Der knöcherne Griff liegt gut in der Hand, obwohl er für meine menschlichen Finger ein wenig zu groß ist, um ihn bequem umfassen zu können. Alles hier auf Not-Hoth ist auf die Sa-Khui ausgerichtet, nicht auf Menschen. Für eine Frau habe ich eine ganz anständige Größe, doch die durchschnittliche Person auf diesem Planeten scheint gut zwei Meter zehn groß zu sein. Zudem ist der Schnee tief und die Höhlen sind riesig. Wirklich, alles fühlt sich einfach ein bisschen zu groß an. Ich komme mir vor wie in dem Haus aus dem Märchen Goldlöckchen und die drei Bären, nur dass alles zu groß ist statt genau richtig.
Das ist noch eines der vielen neuen und beängstigenden Dinge, an die ich mich gewöhnen muss.
Vor einigen Wochen bin ich in meinem eigenen Bett eingeschlafen, und die größte meiner Sorgen war die Frage, wann ich mit der Chemo beginnen würde. Ein paar seltsame Träume später bin ich dann aufgewacht, und man hat mich zitternd und geschwächt aus einer Röhre gezogen und mir gesagt, ich sei von Außerirdischen entführt worden.
Das wäre schwer zu glauben gewesen, wenn ich nicht aus Houston, Texas, stammen würde. Meine Klimaanlage war ausgefallen, sodass ich den Abend über geschwitzt und gebetet habe, der Techniker würde bald auftauchen. Als ich aufwachte, war es so kalt, dass meine nackten Füße am Metallboden festgefroren sind, und ab und zu kamen seltsame blaue Außerirdische herein, um mit uns Menschen zu plaudern.
Es ist nicht leicht, jemanden als Lügner zu bezeichnen, wenn er zwei Meter zehn groß, blau und gehörnt ist. Nachdem ich sie gesehen hatte, musste ich es glauben. Und obwohl ich mich manchmal kneifen möchte, bis ich aufwache, muss ich die Tatsache akzeptieren, dass ich jetzt auf einem Schneeplaneten lebe. Ohne eine Chance, je wieder nach Hause zu kommen, und mit einem außerirdischen Parasiten infiziert, der es mir ermöglicht, unter den unwirtlichen Bedingungen von Not-Hoth zu überleben. Nicht unbedingt das, was ich mir für meine Zukunft vorgestellt hatte.
Aber … wenigstens habe ich eine Zukunft.
Laut den medizinischen Computern des Raumschiffs bin ich nun krebsfrei. Ich weiß nicht, ob es ein Irrtum ist oder ob es an der Atmosphäre von Not-Hoth liegt oder an dem neuen »Luis« in meiner Brust, wie einige der Frauen den Khui nennen.
Ich weiß nur, dass der inoperable Gehirntumor auf den Scans nicht mehr zu sehen ist. Und zum ersten Mal seit einem Jahr habe ich Hoffnung.
Doch zunächst muss ich mich um eine Transportschleife kümmern.
Als ich bei den Bäumen ankomme, gehe ich auf den nächstbesten zu und berühre die Rinde mit den Fingerspitzen. Sie fühlt sich schwammartig und feucht an, trotz der herrschenden Kälte, und scheint nicht stabil genug, um einen riesigen, muskelbepackten Alien zu tragen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber einen Versuch ist es wert. Ich verdanke den Sa-Khui mein Leben, daher werde ich mein Bestes tun, um Haeden und Aehako zu helfen.
Also knie ich mich hin und mache mich daran, auf den ersten Baum einzuhacken. Das Messer versinkt mit einem schmatzenden Geräusch, und Saft spritzt in den Schnee. Igitt. Ich rümpfe die Nase, säbele jedoch entschlossen weiter. Kira ist verschwunden, und die beiden anderen sind verletzt, das heißt, ich bin die Einzige, die ihnen helfen kann.
In der Nähe knirscht etwas im Schnee.
Überrascht stehe ich auf. Es hat sich beinahe wie Schritte angehört. »Hallo?« Ich drehe mich um. »Aehako?«
Es ist niemand da. So weit das Auge reicht, ist in der verschneiten Landschaft nichts außer hügeligen Schneeverwehungen zu sehen. Ich muss mir das Geräusch eingebildet haben. Schließlich bin ich nicht allein hier draußen in der Wildnis. Überall sind irgendwelche Lebewesen, zumindest sagen das die Jäger. Es könnte eins der stachelschweinähnlichen Viecher sein. Oder ein Kaninchen. Oder … was immer das Kaninchen-Äquivalent auf diesem Planeten ist.
Aber ich darf mich nicht wie ein dummes Huhn aufführen und bei jedem kleinen Geräusch ausflippen. Folglich wende ich mich wieder dem Baum zu und hacke weiter daran herum.
Wieder höre ich das Knirschen im Schnee und einen Augenblick später ein heftiges Pochen. Mein Blut fühlt sich an, als würde es mir in die Ohren schießen, und ich presse mir eine Hand an den Kopf und zucke zusammen.
Nein, Moment. Das ist kein Pochen oder Trommeln. Mein Herz ist ruhig. Höre ich da ein … Schnurren?
Etwas knallt gegen meinen Hinterkopf, und ich stürze vornüber in die Dunkelheit.
Selbst dorthin folgt mir das seltsame Geräusch.
Rukh
Lautlos bewege ich mich durch den Schnee, obwohl ich vor Aufregung zittere. Das Herz schlägt mir bis zum Hals und mein Puls rast, als sei ich gerade querfeldein gerannt, statt mich an meine Beute heranzupirschen. Da ist ein Sirren, beinahe wie die klackernden Geräusche der großen grauen Bestien im Salzwasser, aber doch anders.
Es kommt aus meiner Brust. Von mir.
Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass ich die seltsamen Wesen inmitten der Bösen, von denen mein Vater mir gesagt hat, ich solle mich von ihnen fernhalten, gerochen habe. Es sind zwei seltsame Geschöpfe, die mit den Bösen reisen – sie sind so pelzig, dass sich ihr Körperbau unmöglich bestimmen lässt, aber eine dieser Kreaturen hat einen Schopf orangeroter Haare, der mich fasziniert. Seit letzter Nacht bin ich ihr gefolgt, und jetzt ist die mit der rötlichen Mähne allein.
Und ich … gerate in Panik. Als das Wesen Anstalten macht, sich umzudrehen, versetze ich ihm einen Schlag auf den Kopf.
Es bricht in einem vielfarbigen Pelzhaufen zusammen. Ein Knochenmesser, ähnlich dem meines Vaters, fällt ihm aus der Hand.
Verwirrt reibe ich mir die dröhnende Brust.
Als ich auf das Geschöpf zu meinen Füßen schaue, sehe ich, dass es weiblich ist. Es sieht merkwürdig aus, anders als die Bösen. Es hat keine Wülste auf der Stirn, und die Haut weist die weiche, blasse Farbe eines Dvisti-Bauches auf statt eines gesunden Blautons. Die Frau ist mit Erde gesprenkelt, doch der weibliche Zug um die Lippen ist ebenso unverkennbar wie die zarten Gesichtszüge. Stirnrunzelnd lege ich eine Hand auf das dicke Fell ihres Oberkörpers, um nach den Zitzen zu tasten. Zu meiner Überraschung öffnen sich die Pelze. Es ist eine Art von Fellbedeckung, die gar nicht zu dem Wesen gehört. Es trägt sie, wie ich manchmal bei großer Kälte eine Decke umhabe.
Meine Hand streicht über eine der Zitzen, und meine Finger gleiten über eine runzlige Brustwarze.
Das Wesen stöhnt, und das Dröhnen in seiner Brust wird lauter.
Mein eigener Körper reagiert. Sofort wird mein Schwanz hart und schmerzt vor Verlangen. Was mich überrascht – und ziemlich entsetzt. Das Ding ist ganz blass, irgendwie hässlich. Wieso reagiere ich darauf wie auf die seltsamen beunruhigenden Träume, die ich manchmal habe? Mit einer Hand schiebe ich meinen steifen Schwanz beiseite. Schließlich habe ich keine Zeit, mich jetzt damit zu befassen. Ich hebe das bewusstlose Wesen auf und stecke mir sein Messer in die Tasche, dann werfe ich es mir über die Schulter und mache mich auf den Weg zu meiner Höhle.
Dort werde ich entscheiden, was ich mit der Frau mache.
Das Wesen ist immer noch bewusstlos, als ich es in einer Ecke meiner Höhle ablege und überlege, was ich mit ihm machen soll. Unverkennbar ist es weiblich, denn es ist weich und hat Zitzen. Mein Schwanz schmerzt immer noch vor Verlangen, und während ich auf- und abgehe, streiche ich mit der Hand immer wieder darüber, weil es sich gut anfühlt.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieses weibliche Wesen bringt mich ganz durcheinander. Sie ist keins von den essbaren Dingen, die mein Vater mir gezeigt hat. Sie war bei den Bösen, aber sie ist weggelaufen. Gehört sie also zu den Guten?
Ich schließe die Augen und drücke eine Hand auf meine Eichel. Es fühlt sich so gut an, dass mein ganzer Körper erbebt, und das seltsame Surren in meiner Brust wird lauter.
Ich wünschte, mein Vater wäre hier.
Schon seit vielen, vielen bitteren Jahreszeiten ist er tot. Ich war noch ganz klein, als er starb, und seither bin ich allein. Doch Vater hatte auf alles eine Antwort. Er hätte gewusst, warum meine Brust dröhnt oder warum mein Schwanz in der Nähe des Weibchens schmerzt. Eine Welle der Einsamkeit überrollt mich. Manchmal hasse ich es, dass ich keine Antworten habe, bloß Fragen und niemanden, dem ich sie stellen kann.
Ich streichle weiter meinen Schwanz, bis er Feuchtigkeit ausspeit und mein Körper sich endlich entspannt. Während ich das tue, beobachte ich sie, weil ich, wie ich mir sage, einfach neugierig bin. Ihre Brust scheint zusammen mit meiner zu dröhnen, was immer das hier verursacht, beeinflusst also auch sie. Nachdem ich meine nasse Hand am Boden der Höhle abgewischt habe, krieche ich auf das bewusstlose Weibchen zu.
Ich bewege mich vorsichtig, als könne es jeden Augenblick aufwachen und mich angreifen. Es ist klein und rührt sich nicht, und ich frage mich, ob ich es schlimmer verletzt habe, als mir bewusst war. Aus irgendeinem Grund versetzt der Gedanke mir einen Stich, und ich hebe den Kopf der Frau an und untersuche ihren Schädel. Unter ihrer rötlich goldenen Mähne hat sie eine Beule, aber ansonsten scheint es ihr gut zu gehen. Als ich meine Wange an ihre Nase drücke, spüre ich ihren Atem. Sie lebt noch. Ihre Augen sind geschlossen, und sie atmet gleichmäßig.
Ich fühle mich schuldig, weil ich ihr wehgetan habe. Das hätte ich nicht tun sollen. Sie gehört mir. Doch ich bin in Panik geraten. Das Weibchen hat eine Wunde am Kopf, aber zum Glück habe ich noch etwas Schmerzwurzel, die das Blut gerinnen lässt. Behutsam lege ich den Kopf der Frau wieder auf dem Boden ab und suche die getrocknete Wurzel aus meinem Kräutersäckchen heraus. Nachdem ich sie zu einem Brei zerkaut habe, kehre ich zu dem Weibchen zurück und betupfe seine Kopfverletzung mit der Paste. Später wird es dankbar dafür sein.
Vorsichtig lasse ich es wieder auf den Boden herunter, und ich kann nicht aufhören, es anzustarren. Es ist mit einer Art rötlich braunem Schmutz besprenkelt, und ich reibe geistesabwesend daran. Ihre Haut ist anders als meine – sie hat kein weiches helles Fell, sondern ist überall nackt, außer auf dem Kopf, und das fühlt sich … seltsam an. Es lässt meinen Schwanz erneut hart werden, doch ich ignoriere das. Schließlich kann ich nicht den ganzen Tag dasitzen und daran reiben. Mir fällt auf, dass sich die Flecken nicht wegwischen lassen. Sie sind auf ihrer Haut. Sehr merkwürdig. Ich lecke mir über den Daumen und reibe an einem anderen Fleck, aber er verschwindet nicht.
Ein merkwürdiges Wesen, diese Frau.
Ich ziehe an ihrer Fellbedeckung, um zu sehen, ob sie überall gefleckt ist. Die Felle öffnen sich und offenbaren darunter eine weitere dünnere Schicht aus einem ähnlichen Material wie mein Wasserschlauch. Ich ziehe auch sie ab und entdecke noch mehr von der seltsamen bleichen Haut mit den Flecken darauf. Ihre Arme sind glatt und weich, ohne den dicken Panzer, den meine haben. Ich reibe meinen Arm, dann berühre ich ihren. Wir sind total verschieden. Sie ist ganz weich, und daraus schließe ich, dass sie schwach ist.
So etwas wie sie habe ich noch nie gesehen. Erneut ziehe ich an den Lederbedeckungen, woraufhin sie sich öffnen und ihre Zitzen entblößen. Ich weiche zurück, überrascht bei dem Anblick. Die Zitzen sind voll und rund, mit rötlich braunen Spitzen, die in die Luft ragen. Ich berühre eine davon, weil ich wissen will, ob sie wieder diesen kehligen Laut von sich geben wird wie vorhin.
Aber sie ist still, und ich bin enttäuscht. Mein Schwanz zuckt und schmerzt und sehnt sich verzweifelt nach einer weiteren Erlösung. Ich ignoriere es und drücke eine Hand zwischen ihre Zitzen, wo es dröhnt, genau wie bei mir. Ihre Brust vibriert in derselben Geschwindigkeit wie meine, was merkwürdig ist. Es fühlt sich an, als seien wir irgendwie miteinander verbunden. Als hätten unsere Körper beschlossen, zusammen ein Lied zu singen.
Das gefällt mir.
Es gefällt mir auch, das Weibchen anzuschauen. Ich mag seine seltsame fleckige Haut und seine merkwürdige Mähne. Mir gefallen seine kleinen hübschen Zitzen und sogar sein hässliches Gesicht. Soweit ich erkennen kann, hat die Frau weder Hörner noch eine Rute, doch ihr Duft ist betörend. Ich verspüre das merkwürdige Verlangen, sie abzulecken und herauszufinden, woher der Duft kommt, aber bei dem Gedanken pocht mein Schwanz.
Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt, wie sehr mein Körper sich in Gegenwart der Frau meiner Kontrolle entzieht. Stirnrunzelnd lege ich ihr die Felle wieder um, sodass ihre Zitzen nicht mehr zu sehen sind, und gehe dann zurück auf die andere Seite der Höhle. Bevor ich schlafen gehen kann, ist noch einiges zu tun: Schnee muss geschmolzen, Schnüre müssen für Fallen geflochten und Klingen geschärft werden. Außerdem muss ich etwas essen und meine Fallgruben überprüfen.
Es gibt niemanden, der mir hilft, daher kann ich erst schlafen gehen, wenn alles erledigt ist. Während ich ein Stück getrocknete Sehne aufhebe, hocke ich mich hin und beobachte das Weibchen von ferne. Ich verlasse die Höhle nicht und lasse es auch nicht allein zurück.
Diese Frau gehört jetzt mir. Ich habe sie den Bösen weggenommen. Sie gehört mir, und ich werde jeden töten, der versucht, sie mir wegzunehmen.
Harlow
Mein Kopf pocht heftig, und mein erster Gedanke ist, dass der Gehirntumor wieder da ist. Der Computer in dem außerirdischen Schiff hat sich geirrt: Ich bin doch nicht gesund. Ich sterbe, und dies sind meine letzten Augenblicke.
Aber dann kommen allmählich die Erinnerungen zurück. Meine hektische Suche nach Bäumen, daran, eins der Gewächse mit dem Messer bearbeitet zu haben, und wie mich dann plötzlich etwas von hinten traf und alles dunkel wurde.
Und seltsamerweise erinnere ich mich an ein Schnurren.
Die Erleichterung schießt durch mich hindurch. Es geht mir gut. Mein Khui hat mich von dem Gehirntumor befreit. Ich befinde mich nicht auf der Erde, und ich liege nicht im Sterben.
Allerdings ist das Schnurren immer noch da, wie eine gigantische Katze, die nicht von meiner Brust weichen will. Doch als ich langsam die Augen öffne, wird mir bewusst, dass es hier keine Katzen gibt und das Schnurren aus meiner Brust kommt.
Scheiße. Ich bin lange genug mit den anderen zusammen gewesen, um zu wissen, was das bedeutet. Mein Khui wurde in Schwingungen versetzt. Ich vibriere für einen Mann, weil mein Khui – oder Luis, wie wir Menschen ihn gern nennen – beschlossen hat, dass ich die perfekte Gefährtin für jemanden bin. Die einzigen Männer, mit denen wir unterwegs waren, sind jedoch Haeden und Aehako. Ist es einer von den beiden? Ich mag Aehako, aber ich weiß, dass er Kira liebt. Haeden ist ein schroffes, knurriges Wesen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir der Gedanke gefällt, seine Gefährtin zu werden.
Nicht dass ich eine Wahl hätte. Danke, Luis. Danke für nichts.
Nach und nach klärt sich mein Blick, und ich begreife, dass ich an die zerklüftete Decke einer mir unbekannten Höhle starre. Wieso bin ich in einer Höhle? Wurde ich von etwas getroffen und Aehako hat mich gerettet? Ist das der Grund, warum mein Luis in Schwingungen versetzt wurde? Hat er einen Jungfrau in Nöten-Komplex?
Aus dem Augenwinkel bemerke ich eine Bewegung und drehe den Kopf, dann bricht ein Stöhnen aus mir heraus.
Neben mir kniet ein Mann, ein Sa-Khui, aber … es ist keiner, den ich kenne. Ich richte mich auf und rutsche von ihm weg, als mir klar wird, dass er ein Messer in der Hand hält und mich angafft.
Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße.
Nach wenigen Zentimetern stoße ich mit dem Rücken gegen die harte Felswand und starre den Fremden voller Entsetzen an. Das kann nicht sein. Es gibt keine Fremden auf diesem Planeten. Nicht auf Not-Hoth. Es gibt nur Vektals Stamm und die Menschen. Ich kenne hier jedes außerirdische Gesicht.
Doch ich kann nicht leugnen, dass ich in das Antlitz eines Fremden blicke. Das eines Wilden.
Er hockt auf dem Lehmboden der Höhle wie ein Tier, die Schultern hochgezogen. Außerdem ist er nackt. An seinem riesigen, muskulösen blauen Körper ist kein Fitzelchen Stoff. Sein Ding zwischen den Schenkeln ist erigiert und hart, und ich sehe den »Sporn«, über den immer alle reden – der kurze, hornartige Auswuchs direkt über dem Schwanz, der bei allen Sa-Khui-Männern zur Standardausrüstung gehört. Mein Gesicht wird heiß, als mir bewusst wird, dass ich sein Gehänge anstarre.
Aber ernsthaft, sein Schwanz hängt einfach so zwischen seinen geöffneten Beinen herab, wo jeder ihn sehen kann.
Sein Gesicht ist breit, seine Wangenknochen hoch. Er hat scharfe Züge, und seine Augenbrauen sind dicht und wulstig. Das schwarze Haar umrahmt seinen Kopf wie ein zerzauster Heiligenschein, als hätte er vor langer Zeit vergeblich versucht, einen Teil davon zu flechten. Das Ganze sieht eher wie ein Steppenläufer-Knäuel aus als nach Haaren, und es ist klar, dass er kein Fan von Kämmen ist.
Oder vom Waschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein ganzer Körper mit einer Schmutzschicht bedeckt ist. Doch wenn er keine Kleidung trägt, ergibt es wohl wenig Sinn, sich zu pflegen.
Er beobachtet mich mit zusammengekniffenen Augen und fährt mit einem Stein an der Schneide des Messers entlang, um es zu schärfen. Seine Bewegungen sind langsam, und ich kann nicht sagen, ob er damit bedrohlich wirken will oder ob er vielmehr versucht, mir keine Angst zu machen. In Anbetracht der Tatsache, dass er ein Messer in der Hand hat, tippe ich auf bedrohlich.
»Wer bist du?«, flüstere ich.
Er antwortet nicht, und mir wird klar, dass ich Englisch gesprochen habe. Hoppla. Auf dem Raumschiff habe ich die alte Sa-Khui-Sprache – Sakh – gelernt, also versuche ich es stattdessen damit. Doch auch darauf antwortet er nicht.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist er taub? Er beobachtet mich, reagiert aber nicht auf meine Versuche, mit ihm zu sprechen.
»Ich heiße Harlow«, sage ich. »Wo sind meine Freunde?«
Wieder bekomme ich keine Antwort.
Ich drücke beide Hände flach auf den Boden. Unter einer Hand ist ein Kieselstein, und ich greife danach und werfe ihn durch die Höhle, um festzustellen, ob er darauf reagiert.
Er folgt dem Kieselstein mit seinem Blick, dann betrachtet er mich stirnrunzelnd und fletscht knurrend die Zähne, was mich erbeben lässt. Okay, er ist nicht taub. Er hat sich nur dafür entschieden, nicht mit mir zu reden.
Verdammt, was jetzt?
»Hat Vektal dich geschickt?«, versuche ich es weiter. »Haben Aehako und Haeden es geschafft, zurück zu den Höhlen zu kommen? War ich lange bewusstlos?«
Sein Blick wandert zurück zu dem Messer, und er fährt erneut mit dem Stein über die Schneide, um es zu schärfen.
»Du verstehst kein Wort, was?« Ich bin schockiert. Es gibt doch keinen anderen Sa-Khui-Stamm auf dem Planeten, oder? Aber dieser Mann ist allein, und er versteht die Sprache seines Volkes nicht. Ich sehe mich in der kleinen Höhle um. In den Stammeshöhlen hat jede Familie ihr Bestes getan, um aus ihrer Höhle ein Zuhause zu machen. Körbe und Decken füllen die Winkel, und überall werden Lebensmittel, Kräuter und Dinge des täglichen Bedarfs aufbewahrt.
Hier dagegen gibt es nicht viel. In einer Ecke liegen einige achtlos hingeworfene Beutel, doch ich sehe keine Decken, kein Bett, keine Feuerstelle, kein gar nichts.
»Lebst du hier?«, flüstere ich.
Der Fremde starrt mich einen Moment lang an, dann steht er langsam auf und kommt auf mich zu.
Hilfe. In dem Versuch, vor ihm zurückzuweichen, drücke ich mich gegen die Höhlenwand. Aber ich kann nirgendwohin, als er auf mich zukommt, also schließe ich die Augen. Es ist nichts zu hören außer dem Geräusch unserer beiden Luise, die zusammen singen, und meine Brust vibriert unter der Wucht des meinigen.
O nein, nein, nein, nein.
Nicht dieser Typ!
Doch es lässt sich nicht leugnen, dass mein Körper reagiert, wenn er in meiner Nähe ist. Ich spüre, wie meine Haut heiß vor Verlangen wird, und ich werde feucht zwischen den Beinen, als wäre ich gerade total angeturnt. Zugegeben, er ist groß und muskulös und könnte eine Frau wahrscheinlich tragen, als wöge sie nichts …
O Gott. Das ist wirklich übel. Ich meine, schlimmer als jedes Worst-Case-Szenario.
Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich tun soll. Mein Puls beschleunigt sich in einer Mischung aus Angst und der Reaktion auf meinen Khui, und ich hasse es, dass es zwischen meinen Beinen zu pochen beginnt. Georgie hat nicht gelogen, als sie gesagt hat, wenn der Khui in Schwingungen versetzt wird, sei das das Tollste überhaupt. Es fühlt sich dringlich an, als sollte ich diesen Typen – diesen verdreckten Fremden – packen, ihn zu Boden werfen und mich auf seinen Schwanz spießen.
Und was dann? Ein Baby von ihm bekommen? Nein danke, Luis.
Ich presse die Schenkel fest zusammen und versuche, meinen Körper dazu zu zwingen, sich verdammt noch mal wieder einzukriegen.
Seine Finger berühren mein Haar, und obwohl er sanft ist, pocht mein Kopf trotzdem. Als ich mühsam ein Auge öffne, bereit zurückzuweichen, begreife ich, dass ich mich fast auf gleicher Höhe mit seinem erigierten Schwanz befinde. Einen Moment starre ich mit trockenem Mund darauf. Ich bin keine Jungfrau mehr, und wie den meisten Frauen gefällt mir der Anblick eines schönen Schwanzes. Der Typ – wer auch immer er ist – hat einen wirklich schönen, aber das ist vielleicht nur mein Luis, der da aus mir spricht. Er ist natürlich nicht beschnitten, doch es lässt sich nicht leugnen, dass er genau die richtige Länge und den richtigen Umfang hat, und ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie sich das anfühlen würde.
Mein Luis summt noch heftiger in meiner Brust. O Gott. Ich habe das Gefühl, von allen Seiten verraten zu werden.
Er berührt meine Kopfwunde, und ich zucke zurück. »Au!« Ich schlage nach seinen Händen, weil ich mich nicht bezähmen kann.
Der Mann grunzt und tappt auf nackten Sohlen davon. Meine Reaktion scheint ihn nicht weiter zu beunruhigen. Ich mustere ihn stirnrunzelnd und berühre selbst meine Wunde. Sie ist mit einer klebrigen Paste bedeckt, wahrscheinlich irgendeine Art Heilmittel aus der Gegend hier.
»Ich Glückspilz«, murmele ich.
Er grunzt wieder und hockt sich erneut ans andere Ende der Höhle. Doch immerhin greift er nicht noch einmal nach dem Messer, sondern beobachtet mich bloß, die Hände auf den Knien.
Ich schaue zum Eingang der Höhle. Sie ist offen und ungeschützt, und ich kann draußen im spärlichen Sonnenlicht den Schnee glitzern sehen. Die meisten Sa-Khui haben dekorative Tierhäute auf Knochenrahmen gespannt, die sie vor die Höhlenöffnung schieben, um so etwas wie Privatsphäre zu erzeugen oder um das raue Wetter fernzuhalten. Dieser Typ nicht.
»Bist du ein Hardcore-Überlebenskünstler oder so was?« Er antwortet nicht, und ich seufze. »Natürlich sagst du nichts. Ich nehme an, du kannst mir auch nicht sagen, was aus Aehako und Haeden geworden ist? Den beiden verletzten Männern?«
Er kneift die Augen zusammen, bewegt sich jedoch nicht.
Ich gestikuliere und deute mit den Händen Hörner an. »Zwei große Männer? Mit mir unterwegs? Sie sehen aus wie du?«
Nichts als ein leerer Blick.
Ich beiße mir auf die Unterlippe und denke nach. Wenn sie verletzt sind und auf meine Rückkehr warten, kann ich nicht hierbleiben. Was ist, wenn sie sterben? Ich glaube nicht, dass sie der Computertechnologie genug vertrauen, um zurück zum Raumschiff zu gehen und es darum zu bitten, ihre Wunden zu versorgen.
Ich werde irgendwie fliehen müssen.
»Hör zu«, sage ich. »Du bist ein netter Kerl und so und diese Luis-Sache ist lästig, aber ich muss jetzt wirklich los.« Ich ignoriere das beharrliche Dröhnen in meiner Brust und mache Anstalten aufzustehen.
Er knurrt mich an und fletscht erneut die Zähne.
Ich kreische und lasse mich wieder auf den Boden fallen. Okay, er ist also nicht sonderlich gesprächig, aber nonverbale Kommunikation beherrscht er wirklich gut. Ich erkenne ein »Setz dich und halt die Klappe!«, auch wenn es nicht ausgesprochen wird.
Doch er kann ja nicht ewig hier hocken und mich anstarren, oder? Folglich brauche ich nur abzuwarten, bis er sich langweilt. Ich sollte mich schlafend stellen. Also lehne ich mich an die Wand, schließe die Augen und lasse es so aussehen, als würde ich ein Nickerchen machen. Es gelingt mir, die Augen einen winzigen Spalt offen zu halten, gerade so weit, dass ich durch meine Wimpern hindurchspähen kann. Es dauert eine Ewigkeit, aber irgendwann hört er auf, mich anzustarren, und fängt wieder an, mit dem Rücken zu mir an etwas zu arbeiten.
Soll ich nun versuchen zu fliehen?
Es ist fast so, als würde das Schicksal mein stummes Flehen erhören. Im nächsten Moment steht der Außerirdische auf und schlendert in den vorderen Teil der Höhle. Er tritt hinaus ins Tageslicht, und ich höre das Knirschen von Schritten im Schnee, als er nach links davongeht.
So einfach wird es sicher nicht sein, oder?
Ich schnappe mir das Knochenmesser vom Boden und springe auf die Füße. Jeder Muskel in meinem Körper schmerzt und fühlt sich verkrampft an, und bei der plötzlichen Bewegung dröhnt mir der Kopf. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Ich schleiche durch die Höhle zum Eingang und sehe ihn in einiger Entfernung stehen und zu den fernen Bergen blicken, während er mit der Hand seine Augen beschirmt. Seine Hörner ragen bedrohlich aus seiner Stirn, und die Rute auf seiner Hinterseite peitscht hin und her, als sei er verärgert.
Nun muss ich aber schleunigst verschwinden! Ich renne hinaus in den Schnee, in die entgegengesetzte Richtung. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, aber es ist mir auch egal. Abhauen scheint gerade die beste Lösung zu sein.
Doch in dem Schnee kann ich nicht wirklich rennen. Menschliche Füße sind nicht für die Schneeverwehungen auf Not-Hoth geschaffen, und ich versinke bei jedem Schritt. Es ist wie der Versuch, durch Schlamm zu laufen, und ich komme bloß langsam voran. Ich huste und keuche vor Anstrengung und meine Muskeln schmerzen, aber ich darf nicht stehen bleiben.
Ein zorniger, wortloser Schrei ertönt irgendwo hinter mir, und ich weiß, dass er mich entdeckt hat. »Scheiße!« Ich versuche, schneller zu laufen, doch meine Beine sind schwer und schwach, und mein Kopf fühlt sich an, als würde er bei jedem Pulsschlag explodieren.
Während ich renne, höre ich seine stampfenden Schritte näher kommen, woraufhin ich in Panik gerate. Ich umklammere das Messer, bereit zum Angriff, falls er mich packt. Wenn auch nur einer dieser Arme versucht, sich um meine Taille zu schlingen, werde ich zustechen, dass ihm Hören und Sehen vergeht.
Im nächsten Augenblick werde ich auf den Bauch zu Boden geschleudert, und ein schweres Gewicht legt sich auf mich.
Ich schreie vor Zorn und Angst und wehre mich, stoße wild mit dem Messer hinter mich. In meiner Verzweiflung versuche ich, einfach irgendetwas zu treffen. Es ist mir egal, was, Hauptsache, er lässt mich los.
Eine große Hand schließt sich um mein Handgelenk und drückt es über meinem Kopf in den Schnee. Die Finger spannen sich um die Knochen meines Handgelenks, bis ich wimmernd das Messer loslasse, und er entreißt es meinem Griff.
Ich trete nach ihm, und einen Moment später liege ich auch schon auf dem Rücken, sein schwerer Leib auf mir. Meine Brüste heben und senken sich vor Wut, und ich funkle ihn an. Er ist sauer, dass ich weggelaufen bin. Sein Gesichtsausdruck lässt daran keinen Zweifel. »Gut«, knurre ich ihn an. »Mein Luis mag das Stockholm-Syndrom haben, ich aber nicht!«
Er lässt mich für eine Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkommt, auf sich einschlagen, und wird kein bisschen müde. Frustriert bäume ich mich mit dem ganzen Körper auf, versuche, ihn abzuwerfen, jedoch ohne Erfolg. Wahrscheinlich wiegt er doppelt so viel wie ich.
Allerdings hat sich bei diesem Manöver meine Kleidung irgendwie geöffnet, und kurz darauf sind meine Brüste nackt, weil sich die Schnüre meiner Tunika bei dem Kampf gelöst haben. Ich keuche vor Schreck angesichts der kalten Luft auf – und weil ich bis zur Taille entblößt bin.