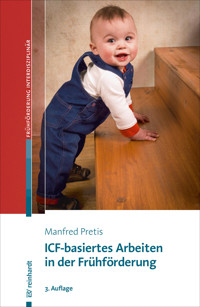28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der inklusiven Schule arbeiten die unterschiedlichsten Fachkräfte zusammen. RegelschullehrerInnen, Sonderpäd-agogInnen, SchulpsychologInnen u. v. m. bilden ein sogenanntes "Team um das Kind mit Beeinträchtigung". Die Kommunikation wird durch unterschiedliche Klassifikationssysteme häufig erschwert. Hier schafft die "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" (ICF) Abhilfe. Sie stellt die Fähigkeiten von Kindern in den Mittelpunkt und zeigt Hilfebedarf auf. Wie können Fachkräfte mit der ICF arbeiten? Und welche Chancen ergeben sich daraus? Diese und weitere Fragen beantworten die AutorInnen in ihrem Buch. Sie laden Fachkräfte anhand von konkreten Beispielen ein, in der eigenen schulischen Praxis mit der ICF zu arbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Prof. Dr. Manfred Pretis, Heilpädagoge und klinischer Psychologe, lehrt Transdisziplinäre Frühförderung an der Medical School Hamburg.
Prof. Silvia Kopp-Sixt lehrt am Institut für Professionalisierung in der Elementar- und Primar-pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Graz.
Rita Mechtl, Sonderschullehrerin und Dipl.-Konduktorin, leitet die privaten Schulen Oberaudorf-Inntal.
Außerdem im Ernst Reinhardt Verlag erschienen:
Pretis, M.: ICF-basiertes Arbeiten in der Frühförderung (2. Aufl. 2019, ISBN 978-3-497-02840-5)
Pretis, M., Dimova, A.: Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern (3. Aufl. 2016, ISBN 978-3-497-02592-3)
Brandau, H., Pretis, M., Kaschnitz, W.: ADHS bei Klein- und Vorschulkindern (3. Aufl. 2014, ISBN 978-3-497-02439-1)
Hinweis: Soweit in diesem Werk eine Dosierung, Applikation oder Behandlungsweise erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass das Autorenteam große Sorgfalt darauf verwandt hat, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen oder sonstige Behandlungsempfehlungen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. – Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-02805-4 (Print)
ISBN 978-3-497-61171-3 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61172-0 (EPUB)
© 2019 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von © istock.com/PeopleImages; Zeichnung in Abb. 4: Snezhana Stojanova; Abb. 16: Pfennigparade Phoenix Schulen und Kitas GmbH
Satz: Katharina Ehle
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
1 Herausforderungen an inklusives schulisches Handeln
1.1 ICF und Inklusion
1.2 ICF und Inklusion erfordern Teamwork
1.3 Was kennzeichnet Teams und wie funktionieren sie, wenn sie die ICF als gemeinsame Sprache einsetzen?
1.4 Team ist nicht gleich Team: Über Wirkungen und Nebenwirkungen der Arbeit in Teams
2 Die ICF als Problemlösungsinstrument inklusiven Handelns
2.1 Was ist die ICF?
2.2 Die ICF als Teil der WHO-Familie von Klassifikationssystemen
2.2.1 Gesundheitsprobleme im schulischen Alltag berücksichtigen: Über die Wichtigkeit von Diagnosen
2.2.2 Die ICF als fähigkeitsorientierter Ansatz
2.2.3 ICF und ihr Verständnis von Behinderung
2.3 ICF und Etikettierung
2.4 Die ICF als gemeinsame Metasprache
3 Aufbau und Funktion der ICF im schulischen Kontext
3.1 Komponenten der ICF
3.2 Kodieren und Bewerten
3.2.1 WHO-Beurteilungsmerkmale beim Bewerten verwenden
3.3 Ressourcenplanung mittels ICF
4 Praktischer Einsatz der ICF in der Schule
4.1 Die ICF im sonderpädagogischen Gutachten
4.1.1 Struktur von sonderpädagogischen Gutachten im Zusammenhang mit dem Schweizer Ansatz des SAV
4.1.2 Induktiver Vorschlag für ein sonderpädagogisches Gutachten unter Verwendung der ICF
4.1.3 Denkmodell eines berufsübergreifenden ICF-basierten sonderpädagogischen Gutachtens
4.2 Aus der Praxis: ICF im Unterricht
4.2.1 Fördermaßnahmen passen sich den Kindern an – nicht umgekehrt
4.2.2 Individualisiertes Lernen und bedarfsorientierte Lernangebote
4.2.3 Ein ICF-basiertes Förderziel
4.2.4 Der Transfer in konkretes Tun
4.2.5 Eltern als Teil des Teams: Die gemeinsame Arbeit
4.2.6 Das pädagogische Konzept
4.2.7 Strukturelle Voraussetzungen
4.3 Förderplanung an der inklusiven Schule nach ICF
4.3.1 Bedarfsanalyse
4.3.2 Zielformulierung
4.3.3 Qualitätssicherung, Überprüfung der Lernziele, Leistungsbeurteilung
4.4 Gelebte Praxis
4.5 Ein Blick über den Tellerrand: Die ICF im schulischen Kontext der Schweiz und in Österreich
5 Was kann die ICF anderes als bisher verwendete Tools?
5.1 Eine gleichberechtigte Sprache von schulischen Fachkräften, Eltern und anderen Experten
5.2 Die ICF als Brückenfunktion zwischen Unterstützungssystemen
5.3 Die ICF-Brücke zu den Eltern
5.4 Die ICF als Brücke zwischen kindlichen Fähigkeiten und Lehrplänen
6 Was braucht es bei der Anwendung der ICF im schulischen Kontext?
6.1 Der Weg zur Förderplanung mit ICF an einer inklusiven Schule – ein Praxisbericht
6.2 Strategieentwicklung
6.3 Training und Schulung
Literatur
Sachregister
1 Herausforderungen an inklusives schulisches Handeln
1.1 ICF und Inklusion
Das allgemeine Ziel der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (kurz ICF, WHO 2005) besteht darin,
„in einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheit und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen zur Verfügung zu stellen“ (Dimdi 2002, 8).
Für die Schule ist dabei vor allem die „Kinder- und Jugendversion“ (ICF-CY, WHO deutsch 2011) wichtig, „um die Besonderheiten des sich entwickelnden Kindes und den Einfluss seiner Umwelt aufzuzeichnen“ (WHO 2011, 9). Im Unterschied zur Erwachsenenversion steht in jener für Kinder und Jugendliche (CY) dabei auch im Vordergrund, dass Verzögerungen nicht dauerhaft sein müssen und dass Entwicklungen in hohem Maße durch physische als auch psychologische Faktoren der Umwelt beeinflusst werden. Beide Versionen werden in Zukunft zu einer gemeinsamen zusammengeführt werden, um Übergänge zwischen dem Kindes- und Jugendalter und dem Erwachsenenalter, d. h. zwischen Schule und Beruf, besser zu gewährleisten, indem vergleichbare Begriffe verwendet werden. Dies betrifft z. B. den Bereich des „Spiels“, der bislang in der Kinderversion eine andere (viel größere) Bedeutung im Sinne der aktiven Auseinandersetzung mit der „Welt“ an sich hatte als in der Erwachsenenversion. Dort wird „Spiel“ vor allem als Freizeitaktivität in Abgrenzung zu „Arbeit“ verstanden.
Die ICF bietet dabei eine gemeinsame und universelle Sprache, die sowohl interdisziplinär als auch international genutzt werden kann (WHO 2011). Damit wird erreicht, dass unterschiedliche Teammitglieder (Fachkräfte, Assistenzkräfte, Schulärzte, Schulpsychologen sowie Eltern bzw. Erziehungsberechtigte u.a.) sich durch eine gemeinsame Sprache verständigen können und somit Unterrichts- und Lernprozesse für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsschwierigkeiten besser koordinieren und im Team gestalten können. Durch ihren Fokus auf die Teilhabe, die Bedeutung der Entwicklungsumwelt und die Entwicklungspotenziale jedes Kindes bzw. Jugendlichen trägt die ICF auch dazu bei, inklusives Handeln von Fachpersonen in der Schule zu unterstützen. Als Fachpersonen in der Schule werden alle Berufsgruppen verstanden, die mit dem Kind oder der Familie arbeiten.
Sowohl im Rahmen inklusiver Theoriebildung als auch in der ICF geht es dabei um die Teilhabe von allen Kindern und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren in wichtigen Lebensbereichen. Dazu gehören das häusliche Leben in der Familie, der vorschulische Bereich, gemeinsame Aktivitäten mit Gleichaltrigen, die Berufsausbildung und somit auch die Schule. Dort findet die ICF als Beschreibungs- und Planungsinstrument für Unterrichts- sowie Unterstützungsprozesse Verwendung. Sie unterstützt Kinder mit einem Gesundheitsproblem – verstanden als übergeordneter Begriff, der unter anderem auch Behinderung miteinschließt – bestmöglich bei der Partizipation an jenen Prozessen, an denen alle anderen Kinder in der Schule teilhaben: Das betrifft das Lernen und den Unterricht, soziale Prozesse in der Gruppe der Gleichaltrigen, die Kommunikation mit den Fachpersonen bis hin zur Mobilität innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes, Selbstständigkeitsleistungen oder das Gemeinschaftsleben (z. B. bei Festen, Feierlichkeiten oder beim Sport). Die ICF versteht Partizipation dabei ganz allgemein als das „Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (WHO 2011, 16).
Im Rahmen einer Schule für alle Kinder ermöglicht die ICF in einem ersten Schritt, konkrete Teilhabeaspekte eines Kindes in der Schule zu beschreiben und in einem zweiten Schritt zu bewerten (z. B. inwiefern diese Teilhabe eingeschränkt sein könnte). Daraus können als konkreter praktischer Nutzen – in Abstimmung mit Lehrplänen – erforderliche Förderbedarfe bezogen auf Schule und Lernen abgeleitet und Unterstützungsleistungen koordiniert umgesetzt werden. Dadurch, dass sich die ICF auf alle relevanten Lebensbereiche eines Schulkindes bezieht, d. h. nicht nur auf Schule und Lernen, sondern auch auf die Familie, die konkrete Umwelt des Kindes oder auch andere Förder- und Therapieangebote, die außerhalb der Schule wahrgenommen werden, fällt es den Anwendern leichter, Förderbedarfe und auch Ressourcen situationsübergreifend, ganzheitlich und kooperativ wahrzunehmen bzw. im Team gemeinsam mit den Eltern zu definieren. Partizipation in der ICF bedeutet somit auch, dass Eltern und Kinder bzw. Jugendliche selbst als gleichwertige Partner in allen Prozessen inklusiven Handelns mitwirken. Beispiele hierfür liefern die Schweiz (Hollenweger / Lienhard 2011) oder auch das Erasmus+ Projekt „A common language“ (www.icf-school.eu, 08.01.2019).
Neben ihrer universellen Begrifflichkeit stellt die ICF auch ein komplexes Klassifikationssystem mit mehr als 1.400 Items dar, das sowohl auf Fachkräfte als auch auf Eltern im ersten Moment herausfordernd wirken könnte. Dies betrifft nicht so sehr den Aspekt der gemeinsamen Sprache mit den Fachpersonen im „Team um die Familie“, sondern häufig das zugrundeliegende System auf Basis der Vielzahl von Items bzw. Kodes. Demzufolge gehen oftmals Fachkräfte in der Schule und auch Eltern vorschnell und unbegründet davon aus, dass die verschiedenen Kodes das Wichtigste sind, um Teilhabe für Kinder und Jugendliche zu erfassen.
!
Die ICF ist nicht primär ein Kodierungssystem, sondern ein Kommunikationsinstrument für Menschen, die sich mit Teilhabe auseinandersetzen. Das betrifft im Kontext Schule und Lernen alle Beteiligten einschließlich der Kinder und Jugendlichen.
Fakt ist, dass die ICF in der Schule auch ohne den Bezug auf Kodes zielführend verwendet werden kann, wie einige internationale Beispiele (Kap. 4.1) zeigen werden.
Wozu aber nun diese umfassende Ausdifferenzierung und Kodierung? Fakt ist auch, dass die zugrundeliegenden Kodes vor allem verwendet werden können, um wissenschaftliche Begleitforschung, smarte Zielformulierungen, Evaluationsstudien oder internationale Vergleiche durchzuführen. Sie müssen aber keineswegs z. B. in sonderpädagogischen Gutachten, Förderplänen oder bei der inklusiven Planung von Unterricht und Lernen eingesetzt werden. Im Zentrum steht die gemeinsame Sprache zwischen verschiedenen Berufsgruppen, die dazu führt, dass alle Beteiligten auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können.
Auch Eltern äußern bisweilen Bedenken, ihre Schulkinder könnten durch die Anwendung der ICF auf ein reines „Kodesystem“ reduziert werden. Dieser Aspekt sollte unbedingt ernst genommen werden, da dies durch die ICF selbst nicht beabsichtigt ist. Genau das Gegenteil ist der Fall: Dadurch, dass die ICF die Lebenssituation eines Menschen mit einem Gesundheitsproblem äußerst individuell beschreibt bzw. eine Vielzahl spezifischer Kategorien verwendet, um Teilhabe zu beschreiben, haben Eltern in der Anwendung auch Vorteile und erhoffen sich von der detaillierten Hinwendung zu ihrem Kind durch die Items der ICF, dass Förderbedarfe und Rechtsansprüche betreffend inklusives Handeln besser dargestellt, dadurch leichter genehmigt und infolge erfolgreicher realisiert werden können (Pretis / Brandt 2018).
Indem sich Fachkräfte individualisiert den Bedürfnissen von Kindern mit einem Gesundheitsproblem oder mit Entwicklungsschwierigkeiten mittels ICF zuwenden, ist zu erwarten, dass Hilfebedarfe passgenauer erfasst werden können – und zwar sowohl die pädagogische Bildungsumwelt in der Schule als auch andere relevante Lebensbereiche betreffend. Dieser „individualisierte Blick“ auf die Lebenssituation eines Menschen mit einem Gesundheitsproblem / mit einer Behinderung mittels ICF führt mit einiger Wahrscheinlichkeit auch zu einer Ausweitung der Bedarfe, was von finanzpolitischen Entscheidungsträgern durchaus kritisch gesehen werden kann. Es kann aber auch davon ausgegangen werden, dass Synergieeffekte und eine erhöhte Transparenz für alle Beteiligten und Zuwendenden diese Ausweitungen kurzerhand ausgleichen. Die Verwendung der ICF stellt somit auch einen Beitrag zur Verfahrens- und Verteilungsgerechtigkeit von (schulischen) Ressourcen dar (Luder et al. 2007).
Da die ICF für alle Kinder gleichermaßen gilt und einsetzbar ist, d. h. nicht nur für Kinder mit einem Gesundheitsproblem, mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit, sondern auch in anderen wichtigen Umständen, die für das schulische Lernen eine Rolle spielen (z. B. Armut, Migration, plötzliche dramatische unvorhergesehene Ereignisse im Leben des Kindes), darf sie in hohem Maße als inklusiv gelten. Auch wenn im Alltag die ICF nach wie vor am häufigsten für Kinder mit Behinderung Anwendung findet, beschränkt sich ihr Einsatz jedoch nicht nur auf Menschen mit Behinderung:
„Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, die ICF gelte nur für Menschen mit Behinderung; tatsächlich kann sie jedoch aufalle[Herv. i. Orig.] Menschen bezogen werden. Mit Hilfe der ICF können der Gesundheitszustand und die mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände (Bildung und Erziehung, Selbständigkeit, Zugehörigkeit, Anmerkung der Autoren) in Verbindung mit jedem Gesundheitsproblem beschrieben werden. Mit anderen Worten, die ICF ist universell anwendbar“ (WHO 2011, 34).
Damit unterstützt die ICF auch eine Grundannahme inklusiven Handelns, dass Inklusion nicht teilbar sei. Begründet wurde dieses Prinzip der Unteilbarkeit als Menschenrecht im Unteilbarkeitspostulat der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz von 1993. Konzeptionell bedeutet dies, dass inklusives Handeln nicht zwischen (leicht) inkludierbaren Menschen und jenen, für die Inklusion nicht zutreffen mag und für die somit ein „separierendes“ bzw. „exkludierendes“ Sonder-/ Fördersystem innerhalb des Schulsystems zuständig wäre, unterscheidet. Dabei läuft die Inklusionsdiskussion auch Gefahr, nur auf Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten zu fokussieren. Im Sinne von Bildungsangeboten für alle Kinder betrifft inklusives Handeln auch z. B. Kinder mit Hochbegabung, mit Inselbegabungen, mit chronischen Erkrankungen oder mit der Notwendigkeit hochtechnisierter Apparatemedizin (z. B. Beatmungsgeräten).
„Inklusion umschreibt den Anspruch, allen Menschen unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder ethnischen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer religiösen und politischen Anschauung, ihrer Behinderung usw. die volle und gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen“ (Krowosch 2014, 26).
Ob konkrete Schulsysteme diese am Papier meist hoch sozial erwünschte Diversität bzw. De-Segregation in der Realität umsetzen können, bleibt dabei häufig offen (Hinz 2013). Als mögliche Hindernisse werden dabei angeführt:
■ Zweifel am Nutzen der Inklusion für alle Kinder im Regelschulsystem sowie
■ die Herausforderungen für die Fachkräfte.
Aus der Sicht der Fachkräfte mag die Inklusion eines Kindes mit einer leichten Lernbehinderung im Regelunterricht oder eines Kindes, das einen Rollstuhl zur Fortbewegung benötigt, „leichter“ sein als für ein Kind mit kognitiven und erheblichen Sinnesbeeinträchtigungen – um ein Extrembeispiel zu nennen, das auch in der Literatur (z. B. Feuser 2010) gerne erwähnt wird.
Grundsätzlich darf jedoch (mit einigen kleinen Ausnahmen z. B. Rechenleistungen typisch entwickelter Jungen in der Studie von Spence 2010) empirisch davon ausgegangen werden, dass inklusive Bildungssysteme nicht weniger erfolgreich sind als separierende – weder für Kinder mit Behinderung noch für typisch entwickelte (Pretis 2017). Kritisch und einschränkend muss dazu angemerkt werden, dass sich die vorhandene wissenschaftliche Literatur in hohem Maße am Konzept der „Integration“ und weniger an einem Modell der „Inklusion“ orientiert.
DEFINITION
Inklusives Handeln in der Schule bedeutet, dass Schule nicht-separierende Rahmenbedingungen schafft, Lernmöglichkeiten für alle Kinder organisatorisch zu ermöglichen.
Dies klingt auf „Papier“ einfach, mag jedoch in der Realität oftmals an organisatorische und ressourcenorientierte Grenzen stoßen: Die organisatorischen Möglichkeiten der Inklusion mögen zwar für Kinder mit schwerwiegenden komplexen Lernschwierigkeiten (in der Vergangenheit als „schwer mehrfach behindert“ bezeichnet) von einigen Autoren als „begrenzt“ eingeschätzt werden (Ackermann 2012); grundsätzlich geht dieses Buch jedoch im Sinne des Leitgedankens der ICF davon aus, dass sowohl das Bildungssystem an sich als auch seine Organisationsformen für alle Kinder verfügbar und zugänglich sein sollten.
Dabei geraten die Unteilbarkeit der Inklusion und das gleichzeitige Wahlrecht der Eltern auch in ein innewohnendes Spannungsfeld. Denn trotz genereller inklusiver Perspektive von Schulsystemen ist in den meisten Schulgesetzen auch ein Wahlrecht der Eltern verankert. D.h., ein (Wahl-)Recht auf Inklusion ins Regelschulwesen schließt auch ein Recht auf „Besonderung“ (im Sinne der Beibehaltung von Förder- oder Sonderbeschulung) mit ein. Dies führt paradoxerweise in einigen Ländern zum Dilemma, dass schulpolitisch alle „Sondereinrichtungen“ in einem absehbaren Zeitraum geschlossen werden (auch wenn dies noch kontrovers diskutiert wird), um ein inklusives Schulsystem für alle zu schaffen, sich jedoch gleichzeitig manche Eltern auch Sorgen machen, inwieweit die erlebten organisatorischen Möglichkeiten inklusiver Beschulung optimale Lern- und Fördermöglichkeiten für ihre Kinder darstellen. Das betrifft vor allem Fragen der sozialen Teilhabe und des Zugehörigkeitsgefühls in der Sekundarstufe, wobei empirisch nur zehn Prozent der Unterschiedlichkeit in Bezug auf soziale Akzeptanz durch Leistungsunterschiede der Kinder erklärt werden können (Huber / Wilbert 2012).
Sich zugehörig zu fühlen, kann jedoch z. B. für Kinder und Jugendliche mit herausfordernden Verhaltensweisen, AD(H)S oder mit Autismus-Spektrum-Störungen sehr schwierig sein. Paradoxerweise entstehen somit in der Hochblüte der Inklusionsdiskussion auch vermehrt (Sonder-)Zentren und (Privat-)Initiativen, die genau auf diese „Besonderung“ hinauslaufen (z. B. im Sinne von „Autismuszentren“, Privatschulen für Kinder mit AD(H)S).
Hervorzuheben ist, dass es (für Eltern) in den meisten Ländern zwar ein Anrecht auf Inklusion, jedoch keine Pflicht zur Inklusion gibt. Sarimski (2017) geht dabei noch einen Schritt weiter und reflektiert, ob es vor dem Hintergrund sehr kompetitiver-, konkurrenz- und leistungsorientierter Gesellschaftssysteme denn auch ethisch wünschenswert wäre, Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten in sogenannten „20-zu-80-Gesellschaften“ (Schuhmann / Martin 1998) zu inkludieren, in denen der Anteil der Globalisierungsverlierer mehr als vier Fünftel unserer Gesellschaft darstellen könnte.
Die ICF selbst kennt keine Unterscheidung zwischen inkludierbaren oder nicht-inkludierbaren Schülern. Vielmehr geht sie davon aus, dass für jedes Kind ein persönliches individuelles Fähigkeitsprofil in Bezug auf seine konkrete Umwelt erstellt werden kann, auf dessen Basis Unterricht und Förderung beschrieben, geplant, durchgeführt und evaluiert werden können. Das jeweilige Setting (inklusive Krippe, KITA, Schule, Lehrstelle …) stellt dabei den notwendigen Ressourcenrahmen dar, d. h., um die Förderbedarfe eines jeden Kindes sollte die notwendige förderliche „Umwelt“ „gebastelt“ werden. Wie in Kapitel 2.2.3 noch detailliert beschrieben wird, steht dies auch in unmittelbarem Zusammenhang damit, dass die ICF auf einem neuem Verständnis von Behinderung beruht – und zwar auf einem Interaktionsmodell zwischen einer Person und ihrer Umwelt in der jeweiligen Situation.
Indem der Stellenwert der Entwicklungsumwelt für Kinder in der ICF besonders hervorgehoben wird, versteht das vorliegende Werk Inklusion vor allem als eine dem System innewohnende Fähigkeit (im gegenständlichen des Schulsystems), Erziehungs- und Bildungsangebote für alle Kinder zu ermöglichen (Pretis 2014; 2017).
Schulische Inklusion wird bisweilen als eine Zugabe verstanden, indem einem Kind mit Hilfebedarf kompensatorische Assistenzleistungen zur Seite gestellt werden. Dabei ist bisweilen zu beobachten, dass Assistenzkräfte Aufträge erhalten, ein Kind in dem Sinne „für den Unterricht fit zu machen“, es vorzubereiten, den pädagogischen Anforderungen in der Schule nachkommen zu können (z. B. das Kind anzuleiten, seine Schulsachen vorzubereiten, individuelle Hilfestellungen zu geben, damit das Kind Anforderungen erfüllt, oder es in seiner Verhaltenskontrolle zu unterstützen). Die Abgrenzung zu pädagogischen Aufgaben, für die sich Fachpersonen verantwortlich zeichnen, ist dabei nicht immer eindeutig. Wo enden Assistenzleistungen und wo beginnt Unterricht? Auch spiegeln diese in der KITA und der Schule gerne in Anspruch genommenen Assistenzleistungen weniger inklusives Handeln wider als viel mehr integratives, da durch persönliche Assistenz ein Kind „fit“ gemacht werden sollte. Wie wäre sonst der rasante Anstieg von leistungsberechtigten Kindern von durchschnittlich neun Prozent im gesamten Altersbereich von null bis achtzehn Jahre auf siebzehn Prozent zwischen fünf und neun Jahren zu erklären (Land Steiermark 2017)? D.h., die meisten der eingesetzten Assistenzkräfte wirken integrativ, indem sie (meist einzeln und als persönlicher Auftrag) das Kind fördern und nicht das Gesamtsystem inklusiv machen. Dabei erscheint die Unterscheidung zwischen „Integration“ und „Inklusion“ für viele Menschen wenig trennscharf und stellt so manches Fragezeichen in den Raum. Personbezogene Assistenzleistungen stellen in hohem Maße einen integrativen Ansatz dar, da die Leistung, die eine Person bekommt, einem Gesundheitsproblem dieser Person zugeordnet wird. Möglicherweise unterstützen auch die meisten gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen solchen integrativen Ansatz, da im Regelfall individuelle Unterstützungsleistungen einer Person oder einem Kind individuell aufgrund eines Gesundheitsproblems (bescheidmäßig) zuerkannt werden. Inklusives Handeln würde im Vergleich dazu bedeuten, dass die Schule selbst Unterstützungsressourcen als System zur Verfügung stellt, um infolge alle individuellen Lern- und Bildungsbedürfnisse von Kindern abdecken zu können.
Inklusion wird somit nicht zur Leistung des einzelnen Kindes, sich an den Unterricht oder die Lernumwelt „Schule“ anzupassen (oder dies mittels Assistenz zu ermöglichen), sondern Inklusion würde bedeuten, dass Schule bauliche Maßnahmen, Assistenz, materielle technische Ausstattung, Fortbildung etc. selbstverständlich zur Verfügung stellt, ohne auf ein spezielles Kind zu fokussieren und erst im konkreten Anlassfall aktiv zu werden. Die Assistenzkraft wäre für alle Kinder und Anlässe verfügbar, die Lerncomputer könnten individuell für alle Kinder eingesetzt werden, Lern- und Übungsangebote stünden allen Kindern individuell zur Verfügung und technische Adaptierungen (z. B. visuelle Symbole) würden – wenn diese den Bedürfnissen entsprechen – von allen Kindern genutzt werden. Tabelle 1 stellt diesen konzeptionellen Unterschied zwischen integrativen und inklusiven Ansätzen an einigen Beispielen dar, wobei der Ausgangspunkt das jeweilige Teilhabebedürfnis des Kindes ist.
Tab. 1: Unterschiede integrativer und inklusiver Ansätze in der Schule unter Berücksichtigung von ICF-Teilhabezielen
Teilhabebedürfnis (nach ICF)
integrativer Ansatz
inklusiver Ansatz
notwendige Ressourcen / Voraussetzungen
am Unterricht teilhaben
persönliche Assistentin bereitet den Arbeitsplatz für das Kind vor; unterstützt bei der Vorbereitung der Schulsachen (z. B. die Unterlagen an der richtigen Stelle aufschlagen)
Unterricht wird so gestaltet bzw. werden Arbeitsaufträge so gegeben, dass dies für alle Kinder umsetzbar und verständlich ist (verbal, mit Symbolen, schriftlich usw.); Assistenzperson unterstützt Fachperson
gleiche Ressourcen, aber Fachpersonen sind verantwortlich für den inklusiven gemeinsamen Unterricht aller Kinder in der gesamten Klasse; dieses Auftragsverständnis basiert auf der inklusiven gesetzlichen Auftragslage
Rechnen lernen
Eine speziell dafür ausgebildete Fachkraft widmet sich einem Mädchen mit Rechenschwäche im Rahmen individueller Förderstunden.
Eine speziell dafür ausgebildete Fachkraft unterstützt das Rechnenlernen im gemeinsamen Unterricht, bereitet mit der Fachperson in der Schule individuelle Aufgaben für alle Kinder vor (d. h. auch z. B. für Kinder mit Hochbegabung).
gleiche Ressourcen wie im integrativen Setting;
Kooperation;
Verfügbarkeit differenzierter Unterrichtsmaterialien;
methodisches
Wissen der Fachpersonen über individualisierte Lernformen der einzelnen Kinder;
Möglichkeit der inneren Differenzierung des Unterrichts oder der Anwendung individualisierter Lehrpläne
mit anderen Kindern während der Pause kommunizieren
Eine Fachkraft / Assistenz wird dem Kind „zur Seite“ gestellt, um sein Verhalten „zu kontrollieren“.
Die Schule organisiert die Pausengestaltung und regelt das Verhaltensmanagement für und gemeinsam mit allen Kindern mit Unterstützung der Fachkraft / Assistenz.
„Umschichten“ der Ressourcen in Richtung gemeinsamen Tuns mit allen / vielen Kindern;
methodisches Wissen der Assistenzkraft (= Ausbildung)
Schwimmen lernen und Erfahrung im Wasser sammeln
Ein Junge mit Zerebralparese kann am Schulschwimmkurs teilnehmen, wenn eine Assistenzperson für ihn anwesend ist.
Alle Kinder können im Schulschwimmkurs teilnehmen, weil eine Assistenzperson für die Schule vorhanden ist.
Oder alle Kinder können im Schulschwimmkurs teilnehmen, weil alle / viele Eltern sich bereit erklären, beim Schwimmkurs zu assistieren.
erhöhte Ressourcen aufgrund einer generell verfügbaren Assistenzkraft
oder
gemeinwohl- / sozialraumorientierte Ansätze mit Freiwilligendiensten (unter Berücksichtigung von Haftungsaspekten)
Was bedeutet dies? Unabhängig davon, ob ein Kind mit Kleinwuchs, mit anderer Erstsprache als der Bildungssprache Deutsch, mit Down Syndrom, mit Zerebralparese, mit einem alleinerziehenden Elternteil, aus einem sozialen Brennpunkt, mit mathematischer Hochbegabung, mit spezifischem Interesse an Dinosauriern oder Autokennzeichen oder mit einem Beatmungsgerät die Schule besucht, bedeutet Inklusion, dass das System Schule für alle diese Kinder Lern- und Bildungsmöglichkeiten selbstverständlich und qualitätsvoll ermöglicht. D.h., Schule ist inklusiv gedacht, wenn es das Schulsystem ermöglicht, dass alle Kinder willkommen sind und dass sich in einem zweiten Schritt das System „Schule“ damit auseinandersetzt, mit welchen Unterstützungsmitteln, Ressourcen, baulichen Maßnahmen oder Anpassungen des Lehrplanes Unterricht für alle Kinder möglich ist. Ob es wirtschaftlich möglich ist, Schulen bzw. Gemeinwesen so zu gestalten, bleibt offen. Studien über notwendige Investitionen in Inklusion liegen 2019 kaum vor. Brito et al. (2017) beleuchteten im Auftrag der WHO und UNICEF Fragen notwendiger Ressourcen verstärkt unter dem Aspekt der Kosten der Inaktivität (d. h. wenn eine inklusive Weiterentwicklung nicht vorangetrieben wird) und bezeichnen dies als Verlust an Entwicklungspotenzial (Engle et al. 2007). Auch wenn MacBeath et al. (2006) versuchen, die Kosten der Inklusion in englischen Schulen zu berechnen, stellen sie dennoch gleichzeitig fest, dass es nicht die einzelne Schule sein sollte, die für „Inklusion“ kämpft, sondern dass Inklusion nur in einem Ambiente der Zusammenarbeit wachsen kann. Banks und Polack (2013) heben in ihren Analysen von 87 Studien hervor, dass sich bei einer lebenslangen Gesamtprävalenz von Behinderung von 15 Prozent der Bevölkerung ein deutlicher Zusammenhang zwischen Armut und Behinderung zeigt. Frühe Entwicklungsprobleme gehen nicht nur mit Stigmatisierung und sozialem Ausschluss (z. B. vom Arbeitsmarkt) einher, sondern auch langfristig mit Armut, sodass sich auch in der nächsten Generation dieser Teufelskreis zu wiederholden droht. Generell zeigt sich jedoch auch, dass sowohl der (ökonomische) Nutzen von Inklusion oder die Kosten von Inaktivität bislang kaum erhoben wurden. Somit bewegt sich die Diskussion um die konkreten Effekte der Inklusion (im Vergleich zu integrativen Ansätzen) noch auf einer sehr „dünnen“ Datenlage, sodass eher einstellungsbezogene Grundsatzdiskussionen geführt werden als konkrete Umsetzungsfragen, inwieweit Inklusion (im Vergleich zur Integration) für Kinder und deren Familien einen Unterschied macht. Vielleicht ist es aufgrund der kurzen Zeitspannen – die UN-Behindertenrechtskonvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde in Österreich 2008, in Deutschland 2009 und in der Schweiz 2014 ratifiziert, auch noch zu früh, konkrete Unterschiede messbar zu machen.
Dies führt zu einer weiteren unabdingbaren Voraussetzung für Inklusion: Schule benötigt Ressourcen, um Inklusion lebbar zu machen, und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass finanzpolitisch Inklusion nicht günstiger wird als Integration. Damit ist wiederum die direkte Verbindung zur ICF hergestellt, da der Aspekt der individuellen Umwelt als Ressource oder Barriere des Kindes vor allem hinsichtlich der Förderplanung ein äußerst wichtiges Kriterium darstellt.
Ersichtlich aus dieser kurzen Übersicht von Herausforderungen und Voraussetzungen ist, dass inklusives Handeln im Regelfall nicht alleine durch eine Lehrperson in der Schule umgesetzt werden kann (Pickl et al. 2015). Es wird üblicherweise ein Team brauchen, das die unterschiedlichen Lern- und Bildungsbedürfnisse von Schulkindern wahrnehmen und abdecken kann, wobei auch darauf hinzuweisen ist, dass vor allem die Eltern ein Teil dieses inklusiven Teams sein müssen.
BEISPIEL
Jürgen (sieben Jahre; Frühgeburtlichkeit und Shunt-Operation, interner Hydrozephalus, Tetraparese, expressive Sprachentwicklungsverzögerung und Lernschwierigkeiten) besucht eine inklusive Schule in einer Kleinstadt. Er wird täglich mit einem Taxidienst zur Schule gebracht, dort von anwesenden Fachkräften mittels Rollstuhl über die Schulrampe in seine Klasse im Parterre gebracht. Eine Stützlehrerin ist für vier Stunden in der Woche in der Klasse anwesend, um gemeinsam mit der Fachkraft Lernprozesse für alle Kinder zu fördern. In einzelnen Sequenzen (das betrifft das Lesen von Einzelwörtern) sucht die Stützlehrerin dabei mit zwei anderen (typisch) entwickelten Kindern und Jürgen ein anderes Klassenzimmer auf. In der Pause helfen die anderen Kinder Jürgen, ihn auf ein Stehbrett zu stellen, damit er auf Augenhöhe mit anderen Kindern beim Spielen interagieren kann. Eine weitere Assistenzkraft für pflegerische Belange (Toilettengang) steht stundenweise für die Klasse zur Verfügung. Eine Ergotherapeutin kommt einmal wöchentlich in die Schule und führt mit allen Kindern graphomotorische Übungen durch. Vierzehntägig erhält Jürgen Physiotherapie in einer privaten physiotherapeutischen Praxis. Die Therapeutin wohnte einigen Besprechungen in der Schule bei, häufig erfolgt die Kommunikation jedoch über Telefon, teilweise über Konferenzschaltung. Handling und die Förderung graphomotorischer Kompetenzen sind aufeinander abgestimmt. Die Mutter trifft sich einmal im Monat mit dem Team in der Schule. Jürgen, der sich durch seinen Zwischenfersensitz und Sitzrutschen im Schulgebäude fortbewegt, genießt den Unterricht und die Kontakte mit den anderen (typisch) entwickelten Kindern. Die Lehrplananforderungen sind für Jürgen individuell angepasst (der Bescheid zu seinem sonderpädagogischen Förderbedarf liegt vor, weiterhin haben die Eltern zugestimmt, Gutachten sowie pädagogische Empfehlungen an die Schule weiterzugeben, die im Zuge des Feststellungsprozesses eingeholt bzw. erstellt worden sind). Falls es Probleme mit seinem Shunt geben sollte, ist die Fachkraft in der Klasse und die Schulärztin über ein Notfallprozedere informiert. Trotz seiner komplexen und tiefgreifenden Lernschwierigkeiten dürfen die schulischen inklusiven Bemühungen als geglückt angesehen werden, da die einzelnen beteiligten Helfersysteme koordiniert vorgehen und gemeinsame Lern- und Förderziele definiert haben:
– Im Sinne seiner Teilhabe, Geschriebenes lesen und verstehen zu können, besteht ein Unterrichts- / Förderziel darin, dass Jürgen in der Lage ist, einsilbige Wörter zu lesen.
– In Bezug auf ein weiteres Teilhabeziel (den Umgang mit schriftlichen Symbolen) ist Jürgen in der Lage, einfache Formen nachzuzeichnen.
– Im Sinne seiner Selbstständigkeit (als Teilhabe) ist Jürgen in der Lage, sprachlich mitzuteilen, wann er die Toilette aufsuchen möchte.
Die Situation von Jürgen stellt einen Glücksfall dar, da alle Beteiligten sowohl miteinander kommunizieren wollten, einander Respekt entgegenbrachten und auch die notwendigen Ressourcen bereitstellten, um sich auszutauschen und die Unterstützung zu koordinieren. Die Frage der Ressourcen betrifft dabei in der Schule vor allem andere Fachkräfte aus dem Privatsektor. Im Falle Jürgens darf mit einiger Wahrscheinlichkeit auch davon ausgegangen werden, dass die inklusiven Bemühungen der Regelschule ökonomisch günstiger waren als eine Sonderbeschulung in einer Förderschule.
Dass sich Fachpersonen in der Schule häufig als Einzelkämpfer erleben, mag daran liegen, dass bisweilen Teammitglieder und die Familie schwer fassbar sind, dass die Kommunikation mit vor allem externen Teammitgliedern herausfordernd ist oder dass Fachpersonen manchmal erleben, dass notwendige Teamressourcen kaum verfügbar und schulische sowie familiäre Zeitabläufe gegenläufig zueinander sind.
!
Schulische Inklusion ist eine Eigenschaft des Systems Schule und nicht eine Leistung des Menschen mit einem Gesundheitsproblem. Schulische Inklusion stellt ein Recht für die Eltern dar, keine Pflicht. Inklusion ist nicht teilbar und benötigt Ressourcen.
1.2 ICF und Inklusion erfordern Teamwork
Wie die komplexe Situation von Jürgen verdeutlicht, basieren Systeme, die Erziehungs- und Bildungsangebote für alle Kinder vorsehen, meist auf der Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachleute: Im Regelfall betrifft das neben Fachkräften in der Schule Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Sozialarbeiter, Assistenzkräfte bis hin zum Busfahrer oder Nachbarn. Auch die ICF ist für die Arbeit in interdisziplinären Teams entwickelt. Dabei geht es um Fachpersonen in klinischen Settings, in der Pädagogik, Gesetzgebung und Forschung sowie um Angehörige und Betroffene, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten.
Sowohl die Verwendung der ICF als auch inklusives Handeln basieren im Regelfall somit auf der Zusammenarbeit unterschiedlicher Menschen, um die Entwicklungspotenziale von jungen Menschen mit Entwicklungsschwierigkeiten bzw. die Lebensqualität von Familien zu fördern. Trotz der Vielzahl von unterschiedlichen Definitionen von Teamwork aus den verschiedenen Perspektiven aller Beteiligten eines Teams um ein Kind ist Teamarbeit grundlegend in hohem Maße eine lösungsorientierte koordinierte Zusammenarbeit unterschiedlicher Menschen zur Erreichung eines Zieles (Hackman 2002). Im Regelfall reicht es nicht aus, wenn nur eine Fachkraft versucht, die komplexen Bedürfnisse eines Kindes mit Entwicklungsschwierigkeiten abzudecken. Im besten Fall stellt die Schule einen gemeinschaftlichen Bezugsrahmen um das Kind bzw. die Familie dar. Dieser beinhaltet, dass für die Fachkraft in der Schule Kommunikation zu den Eltern besteht – unter Wahrung des Datenschutzes – zur Hausärztin, möglicherweise zur behandelnden Physiotherapeutin, wenn notwendig zur zuständigen Sozialarbeiterin des allgemeinen Sozialen Dienstes, aber eventuell auch zu weiteren Fachkräften, die mit dem Kind zu tun haben (z. B. Freizeitassistenten, Logopäden und Psychologen). Dazu können auch noch schulinterne Teammitglieder (z. B. Beratungslehrer, Hörgeschädigten- oder Blindenpädagogen im mobilen Dienst, Schulsozialarbeiter, Schulärzte oder -psychologen) kommen. Wie die Aufzählung verdeutlicht, ist es im Einzelfall durchaus möglich, dass das Team um das Kind bzw. die Familie unzählige Fachpersonen inklusive freiwillige Helfer bzw. Bezugspersonen umfasst, sodass Koordination dringend notwendig erscheint.
Der Begriff der „Teamarbeit“ selbst ist zwar äußerst positiv konnotiert (es wird kaum eine Fachkraft in der Schule, in der Klinik oder am Jugendamt geben, die nicht im Team arbeitet), gleichzeitig bleibt offen, was die einzelnen Teammitglieder unter Teamarbeit verstehen. Auch die wissenschaftliche Diskussion mag für manche Fachkräfte in der Schule verwirrend sein: Es ist teils von „multidisziplinären“, „interdisziplinären“ oder „transdisziplinären“ Team die Rede.
Abbildung 1 versucht, die konzeptionellen Unterschiede zu vereinfachen. Wichtig erscheint, dass im interdisziplinären Team Fachkräfte Aktivitäten koordinieren und dann meist „parallel“ arbeiten. Wenn ein Kind mit Verhaltensproblemen (auf Wunsch der Fachkraft in der Schule) auch die schulpsychologische Beratungsstelle aufsucht und dort im besten Fall Behandlung oder die Eltern Beratung erfahren, entspricht dies in hohem Maße einem interdisziplinären Team.
Abb. 1: Konzeptionelle Unterschiede zwischen multi-, inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit
Wenn sich der Schulpsychologe gemeinsam mit den Eltern und der Fachkraft, möglicherweise auch der Schulsozialarbeiter und dem Schularzt austauschen und beraten, wie eine gemeinsame Strategie entwickelt werden kann und die Eltern ein unverzichtbarer Bestandteil dieses Teams sind, dann spricht man von einem „transdisziplinären“ Team. Die terminologischen Unterscheidungen mögen jedoch für den schulischen Alltag wenig relevant sein.
Ein transdisziplinäres Team zeichnet sich durch gemeinsame Planungsarbeit und gemeinsame Umsetzungsarbeit aus (Pretis 2004). In solch einem Team, in dem vor allem die Eltern eine Hauptrolle spielen, werden Aufgaben nicht mehr primär den Fachkräften zugeordnet, sondern unter Anleitung einer jeweiligen Fachkraft gelingt es auch anderen Berufsgruppen, Lernaktivitäten und Fördermaßnahmen umzusetzen. Dies bedeutet z. B., dass auch die Fachpersonen in der Schule Basiskenntnisse physiotherapeutischen Handlings durch die behandelnde Physiotherapeutin vermittelt bekommen, dass die behandelnde Ärztin eine Grundidee über Lehrplanerfordernisse und methodische Vorgehensweisen z. B. bei einem Kind mit fetalem Alkoholsyndrom hat. Eine solche transdisziplinäre Zusammenarbeit ist im Rahmen von Team-Teachingprozessen meist leichter möglich als im Bereich von Maßnahmen, die zeitlich und örtlich voneinander getrennt sind. Bei Letzteren wird die Koordination der durchgeführten Maßnahmen in hohem Maße von der Fähigkeit abhängen, inwiefern sich die Fachleute untereinander austauschen können und gegenseitig respektieren.
Generell darf darauf hingewiesen werden, dass ein solch transdisziplinäres Vorgehen im Regelfall für ein Kind oder eine Familie drei bis vier Förderziele für einen definierten Zeitraum (z. B. ein halbes Jahr) ermöglichen. Alles andere erscheint im Regelfall sowohl für die Fachpersonen als auch die Eltern und die Kinder organisatorisch und gedächtnispsychologisch überfordernd. Der Vorteil eines solchen transdisziplinären Vorgehens besteht darin, dass die Eltern koordiniertes Vorgehen erleben, dass alle Fachkräfte gemeinsam an vereinbarten Zielen arbeiten und dass im Regelfall Informationsflüsse sehr viel einfacher und zielorientierter ablaufen. Wenn die Fachkräfte dann noch die ICF verwenden im Sinne von spezifischen Kodes, ist auch gewährleistet, dass sie über das Gleiche sprechen.
Gemeinsames Planen und Handeln kostet im Regelfall Zeit. In der Frühförderung werden – nachdem meist fachspezifische diagnostische Verfahren durch Ärzte, Psychologen, Therapeuten und Frühförderinnen durchgeführt wurden, z. B. zur koordinierten Förder- und Behandlungsplanung unter Verwendung der ICF meist zwei Stunden Zeit verwendet (Pechstädt / Svaton 2016). Neben dem durchaus deutlichen Aufwand in Bezug auf Koordination und Ressourcen zeigt sich aber auch, dass koordinierte Teamarbeit im Regelfall Eltern entlastet. Sie haben das Gefühl, dass Fachkräfte einander verstehen und koordiniert für das Kind und die Familie vorgehen. Koordinierte Teamarbeit kann im Regelfall auch ressourcenschonend wirken, wenn Informationen nicht mehrmals hintereinander extra erhoben werden müssen. Vor allem anamnestische Informationen betreffend ist das auch in der Schule häufig zu beobachten: Die Fachkraft erhebt Informationen, parallel dazu die Stützlehrerin sowie z. B. die Physiotherapeutin in ihrer privaten Praxis. Wenn Eltern das Gefühl haben, dass Fachkräfte in der Schule koordiniert vorgehen, wirkt sich dies im Normalfall auch positiv auf ihr Stressniveau aus. Diese Koordination von verschiedensten Aktivitäten führt auch dazu, dass Familien z. B. höhere Lebensqualität, schnelleren und besseren Zugang zu Services und reduzierten Stress schildern (Shelden / Rush 2013). Dies führt auch im Regelfall dazu, dass sich Familien besser informiert fühlen. Dabei zeigen sich durchaus auch positive ökonomische Aspekte: Gemeinsame diagnostische Prozesse benötigen weniger Gesamtzeit (Myers et al. 1996