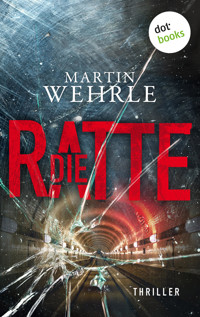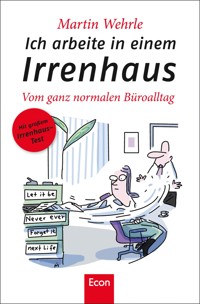
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In deutschen Betrieben herrschen haarsträubende Zustände – ob in mittelständischen Unternehmen oder großen Konzernen, die zunehmend zu geschlossenen Anstalten mutieren. Tyrannische Chefs pflegen ihre Marotten. Statt über Sachfragen zu diskutieren, werden in endlosen Meetings Machtkämpfe ausgefochten. Absurde Arbeitsabläufe sind fast schon die Regel. Der renommierte Karrierecoach Martin Wehrle liefert einen schonungslosen Bericht aus dem Katastrophengebiet Büro. Anhand eines Tests kann der Leser herausfinden, wie sehr der Wahnsinn in seiner Firma das Zepter schwingt. Wehrle gibt zudem anschauliche Tipps, wie Sie den Bürowahnsinn überleben und irren Arbeitgebern durch ein Frühwarnsystem aus dem Weg gehen. Ein Buch für alle, die Tag für Tag wahnwitzige Arbeitsbedingungen zu ertragen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Martin Wehrle
Ich arbeite in einem
Irrenhaus
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie
etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder
Übertragung können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
5. Auflage 2011
Econ ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
ISBN 978-3-8437-0135-8
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten
Illustrationen:© Dirk Meissner
TEIL EINS
EinleitungDie Spuren des Irrsinns
Was deutsche Firmen anpacken, das packen sie gründlich an. Ihre Arbeit gilt als präzise, auf den Millimeter. Ihre Termintreue gilt als legendär, auf die Sekunde. Und ihnen wird immer noch so viel Seriosität zugeschrieben, dass einige Kunden den Mann hinterm Bankschalter als »Schalterbeamten« bezeichnen, auch wenn er nicht für den Staat arbeitet, sondern für eine moderne Zockerbande.
Doch eines fällt auf. Der Ruf der deutschen Firmen ist umso besser, je weiter man sich aus Deutschland entfernt. Am besten auf andere Kontinente. Wer in Fernost den Namen einer deutschen Weltfirma nennt, zaubert Glanz in die Augen seines Gesprächspartners. Dagegen kann es in Deutschland passieren, dass der andere nur die Augen verdreht. Vielleicht ist er ja Mitarbeiter dieser Firma. Und kennt die ganze Wahrheit!
Wenn Mitarbeiter auspacken, bröckeln die Fassaden deutscher Unternehmen. Scheinbar seriöse Firmen, mit Namen wie Gütesiegeln, entpuppen sich als Blindgänger, als Geldvernichter, als lächerliche Chaostruppen. Die Vernunft hat zum Firmengelände keinen Zutritt – der Irrsinn sehr wohl.
Wie ich zu dieser Aussage komme? Ich bin Karriereberater. Wer mich bucht, will offen über seine Firma reden – über Zustände, Missstände und Abgründe. Über das, was er im Alltag runterschluckt, statt es rauszubrüllen, was er in seiner Firma sieht, aber nicht gesehen haben darf: All diesen Irrsinn packt er im Beratungsgespräch aus. So entsteht ein ungeschminktes Bild seiner Firma, eine Innenansicht, die jeder Werbeagentur die Haare zu Berge stehen ließe.
Wie oft habe ich schon gedacht: »Völlig irre, was in deutschen Firmen läuft! Das sollte die Öffentlichkeit einmal wissen.« Zeit für dieses Buch! Hier habe ich haarsträubende Erlebnisse von Mitarbeitern versammelt und zeige die Unternehmen von einer Seite, die in der Imagebroschüre aus gutem Grund fehlt: von der Innenseite.
Wenn Sie bislang dachten, nur Ihre Firma sei ein Irrenhaus – Sie werden sich die Augen reiben. Denn die meisten Unternehmen in Deutschland gibt es zweifach: in der Außendarstellung, wie sie gerne wären – und in der Innenansicht, wie sie wirklich sind. Verschleiert von Hochglanzbroschüren, ausgelassen in Geschäftsberichten, schöngeredet von Managern, tobt sich hinter vielen Firmenmauern der reinste Irrsinn aus.
Die Firmen sind nicht mit den Märkten, sondern mit sich selbst beschäftigt: Konzerne gleichen Kindergärten. Mittelständler pflegen Mittelmaß. Familienbetriebe bräuchten Familientherapie. Die Führung kommt als Verführung, der Vertrieb als Kundenvertreibung, die Gemeinschaft als Gemeinheit daher.
Diesen alltäglichen Irrsinn hinter Firmenmauern kennen nur die Mitarbeiter. Sie erleben ihre Firma, wie sie keiner kennt – als Käfig voller Narren, als Irrenhaus GmbH. Nach einer Umfrage der Internet-Jobbörse StepStone »schämen« sich 50 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland für ihren Arbeitgeber.1
Man kann die Firmen mit Restaurants vergleichen. Es gibt den Speiseraum, wo die Gäste dinieren, die Kunden hofiert werden, das Personal freundlich ist. Aber die eigentliche Arbeit passiert hinter den Kulissen: in der Küche. Kein Außenstehender bekommt mit, wie viele Teller am Boden zerschellen, wie viele Pfannen in Flammen aufgehen und ob der Küchenchef in die Suppe spuckt. Dieses Gesicht – das wahre Gesicht einer Firma – ist in der Speisekarte nicht enthalten. Nur das Personal sieht es.
Wer in einer Küche arbeitet, nimmt den Geruch der Speisen an. Wer in einem Irrenhaus arbeitet, auf den kann der Irrsinn abfärben. Das fängt an mit kleinen Marotten, etwa indem ein Mitarbeiter seinen tyrannischen Chef imitiert, und hört auf mit gesundheitlichen Katastrophen. Nie war die Zahl der psychischen Erkrankungen unter deutschen Arbeitnehmern so hoch wie heute; ihr Anteil hat sich von 1990 bis 2008 verdoppelt. Als Gründe gelten: irrer Stress und irrsinnig wenig Anerkennung.2
Die Unternehmen, Tretmühlen von einst, sind die Klapsmühlen von heute geworden. Was in diesen »geschlossenen Anstalten« vorfällt, wie es zur Einweisung der Insassen kommt und welche Zwangsjacken gängig sind – diese Abgründe werde ich für Sie ausleuchten.
Im ersten Teil des Buches stelle ich Ihnen »Einen Käfig voller Narren« vor und erkläre die heimliche Irrenhaus-Ordnung. Sie werden erleben, wie der »Irrsinn in XXL« die Konzerne regiert, wie der »vererbte Wahnsinn« den Mittelstand ruiniert und wie schäbige Wahrheiten mit grellen Imagelügen überpinselt werden.
Im zweiten Teil können Sie mit einem »großen Irrenhaus-Test« prüfen, wie durchgeknallt Ihre Firma wirklich ist. Und Sie bekommen Wege aufgezeigt, wie Sie diesen Irrsinn hinter sich lassen. Ein »Frühwarnsystem« sorgt dafür, dass Sie künftig durchgeknallte Firmen meiden.
Machen Sie sich auf ein irres Buch gefasst, auf Katastrophenberichte aus einem Krisengebiet namens Unternehmen. Einiges ist so dumm, dass man heulen könnte; anderes so schräg, dass man einfach lachen muss. Und auf jeder Seite dieses Buches kann Ihnen eine alte Bekannte begegnen: Ihre Firma.
P.S. Schreiben Sie mir gerne, welche Blüten der Irrsinn in Ihrer Firma treibt und wie Sie über dieses Buch denken. Sie erreichen mich über meine Homepage www.karriereberater-akademie.de
1.
Gestatten, Irrenhaus GmbH!
Sie wollten doch unbedingt wissen, wie dick Ihr Fell noch werden muss, um hier auf Dauer zu arbeiten!
Der neue Mitarbeiter will wissen: »Wie tickt die Firma?« Der Erfahrene fragt sich eher: »Tickt sie noch richtig?« Dieses Kapitel verrät Ihnen …
• an welchen vier Symptomen Sie ein Irrenhaus erkennen,
• in welchen Phasen der Irrsinn in einer Firma wächst,
• wie der Geiz in einem Konzern zur Hungersnot führte
• und warum Erich Honecker eines Abends nicht ganz zufällig fünf Hirsche erlegte.
Ich heirate eine Firma
»Wir sind der Meinung, dass …« Wenn ein Mitarbeiter die Wir-Form verwendet, dürfen Sie sicher sein: Er spricht für sein Unternehmen. Wie der Fan mit seinem Verein verschmilzt (»Wir haben gewonnen!«) und die Mutter mit ihrem Baby (»Wir löffeln unseren Brei!«), so wird der Mitarbeiter mit seiner Firma eins. Er spricht nicht in der dritten Person, nicht mit Distanz, sondern ergreift stellvertretend das Wort. Die Firma ist er. Und er ist die Firma.
Und so geschieht ein kleines Wunder: Einem einzelnen Menschen, der eigentlich nur über ein Gehirn verfügt, wachsen dreitausend Köpfe (falls das Unternehmen so viele Mitarbeiter hat). Sein Jahresumsatz schießt von 40000 Euro auf 4 Milliarden in die Höhe (falls seine Firma so viel Geld macht). Er ist nicht mehr Hans Müller, nicht mehr Lisa Schulz – er ist Teil von etwas Größerem. Ist Daimler. Ist Microsoft. Ist Porsche. Und tritt auch so in seinem Freundeskreis auf.
Er ist bedeutend.
Welche Sogwirkung dieses »Wir« hat, erlebe ich in der Karriereberatung: Nach fünf Tagen in einer neuen Firma sagt der Mitarbeiter noch: »Die wollen ein neues Produkt einführen!« Doch bereits nach zwei Wochen heißt es: »Unser neues Produkt kommt voran.« Der Mitarbeiter verschmilzt mit der Firma wie ein Zuckerwürfel mit dem heißen Kaffee. Eine solche Vereinigung ist durch nichts in der Welt rückgängig zu machen, nicht mal durch eine Kündigung.
Einer meiner Klienten war Manager bei einem Chemiekonzern und wurde mit einer Abfindung vom Hof gejagt. Doch noch heute, fünf Jahre später, ist seine Distanz zum ehemaligen Arbeitgeber gleich null. Er spricht von »unserem Aktienkurs«, »unserer Produktlinie«, und es fehlt nur noch, dass er seine eigene Entlassung bald als »unsere weise Personalentscheidung« bezeichnet.
Neulich habe ich ihn auf diese Tatsache angesprochen: »Mir fällt auf, dass Sie immer noch ›wir‹ sagen, wenn Sie Ihre alte Firma meinen …«
»Ach, tu ich das? War mir gar nicht klar.«
»Warum immer noch ›wir‹?«
»Ich war 15 Jahre dort. Ich habe viel bewegt. Das ist die liebe Gewohnheit.«
»Aber nach fünf Jahren könnten Sie sich auch daran gewöhnt haben, dass Sie jetzt nicht mehr dort sind …«
»Hab ich ja auch. Aber mit einer Firma ist das doch so wie mit …« Er zögerte und sah lange zur Decke, als würde er dort nach einem Wort suchen. Dann hellte sich sein Gesicht auf: »Wie mit einem eigenen Kind ist das!«
»Inwiefern?«
»Wenn ich ein Kind in die Welt setze, wird es immer meines bleiben. Auch wenn die Mutter mich verlässt und ich es nicht mehr sehe: Es bleibt mein Kind!«
Ich musste schmunzeln: »Sie der Vater, der Konzern Ihr Kind – bringen Sie da nicht die Größenverhältnisse durcheinander?«
Er zog eine Grimasse: »Jetzt legen Sie doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage! Es geht mir ums Prinzip. Ich habe dort viele Projekte in die Welt gesetzt. Einige laufen bis heute.«
Es ist tatsächlich so: Die meisten Mitarbeiter sehen ihr Verhältnis zur Firma nicht als nüchterne Geschäftsbeziehung, sondern als emotionale Bindung. Manche lieben ihre Firma. Manche hassen sie. Aber kaum einer steht ihr gleichgültig gegenüber, wie es bei einem nüchternen Vertragsverhältnis zu erwarten wäre.
Der Spruch »Ich heirate eine Firma« mag augenzwinkernd gemeint sein, doch er streift die Wahrheit: Erstens lieben die meisten Menschen ihren Beruf und damit ihren Arbeitgeber – wenigstens so lange, bis ihnen der Firmen-Irrsinn diese Liebe austreibt. Zweitens heiratet jeder neue Mitarbeiter nicht nur seinen Job, sondern gleichzeitig die komplette Arbeitsfamilie – als wäre der Chef ein mächtiger Schwiegervater mit weitverzweigtem Anhang. Und drittens gilt für Arbeits-Ehen dasselbe wie für andere Ehen auch: Mit den Jahren werden sich die Eheleute immer ähnlicher. Nicht, weil die Firma sich verändert. Sondern, weil der Mitarbeiter sich anpasst.
Aber welche Sitten gelten in dieser schrägen Firmenfamilie? Was muss ein (neuer) Mitarbeiter erdulden? Und wo liegt die Grenze zum Irrsinn? Zum Beispiel könnten Sie sich fragen:
Ist es normal, dass Ihr Chef in der Weihnachtsrede ein hohes Lied auf Weiterqualifizierung singt, Sie aber mit Ihrem Fortbildungswunsch gegen eine Wand laufen?
Ist es normal, dass eine ausgeschriebene Stelle, auf die Sie sich bewerben, schon zwei Monate zuvor unter der Hand vergeben wurde?
Ist es normal, dass der Dienstweg, den Sie gehen, und das Meeting, das Sie besuchen, nur Treffpunkte für Idioten sind – während die Entscheidungsfäden hinter den Kulissen gezogen wurden?
Ist es normal, dass Ihr neuer Chef ein erfolgreiches Projekt seines Vorgängers killt, nur weil es nicht von ihm selbst auf den Weg gebracht wurde?
Ist es normal, dass Ihre Firma die Teamarbeit offiziell hochleben lässt, aber immer nur die Ellbogentypen ins Management befördert werden?
Ist es normal, dass in der Werbebroschüre der Kundenservice in höchsten Tönen gepriesen, aber in Wirklichkeit die ganze Serviceabteilung von Ihrer Firma wie stinkender Sondermüll »ausgelagert« wird?
Und ist es normal, dass auf die Aktionäre ein Dividendenregen einprasselt, während bei den Mitarbeitern Einstellungsstopps verhängt, Gehälter eingefroren und Sozialleistungen gekürzt werden – angeblich mangels Geld?
Ja, all das ist unter deutschen Firmendächern gängig. Üblich. Weit verbreitet. Aber normal, wenn Sie mich fragen, ist es nicht – es ist irre!
§ 1 Irrenhaus-Ordnung: Ein neuer Mitarbeiter denkt, Teil des Unternehmens zu werden. Dabei wird das Unternehmen ein Teil von ihm.
Kleiner Irrenhaus-Steckbrief
Woran können Sie schnell erkennen, ob Ihre Firma ein Irrenhaus ist (ein detaillierter Test erwartet Sie ab Seite 199)? Im Laufe der Jahre sind mir vier wichtige Kennzeichen aufgefallen, von denen mindestens eines zutreffen muss:
1. Heuchelei: Die Firma tut nicht, was sie sagt, und sagt nicht, was sie tut. Sie verspricht Mitarbeitern (und Kunden) mehr, als sie hält. Sie pflegt Leitsätze, die nicht gelten. Sie stellt Forderungen, die nicht zu erfüllen sind. Nur eine Moral ist ihr heilig: die Doppelmoral. Wahr ist, was ihr nützt. Solche Firmen sind Spezialisten für Fassadenbau – nur ihr Außenbild ist makellos.
2. Profitsucht: Die Firma fühlt sich nur einem »höheren« Ziel verpflichtet: der Gewinnmaximierung. Der Kunde ist für sie nur eine Einnahmequelle, ein »Account«; die Umwelt ist für sie nur ein Rohstoff, den es auszubeuten gilt; und der Mitarbeiter ist nur ein Mohr, der gehen kann, wenn er seine Schuldigkeit getan hat. Der Bagger des Personal- und Kostenabbaus schlägt ohne Skrupel zu. Vor allem Konzerne handeln nach dieser plutokratischen Maxime.
3. Egozentrik: Die Firma ist vor allem mit sich selbst beschäftigt – nicht mit dem Markt. Man definiert Prozesse, zelebriert Meetings, schlägt Schaum. Mal herrscht Chaos, etwa nach einer Restrukturierung, dann Erstarrung, etwa nach einer Budgetsperre. Die Mitarbeiter sind auf den Chef fixiert. Der Kunde spielt die letzte Geige.
4. Dilettantismus: Die Firma stolpert über die eigenen Füße. Hier wird kein Geschäft geführt, hier wird fröhlich dilettiert. Die Führungskräfte verdienen ihren Namen nicht. Die Entscheidungen werden gewürfelt. Der Horizont reicht nicht weiter als der Stadtbus. Vor allem im Mittelstand macht sich dieser unfähige Irrenhaus-Typus breit.
Haben Sie Ihre aktuelle Firma erkannt? Und Ex-Firmen womöglich auch? Dann interessiert es Sie bestimmt, wie dieser Irrsinn unterm Firmendach gewachsen ist. Davon handelt gleich »die Wachstumsstory«.
Betr.: Ich arbeite für eine Windmaschine
Unsere Firma ist eine einzige Windmaschine. Das mag typisch für eine Werbeagentur sein, aber wir schießen den Vogel ab. Unser Ruf in der Branche ist erstklassig. Und warum? Wir betreuen zwei deutsche Top-Firmen. Und diese Namen posaunen wir bei jeder Gelegenheit hinaus.
Was aber kein Mensch von außerhalb weiß (und ich auch nur durch eine Indiskretion): Diese Aufträge, mit denen wir trommeln, sind gar keine Aufträge. Es sind Geschenke an die Kunden. Wir texten Slogans, fahren Kampagnen und betreuen die Homepages. Doch unsere GL hat einen schrägen Deal vereinbart: Wir erbringen unsere Leistung für ein besseres Trinkgeld, einen nichtigen Betrag – im Gegenzug dürfen wir die Namen dieser Firmen stolz auf unsere Fahnen schreiben.
Diese Kunden ziehen die meiste Arbeitskraft auf sich, spülen aber kaum Geld in die Kasse. Und die Sogwirkung, die sie entfalten sollen, hält sich in Grenzen: Die anderen Konzerne, die wir dringend als zahlende Kunden bräuchten, denken offenbar: »Mehr als zwei Großkunden schaffen die nicht!«
Wir sperren die Tür, durch die normal zahlende Großkunden spazieren sollen, durch einen Bluff selbst zu. Völliger Irrsinn, zumal Einnahmen fehlen. Die Gehaltszahlungen kommen immer wieder verzögert. Unsere halbe Firma besteht schon aus Praktikanten. Keiner von denen weiß, dass ihr »Geschäftsmodell« mit dem der Agentur identisch ist: Arbeiten ohne Vergütung, nur für den klangvollen Namen im Lebenslauf.
Bitte behandeln Sie diese Angaben vertraulich und verändern Sie alle Namen und wiedererkennbaren Fakten (das ist hier und auch bei allen folgenden Fallgeschichten geschehen, M.W.).
Tanja Klever, Werbetexterin
§ 2 Irrenhaus-Ordnung: Menschen, die durchdrehen, kommen ins Irrenhaus. Mitarbeiter, die durchdrehen, arbeiten schon für eines.
Die Wachstumsstory: Wie Firmen (irrsinnig) groß werden
Wo kommt der Irrsinn her? Das fragen sich die Psychiater seit Jahrhunderten. Gründliche Therapeuten graben den Misthaufen der Vergangenheit so lange um, bis es nicht nur ordentlich stinkt, sondern die Ursachen für jedes psychische Problem aufgedeckt sind. Wer von seinem Vater zu wenig Anerkennung und von seiner Mutter zu viel Lakritze bekommen hatte, dessen Psyche musste ja vom Gleis springen!
Leider haben Firmen eine unpraktische Eigenschaft: Sie sind zu groß, um sich mal eben auf eine Couch legen zu können. Selbst wenn das möglich wäre, würde der »Patient Firma« nicht mit einer Stimme sprechen. Ein Unternehmen hat so viele Münder wie Mitarbeiter, vom Gründer bis zum Portier würden alle durcheinander reden. Das ließe auf eine schwere Schizophrenie schließen.
Und doch spielt die Entwicklung eine Rolle. Was für ein Menschenleben die Sozialisation ist, der prägende Weg von der Geburt ins Erwachsenenleben, ist für Firmen ihre Gründungsphase. Welche Rolle spielt dabei die Persönlichkeit des Gründers? Muss das, was ein Irrer sich ausdenkt, zwangsläufig auch in Irrsinn ausarten?
Oder gibt die Geschäftsidee den Ausschlag? Muss eine Werbeagentur, um sich verrückte Ideen auszudenken, nicht selbst ein wenig verrückt sein? Wird eine Unternehmensberatung, die täglich Weisheiten verkauft, ohne sie zu besitzen, nicht zwangsläufig schizophren? Und ist ein Marktführer, an dessen Festung ständig Konkurrenten rütteln, nicht für den Verfolgungswahn prädestiniert?
Und nicht zuletzt: Welchen Einfluss haben die Irrenhaus-Direktoren auf das (geistige) Befinden ihrer Mitarbeiter? Kann ein Chef, der sich wie ein Brüllaffe aufführt, zivilisierte Mitarbeiter erwarten? Oder muss ein Fisch, dessen Kopf nach Wahnsinn stinkt, bis zum Schwanz denselben Geruch haben?
Diese Fragen zeigen Ihnen: Ein Blick in den Lebenszyklus der Firma, von der Gründungsphase bis zur Etablierung, kann äußerst spannend sein – um dem Irrsinn auf die Schliche zu kommen.
Es gibt vier Firmenkulturen, die oft ineinander übergehen.3
1. Dorfkultur
Die meisten Gründer, die ich beraten habe, hatten eine Gemeinsamkeit: Sie verstanden nichts vom Gründen. Ihre Geschäftsidee war ihnen zugeflogen wie ein buntes Vögelchen, das sie aufpäppeln wollten. Aber wie bloß?
Gründung – dieses Thema ist in Deutschland so tabu, als wäre es eine unappetitliche Krankheit. In der Schule lernt man bestenfalls, wie die Weimarer Republik gegründet wurde. Aber Unternehmertum? Pfui Teufel, damit wird immer noch der fette Kapitalist mit der Zigarre, der menschliche Blutsauger verbunden. Der anständige Weg führt in eine Festanstellung.4
Doch viele Gründer werden von einem fleißigen Gehilfen unterstützt: ihrem jugendlichen Übermut. Sie lenken, ehe sie denken. So ging auch Bill Gates ans Werk, als er 1975 mit nur 19 Jahren Microsoft aus dem Boden einer Garage stampfte. Vorteil der Jugend: Wenn der Gründer schnell pleitegeht, bleiben ihm 60 Jahre, um seinen Gläubigern das Geld zurückzuzahlen.
Und wenn seine Firma wie eine Rakete durchstartet? Dann ist niemand so überrascht wie er selbst. Seine Schockstarre hält an, bis ihn die anschwellende Arbeitslawine unter sich begräbt. Jetzt braucht er fleißige Hände, die ihn wieder ans Licht buddeln.
Welche Eigenschaft müssen die ersten Mitarbeiter haben? Schon manches Anforderungsprofil habe ich zusammen mit Gründern entwickelt – und am Ende in den Papierkorb gesteckt. Denn mit einem Kettcar lassen sich keine Formel-1-Piloten und mit einer leeren Firmenkasse keine Hochqualifizierten anlocken. Die billigsten Bewerber – meist Bekannte des Gründers – bekommen den Zuschlag, auch wenn ihr Gehalt nur eine geringe Qualifikation, wenig Erfahrung und schlimmstenfalls Talentmangel spiegelt.
Damit ist ein Saatkorn für den späteren Irrsinn gepflanzt. Die Gründungstruppe ist oft ein Kompetenzfrei-Team. Aber ausgerechnet diese Mitstreiter der ersten Stunde betrachtet der Gründer als Erste unter Gleichen. Der Ritterschlag einer Beförderung trifft sie unvermeidlich, sobald der Rubel zu rollen und das Personalkarussell sich zu drehen beginnt.
In der Dorfkultur kennt jeder jeden. Die Entscheidungswege sind Katzensprünge. Eine Idee, die dem Mitarbeiter nach dem Frühstück kommt, nickt der Gründer noch vor dem Mittagessen ab. Der Antrag auf eine Dienstreise besteht aus der Aussage: »Ich flieg dann mal nach Zürich.« Eine neue Planstelle entsteht durch den Satz: »Ich muss jemanden einstellen!« Und über Gehaltserhöhungen wird grundsätzlich nur dann gesprochen, wenn der Chef in der Kneipe schon so besoffen ist, dass ihm ein »ja« (mit zwei Buchstaben) leichter als ein »nein« (mit vier Buchstaben) über die Lippen geht.
Viele Abteilungen bestehen aus einem einzigen Mitarbeiter. Wenn ich in solchen Firmen anrufe und den Gründer sprechen will, höre ich oft Antworten wie: »Der hat gerade noch einen Brief geschrieben. Und jetzt ist er rüber zur Post gelaufen. Danach will er noch im Bürogeschäft vorbeischauen.« Jeder Einwohner des Firmendorfes weiß, was der andere gerade macht. Die Informationen werden wie Tennisbälle hin und her gespielt.
Der Gründer ist nicht nur Geschäftsführer, sondern zur gleichen Zeit Personalchef, Produktionsleiter, Controller und Werbeagentur. Sein Firmendorf regiert er wie ein Bürgermeister. Jeden Tag sieht, spricht, erlebt er seine Mitarbeiter, werkelt an ihrer Seite und hört im Detail, was läuft und was hakt. Niemals käme er auf die Idee, darüber ein Protokoll anzufertigen. Wozu auch? Es hören ja alle mit!
Seine Mitarbeiter kennt der Gründer so gut, dass er ihren zweiten Vornamen auf Anhieb nennen und ihren Lieblingsdrink an der Bar ohne Rücksprache bestellen kann. Einige Firmen kommen nie über diese Größe hinaus. Diese Zwerge unter den Firmen bleiben Klein- oder Kleinstbetriebe.
Andere Firmen bekommen ein gewaltiges Problem: Der Erfolg lässt sie wachsen.
2. Dschungelkultur
Mehr Aufträge, mehr Mitarbeiter, mehr Büros – mehr Chaos. Bislang war alles so übersichtlich, dass der einzige Dienstweg der Firmenflur war. Jetzt, da die Firma größer wird, fehlen die Strukturen. Wofür eine Abteilung zuständig ist, auf welchem Weg Informationen fließen, wie weit die Entscheidungsbefugnisse gehen – nichts ist geregelt. In der Dorfkultur arbeiten alle miteinander. In der Dschungelkultur arbeiten alle aneinander vorbei.
In einer jungen Internetfirma wurde zum Beispiel dringend ein Kalkulator gesucht, da die Ausgaben aus dem Ruder liefen. Der Gründer wäre nie auf die Idee gekommen, die Stelle auszuschreiben. Er trommelte seine Leute zusammen und bat sie, einen solchen Mitarbeiter aufzutreiben.
Diesem Wunsch wurde Folge geleistet. Allerdings von zwei Mitarbeitern, die jeweils durch mündliche Zusage einen Bekannten anheuerten – was im allgemeinen Durcheinander erst auffiel, als sich zwei Leute auf denselben Stuhl setzen wollten. Beide übrigens keine gelernten, sondern nur angelernte Kalkulatoren.
Das Chaos ging in dieser Firma noch viel weiter: Wenn ein Mitarbeiter morgens nicht am Arbeitsplatz war, wurde eine lange Fahndung eingeleitet, um herauszufinden: War er …
a.) … im Urlaub?
b.) … erkrankt?
c.) … plötzlich verstorben?
In den ersten beiden Fällen galt die Regelung, sich selbst um einen Stellvertreter zu kümmern. Ein offizieller Dienstweg, etwa Urlaubsanträge, war so unbekannt wie die DVD im Spätmittelalter. Und der dritte Fall (»Lebt er eigentlich noch?«) kam ins Gespräch, als ein junger Mitarbeiter einfach nicht mehr auftauchte. Seine Telefonnummer? Hatte niemand parat. Seine Postanschrift? Galt nicht mehr. Erst Wochen später wurde bekannt: Er war zu einer anderen Firma gewechselt. Eine offizielle Kündigung hatte er, ganz Dschungelkind, nicht für nötig gehalten.
Die einzige Ordnung im Chaos: Die Firma spaltet sich in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die Oberschicht besteht aus denen, die von Anfang an mit dabei waren, den Pionieren. Sie stehen an der Spitze, mittlerweile auch mit ihren Gehältern. Die Unterschicht besteht aus allen, die den Anfang verpasst und sich später hinzugesellt haben. Sie gelten als Zugereiste, als Diener der Gründungsfürsten.
Wenn die Firma genug Geld hat, sich erstklassige Mitarbeiter zu leisten, haben es sich auf den Führungssesseln schon die Insassen der ersten Stunde bequem gemacht. Diese Amateure leiten nun hochqualifizierte Profis an. Das ist so, als ließe ein Kreisligaverein nach seinem Bundesligaaufstieg immer noch Hobbyspieler auflaufen – und verbannte die inzwischen erworbenen Profis ins zweite Glied.
Der Pionierverein, angeführt vom Gründer, hält wie Pech und Schwefel zusammen. Alle Beschlüsse, die über die Anschaffung eines Bleistiftspitzers hinausgehen, machen die alten Haudegen unter sich aus. Am liebsten nach Feierabend, etwa an der Bar. Die Neuen sind verzweifelt. Dort, wo sie den Dienstweg vermuten, ist gar nichts.
Und der Gründer? Nach wie vor will er wie ein Dorfbürgermeister regieren. Doch sein Terminkalender quillt über, sein Telefon klingelt permanent, und sein Mailfach ist voller als die örtliche Mülldeponie. Er schafft seine Arbeit nicht mehr – die Arbeit schafft ihn. Wichtige Vorgänge bleiben auf der Strecke. Mitarbeiter bekommen keine Termine. Meetings fallen aus. Kundenanfragen bleiben ohne Antwort.
Der Dschungel überwuchert den Erfolg. Jetzt wird’s gefährlich.
Betr.: Als ich vor der verschlossenen Firma stand
Es passierte in der Zeit, als unsere Firma allmählich von 15 auf 60 Mitarbeiter aufstockte. Ich war drei Wochen in Urlaub gewesen. Erster Arbeitstag, ich gehe in großen Schritten auf die Firmentür zu – doch pralle zurück. Sie ist abgeschlossen. Nanu, wir haben doch schon 8.00 Uhr. Die ersten Kollegen fangen sonst um sieben an.
Ich klingele. Nichts tut sich. Ich schaue auf das Gebäude. Nichts regt sich. Ich warte auf weitere Kollegen. Niemand kommt.
Verdammt, was war hier los? War mein Arbeitgeber pleitegegangen, während ich urlaubte? Und hatte es niemand für nötig gehalten, mich zu informieren? Bei all dem Chaos, das ich in den letzten Monaten erlebt hatte, hätte mich das nicht gewundert.
Eine Kollegin, die auch aus dem Jahresurlaub kam, stieß nach fünf Minuten zu mir. Beide hatten wir keinen Schlüssel für das Gebäude – und erst recht keine Ahnung, was hier gespielt wurde.
Was tun? Per Handy rief ich einen Kollegen an. Als er sich meldete, hörte ich fröhliche Bierzelt-Musik im Hintergrund. »Wir sitzen hier gerade im Bus«, erzählte er. »Hat euch denn keiner gesagt, dass heute der Betriebsausflug ist?« Diese Tour war kurzfristig anberaumt worden. Man hatte schlicht übersehen, dass zwei im Urlaub waren. Es gab ja keine Personalabteilung – diese Arbeit machte die völlig überforderte Sekretärin mit.
Saudummes Gefühl, bei einem Ausflug nicht dabei sein zu können. Und ein Wunder, dass auf der Fahrt kein Mitarbeiter verloren gegangen ist. Es hätte gut zu dieser Chaos-Firma gepasst.
Alexander Dremmler, Projektleiter
3. Stadtkultur
Wenn die Schäden nicht mehr zu übersehen sind, wenn Rechnungen nicht gestellt, Gehälter nicht beglichen, Steuern nicht bezahlt wurden, wenn die ersten Mitarbeiter in den Wahnsinn getrieben, zum Heulen gebracht oder als Sündenböcke vom Hof gejagt worden sind – irgendwann mitten im Chaos dämmert die Erkenntnis: »Wir brauchen Regeln!«
Bis dahin war oft nicht klar, worin die Aufgabe eines Mitarbeiters eigentlich besteht (mangels Stellenprofilen), wer einen Anspruch auf welche Leistung hat (mangels Gehaltsstruktur) oder dass vielleicht doch eine Personalabteilung und eine Buchhaltung vonnöten wären.
Ein Teil der »Pioniere« schafft es, die eigene Macht in der Stadtkultur zu erhalten. Der Rest stößt an seine Grenzen: Die frisch gegründete Personalabteilung reklamiert, dass man diese Dilettanten nichts führen lassen darf, höchstens ein Tagebuch. Einige Pioniere werden degradiert.
»Stadtkultur« bedeutet auch: Das Unternehmen wird anonymer. Statt mit dem Gründer täglich zu plaudern, sprechen die Mitarbeiter nur noch mit ihrem Abteilungsleiter. Statt alle Kollegen zu duzen, kennen sie von den Neuen kaum mehr die Namen. Und statt eine Aufgabe von Anfang bis Ende im Alleingang durchzuziehen, laufen die Mitarbeiter oft nur noch Sprints, ehe sie das (nun sauber definierte) Ende ihrer Kompetenzen erreicht haben und die nächste Abteilung den Staffelstab übernimmt.
Mit jeder Regel, die eingeführt wird, nimmt die Beweglichkeit des Unternehmens ab. Die Bürokratie lähmt Entscheidungen. In dieser Phase habe ich es schon erlebt, dass wichtige Beschlüsse – etwa ein Angebot, auf das der Kunde gewartet hat – nur deshalb aufgeschoben wurden, weil ein Gremium nicht komplett war (in größeren Unternehmen urlaubt immer jemand!), ein Etat schon ausgeschöpft oder den Abteilungen der Machtkampf untereinander wieder einmal wichtiger als die Interessen des Unternehmens.
Die Stadtkultur regelt alles. Die Gehälter werden gruppiert, die Personalakten gepflegt, die Arbeitszeiten erfasst. Kein Schritt ist mehr möglich, ohne sich im Spinnennetz der Bürokratie zu verfangen: Vor den Räumen der Firma wird eine Stempeluhr postiert, vor die Dienstreise ein Antrag geschaltet, vor die Einstellung ein Auswahlverfahren. Jeder Vorgang, der komplizierter als das Hochfahren eines Computers ist, artet in einen bürokratischen Prozess aus (siehe auch Seite 127). Die Formalie feiert Feste. Die Vernunft wird zum Zaungast.
Zum Beispiel stand ein Klient von mir vor folgendem Problem: Einer seiner Mitarbeiter betreute ein wichtiges Kundenprojekt, hatte einen Motorradunfall und meldete sich sechs Wochen krank. Es war klar: Der Mitarbeiter musste für diese Zeit ersetzt werden. Blitzschnell. Doch die Personalabteilung teilte meinem Klienten mit, der Etat für Zeitarbeitskräfte sei leider schon aufgebraucht.
Sein Argument, dass ein Auftrag mit sechsstelligem Umsatzvolumen an diesem Arbeitsplatz hinge, stieß auf taube Ohren. Die Personalabteilung verwies ihn an die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung verwies ihn zurück an die Personalabteilung. Und wenn sie nicht gestorben sind, suhlen sie sich noch heute in ihrer Bürokratie – während der Kunde ein langes Gesicht macht. Das ist die irre Seite der Stadtkultur.
4. Wanderkultur
Ein Kommen und Gehen wie im Taubenschlag, ein ständiger Wechsel der Mitarbeiter – das ist typisch für eine Wanderkultur, die der Stadtkultur nicht folgen muss, aber kann. Wer hier arbeitet, will dem Irrenhaus entfliehen. Kaum haben die Mitarbeiter eine solche Firma betreten, suchen sie auch schon nach dem Notausgang, einem neuen Job. Wenn sie doch ein oder zwei Jahre bleiben, dann nur dem Lebenslauf zuliebe. Und gegen ihre Überzeugung.
Ich kenne eine solche Firma im IT-Bereich. Die durchschnittliche Verweildauer liegt hier bei unter zwei Jahren. Der Grund sitzt auf dem Chefsessel: Der Direktor dieses Irrenhauses erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie einen Begriff aus ihrem Wortschatz streichen – Feierabend. Die Arbeitstage dauern von 9.00 bis 21.00 Uhr. Wer früher nach Hause will oder gar das Geständnis ablegt, er habe auch noch ein Privatleben, wird von allen Seiten mit Giftpfeilen beschossen.
Irrsinnigerweise gelingt es den Mitarbeitern nicht, sich gegen ihren Chef zu solidarisieren. Vielmehr mutieren sie zu Wachhunden und schlagen an, wenn ein Kollege später kommt oder früher geht. Und sie beißen zu, wenn sich dieser Vorgang wiederholt. Weil sie selbst Gefangene dieser Unternehmenskultur sind, können sie offenbar nicht ertragen, dass sich andere mehr Freiheit nehmen. Kaum einer hält das länger als zwei Jahre aus.
Meist stinkt der Fisch vom Kopf her. Das gilt auch für Abteilungen. Ich kenne Unternehmen, wo die Mitarbeiter es in der einen Einheit im Schnitt zwölf Jahre aushalten, während es in der nächsten nur zwölf Monate sind. Früher war das gefährlich für den Vorgesetzten, denn Abteilungen mit hoher Fluktuation galten als schlecht geführt. Doch heute, in Zeiten des Personalabbaus, begrüßen es viele Irrenhäuser, wenn sich zweibeinige Kostenstellen ohne Kündigungs-Tritt aus der Anstalt verabschieden (das kostet keine Abfindung!). So kommt es zu der grotesken Situation, dass Personalvertreibung statt -führung durch das Prinzip des Profit-Centers auch noch belohnt wird, etwa durch höhere Prämien.
Einige Branchen neigen zur Wanderkultur. Zum Beispiel ist die Fluktuation der Arbeitskräfte im Hotelgewerbe, in der Werbung oder in den Unternehmensberatungen deutlich höher als in der Autoindustrie oder in der Energiewirtschaft.
Der Irrsinn kann sich in allen Kulturen einnisten, doch ich habe beobachtet: Je älter ein Unternehmen wird, desto hartnäckiger setzt er sich fest, desto konsequenter breitet er sich aus und desto schwerer ist er zu tilgen. Stellen Sie sich das wie bei einem Baum vor: Ist er frisch gepflanzt, lässt er sich mit etwas Kraft aus der Erde ziehen. Aber wurzelt er seit Jahrzehnten und hat Größe gewonnen, dann lässt er sich nicht mehr bewegen. Es sei denn mit der Axt.
Die folgenden Kapitel liefern Ihnen ein paar Beispiele, welche grotesken Blüten der Irrsinn in deutschen Firmen treibt und welche Rolle die Mitarbeiter dabei spielen.
§ 3 Irrenhaus-Ordnung: Alle Dummheiten, die eine Firma früh begeht, sind durch ihre Jugend entschuldigt. Alle Dummheiten, die sie später begeht, durch die Abwesenheit ihrer Jugend.
Der Honecker-Effekt
Was glauben Sie: Hat sich Erich Honecker, der Staatsratsvorsitzende der DDR, für einen guten Jäger gehalten? Und ob! Jedes Mal, wenn er zur Jagd ging, liefen ihm die kapitalsten Hirsche, die fettesten Wildschweine, die stolzesten Rehe vor die Flinte. Niemand schoss so viel wie Honecker. Er hielt sich für den Schützenkönig der Wälder, für einen vorzüglichen Waidmann.
Und auch andere hohe SED-Tiere, von Willi Stoph bis Günter Mittag, konnten sich für ihre Jagderfolge auf die Schulter klopfen. Dass die Herren ihr Revier einmal verließen, ohne Beute gemacht zu haben – wie bei anderen Jägern üblich –, kam so gut wie nicht vor.
Dieser phänomenale Jagderfolg basierte auf einem kleinen Geheimnis: Honecker jagte in einem Revier, der Schorfheide nordöstlich von Berlin, das in Wirklichkeit kein Revier war – sondern ein mit Tieren gefüllter Freilichtzoo.5
Um Honeckers Jagdareal hatten fleißige Untertanen in aller Stille einen Zaun gezogen. Nicht mal ein Hase konnte aus dem Revier heraushoppeln, wenn der SED-Chef mit seiner Flinte durch den Wald zog.
Gleichzeitig waren Dutzende von Forstmeistern im Einsatz, die rund um die Uhr so viele Hasen, Rehe und Rothirsche heranschafften, dass es fast schwerer war, vorbeizuschießen als zu treffen. Die »Abschussbücher« sprechen eine deutliche Sprache: Pro Jahr machte Honecker hundert Hirschen den Garaus, dazu noch ebenso vielen Rehen und Hasen. Sein spektakulärster Jagderfolg: An einem einzigen Abend strecke er mit einem Kugelhagel fünf Hirsche nacheinander nieder.
Honecker und Co. wünschten sich »Waidmanns Heil« – und wären nie auf die Idee gekommen, dass ihre Glanzleistungen als Jäger nur eine Illusion, nur das künstliche Produkt eines überbesetzten Jagdreviers waren.
Genau dieses Spielchen findet jeden Tag in den deutschen Irrenhäusern statt. Die Irrenhaus-Direktoren sind die Jäger, die Insassen präparieren das Revier. Das Bild der Wirklichkeit, das die Chefs präsentiert bekommen, hat nichts mit den Tatsachen, aber viel mit den Wunschphantasien der Chefs zu tun. Die Geschäftszahlen, die Kundenzufriedenheit, die Verkaufserwartungen werden so lange frisiert, bis die Mitarbeiter davon ausgehen können: Der Chef wird zufrieden sein!
Ein Beispiel für dieses Verhalten habe ich aus nächster Nähe erlebt. Der Verleger eines mittelständischen Verlages für Hobby-Zeitschriften, ein Mann mit prominentem Namen, hatte einen hohen Anspruch. Die Blätter seines Verlages sollten überall erhältlich sein, sogar im letzten Dorfkiosk. Er predigte seinen Mitarbeitern, dass die Zeitschriften nur dort verkauft würden, wo sie auch ausliegen. Immer wieder zitierte er den Vertriebsleiter zu sich, um zu hören, welche Fortschritte das Vertriebsnetz machte.
Der Vertriebsleiter benahm sich wie ein Kellner: Sein Chef hatte Erfolgsmeldungen bei ihm bestellt – und er servierte sie auf dem Silbertablett. Das Problem war nur: Diese Erfolge gab es in Wirklichkeit gar nicht. Der Vertriebsmann polierte seine Statistik und rückte die Zahlen in ein immer positiveres Licht, bis schließlich der Eindruck entstand, ganz Deutschland sei mit den Blättern des eigenen Verlages gepflastert.
Der Honecker-Effekt wurde durch Anschauungsarbeit verstärkt: Wann immer der Herr Verleger verreiste (was verlagsintern von langer Hand geplant wurde), schicke der Vertriebchef eine Vorhut los. Diese flinken Helfer präparierten den jeweiligen örtlichen Kiosk mit Zeitschriften des Verlages so dicht, dass sie ebenso schnell wie der »Stern« oder der »Spiegel« zu finden waren.
Wo immer der Verleger bei seinen Reisen ankam, sei es am Flughafen in Zürich oder am Bahnhof in Buxtehude: Die Flaggschiffe seines Hauses, die wichtigsten Zeitschriften, segelten ihm an jedem Verkaufsstand entgegen. Kein Zweifel: Seine Zeitschriften waren auf dem Weg, »Spiegel« und »Stern« den Rang abzulaufen …
Alle im Verlag, sogar die Lagerarbeiter, wussten Bescheid über diese Komödie. Nur der Verleger selbst betrachtete die Aufführung als die Wirklichkeit – so wie sich Honecker für einen guten Jäger hielt.
In Wahrheit war der Vertrieb übrigens bescheiden. Er erreichte vor allem die Fachgeschäfte, aber viel zu selten über Grossisten die Kioske.
Mag diese Anekdote zum Schmunzeln sein: Andere sind zum Heulen, weil die Unternehmen sich selbst schädigen. Ein Klient von mir, Fertigungsingenieur eines großen Maschinenbauers, beschrieb mir folgende Situation: Die Lieferung des Prototyps einer Großmaschine, die in Serie gehen sollte, war vom Vorstand zu einem bestimmten Termin zugesagt worden – nicht nur dem Kunden, sondern über die Medien der ganzen Republik.