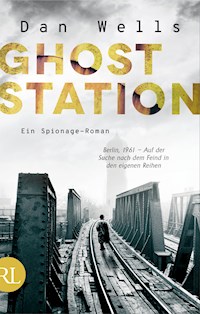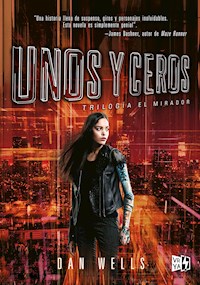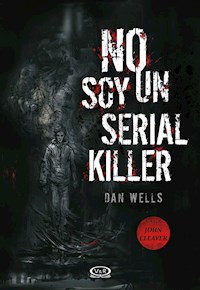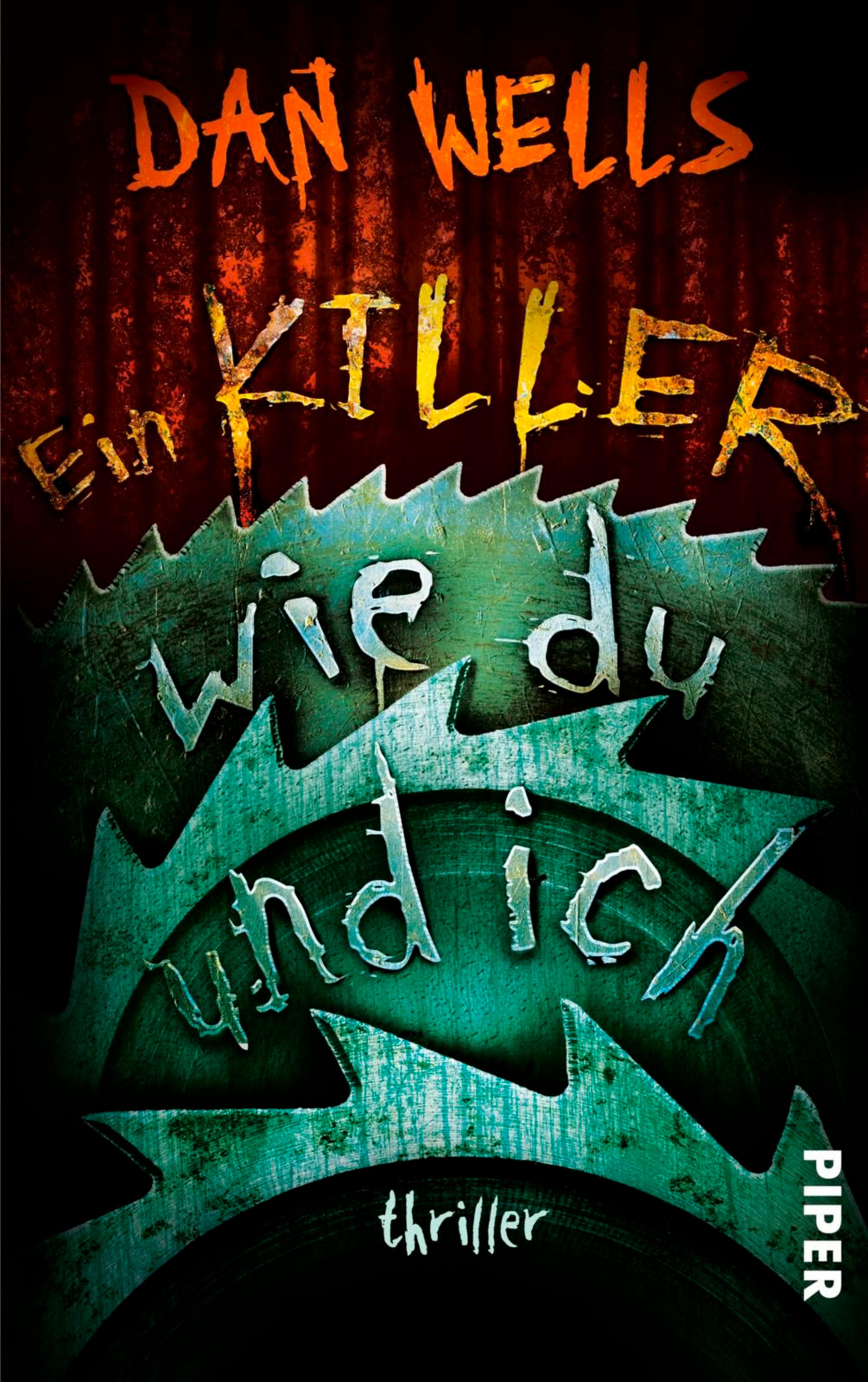9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Du spürst, da ist etwas Böses in dir. Deine Freunde behaupten, es sei bloß Einbildung. Aber du weißt es besser. Du versuchst es mit allen Mitteln zurückzuhalten. Verbietest dir selbst den Kontakt zu Mädchen, besuchst den Psychotherapeuten, hältst dich stets unter Kontrolle. Doch niemand kann dir helfen. Denn diese dunkle Gewissheit ist da. Eines Tages wird es ausbrechen. Du wirst zum Serienkiller werden. Die Frage ist nur – wann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
4. Auflage 2009
ISBN 978-3-492-95010-7
© Daniel A. Wells 2009
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2009
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München / www.guter-punkt.de
Umschlagabbildung: Anke Koopmann / Guter Punkt
Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für Rob, der mir die beste Anregung gab,
die ein kleiner Bruder überhaupt geben kann:
Er wurde vor mir veröffentlicht.
Ein Paar gezackter Scheren hätte ich sein sollen
Und über den schweigenden Meeresgrund huschen.
T. S. Eliot
Liebeslied des J. Alfred Prufrock
Mrs Anderson war tot.
Nichts Spektakuläres, es war das Alter – sie ging eines Abends zu Bett und stand am nächsten Morgen nicht mehr auf. In den Nachrichten hieß es, sie sei friedlich eingeschlafen und würdevoll gestorben, was im Prinzip wohl sogar zutrifft, aber die drei Tage, die vergingen, bis jemand merkte, dass sie schon eine Weile nicht mehr aufgetaucht war, nahmen ihren sterblichen Überresten jegliche Würde. Schließlich schaute Mrs Andersons Tochter vorbei und fand die Leiche, die mittlerweile stank wie ein überfahrenes Tier. Das Schlimmste war dabei nicht einmal die Verwesung, sondern die Tatsache, dass es volle drei Tage dauerte, bis jemand fragte: »Sag mal, wo steckt eigentlich die alte Dame, die da unten am Kanal wohnt?« Das ist nicht besonders würdevoll.
Aber friedlich? Ganz sicher. Wie der Gerichtsmediziner erklärte, starb sie am 30. August im Schlaf, also zwei Tage, bevor der Dämon Jeb Jolley die Eingeweide herausriss und ihn in einer Pfütze hinter dem Waschsalon liegen ließ. Damals wussten wir es noch nicht, aber Mrs Anderson sollte für sechs Monate der letzte Mensch im Clayton County bleiben, der auf natürliche Weise gestorben war. Die anderen holte der Dämon.
Na ja, die meisten jedenfalls. Alle bis auf einen.
Am Sonnabend, dem 2. September, bekamen wir Mrs Andersons Leiche herein, nachdem der Gerichtsmediziner mit ihr fertig war – das heißt, ich sollte wohl besser sagen, dass meine Mutter und Tante Margaret die Leiche bekamen, nicht ich. Den beiden gehört das Bestattungsunternehmen. Ich bin erst fünfzehn. Den Tag über hatte ich mich in der Stadt herumgetrieben und der Polizei zugesehen, während sie das Chaos bei Jebs Leiche aufgeräumt hatte. Kurz vor Sonnenuntergang kehrte ich zurück und schlüpfte durch den Hintereingang ins Haus, denn ich befürchtete, dass meine Mutter vorn im Büro saß. Ich wollte ihr wirklich nicht begegnen.
Hinten in der Leichenhalle war niemand außer mir und Mrs Andersons Leiche. Sie lag, in Tücher gehüllt, ganz still auf dem Tisch und roch nach verfaultem Fleisch und Insektenspray. Der große Ventilator, der sich klappernd über mir drehte, half nicht viel. Ich wusch mir im Waschbecken leise die Hände und fragte mich, wie viel Zeit mir noch blieb. Dann berührte ich vorsichtig die Tote. Alte Haut hatte ich am liebsten – sie war trocken und runzlig und fühlte sich an wie Pergament. Der Gerichtsmediziner hatte sich keine große Mühe gegeben, Mrs Anderson zu säubern, was wahrscheinlich daran lag, dass er mit Jeb so viel Arbeit hatte, aber der Geruch verriet mir, dass er wenigstens daran gedacht hatte, die Insekten zu vernichten. Nach drei Tagen spätsommerlicher Hitze hatte es wahrscheinlich eine ganze Menge von dem Viehzeug gegeben.
Jemand öffnete die Eingangstür der Leichenhalle und trat ein, grün gekleidet wie ein Chirurg mit Mundschutz. Ich zuckte zusammen, weil ich dachte, es sei meine Mutter, doch die Frau warf mir nur einen kurzen Blick zu und ging zu einem Vorratsschrank.
»Hallo, John«, sagte sie, während sie ein paar sterile Tücher zusammensuchte. Es war nicht meine Mutter, sondern ihre Schwester Margaret. Sie waren Zwillinge, und wenn sie Masken trugen, konnte ich sie kaum auseinanderhalten. Margarets Stimme klang ein wenig lebhafter und energischer. Vielleicht lag es daran, dass sie nie geheiratet hatte.
»Hallo, Margaret.« Ich zog mich einen Schritt zurück.
»Ron wird immer fauler.« Sie nahm eine Sprühflasche mit einem Desinfektionsmittel in die Hand. »Er hat sie nicht einmal gesäubert, sondern einfach nur auf natürlichen Tod befunden und sie hierherbefördert. Mrs Anderson verdient wirklich etwas Besseres.« Dann wandte sie sich an mich. »Willst du einfach nur herumstehen, oder hilfst du mir?«
»Entschuldige.«
»Wasch dich vorher.«
Bereitwillig krempelte ich mir die Ärmel hoch und kehrte zum Waschbecken zurück.
»Ehrlich«, fuhr sie fort, »ich weiß gar nicht, was sie da drüben im Büro des Gerichtsmediziners überhaupt machen. Die haben ja nicht gerade viel zu tun – wir halten uns mit dem Bestattungsinstitut gerade eben über Wasser.«
»Jeb Jolley ist tot«, berichtete ich, während ich mir die Hände abtrocknete. »Sie haben ihn heute Morgen hinter dem Waschsalon gefunden.«
»Den Automechaniker?«, fragte Margaret nicht mehr ganz so munter. »Das ist ja furchtbar. Er war jünger als ich. Was ist passiert?«
»Ermordet.« Ich nahm mir einen Mundschutz und eine Schürze vom Wandhaken. Der Dämon hatte ihn erwischt, aber das wusste ich noch nicht. Erst drei Monate später erfuhr ich, dass es überhaupt einen Dämon gab. Damals im August – es kommt mir jetzt vor, als sei das eine Ewigkeit her – hatte noch niemand eine Vorstellung von den Schrecken, die uns bevorstanden. »Sie dachten, es sei vielleicht ein streunender Hund gewesen«, erzählte ich Margaret. »Aber die Därme lagen neben ihm auf einem Haufen.«
»Das ist ja furchtbar«, wiederholte Margaret.
»Da brauchst du dir keine Sorgen um das Geschäft zu machen. Zwei Leichen an einem Wochenende, das ist doch ein guter Schnitt.«
»Mach darüber keine Witze, John.« Sie sah mich streng an. »Der Tod ist eine traurige Angelegenheit, auch wenn er uns hilft, die Hypothek abzutragen. Bist du so weit?«
»Ja.«
»Streck mal ihren Arm aus.«
Ich zog den rechten Arm der Toten gerade und hielt ihn fest. Die Totenstarre macht eine Leiche so steif, dass man die Gliedmaßen kaum noch bewegen kann, hält jedoch nur etwa anderthalb Tage an. Die Frau war allerdings schon lange tot, und die Muskeln hatten sich wieder entspannt. Ihre Haut war wächsern und das Fleisch darunter weich wie Kuchenteig. Margaret sprühte den Arm mit Desinfektionsmittel ein und wischte ihn sacht mit einem Tuch ab.
Selbst wenn der Gerichtsmediziner seine Arbeit ordentlich macht und die Leichen säubert, waschen wir sie noch einmal gründlich ab, bevor wir anfangen. Das Einbalsamieren ist ein langwieriger Prozess und erfordert große Genauigkeit. Außerdem braucht man dazu eine saubere Grundlage.
»Es stinkt ganz schön«, sagte ich.
»Sie.«
»Sie stinkt ganz schön«, korrigierte ich mich. Mutter und Margaret beharrten unerbittlich darauf, dass wir mit den Toten respektvoll umgingen. Ich hingegen hielt das für sinnlos. Ein Toter war keine Person mehr, sondern nur ein lebloser Körper. Ein Ding.
»Ja, sie riecht«, stimmte mir Margaret zu. »Die arme Frau. Hätte man sie doch nur früher gefunden.« Sie blickte zum Ventilator hoch, der sich langsam über uns drehte. »Hoffen wir, dass uns heute Abend der Motor nicht im Stich lässt.« Das sagte sie immer vor dem Einbalsamieren, es war fast wie ein ritueller Gesang. Über uns quietschte unbeirrt der große Quirl.
»Das Bein«, sagte sie. Ich trat zum Fußende und zog das Bein gerade, damit Margaret es einsprühen konnte. »Dreh dich um.« Ich hielt das Bein fest und starrte die Wand an, während Margaret das Tuch hob und die Oberschenkel wusch. »Ein Gutes hat es ja«, fuhr sie fort. »Ich könnte wetten, dass heute oder morgen jede Witwe im County Besuch bekommt. Jeder, der von Mrs Andersons Tod erfährt, will sehen, wie es seiner eigenen Mutter geht. Das andere Bein.«
Um ein Haar hätte ich erwidert, dass dann vermutlich auch jeder, der von Jebs Tod erfuhr, schnurstracks seinen Automechaniker aufsuchen müsste, aber Margaret mochte solche Scherze nicht.
Wir arbeiteten am Körper, vom Bein zum Arm, vom Arm zum Rumpf, vom Rumpf zum Kopf, bis die ganze Leiche abgeschrubbt und desinfiziert war. Im Raum roch es nach Tod und Seife. Endlich warf Margaret die Lappen in den Wäschekorb und holte die Sachen zum Einbalsamieren.
Schon als kleiner Junge, bevor Dad abgehauen war, hatte ich meiner Mutter in der Leichenhalle geholfen. Meine erste Aufgabe war die Reinigung der Kapelle gewesen. Alte Programmhefte einsammeln, Aschenbecher leeren, den Fußboden saugen und andere Hilfsarbeiten verrichten, die ein Sechsjähriger ohne Aufsicht übernehmen konnte. Als ich größer wurde, bekam ich größere Aufträge, aber erst mit zehn durfte ich bei den wirklich coolen Sachen wie dem Einbalsamieren mitmachen. Das Einbalsamieren war … ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war, als spielte ich mit einer Riesenpuppe, die ich ankleiden, baden und öffnen musste, um zu sehen, was im Innern steckte. Einmal, als ich acht war, beobachtete ich Mutter dabei. Ich linste durch eine Tür, weil ich das große Geheimnis wissen wollte. Vermutlich erkannte sie meine Beweggründe nicht, als ich in der folgenden Woche meinen Teddy aufschnitt.
Margaret gab mir einen Baumwolltupfer, den ich festhielt, während sie der Toten kleine Wattebäusche unter die Augenlider schob. Die Augäpfel fielen bereits in sich zusammen und schrumpften, weil sie Flüssigkeit verloren. Die Watte hielt die Lider in der richtigen Lage für die Aufbahrung. So blieben die Augenlider auch geschlossen, aber Margaret legte sicherheitshalber immer noch etwas Creme auf, um die Feuchtigkeit zu halten und die Lider zu verkleben.
»Jetzt die Nadelpistole, John«, sagte sie. Ich legte die Watte weg und holte die Pistole vom Metalltisch an der Wand. Es war eine lange Metallröhre mit zwei Ösen für die Finger an der Seite, einer Spritze nicht unähnlich.
»Darf ich das dieses Mal machen?«
»Klar.« Sie zog die Oberlippe und die Wange der Toten zurück. »Genau hier.«
Ich setzte das Gerät sanft auf das Zahnfleisch und presste eine kleine Nadel in den Knochen. Die Zähne waren groß und gelb. Eine weitere Nadel kam in den Unterkiefer, danach spannten wir zwischen den Stiften einen Draht, der den Mund geschlossen hielt. Zuletzt schmierte Margaret etwas Creme auf ein kleines Plastikpolster, das ähnlich wie der Fruchtkeil einer Orange geformt war, und schob es in den Mund, damit alles an Ort und Stelle blieb.
Nachdem wir das Gesicht behandelt hatten, legten wir die Tote sorgfältig zurecht, streckten die Beine und überkreuzten die Arme in der klassischen Haltung auf der Brust. Sobald das Formaldehyd in die Muskeln eindringt, wird der Körper steif und sperrig. Deshalb muss man zuerst das Gesicht behandeln, denn die Angehörigen sollen keine entstellte Leiche ansehen müssen.
»Halt den Kopf fest«, sagte Margaret, und ich legte gehorsam links und rechts die Hände an die Schläfen der Toten, damit nichts wackelte. Margaret tastete unterdessen ein wenig über dem rechten Schlüsselbein umher, dann brachte sie der Toten am Halsansatz einen langen, nicht sehr tiefen Schnitt bei. Wenn man Tote aufschneidet, fließt praktisch kein Blut, denn sobald das Herz nicht mehr schlägt, fällt der Druck ab, und das Blut sammelt sich im Rücken der Toten. Da diese Leiche länger als gewöhnlich herumgelegen hatte, war ihr Oberkörper schlaff und leer, während der Rücken verfärbt war wie ein riesiger blauer Fleck. Margaret fuhr mit einem kleinen Metallhaken in den Schnitt, zog zwei große Venen heraus – nein, eigentlich waren es eine Arterie und eine Vene – und legte mit Fäden Schlingen darum. Die Blutgefäße waren purpurn und glatt, zwei elastische dunkle Schlaufen, die sich ein paar Zentimeter aus dem Körper ziehen ließen und anschließend wieder hineinglitten. Danach drehte Margaret sich um und bereitete die Pumpe vor.
Den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie viele verschiedene Chemikalien zum Einbalsamieren nötig sind, und wenn man sie einmal zu sehen bekommt, dann fallen vor allem die bunten Farben auf. Jede Flasche – das Formaldehyd, die gerinnungshemmenden Zusätze, die Ätzmittel und die anderen Sachen – hat eine eigene Farbe, die manchmal sogar an Fruchtsaft erinnert. Insgesamt ist die Reihe der Flüssigkeiten bunt wie ein Bonbonladen. Margaret wählte die Chemikalien sorgfältig aus, als dächte sie über die Zutaten für eine Suppe nach. Nicht jeder Körper brauchte jede Chemikalie, und es war ebenso sehr eine Kunst wie eine Wissenschaft, für jede Leiche das richtige Rezept zu finden. Während sie sich damit beschäftigte, ließ ich den Kopf los und nahm das Skalpell zur Hand. Ich durfte nicht immer die Einschnitte vornehmen, aber wenn ich es tat, während Mutter und Margaret nicht hinschauten, bekam ich eigentlich nie Ärger. Außerdem war ich ganz gut darin, was für mich sprach.
Margaret würde die freigelegte Arterie benutzen, um den Chemiecocktail, den sie gerade ansetzte, in den Körper zu pumpen. So konnten wir die alten Körperflüssigkeiten wie Blut und Wasser aus der ebenfalls freigelegten Vene herauspressen und durch einen Schlauch zum Ablauf im Boden leiten. Manchmal wunderte ich mich, dass letzten Endes alles im Abwasserkanal landete, aber ehrlich gesagt, wo sonst? Unser Abfall ist nicht schlimmer als alles andere da unten. Ich hielt die Arterie ruhig und schnitt sie langsam auf, ohne sie völlig zu durchtrennen. Als das Loch groß genug war, schob ich eine dicke Metallkanüle hinein. Die Arterie fühlte sich wie ein dünner Gummischlauch an und war von kleinen Muskeln und Kapillaren überzogen. Danach legte ich die Metallröhre vorsichtig auf die Brust der Toten und machte einen ähnlichen Einschnitt in die Vene. Dieses Mal brachte ich jedoch einen Anschluss an, der mit einem durchsichtigen Plastikschlauch verbunden war. Der Schlauch schlängelte sich bis zum Abfluss im Fußboden. Zuletzt zog ich die Fäden an, die Margaret um die Blutgefäße gelegt hatte, um sie abzubinden.
»Das sieht gut aus«, lobte mich Margaret, als sie die Pumpe auf dem Gestell zum Tisch schob. Der Apparat war auf Rädern montiert, damit er zur Seite gefahren werden konnte und nicht störte. Jetzt aber bekam er den Ehrenplatz mitten im Raum, als Margaret den Schlauch mit der Kanüle verband, die ich in die Arterie eingeführt hatte. Sie prüfte kurz die Versiegelung, nickte anerkennend und kippte die erste Chemikalie – ein hell orangefarbenes Mittel, um die Blutgerinnsel aufzulösen – oben in den Behälter der Pumpe. Dann drückte sie auf einen Knopf, und die Pumpe erwachte polternd zum Leben. Sie klapperte wie ein echter Herzmuskel. Margaret beobachtete sie genau und verstellte dabei einige Knöpfe, die Druck und Geschwindigkeit regelten. Rasch stieg der Druck im Körper der Toten an, und bald darauf verschwand dunkles dickes Blut im Abfluss.
»Wie geht’s in der Schule?« Margaret zog einen Gummihandschuh aus und kratzte sich am Kopf.
»Bin ja erst seit zwei Tagen da«, entgegnete ich. »In der ersten Woche passiert nicht viel.«
»Immerhin, es ist deine erste Woche auf der Highschool«, wandte sie ein. »Das muss doch ziemlich aufregend sein.«
»Nein, eigentlich nicht«, antwortete ich.
Das Antigerinnungsmittel war fast durch, und nun goss Margaret einen hellblauen Festiger in die Pumpe, damit die Blutgefäße bereit waren, das Formaldehyd aufzunehmen. »Hast du schon neue Freunde gefunden?«
»Ja«, erwiderte ich. »Im Sommer ist eine komplette Schule neu in die Stadt gekommen, deshalb hänge ich wunderbarerweise nicht mehr mit den Leuten herum, die ich schon aus dem Kindergarten kenne, und natürlich wollen sie sich alle mit dem verrückten Jungen anfreunden. Das ist wirklich klasse.«
»Du solltest dich nicht über dich selbst lustig machen.«
»Eigentlich habe ich mich eher über dich lustig gemacht.«
»Das solltest du auch nicht tun.« Margaret grinste leicht. Sie holte weitere Chemikalien, die sie in den Behälter kippte. Da die beiden vorbereitenden Mittel inzwischen den Körper durchspülten, mischte sie nun die eigentliche Einbalsamierungsflüssigkeit. Sie sollte die Feuchtigkeit halten und das Wasser weich machen, damit das Gewebe nicht anschwoll. Sie enthielt Konservierungsstoffe und keimtötende Mittel, damit der Körper in einem ansehnlichen Zustand blieb (so gut das in diesem Stadium überhaupt noch möglich war), außerdem Färbemittel, die der Toten eine rosige, natürliche Hautfarbe verliehen. Der Schlüssel zu alledem ist natürlich das Formaldehyd, ein starkes Gift, das alles im Körper abtötet, die Muskeln härtet, die Organe konserviert und das eigentliche »Einbalsamieren« erledigt. Margaret gab also einen ordentlichen Schuss Formaldehyd hinein, worauf ein schweres grünes Parfüm folgte, um den stechenden Geruch zu überdecken. Im Behälter der Pumpe schwappte jetzt eine knallbunte Pampe wie in den Saftautomaten einer Tankstelle. Margaret schloss den Deckel und scheuchte mich hinaus. Der Ventilator war nicht stark genug, um mit so starken Formaldehyddämpfen fertig zu werden. Inzwischen war es völlig dunkel geworden, und die Stadt war still. Ich setzte mich auf die Hintertreppe, während Margaret sich an die Wand lehnte und durch die offene Tür beobachtete, ob auch nichts schiefging.
»Hast du denn schon Hausaufgaben bekommen?«, fragte sie.
»Ich muss übers Wochenende die Einführungen meiner Schulbücher lesen, wie es alle braven Schüler tun, und in Geschichte soll ich einen Aufsatz schreiben.«
Margaret musterte mich prüfend und gab sich große Mühe, gelassen zu bleiben. Doch sie presste die Lippen zusammen und blinzelte nervös. Ich kannte sie schon lange und wusste, dass sie sich wegen irgendetwas Sorgen machte.
»Welches Thema?«, fragte sie.
Ich ließ mir nichts anmerken. »Wichtige Gestalten der amerikanischen Geschichte.«
»Das wären dann beispielsweise George Washington oder Lincoln?«
»Ich hab den Aufsatz schon geschrieben.«
»Das ist gut«, sagte sie, aber es kam nicht von Herzen. Sie schwieg kurz, doch dann gab sie jegliche Zurückhaltung auf. »Muss ich raten, oder erzählst du mir freiwillig, über welchen deiner Psychopathen du geschrieben hast?«
»Sie sind nicht meine Psychopathen.«
»John …«
»Dennis Rader«, murmelte ich und blickte zur Straße. »Sie haben ihn erst vor ein paar Jahren geschnappt. Deshalb fand ich es nett, weil es noch halbwegs aktuell ist.«
»John, Dennis Rader ist der BTK-Killer. Er ist ein Mörder. Du solltest große Gestalten beschreiben, keinen …«
»Der Lehrer wollte, dass wir uns mit bedeutenden Gestalten beschäftigen, nicht mit großen Staatsmännern. Also gelten auch Verbrecher«, erwiderte ich. »Er nannte sogar John Wilkes Booth als Beispiel.«
»Zwischen einem politischen Attentäter und einem Serienkiller besteht ein großer Unterschied.«
»Ich weiß«, antwortete ich und sah sie wieder an. »Deshalb habe ich ja über den Mörder geschrieben.«
»Du bist wirklich ein kluger Junge«, sagte Margaret. »Das meine ich ernst. Wahrscheinlich bist du der einzige Schüler, der mit seinem Aufsatz schon fertig ist. Aber du kannst doch nicht … es ist nicht normal, John. Ich hatte wirklich gehofft, du würdest diese Besessenheit für Mörder irgendwann mal ablegen.«
»Keine einfachen Mörder«, widersprach ich. »Serienmörder.«
»Das unterscheidet dich vom Rest der Menschheit. Wir sehen da nämlich keinen Unterschied.« Damit ging sie wieder hinein, um die Galle und das Gift und alle anderen Körperflüssigkeiten abzusaugen, bis die Leiche sauber und rein war. Ich dagegen blieb draußen, starrte zum Himmel und wartete.
Ich wusste nicht worauf.
Wir bekamen Jeb Jolleys Leiche weder an diesem noch in den folgenden paar Tagen herein. Die ganze Woche verbrachte ich in atemloser Erwartung und eilte jeden Nachmittag nach Hause, um zu sehen, ob sie schon eingetroffen war. Es fühlte sich an wie Weihnachten. Der Gerichtsmediziner hielt die Leiche allerdings länger fest als gewöhnlich, um eine volle Autopsie durchzuführen. Das bedeutete, dass er den Toten aufschnitt und untersuchte, wie und wann er gestorben war und wer ihn umgebracht hatte. Der Clayton Daily brachte jeden Tag etwas über den Todesfall und bestätigte schließlich sogar, dass die Polizei wegen Mordes ermittelte. Ihrem ersten Eindruck zufolge hatte ein wildes Tier Jeb getötet, doch es gab anscheinend mehrere Hinweise, nach denen auf eine vorsätzliche Tat zu schließen war. Welcher Art diese Hinweise waren, verriet man natürlich nicht. Das war das sensationellste Ereignis, das es in meinem ganzen Leben im Clayton County gegeben hatte.
Am Donnerstag bekamen wir unsere Geschichtsaufsätze zurück. Ich hatte die volle Punktzahl, und am Rand stand: »Interessante Wahl!« Maxwell, der Typ, mit dem ich oft zusammen war, bekam zwei Punkte Abzug wegen des geringen Umfangs und zwei weitere wegen schlechter Rechtschreibung. Er hatte nur eine halbe Seite über Albert Einstein eingereicht und den Namen jedes Mal anders geschrieben.
»Über Einstein gibt es ja auch nicht viel zu sagen«, verteidigte sich Max, als wir in der Cafeteria der Schule in einer Ecke saßen. »Er hat e = mc2 und die Atombombe entdeckt, und das war’s auch schon. Ich bin froh, dass ich überhaupt eine halbe Seite zusammenbekommen habe.«
Eigentlich konnte ich Max nicht besonders gut leiden, und das war fast das Normalste an mir, weil auch sonst niemand Max mochte. Er war klein und ziemlich dick, trug eine Brille, benutzte einen Inhalator und hatte jede Menge Kleidungsstücke aus zweiter Hand im Schrank. Außerdem war er vorlaut und nervig und redete im Brustton der Überzeugung mit Vorliebe über Dinge, von denen er nichts verstand. Anders ausgedrückt, verhielt er sich wie die Schulrowdys, ohne aber deren Körperkraft oder Charisma zu besitzen. Das alles passte mir gut, weil er obendrein eine Eigenschaft besaß, die ich bei Schulfreunden ganz besonders schätzte – er redete gern, und es war ihm egal, ob ich ihm zuhörte oder nicht. Das war ein Teil meines Plans, möglichst unauffällig zu bleiben. Allein waren wir ein verrückter Junge, der mit sich selbst redete, und ein anderer verrückter Junge, der mit überhaupt niemandem sprach. Zusammen waren wir zwei verrückte Jungs, die beinahe so etwas wie einen Dialog führten. Es war nicht viel, aber dadurch wirkten wir ein wenig normaler. Zweimal falsch ergibt einmal richtig.
Die Clayton Highschool war alt und fiel auseinander wie alles andere in der Stadt. Mit Bussen wurden die Kinder aus dem ganzen County herkutschiert, schätzungsweise ein Drittel der Schüler kam von Farmen und aus Orten jenseits der Stadtgrenze. Einigen Mitschülern war ich noch nie begegnet, weil es manche der weit draußen lebenden Familien vorzogen, ihre Kinder daheim zu unterrichten, bis diese die Highschool besuchen konnten, aber die meisten kannte ich schon aus dem Kindergarten. Nach Clayton kamen keine neuen Leute. Fremde fuhren auf dem Interstate vorbei und warfen einen flüchtigen Blick auf die Stadt. Sie lag neben dem Highway und vergammelte wie ein totes Tier.
»Über wen hast du geschrieben?«, wollte Max wissen.
»Was?« Ich hatte gar nicht zugehört.
»Ich habe gefragt, über wen du deinen Aufsatz geschrieben hast«, wiederholte er. »Ich tippe auf John Wayne.«
»Warum sollte ich mich für John Wayne entscheiden?«
»Weil du nach ihm benannt bist.«
Er hatte recht – mein voller Name lautet John Wayne Cleaver. Meine Schwester heißt Lauren Bacall Cleaver. Mein Vater war ein großer Fan dieser alten Filme.
»Wenn man nach jemandem benannt ist, heißt das nicht, dass er auch interessant ist«, widersprach ich, während ich das Gedränge beobachtete. »Warum hast du nicht etwas über Maxwell House geschrieben?«
»Ist das ein Mann?«, fragte Max. »Ich dachte, das sei eine Kaffeemarke.«
»Ich habe über Dennis Rader geschrieben. Er war der BTK-Killer.«
»Was ist das denn?«
»Bind, torture, kill – fesseln, foltern, töten«, erklärte ich ihm. »Dennis Rader hat alle Briefe, die er an die Medien schickte, mit BTK unterschrieben.«
»Das ist krank, Mann«, erwiderte Max. »Wie viele hat er denn umgebracht?« Anscheinend fand er es doch nicht so widerlich.
»Etwa zehn«, sagte ich. »Die Polizei ist noch nicht sicher.«
»Nur zehn? Das ist doch gar nichts. Du könntest schon mehr als zehn töten, wenn du bloß eine Bank ausraubst. Der Kerl, den du letztes Jahr in deinem Projekt behandelt hast, war viel besser.«
»Es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen jemand umbringt«, widersprach ich, »und es ist auch nicht cool. Es ist falsch.«
»Warum redest du dann die ganze Zeit über solche Leute?«, wollte Max wissen.
»Weil falsche Sachen interessant sind.« Ich war kaum noch bei der Sache. Vor allem dachte ich darüber nach, wie cool es wäre, eine Leiche zu bekommen, an der man eine Autopsie vorgenommen hatte.
»Du bist verrückt, Mann«, sagte Max und biss wieder in sein Sandwich. »Mehr kann ich dazu nicht sagen. Eines Tages wirst du einen Haufen Leute umbringen. Wahrscheinlich sogar mehr als zehn, weil du so ein Streber bist, und dann komme ich ins Fernsehen und werde gefragt, ob ich das schon vorher geahnt habe, und ich antworte: ›Und ob, ja, dieser Kerl war echt bekloppt.‹«
»Dann muss ich wohl dich zuerst umbringen«, entgegnete ich.
»Nette Idee.« Max lachte und zückte seinen Inhalator. »Ich bin so ungefähr dein einziger Freund auf der Welt. Du kannst mich nicht umbringen.« Er verpasste sich eine Prise und steckte die Spraydose wieder in die Tasche. »Außerdem war mein Dad in der Army, und du bist ein dürrer Emo. Das möchte ich mal sehen, wie du das probierst.«
»Jeffrey Dahmer«, warf ich ein. Wieder hatte ich nur mit halbem Ohr zugehört.
»Was?«
»Mein Projekt im letzten Jahr hat sich um Jeffrey Dahmer gedreht. Er war ein Kannibale, der mehrere Köpfe im Kühlschrank aufbewahrte.«
»Jetzt erinnere ich mich.« Max’ Blick verdüsterte sich. »Ich habe von deinen Postern Albträume bekommen. Das war krass.«
»Albträume sind gar nichts«, gab ich zurück. »Die Poster hat mir übrigens ein Therapeut geschenkt.«
Ich war schon lange von Serienmördern fasziniert – um nicht zu sagen besessen – gewesen. Aber erst mein Aufsatz über Jeffrey Dahmer in der letzten Woche auf der Mittelschule hatte meine Mutter und meine Lehrer veranlasst, sich Sorgen zu machen und mir eine Therapie zu verordnen. Mein Therapeut war Dr. Ben Neblin, den ich den ganzen Sommer über an jedem Mittwochmorgen aufgesucht hatte. Wir hatten über vieles geredet, etwa darüber, dass mein Vater nicht mehr bei uns lebte und wie eine Leiche aussah oder wie schön ein Feuer war, aber meist hatten sich unsere Gespräche um Serienmörder gedreht. Er hatte zugegeben, dass ihm das Thema nicht behagte. Sein Unbehagen hatte mich aber nicht aufhalten können. Meine Mutter bezahlte die Therapie, und ich hatte sonst kaum jemanden zum Reden, also musste Neblin herhalten.
Mit Beginn des Schuljahrs im Herbst hatten wir die Sitzungen auf den Donnerstagnachmittag verlegt. Sobald meine letzte Stunde vorbei war, lud ich mir den Rucksack mit den viel zu vielen schweren Büchern auf und strampelte die sechs Blocks zu seinem Büro. Auf halbem Weg bog ich jedoch am alten Theater ab und schlug einen Umweg ein. Der Waschsalon war nur zwei Blocks entfernt, und ich wollte an der Stelle vorbeifahren, wo Jeb getötet worden war.
Das Absperrband der Polizei war endlich verschwunden, und der Waschsalon war geöffnet, aber leer. In der Rückwand gab es nur ein einziges Fenster: klein, vergittert und gelb getönt. Vermutlich die Toilette. Den Platz hinter dem Gebäude konnte man von der Straße aus nicht einsehen. Deshalb, so hieß es in der Zeitung, gestalteten sich die polizeilichen Ermittlungen schwierig. Niemand hatte den Angriff gesehen oder gehört. Man nahm allerdings an, dass er um zehn Uhr abends stattgefunden hatte, als die meisten Bars noch geöffnet gewesen waren. Wahrscheinlich war Jeb auf dem Heimweg nach dem Besuch in einem Lokal umgekommen. Ich rechnete damit, auf dem Asphalt mit Kreide gezeichnete Umrisse vorzufinden – einmal den Körper und dann den Haufen Innereien daneben. Doch man hatte den ganzen Bereich mit einem Hochdruckreiniger behandelt, und das Blut und der Kies waren restlos verschwunden.
Ich lehnte mein Fahrrad an die Wand und ging gebückt langsam hin und her, um zu erkunden, ob es noch irgendwelche Spuren gab. Der Asphalt lag im Schatten, war kühl und, nachdem die losen Steinchen weggespült waren, beinahe spiegelglatt. Sogar einen Teil der Mauer hatte man geschrubbt. Mit etwas Phantasie konnte ich mir leicht vorstellen, wo die Leiche gelegen hatte. Ich kniete nieder, und als ich den Boden betrachtete, entdeckte ich hier und dort ein paar purpurne Flecken, wo sich das geronnene Blut am Stein festgeklammert und dem Wasser widerstanden hatte.
Bald danach fand ich auch einen dunklen Klecks, ungefähr so groß wie meine Hand, aber dunkler und zäher als Blut. Ich kratzte mit dem Fingernagel darüber und stieß auf etwas, das sich anfühlte wie fettiger Ruß, als hätte jemand einen Holzkohlengrill nicht ordentlich gesäubert. Ich wischte mir die Finger an der Hose ab und richtete mich auf.
Es war seltsam, an der Stelle zu stehen, wo jemand gestorben war. Auf der Straße fuhren langsam die Autos vorbei, das Brummen war wegen der Mauern und der Entfernung etwas gedämpft. Ich überlegte mir, was hier geschehen war – woher Jeb gekommen war, wohin er gewollt und warum er diesen Hinterhof als Abkürzung benutzt hatte, wo er gestanden hatte, als der Killer ihn angegriffen hatte. Vielleicht hatte er gefürchtet, zu spät zu einer Verabredung zu kommen, und war durch den Hof gelaufen, um Zeit zu sparen, oder er war betrunken gewesen, hatte gefährlich geschwankt und nicht mehr genau gewusst, wo er war. Vor meinem inneren Auge sah ich sein rotes Gesicht. Grinsend, weil er nichts vom lauernden Tod ahnte.
Auch den Angreifer stellte ich mir vor und überlegte – nur einen Moment lang –, wo ich mich versteckt hätte, wenn ich hier jemanden hätte töten wollen. Auf dem Hof gab es selbst am Tag viel Schatten. Der Zaun, die Mauern und der Boden bildeten seltsame Winkel. Vielleicht hatte der Mörder hinter einem Zementklotz gewartet oder hinter einem Telefonmast gehockt. Ich stellte mir vor, wie er im Dunkeln gelauert und mit scharfen Augen den betrunken stolpernden und wehrlosen Jeb beobachtet hatte.
War er hungrig gewesen? Oder zornig? Die ständig wechselnden Theorien der Polizei warfen nur noch mehr Fragen auf. Welcher Angreifer konnte so brutal und doch so überlegt zuschlagen, dass die Hinweise sowohl auf einen Menschen als auch auf ein Tier deuteten? Ich dachte an spitze Krallen und schimmernde Zähne, die im Mondlicht einen Körper so brutal zerfetzten, dass das Blut in hohem Bogen an die Wand dahinter spritzte. Einen Teil der Wand hatte man bis fast zum Dach abgewaschen. Ein Beleg für die Wildheit des Angriffs.
Ich trieb mich noch eine Weile herum und nahm nicht ohne Schuldgefühle alles begierig in mich auf. Dr. Neblin würde nach dem Grund meiner Verspätung fragen und mit mir schimpfen, wenn ich ihm sagte, wo ich gewesen war, aber darüber machte ich mir keine Sorgen. Dadurch, dass ich hergekommen war, hatte ich an den Grundlagen von etwas Größerem und Tieferem gekratzt und kleine Stücke aus einer Mauer geschlagen, die ich nicht durchbrechen durfte. Hinter dieser Mauer lauerte ein Monster, und ich hatte die Barriere extrastark gebaut, um es im Zaum zu halten. Jetzt regte und reckte es sich und träumte unruhige Träume. Anscheinend war nun ein neues Monster in der Stadt – würde es durch seine Gegenwart dasjenige wecken, das ich versteckt hielt?
Zeit zu gehen. Ich kehrte zu meinem Fahrrad zurück und fuhr die letzten paar Blocks bis zu Neblins Praxis.
»Heute habe ich eine meiner Regeln gebrochen«, berichtete ich, während ich durch das Rollo zur Straße hinausblickte. Wie in einer unordentlichen Parade fuhren glänzende Autos vorbei. Ich spürte Dr. Neblins aufmerksamen Blick im Nacken.
»Eine deiner eigenen Regeln?«, fragte er. Seine Stimme klang gleichmütig und ruhig. Er war einer der ruhigsten Menschen, die ich je kennengelernt hatte, aber andererseits war ich meist mit Mom, Margaret und Lauren zusammen. Seine Gelassenheit war einer der Gründe, warum ich ihn freiwillig aufsuchte.
»Ich habe Regeln«, sagte ich, »damit ich nichts … Falsches tue.«
»Kannst du ein Beispiel nennen?«
»Meinen Sie für die Dinge, die ich nicht falsch machen will, oder für meine Regeln?«
»Mich würde beides interessieren, aber du kannst beginnen, wo du willst.«
»Dann beginnen wir lieber mit den Dingen, die ich vermeiden will«, entschied ich. »Die Regeln sind ja unverständlich, wenn Sie darüber nichts wissen.«
»In Ordnung.« Ich drehte mich wieder zu ihm um. Er war klein, weitgehend kahl und trug eine kleine Brille mit runden Gläsern und einem dünnen schwarzen Gestell. Immer lag ein Notizblock vor ihm, und gelegentlich schrieb er etwas auf, wenn wir uns unterhielten. Das machte mich nervös, aber ich durfte seine Notizen jederzeit sehen, wenn ich wollte. Er schrieb nie etwas wie »Was für ein Irrer« oder »Der Bursche ist verrückt«, sondern einfach nur Kleinigkeiten, die ihm halfen, sich an unsere Gespräche zu erinnern. Ich bin sicher, dass er irgendwo auch ein Buch hatte, in dem »Was für ein Irrer« stand, aber das hielt er unter Verschluss. Falls er vorher keins besessen hatte, war er nach den ersten Sitzungen mit mir sicher auf diese Idee gekommen.
»Ich glaube«, sagte ich und beobachtete sein Gesicht genau, »das Schicksal will, dass ich ein Serienkiller werde.«
Er zog eine Augenbraue hoch, nichts weiter. Ich sagte ja schon, dass er sehr ruhig war.
»Tja«, erwiderte er. »Offensichtlich bist du von Serienmördern fasziniert. Du hast vermutlich mehr über sie gelesen als jeder andere in der Stadt, mich selbst eingeschlossen. Willst du denn wirklich ein Serienkiller werden?«
»Natürlich nicht«, antwortete ich. »Ich will ganz sicher vermeiden, ein Serienkiller zu werden. Ich weiß nur nicht, wie günstig meine Aussichten sind.«
»Also versuchst du unter anderem zu vermeiden – was denn? Haufenweise Menschen umzubringen?« Er beäugte mich mit einem verschlagenen Ausdruck, was bedeutete, dass er einen Scherz machte. Wenn wir über schwierige Dinge sprachen, gab er oft sarkastische Bemerkungen zum Besten. Ich glaube, das war seine Art, mit seinen Ängsten umzugehen. Einmal, nach meiner Schilderung, wie ich Schicht um Schicht ein totes Erdhörnchen seziert hatte, waren sogar drei Scherze nacheinander gekommen, und er hatte beinahe gekichert. »Wenn du eine so wichtige Regel gebrochen hast«, fuhr er nun fort, »dann muss ich die Polizei einschalten, ob du nun mein Patient bist oder nicht.«
Die Gesetze über die Vertraulichkeit zwischen Arzt und Patient hatte er mir in einer unserer ersten Sitzungen erklärt, als wir über Brandstiftung gesprochen hatten. Wenn er der Ansicht war, ich hätte ein Verbrechen begangen oder plante, eines zu begehen, oder wenn er glaubte, ich sei eine reale Gefahr für andere Menschen, dann war er nach dem Gesetz verpflichtet, die Behörden einzuschalten. Außerdem erlaubte ihm das Gesetz, alles, was ich sagte, mit meiner Mutter zu besprechen, ob er nun einen guten Grund dazu hatte oder nicht. Im Sommer hatten die beiden zahlreiche Diskussionen geführt, und anschließend hatte mir meine Mutter das Leben zur Hölle gemacht.
»Die Handlungen, die ich vermeiden will, liegen ein paar Stufen niedriger als ein Mord«, sagte ich. »Serienkiller sind in gewisser Weise praktisch immer die Sklaven ihrer eigenen Zwänge. Sie töten, weil sie töten müssen, sie können sich nicht beherrschen. Da ich nicht bis zu diesem Punkt kommen will, habe ich Regeln für kleinere Dinge aufgestellt – etwa die, dass ich keinen Menschen allzu lange beobachten darf. Wenn ich es doch mal tue, dann bemühe ich mich, den Betreffenden eine ganze Woche lang nicht zu beachten und nicht einmal mehr über ihn nachzudenken.«
»Demnach hast du Regeln aufgestellt, die dich an untergeordneten Verhaltensweisen von Serienmördern hindern sollen«, sagte Neblin, »weil du den großen Taten so fern wie möglich bleiben willst.«
»Genau.«
»Es ist interessant«, sagte er, »dass du das Wort Zwänge benutzt hast. Das klammert die Frage der Verantwortung aus.«
»Aber ich rede doch über Verantwortung«, wandte ich ein. »Ich versuche ja, mich daran zu hindern.«
»Das ist richtig«, stimmte er zu, »und das ist bewundernswert. Andererseits hast du dieses Gespräch mit der Bemerkung eingeleitet, das Schicksal wolle dich zu einem Serienmörder machen. Wenn du dir sagst, es sei deine Bestimmung, ein Serienmörder zu werden, weichst du dann nicht der Verantwortung aus, indem du dem Schicksal die Schuld gibst?«
»Ich sagte Schicksal, weil es hier um mehr als eigenartige Verhaltensweisen geht«, erklärte ich. »Es gibt einige Aspekte in meinem Leben, die ich nicht kontrollieren kann und die sich nur durch das Schicksal erklären lassen.«
»Was denn zum Beispiel?«
»Ich trage den Namen eines Serienmörders«, sagte ich. »John Wayne Gacy tötete in Chicago dreiunddreißig Menschen und begrub die meisten unter seinem Haus.«
»Deine Eltern haben dich nicht nach John Wayne Gacy benannt«, widersprach Neblin. »Ob du es glaubst oder nicht, ich habe deine Mutter danach gefragt.«
»Wirklich?«
»Ich bin klüger, als man vermuten sollte«, sagte er. »Du musst auch bedenken, dass eine einzige zufällige Verbindung zu einem Serienmörder noch kein Schicksal formt.«
»Mein Vater hieß Sam«, fuhr ich fort. »Damit bin ich der Sohn des Sam – so nannte sich der Serienmörder in New York, der behauptete, ein Hund habe ihn veranlasst, die Menschen zu töten.«
»Damit hast du zwei zufällige Verbindungen zu Serienmördern«, antwortete er. »Ich muss zugeben, dass dies ein wenig seltsam ist, vermag jedoch immer noch keine kosmische Verschwörung gegen dich zu erkennen.«
»Mein Nachname lautet Cleaver«, fuhr ich fort. »Ich bin ein Hackmesser. Wie viele Menschen kennen Sie, die nach zwei Serienmördern und einer Mordwaffe benannt sind?«
Dr. Neblin rutschte auf seinem Stuhl hin und her und tippte mit dem Stift auf das Notizpapier. Das bedeutete, dass er angestrengt nachdachte. »John«, sagte er nach einer Weile, »ich wüsste gern, welche Dinge dich besonders ängstigen. Deshalb möchte ich zurückspringen und etwas betrachten, das du vorhin gesagt hast. Könntest du mir einige deiner Regeln beschreiben?«
»Über das Beobachten anderer Menschen habe ich schon etwas gesagt«, antwortete ich. »Das ist eine wichtige Regel. Ich beobachte gern andere Menschen, aber ich weiß, dass ich mich zu sehr für sie interessieren könnte, wenn ich sie zu lange beobachte – ich könnte beginnen, ihnen zu folgen, herausfinden, wohin sie gehen, mit wem sie reden und was in ihnen vorgeht. Vor ein paar Jahren wurde mir bewusst, dass ich ein Mädchen auf der Schule regelrecht beschattet habe – ich bin ihr praktisch überallhin gefolgt. So etwas kann viel zu schnell zu weit gehen, und deshalb habe ich eine Regel aufgestellt: Wenn ich jemanden zu lange beobachte, beachte ich ihn eine ganze Woche lang nicht.«
Neblin nickte, unterbrach mich aber nicht. Ich war froh, dass er nicht nach dem Namen der Mitschülerin fragte, denn ich hatte das Gefühl, bereits meine Regeln zu brechen, wenn ich nur über sie sprach.
»Außerdem habe ich eine Regel in Bezug auf Tiere«, fuhr ich fort. »Sie erinnern sich doch an das Erdhörnchen?«
Neblin lächelte gequält. »Ich schon, das Erdhörnchen vermutlich nicht.« Seine nervösen Witze wurden immer schlechter.
»Das war nicht das einzige Mal«, sagte ich. »Mein Dad hat früher im Garten Fallen für Erdhörnchen und Maulwürfe und so weiter aufgestellt, und es war meine Aufgabe, die Fallen jeden Morgen zu überprüfen und mit einer Schaufel alle Tiere zu erschlagen, die noch nicht tot waren. Mit sieben habe ich angefangen, sie aufzuschneiden, weil ich wissen wollte, wie sie innen aussahen, aber damit habe ich aufgehört, als ich mich für Serienmörder zu interessieren begann. Haben Sie schon einmal von Macdonalds Triade gehört?«
»Die drei Merkmale, die bei fünfundneunzig Prozent aller Serienmörder auftreten«, erwiderte Dr. Neblin. »Bettnässen, Pyromanie und Tierquälerei. Ich muss zugeben, dass alle drei auf dich zutreffen.«
»Das fand ich mit acht heraus«, fuhr ich fort. »Was mir aber wirklich unter die Haut ging, war nicht die Tatsache, dass Tierquälerei ein Vorbote für gewalttätiges Verhalten gegenüber Menschen sein könnte, sondern vielmehr, dass ich es bis dahin überhaupt nicht für falsch gehalten hatte. Ich hatte Tiere getötet und zerlegt und dabei ungefähr die gleichen Gefühle gehabt wie ein Kind, das mit Legosteinen spielt. Irgendwie waren die Tiere für mich keine Lebewesen, sondern nur Spielzeuge gewesen, die ich eben benutzt hatte. Gegenstände und keine Geschöpfe.«
»Warum hast du damit aufgehört, obwohl du gar nicht das Gefühl hattest, dass es falsch war?«, wollte Dr. Neblin wissen.
»An diesem Punkt wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass ich anders bin als die anderen«, erklärte ich. »Ich hatte die ganze Zeit etwas getan, ohne mir etwas dabei zu denken, und auf einmal fand ich heraus, dass alle anderen Menschen es für abscheulich hielten. Da wurde mir klar, dass ich mich ändern musste, und deshalb stellte ich Regeln auf. Die erste lautete: Quäl keine Tiere.«
»Töte sie nicht?«
»Tu ihnen überhaupt nichts«, ergänzte ich. »Ich wollte kein Haustier haben, ich wollte auf der Straße keine Hunde streicheln und nicht einmal ein Haus betreten, in dem ein Tier gehalten wird. Ich vermeide jede Situation, die mich verleiten könnte, etwas Verbotenes zu tun.«
Neblin betrachtete mich eine Weile. »Gibt es noch weitere Regeln?«, fragte er.
»Wann immer ich den Wunsch verspüre, jemandem wehzutun«, sagte ich, »mache ich ihm ein Kompliment. Wenn mir jemand wirklich auf die Nerven geht, bis ich ihn so sehr hasse, dass ich ihn umbringen könnte, dann sage ich etwas Nettes und setze mein strahlendstes Lächeln auf. Das zwingt mich, freundliche Gedanken und keine bösen zu haben, und meistens verschwinden die bösen Gedanken dann wie von selbst.«
Wieder überlegte Neblin eine Weile, ehe er antwortete. »Liest du deshalb so viel über Serienkiller?«, fragte er. »Weil du nicht wie andere Menschen zwischen Richtig und Falsch unterscheiden kannst, willst du herausfinden, was du vermeiden musst?«
Ich nickte. »Es ist natürlich auch ziemlich cool, so was zu lesen.«
Er machte sich Notizen.
»Welche Regel hast du heute gebrochen?«, fragte er.
»Ich bin zu der Stelle gegangen, wo Jeb Jolleys Leiche gefunden wurde«, erwiderte ich.
»Ich habe mich schon gewundert, dass du ihn nicht längst erwähnt hast«, sagte er. »Gibt es auch eine Regel, den Tatorten von Gewaltverbrechen fernzubleiben?«
»Eigentlich nicht. Deshalb konnte ich auch vor mir rechtfertigen, mir den Tatort anzusehen. Ich habe keine bestimmte Regel gebrochen, aber ich habe gegen ihren Geist verstoßen.«
»Warum bist du hingegangen?«
»Weil dort jemand getötet wurde«, sagte ich. »Ich … ich musste es einfach sehen.«
»Warst du ein Sklave deiner Zwänge?«, fragte er.
»Das sollten Sie aber nicht gegen mich verwenden.«
»Mir bleibt nichts anderes übrig«, erwiderte Neblin. »Ich bin Therapeut.«
»In der Leichenhalle sehe ich ständig Tote«, fuhr ich fort. »Das ist aber ganz in Ordnung. Mom und Margaret arbeiten schon seit Jahren dort und sind auch keine Serienmörderinnen. Ich sehe eine Menge lebendige und tote Menschen, war aber noch nie Zeuge, wie ein lebendiger Mensch sich in einen Toten verwandelte. Ich bin … neugierig.«
»Bietet dir der Schauplatz eines Verbrechens die Möglichkeit, dem Verbrechen nahezukommen, ohne es selbst zu begehen?«
»Ja«, gab ich zu.
»Hör mal, John.« Neblin beugte sich vor. »Du zeigst, wie ich zugeben muss, einige Aspekte des Verhaltens eines Serienmörders. Sogar mehr, als ich je bei einem Menschen beobachtet habe. Dabei darfst du jedoch nicht vergessen, dass diese Aspekte lediglich Hinweise darauf sind, was passieren könnte, aber keine Vorhersage erlauben, dass es auch passieren wird. Fünfundneunzig Prozent der Serienmörder machen ins Bett, legen Feuer und quälen Tiere, aber das heißt nicht, dass fünfundneunzig Prozent aller Kinder, die dies tun, zwangsläufig Serienmörder werden. Du hast immer die Möglichkeit, dein Schicksal frei zu wählen, und du bist derjenige, der entscheidet. Niemand sonst. Die Tatsache, dass du dir Regeln aufgestellt hast und sie gewissenhaft befolgst, sagt viel über dich und deinen Charakter aus. Du bist ein guter Mensch, John.«
»Ich bin ein guter Mensch, weil ich weiß, wie gute Menschen sich verhalten, und weil ich sie kopiere«, antwortete ich.
»Wenn du so gründlich bist, wie du behauptest«, erklärte Neblin, »wird niemand jemals einen Unterschied bemerken.«
»Aber wenn ich mal nicht gründlich genug bin?« Ich blickte aus dem Fenster. »Wer weiß, was dann geschieht?«
Mom und ich aßen in unserer Wohnung über der Leichenhalle schweigend zu Abend. Die Pizzaschachtel und der Fernseher ersetzten das Gemeinschaftsgefühl und die Gespräche einer echten Beziehung. Gerade liefen die Simpsons. Es war Samstagabend, und wir hatten Jebs Leiche immer noch nicht bekommen. Wenn die Polizei ihn noch lange behielt, konnten wir ihn überhaupt nicht mehr einbalsamieren, sondern mussten ihn in einen Beutel stecken und sofort den Sargdeckel auflegen.
Mom und ich waren uns nie einig, welche Pizza wir nehmen sollten, deshalb ließen wir sie immer in der Mitte teilen. Auf meiner Seite gab es Salami und Pilze, auf ihrer Peperoni. Sogar die Simpsons waren ein Kompromiss. Da jeder Kanalwechsel zu einem Streit geführt hätte, ließen wir den Apparat einfach laufen.
In der ersten Werbepause legte Mom die Hand auf die Fernbedienung, was gewöhnlich bedeutete, dass sie den Ton abschalten und über irgendetwas reden wollte – was wiederum zur Folge hätte, dass wir uns streiten würden. Sie legte den Finger auf den Stumm-Knopf, ohne zu drücken. Wenn sie so lange zögerte, ehe sie anfing, wollte sie vermutlich über etwas wirklich Übles sprechen. Dann aber zog sie die Hand zurück, nahm sich ein Stück Pizza und biss ab.
So verfolgten wir angespannt den nächsten Abschnitt der Sendung, während wir schon wussten, was kommen würde, und unsere Angriffe planten. Ich spielte mit dem Gedanken, aufzustehen und mich unter der Deckung des Zeichentrickfilms zu verdrücken, aber damit hätte ich sie nur gequält. So kaute ich langsam und schaute wie betäubt zu, während Homer kreischend auf dem Bildschirm herumraste.
Dann kam die nächste Werbeunterbrechung, und dieses Mal verharrte der Finger meiner Mutter nur kurz über dem Knopf, ehe sie ihn drückte. Sie kaute, schluckte hinunter und legte los.
»Ich habe heute mit Dr. Neblin gesprochen«, begann sie.
Ich hatte mir schon gedacht, dass es damit zu tun hatte.
»Er meinte … also, er hat mir einiges höchst Interessantes erzählt.« Sie blickte unverwandt zum Fernseher, zur Wand und zur Decke. Überallhin, nur nicht in meine Richtung. »Möchtest du mir etwas sagen?«
»Danke, dass du mich zum Therapeuten schickst, und es tut mir leid, dass ich überhaupt einen Therapeuten brauche?«
»Sei nicht so schnippisch, John. Vor uns liegen große Schwierigkeiten, und ich würde gern einen großen Teil davon bewältigen, ehe wir schnippisch werden.«
Ich holte tief Luft und blickte zum Fernseher. Die Simpsons liefen wieder, ohne Ton genauso hektisch wie sonst. »Was hat er denn gesagt?«
»Er meinte, dass du …« Jetzt blickte sie mich an, das schwarze Haar zurückgekämmt, die grünen Augen voller Sorgen. Sie war fast vierzig, ihrer Ansicht nach noch recht jung, doch an Abenden wie diesem, wenn wir uns im fahlen Schein des Fernsehapparats stritten, kam sie mir verhärmt und verlebt vor. »Er sagte, du denkst darüber nach, jemanden zu töten.« Sie hätte mich nicht ansehen sollen. Sie hätte mir nicht so etwas sagen sollen, ohne von Gefühlen überwältigt zu werden. Wenigstens wurde sie rot, und ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Das ist komisch«, erwiderte ich. »Das habe ich nicht gesagt. Bist du sicher, dass er sich ganz genau so ausgedrückt hat?«
»Auf die Worte kommt es hier nicht an«, beharrte sie. »Es ist kein Scherz, John, es ist bitterer Ernst. Die … ich weiß nicht. Soll das wirklich so für uns enden? Du bist alles, was ich noch habe, John.«
»Tatsächlich sagte ich ihm, dass ich strikte Regeln befolge, um dafür zu sorgen, dass ich nichts Falsches tue. Ich dachte, darüber könntest du dich freuen, aber stattdessen giftest du mich an. Deshalb brauche ich die Therapie.«
»Wie kann ich über einen Sohn glücklich sein, der Regeln braucht, damit er niemanden umbringt?«, gab sie zurück. »Ich bin auch nicht glücklich darüber, dass mir ein Psychologe erklärt, mein Sohn sei ein Soziopath. Ich bin nicht glücklich, wenn …«
Ende der Leseprobe