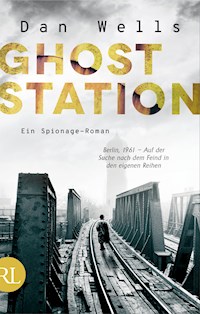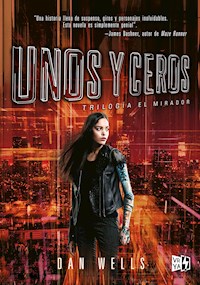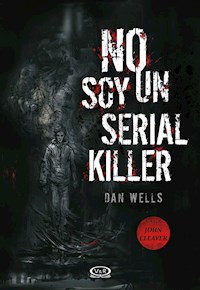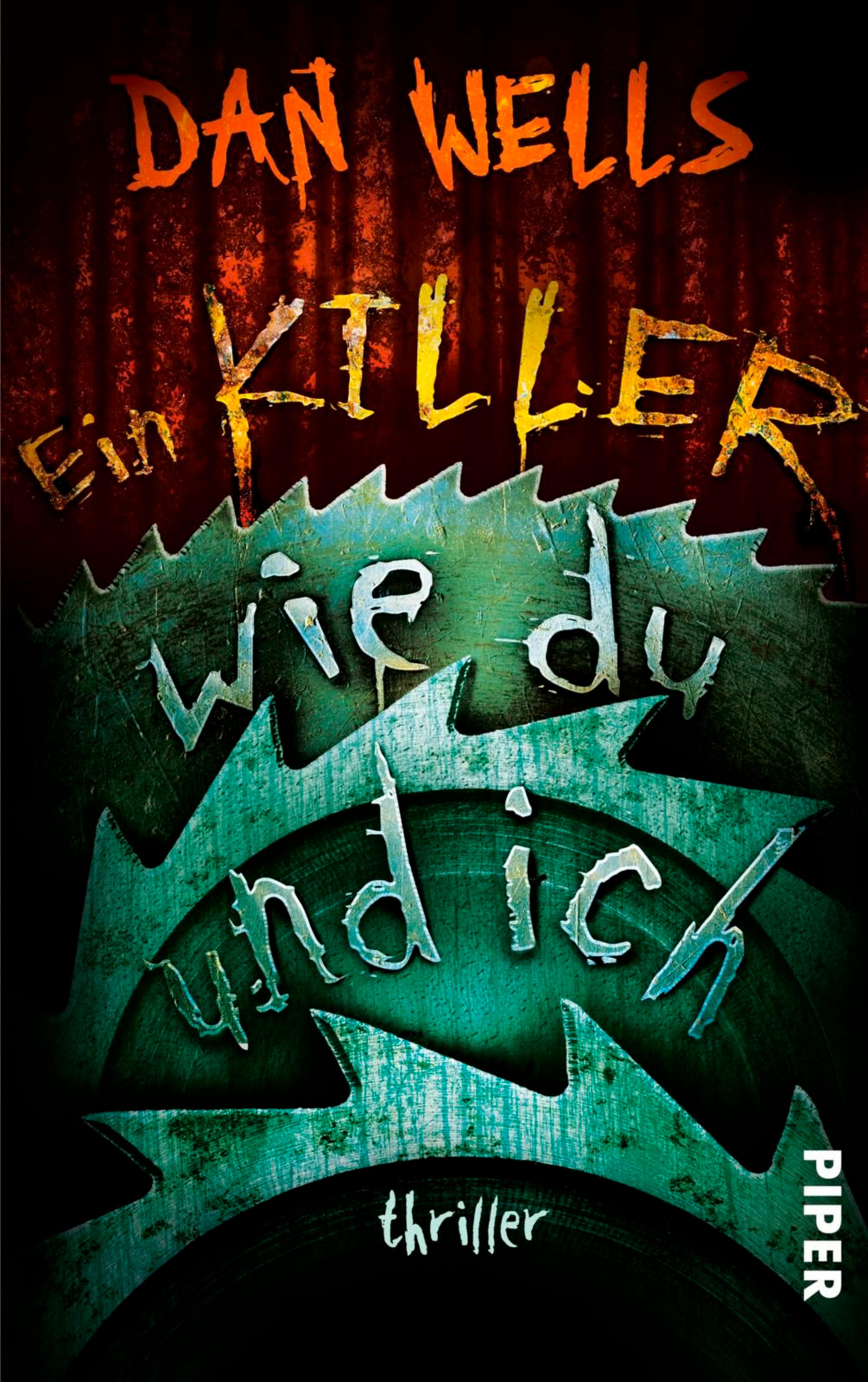9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
In ferner Zukunft wurde die Menschheit durch den Isolationskrieg fast vollständig vernichtet - besiegt von den Partials, künstlichen Kriegern, die die Menschen selbst erschaffen hatten, um an ihrer Stelle zu kämpfen. Eine der letzten Überlebenden ist Kira Walker, die erfahren hat, dass sie selbst ein verhängnisvolles Erbe in sich trägt, von dem sie nichts ahnte. Auf der Suche nach ihrer eigenen Herkunft muss sie sich ausgerechnet auf die Hilfe zweier Partials verlassen - Samm und Heron, die als Einzige ihr Geheimnis kennen. Kiras Weg führt sie durch das verwüstete Land, das der Isolationskrieg aus dem nordamerikanischen Kontinent gemacht hat - und dort wird sie dem schrecklichsten Feind begegnen, den die Menschheit je gekannt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Lesen was ich will!
www.lesen-was-ich-will.de
Dieses Buch ist allen gewidmet, die sich schon einmal zu einem Irrtum bekannt haben. Das ist kein Anzeichen von Schwäche oder mangelnder Entschlossenheit, sondern eine der größten Stärken, die eine Person – ob Mensch oder Partial – überhaupt an den Tag legen kann.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Jürgen Langowski
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96623-8
© 2013 Dan Wells Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Fragments. Partials 2« bei Balzer + Bray, HarperCollins, New York Deutschsprachige Ausgabe: © ivi, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München Coverabbildung: FinePic
®
, München; Trinette Reed, Getty Images; Christophe Dessaigne, Trevillion Images Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
ERSTER TEIL
1
»Trinken wir auf den besten Offizier in Neu-Amerika«, sagte Hector.
Hundert Stimmen erhoben sich im Raum, Gläser klirrten. »Cornwell! Cornwell!« Die Männer stießen mit Bechern und Flaschen an und leerten sie in einem glucksenden Chor, setzten Gläser und Flaschen entschlossen ab oder warfen sie sogar zu Boden, wenn sich kein Alkohol mehr darin befand. Samm beobachtete alles schweigend und stellte das Spektiv ein wenig nach. Das Fenster war trüb, doch er konnte die Soldaten drinnen sehen, wie sie grinsten und Grimassen schnitten, einander auf den Rücken klopften, über derbe Scherze lachten und sich bemühten, den Colonel nicht anzusehen. Über den Link erfuhren sie ohnehin alles Wissenswerte über Cornwell.
Samm hatte sich außer Reichweite des Links auf der anderen Talseite zwischen den Bäumen versteckt und musste auf diesen Luxus verzichten.
Er verstellte den Knopf am Dreibein und verschob das Mikrofon um den Bruchteil eines Millimeters nach links. Auf diese Entfernung führte selbst eine winzige Veränderung des Winkels zu einer deutlichen Verlagerung des erfassten Bereichs. Stimmen drangen ihm ans Ohr. Abgerissene Worte und Gesprächsfetzen stürmten auf ihn ein, und dann hörte er eine Stimme, die ihm fast so vertraut war wie die von Hector. Sie gehörte Adrian, Samms altem Sergeant.
»… nicht wissen, was sie getroffen hat«, sagte Adrian gerade. »Die feindlichen Linien wurden genau wie geplant zerschmettert, aber in den ersten paar Minuten war es umso gefährlicher. Die Gegner waren desorientiert und feuerten blindlings in alle Richtungen, und wir mussten in Deckung bleiben und konnten ihn nicht unterstützen. Cornwell hielt unerschütterlich seinen Sektor, ohne mit der Wimper zu zucken. Die ganze Zeit heulte der Wachhund so laut, dass wir fast taub wurden. Kein Wachhund war jemals seinem Herrn so treu ergeben wie dieser. Er betete Cornwell an. Das war die letzte größere Schlacht, die es überhaupt in Wuhan gab, und zwei Tage später gehörte uns die Stadt.«
Samm erinnerte sich an das Gefecht. Fast auf den Tag genau vor sechzehn Jahren im März 2061 war Wuhan erobert worden, eine der letzten Städte, die im Isolationskrieg gefallen waren. Für Samm war es mehr oder weniger der erste Einsatz gegen den Feind gewesen. Alle Geräusche, Gerüche und den beißenden Schießpulverdunst nahm er wieder wahr, bis ihm vor Erinnerungen der Schädel brummte. Über den Link kamen Phantomdaten herein, die seinen Adrenalinausstoß noch verstärkten. Der Kampfinstinkt erwachte, als er auf der dunklen Anhöhe hockte und sich für eine Schlacht wappnete, die es nur in seiner Vorstellung gab. Fast sofort setzte die Gegenreaktion ein – eine sehr beruhigende Vertrautheit. Seit Tagen hatte er sich mit niemandem mehr verlinkt, und das Gefühl, das unversehens in ihm aufstieg, war fast schmerzhaft behaglich, ob es nun auf realen Gegebenheiten beruhte oder nicht. Er schloss die Augen und hielt daran fest, konzentrierte sich auf die Erinnerungen und wollte ihnen noch einmal und viel stärker nachspüren. Nach einigen flüchtigen Augenblicken entglitten sie ihm jedoch. Er war allein. Er öffnete die Augen und blickte wieder durch das Spektiv.
Die Männer hatten inzwischen den Proviant ausgepackt. Auf breiten Metalltabletts türmte sich dampfendes Fleisch. In Connecticut gab es zahlreiche Rotten verwilderter Schweine, die jedoch meist im tiefen Wald blieben, weit entfernt von den Siedlungen der Partials. Wenn die Männer ein solches Festmahl veranstalten konnten, hatten sie offenbar einen ausgedehnten Jagdausflug unternommen. Samm blieb ruhig, obwohl ihm bei dem Anblick der Magen knurrte.
In der Ferne merkten die Soldaten kurz auf. Alle zeigten im gleichen Augenblick die gleiche Reaktion, weil der Link sie vor etwas warnte, das Samm nur ahnen konnte. Der Colonel, dachte er und drehte das Spektiv, um Cornwell zu beobachten. Er sah wirklich schlimm aus, wie er da bei lebendigem Leib verfiel und verweste, aber der Brustkorb hob und senkte sich noch, und auf den ersten Blick war nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Höchstens ein schmerzliches Zucken. Die Männer in dem Raum achteten nicht darauf, und Samm beschloss, ihrem Beispiel zu folgen. Anscheinend war Cornwells Zeit noch nicht gekommen, und die Party ging weiter. Samm belauschte eine Unterhaltung, in der es um die alten Zeiten im Isolationskrieg ging. Hier und dort fing er auch eine Geschichte über die Revolution auf, aber nichts vermochte seine Erinnerungen so stark zu beflügeln wie die Erzählung des Sergeants. Irgendwann wurde der Anblick der Schweinerippchen und das Schmatzen unerträglich, und Samm zog behutsam einen Plastikbeutel mit gedörrtem Rindfleisch aus seinem Rucksack. Es war ein schlechter Ersatz für die saftigen Koteletts, die sich seine früheren Kameraden schmecken ließen, aber immer noch besser als nichts. Dann blickte er wieder durch das Spektiv und sah, wie Major Wallace sich erhob und eine Ansprache hielt.
»Lieutenant Colonel Richard Cornwell ist nicht in der Lage, heute zu Ihnen zu sprechen, aber es ist mir eine Ehre, in seinem Namen ein paar Worte zu sagen.« Wallace bewegte sich in jeder Hinsicht langsam, was den Gang und die Gesten, aber auch die Sprechweise betraf. Jede Regung war gemessen und bewusst. Äußerlich war er nicht älter als Samm, ein achtzehnjähriger junger Mann, doch in Wahrheit war er schon beinahe zwanzig und seinem Verfallsdatum nahe. In wenigen Monaten, vielleicht schon in einigen Wochen, würde er genauso verwesen wie Cornwell. Samm fröstelte und zog die Jacke eng um die Schultern.
Nun wurde die Gruppe so still, wie Samm es bereits war. Wallace’ Stimme füllte mühelos den ganzen Saal und hallte blechern in Samms Kopfhörern. »Ich hatte die Ehre, mein ganzes Leben lang unter dem Colonel zu dienen. Er zog mich persönlich aus dem Bruttank und führte mich durch das Ausbildungslager. Er ist ein besserer Mensch als die meisten, die mir begegnet sind, und er war immer ein guter Anführer. Wir haben keine Väter, aber ich stelle mir vor, dass mein Vater ein Mann wie Richard Cornwell gewesen wäre, wenn wir Väter hätten.«
Er hielt inne. Samm schüttelte den Kopf. Abgesehen von der biologischen Abstammung war Cornwell tatsächlich ihr Vater. Er hatte sie unterwiesen, sie angeführt, sie beschützt und alles getan, was die Aufgabe eines Vaters gewesen wäre. Alles, was Samm niemals selbst tun könnte. Er stellte den Zoom seines Spektivs nach und holte das Gesicht des Majors so nahe wie möglich heran. Tränen entdeckte er nicht, nur die tief in den Höhlen liegenden müden Augen.
»Man hat uns gemacht, damit wir sterben«, fuhr der Major fort. »Wir sollten töten und fallen. Unser Leben diente nur zwei Zielen, und das erste haben wir vor fünfzehn Jahren erreicht. Manchmal denke ich, das Grausamste bei allem war nicht das Verfallsdatum, sondern die Spanne von fünfzehn Jahren, die wir warten mussten, bis wir es herausfanden. Für die Jüngsten unter euch ist es am schwersten, weil ihr als Letzte untergehen werdet. Wir wurden im Krieg geboren, wir haben Ruhm erworben, und nun befinden wir uns auf dem Abstellgleis und sehen einander beim Sterben zu.«
Wieder zuckten die Partials in dem Raum zusammen, dieses Mal sprangen einige sogar auf. Samm schwenkte das Spektiv wild hin und her und suchte den Colonel, doch da er das Gesicht des Majors herangezoomt hatte, verlor er den Überblick. Hilflos und wie in Panik suchte er einige Sekunden lang und hörte die Rufe »Der Colonel!« oder »Die Zeit ist gekommen!«. Schließlich gab Samm auf, fuhr das Spektiv zurück und zoomte aus fast anderthalb Kilometern Entfernung neu heran. Er fand das Bett des Colonels am Ehrenplatz ganz vorn im Raum und beobachtete, wie der alte Mann sich schüttelte und hustete. Aus den Mundwinkeln rannen schwarze Blutstropfen. Er sah bereits aus wie eine Leiche. Die Zellen degenerierten, der Körper verfiel so schnell, dass man dabei schier zusehen konnte. Er stammelte etwas, schnitt eine Grimasse, hustete und lag wieder still. Schweigen herrschte in dem Raum.
Mit versteinertem Gesicht beobachtete Samm, wie die Soldaten das Todesritual vollzogen. Ohne ein einziges Wort zu sprechen, öffneten sie alle Fenster, zogen die Vorhänge zurück und schalteten die Ventilatoren ein. Menschen weinten, wenn sie mit Tod konfrontiert wurden. Sie hielten Reden, klagten und knirschten mit den Zähnen. Die Partials trauerten, wie es nur ihnen möglich war: über den Link. Ihre Körper waren für das Schlachtfeld erschaffen. Wenn sie starben, setzten sie einen Datenstrom frei, um ihre Gefährten vor der Gefahr zu warnen. Und wenn diese es fühlten, setzten sie ihrerseits Daten frei, um die Warnung weiter zu verbreiten. Die Ventilatoren surrten, wälzten die Luft um und bliesen die Daten in die Welt hinaus, damit jeder sich verlinken und erfahren konnte, dass ein großer Mann gestorben war.
Samm wartete angespannt, während ihm der Wind über das Gesicht strich. Er sehnte sich nach der Gemeinschaft und schreckte zugleich davor zurück. Es war eine Verbindung, die ihn quälte, diese Nähe und zugleich die Trauer. Es war niederschmetternd, wie häufig in letzter Zeit beides zusammenfiel. Unter ihm im Tal bewegten sich die Blätter an den Bäumen. Leise wiegten sich die Zweige, als der Wind hindurchstrich. Die Daten erreichten ihn nicht.
Er war zu weit entfernt.
Samm packte Spektiv und Richtmikrofon ein und verstaute beides zusammen mit der kleinen Solarbatterie im Rucksack. Zweimal suchte er seinen Lagerplatz ab und vergewisserte sich, dass er nichts vergessen hatte. Der Plastikbeutel mit dem Essen steckte schon wieder im Ranzen, die Kopfhörer waren im Rucksack verstaut, das Gewehr hatte er sich über die Schulter geschlungen. Selbst die Abdrücke des Dreibeins in der Erde glättete er mit dem Stiefel, bis es keine Spuren mehr gab.
Schließlich warf er einen letzten Blick auf die Beerdigung des Colonels, setzte die Gasmaske auf und schlich zurück in sein Exil. In jenem Lagerhaus war kein Platz für Deserteure.
2
Die Sonne schien durch die Lücken zwischen den Hochhäusern hindurch und malte gezackte gelbe Dreiecke auf die rissigen Straßen. Kira Walker hockte tief in der Straßenschlucht hinter einem verrosteten Taxi und beobachtete aufmerksam die Umgebung. Aus dem aufgeplatzten Asphalt wuchsen Büsche und kleine Bäume, die reglos in der Windstille standen. Kein Laut war in der Stadt zu hören.
Dennoch hatte sich irgendetwas bewegt.
Kira legte das Gewehr an und hoffte, mithilfe des Zielfernrohrs einen besseren Blick zu haben. Dann erinnerte sie sich – wie schon unzählige Male zuvor –, dass ihr Zielfernrohr vergangene Woche bei dem Erdrutsch entzweigegangen war. Fluchend ließ sie das Gewehr sinken. Sobald ich hier fertig bin, muss ich ein Waffengeschäft finden und das blöde Teil ersetzen. Sie spähte die Straße entlang und bemühte sich, Umrisse und Schatten zu unterscheiden. Wieder murmelte sie Flüche und setzte die Waffe abermals an. Alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Schließlich zog sie den Kopf ein und kroch zum Heck des Taxis zurück. Dreißig Meter entfernt ragte ein Lieferwagen halb in die Straße hinein. Der Kastenaufbau sollte ihr Deckung geben vor allem, was sich dort unten herumtrieb. Sie spähte, starrte fast eine Minute lang auf die verlassene Straße, knirschte mit den Zähnen und rannte los. Kein Kugelhagel setzte ein, weder Geklapper noch Gebrüll waren zu hören. Der Lieferwagen erfüllte seinen Zweck. Sie ging in Deckung, sank auf ein Knie und spähte an der Stoßstange vorbei.
Eine Elenantilope zog durch das Unterholz. Die gedrehten langen Hörner ragten hoch auf, die lange Zunge tastete nach Sprossen und Grünzeug im Schutt. Kira wartete ab und beobachtete aufmerksam die Umgebung. Die Bewegung, die sie zuvor wahrgenommen hatte, war vermutlich nicht von der harmlosen Antilope ausgegangen. Über ihr flog ein kreischender Rotkardinal vorbei, kurz danach kam ein weiterer. Die hellroten Farbtupfer wirbelten umeinander, wichen einander aus und jagten sich zwischen den Stromleitungen und den Ampeln. Unterdessen knabberte die Elenantilope friedlich und selbstvergessen an den kleinen grünen Blättern eines Ahornschösslings. Kira beobachtete das Tier, bis sie sicher war, dass es sonst nichts zu sehen gab, und wartete vorsichtshalber noch eine Weile. In Manhattan konnte man gar nicht vorsichtig genug sein. Bei ihrem letzten Besuch hatten die Partials angegriffen, und bei diesem Ausflug waren ihr bereits ein Bär und ein Panther auf den Fersen gewesen. Als sie sich daran erinnerte, hielt sie inne, wandte sich um und überprüfte das Gelände hinter sich. Nichts. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich, um zu fühlen, ob Partials in der Nähe waren, doch es klappte nicht. Es hatte noch nie geklappt. Noch nie hatte sie bewusst etwas Brauchbares aufgefangen, selbst dann nicht, als sie eine ganze Woche in engem Kontakt zu Samm verbracht hatte. Auch Kira war eine Partial, aber sie war anders – anscheinend fehlten ihr der Link und einige andere Eigenschaften. Außerdem wuchs und alterte sie wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Eigentlich wusste sie nicht, was sie war und wen sie hätte fragen sollen. Mit wem hätte sie reden können? Nur Samm und die verrückte Partialwissenschaftlerin Dr.Morgan wussten, was sie war. Nicht einmal ihren Freund und engsten Vertrauten Marcus hatte sie eingeweiht.
Sie schauderte und schnitt eine Grimasse, als sich die scheußliche Verwirrung einstellte, die immer auf solche selbstkritischen Fragen folgte. Genau das will ich hier herausfinden, dachte sie. Ich brauche Antworten auf meine Fragen.
Sie setzte sich auf den löcherigen Asphalt und lehnte sich an den platten Reifen des Lieferwagens. Wieder einmal holte sie ihren Notizblock hervor, obwohl sie die Adresse längst auswendig kannte: Vierundvierzigste, Ecke Lexington. Sie hatte Wochen gebraucht, um die Adresse herauszufinden, und dann noch einmal mehrere Tage, um sich durch die Ruinen einen Weg hierher zu bahnen. Vielleicht war sie auch viel zu vorsichtig …
Unwirsch schüttelte sie den Kopf. Zu vorsichtig konnte man hier gar nicht sein. Die unbesiedelten Gebiete waren viel zu gefährlich, man durfte keinerlei Risiko eingehen, und Manhattan war sogar noch gefährlicher als die meisten anderen Gegenden. Sie hatte sorgfältig auf ihre Sicherheit geachtet und war noch am Leben. Eine Strategie, die sich als so wirkungsvoll erwiesen hatte, wollte sie nicht hinterfragen.
Noch einmal betrachtete sie die Adresse, dann wanderte ihr Blick zu den verwitterten Straßenschildern hinüber. Keine Frage – sie war am richtigen Ort. Sie schob den Block in die Hosentasche und wog das Gewehr in der Hand. Es wurde Zeit hineinzugehen.
Zeit, ParaGen einen Besuch abzustatten.
Das Bürogebäude war einst mit Glastüren und Fenstern vom Boden bis zur Decke ausgestattet gewesen. Nach dem Zusammenbruch hatten die Glaselemente nicht lange gehalten, und nun war das ganze Erdgeschoss der Witterung ausgesetzt. Dies war nicht der Hauptsitz von ParaGen – die Zentrale lag irgendwo im Westen auf der anderen Seite des Landes –, aber es war besser als nichts. Eine Finanzabteilung, die in Manhattan eingerichtet worden war, um als Schnittstelle zu den Buchhaltungen der anderen Konzerne zu dienen. Sie hatte Wochen gebraucht, um die Existenz dieses Büros herauszufinden. Kira tappte durch die Reste der geborstenen Sicherheitsverglasung und wich den Trümmern der Fassadenverkleidung aus, die sich in den oberen Stockwerken gelöst hatte. Nach elf Jahren der Verwahrlosung war auch der Boden im Innern von einer dicken Erdschicht bedeckt, aus der mittlerweile Unkraut und kleine Gräser hervorwuchsen. Niedrige Bänke, einst mit glattem Kunststoff bespannt, hatten im Sonnenlicht und im Regen gelitten und waren anscheinend von Katzenkrallen zerfetzt worden. Ein breiter Schreibtisch, an dem vermutlich früher eine Empfangsdame gesessen hatte, war vermodert und stand schief, ringsum lagen vergilbte Hausausweise verstreut. Einer Wandtafel war zu entnehmen, dass dieses Gebäude mehrere Dutzend Firmen beherbergt hatte. Kira überflog die verwitterten Buchstaben, bis sie ParaGen gefunden hatte: zwanzigstes Stockwerk. In der Wand hinter dem Empfangstisch gab es drei Aufzugtüren, eine hing schief im Rahmen. Kira kümmerte sich nicht weiter darum und ging zu der Tür in der hinteren Ecke, die zum Treppenhaus führte. Daneben war eine schwarze Tafel in die Wand eingelassen. Es war die Sensortafel einer elektrischen Verriegelung, die ohne Strom völlig nutzlos war. Die Scharniere stellten vermutlich das größte Problem dar. Kira stemmte sich gegen die Tür, schob sanft, um den Widerstand zu prüfen, dann fester, weil sich die alten Scharniere sperrten. Endlich gab die Tür nach, und sie konnte das turmhohe Treppenhaus betreten.
»Zwanzigster Stock.« Sie seufzte. »Na klar.«
Es war gefährlich, in den alten Gebäuden herumzuklettern, da sie schon im ersten Winter nach dem Zusammenbruch verwüstet worden waren: die Fenster geborsten, die Leitungen geplatzt. Im Frühling hatte sich in den Räumen und Wänden die Feuchtigkeit eingenistet. Zehnmal Frost und Tauwetter später, und die Wände waren verzogen, die Decken hingen durch, die Fußböden zersetzten sich. Der Schimmel eroberte das Holz und die Teppiche, Insekten bewohnten die Risse, die ehemals stabilen Gebäude verwandelten sich in gefährliche Türme aus Krümeln und Bruchstücken. Der Schutt, der noch nicht heruntergefallen war, wartete nur auf einen Tritt, einen Schritt oder eine laute Stimme, um zu Boden zu krachen. Größere Gebäude und besonders solche, die so neu waren wie dieses, erwiesen sich als erheblich widerstandsfähiger – ihr Gerippe bestand aus Stahl, das Fleisch aus versiegeltem Beton und Kohlenstofffasern. Die Haut, wenn man das Bild so weit treiben wollte, war natürlich trotzdem schwach – Glas, Putz, dünne Steinplatten und Teppiche –, aber das Gebäude selbst stand unerschütterlich. Das Treppenhaus, in dem Kira sich nun befand, war außerordentlich gut erhalten, staubig, ohne verdreckt zu sein, und die abgestandene Luft verriet, dass es seit dem Zusammenbruch mehr oder weniger gut versiegelt gewesen war. Es war gespenstisch wie eine Grabkammer, obwohl hier, soweit sie es sehen konnte, niemand gestorben war. Sie fragte sich, ob sie weiter oben auf Tote stoßen würde. Falls jemand die Treppe hinuntergelaufen war, als das RM-Virus ihn erwischt hatte, war er hier eingeschlossen worden. Doch als sie das zwanzigste Stockwerk erreichte, hatte sie noch kein einziges Opfer entdeckt. Sie spielte mit dem Gedanken, weiter hinaufzusteigen, um die seit zwanzig Stockwerken aufgestaute Neugierde zu befriedigen, entschied sich aber dagegen. In einer Stadt dieser Größe gab es genügend Leichen. Die Hälfte der Autos auf den Straßen war mit Toten besetzt, und in den Häusern und Büros lagen Millionen weitere. Ein Toter mehr oder weniger in einem verlassenen alten Treppenhaus änderte überhaupt nichts. Sie stemmte die quietschende Tür auf und betrat die Niederlassung von ParaGen.
Natürlich war dies nicht das Hauptbüro, das sie ein paar Wochen zuvor auf einem Foto gesehen hatte: sie selbst als Kind, ihr Vater und ihre Adoptivmutter Nandita vor einem großen gläsernen Gebäude, hinter dem sich schneebedeckte Berge erhoben. Sie wusste nicht, wo das Gebäude stand, und erinnerte sich nicht, wann das Foto aufgenommen worden war. Und ganz gewiss konnte sie sich nicht erinnern, Nandita schon vor dem Zusammenbruch gekannt zu haben. Aber was sollte sie machen? Sie war erst fünf gewesen, als die Welt untergegangen war, auf dem Foto vielleicht erst vier. Was hatte das zu bedeuten? Wer war Nandita überhaupt, und inwiefern stand sie mit ParaGen in Verbindung? Hatte sie dort gearbeitet? Und ihr Vater? Sie wusste noch, dass er in einem Büro gearbeitet hatte, war aber zu klein gewesen, um sich an Einzelheiten zu erinnern. Wenn Kira wirklich als Partial gelten musste, war sie dann das Ergebnis eines Experiments im Labor? Eines Unfalls? War sie ein Prototyp? Warum hatte Nandita ihr nichts davon erzählt?
Das war in gewisser Weise die wichtigste Frage überhaupt. Kira hatte fast zwölf Jahre bei Nandita gelebt. Die Vorstellung, dass die Frau die ganze Zeit Bescheid gewusst und nie ein Wort darüber verloren hatte, was Kira wirklich war, behagte ihr ganz und gar nicht.
Außerdem wurde sie schon wieder nervös, genau wie gerade vorher auf der Straße. Ich bin nicht echt, dachte sie. Ich bin eine künstliche Konstruktion, die sich für eine Person hält. Ich bin ebenso unecht wie das Natursteinimitat auf diesem Schreibtisch. Sie betrat den Vorraum und berührte den Empfangstisch, dessen Belag sich abschälte: angemalter Kunststoff über gepressten Plastikplatten. Noch nicht einmal richtig natürlich und erst recht nicht echt. Sie hob den Kopf, verdrängte das Unbehagen und konzentrierte sich auf ihre Aufgabe. Der Empfangsbereich war für die Verhältnisse in Manhattan geräumig – ein weitläufiger Raum voller aufgeplatzter Ledersofas mit einem zerklüfteten Felsgebilde, auf dem vermutlich früher ein Wasserfall oder ein Springbrunnen geplätschert hatte. An der Wand hinter dem Empfangstisch hing das Firmenzeichen von ParaGen aus massivem Metall, das sie schon auf dem Foto im Hintergrund gesehen hatte. Sie öffnete ihren Beutel, zog das sorgfältig gefaltete Bild heraus und verglich die Symbole. Identisch. Dann steckte sie das Foto wieder weg und trat hinter den Empfangstisch, um die Dokumente durchzusehen, die darauf verstreut waren. Wie das Treppenhaus besaß auch dieser Raum keine Öffnung nach draußen und war deshalb von den Naturgewalten verschont geblieben. Die Papiere waren alt und vergilbt, aber unversehrt und sogar geordnet. Überwiegend waren es Belanglosigkeiten: Telefonlisten, Firmenbroschüren, ein Taschenbuch, das die Empfangsdame gelesen hatte. Tödliche Liebe, lautete der Titel, auf dem Einband ein blutiger Dolch. Möglicherweise keine geeignete Lektüre, wenn gerade die Welt unterging, aber andererseits war die Empfangsdame während des Zusammenbruchs wahrscheinlich gar nicht mehr hier gewesen. Vermutlich hatte man sie evakuiert, als die RM-Seuche aus dem Ruder gelaufen war. Oder gleich nach Freisetzung des Virus – oder womöglich sogar noch früher, unmittelbar nach Beginn des Partialkriegs. Kira tippte mit einem Finger auf das Buch und bemerkte das Lesezeichen im letzten Viertel. Sie hat nicht mehr herausgefunden, wer wen mit tödlichen Folgen geliebt hat.
Kira überprüfte das Telefonverzeichnis. Einige der vierstelligen internen Nummern begannen mit einer 1, einige mit einer 2. Vielleicht hing es damit zusammen, dass dieses Büro zwei Stockwerke des Gebäudes einnahm. Sie blätterte die Seiten durch und fand hinten eine Liste mit längeren Nummern. Jede hatte zehn Ziffern, einige begannen mit 1303, andere mit 1312. Sie wusste aus Gesprächen mit Erwachsenen, die sich an die alte Welt erinnerten, dass es sich um Vorwahlnummern für verschiedene Landesteile gehandelt hatte, doch sie konnte die Nummern nicht zuordnen, und das Verzeichnis half ihr nicht weiter.
Die Broschüren waren ordentlich in einer Ecke des Schreibtischs aufgestapelt. Auf der Vorderseite prangte eine stilisierte Doppelhelix über einem Bild des Gebäudes, das Kira auf dem Foto gesehen hatte, allerdings aus einem anderen Blickwinkel aufgenommen. Kira nahm die Broschüre in die Hand, betrachtete sie genauer und entdeckte zahlreiche ähnliche Gebäude im Hintergrund. Besonders auffällig war ein mächtiger hoher Turm, der anscheinend aus großen Glaswürfeln bestand. Unten auf der Seite stand in Schreibschrift: Besser werden als das, was wir sind. Die inneren Seiten zeigten viele lächelnde Gesichter und Verkaufsargumente für Genmodifikationen – kosmetische Veränderungen der Augen- oder Haarfarbe, Eingriffe zur Gesundheitsvorsorge, um Erbkrankheiten zu beseitigen oder die Widerstandskraft gegenüber anderen Leiden zu steigern, sogar Anpassungen, damit der Bauch flacher oder die Brüste größer wurden, um Körperkraft und Geschwindigkeit zu erhöhen, um die Sinne und die Reaktionszeit zu verbessern. Vor dem Zusammenbruch waren Genveränderungen sehr verbreitet gewesen. Fast alle Einwohner von Long Island hatten Veränderungen an sich vornehmen lassen. Selbst an den Seuchenbabys, den Kindern, die während des Zusammenbruchs zu klein gewesen waren, um sich an das vorherige Leben zu erinnern, waren gleich nach der Geburt verschiedene genetische Verbesserungen vorgenommen worden. Dies hatte als Standardverfahren in vielen Kliniken auf der ganzen Welt gegolten, und ParaGen hatte zahlreiche dieser Verfahren entwickelt. Kira hatte immer angenommen, sie habe die üblichen Modifikationen für Kinder erhalten, und sich gelegentlich gefragt, ob sie nicht noch einige weitere bekommen hatte. War sie eine gute Läuferin, weil sie entsprechende Gene von den Eltern geerbt hatte? Oder hatte sie dies einer frühen Genmodifikation zu verdanken? Wie sie inzwischen wusste, war sie so leistungsfähig, weil sie eine Partial war. Sie war in einem Labor als Idealbild des Menschen erschaffen worden.
Der hintere Teil der Broschüre handelte ausdrücklich von den Partials, die hier jedoch BioSynths genannt wurden, und es gab erheblich mehr Modelle, als sie erwartet hätte. Zuerst wurden die militärischen Partials vorgestellt, allerdings eher in Form einer Erfolgsgeschichte denn in Form von Produkten, die man erwerben konnte: eine Million erfolgreiche Feldversuche für die wichtigste Biotechnologie. Natürlich konnte man die Soldatenmodelle nicht kaufen, aber die Broschüre zeigte noch andere, weniger humanoid gestaltete Versionen dieser Produktfamilie: hyperintelligente Wachhunde, Löwen mit dicken Mähnen, die fügsam blieben und sich als Haustiere eigneten, sogar ein Geschöpf mit dem Namen MiniDrache®, das an eine geflügelte schlanke Eidechse in der Größe einer Hauskatze erinnerte. Die letzte Seite kündigte neue Arten von Partials an – Sicherheitskräfte auf der Grundlage des Soldatenmodells und weitere Versionen, die man online betrachten konnte. Bin ich das? Eine Wächterin, eine Liebessklavin oder was diese Leute sonst noch an krankem Mist verkauft haben? Sie las den Text noch einmal durch und suchte nach Hinweisen auf sich selbst, entdeckte jedoch nichts. Dann warf sie die Broschüre weg und nahm eine andere zur Hand, in der sich jedoch unter einem anderen Titelblatt der gleiche Inhalt verbarg. Auch dieses Heft warf sie fluchend weg.
Ich bin nicht nur ein Produkt aus einem Katalog, sagte sie sich. Jemand hat mich aus einem bestimmten Grund gemacht. Nandita ist aus einem bestimmten Grund bei mir geblieben und hat mich beobachtet. Bin ich eine Agentin, eine Schläferin? Ein Abhörgerät? Eine Meuchelmörderin? Doktor Morgan, die Partialwissenschaftlerin, die mich geschnappt hat, wäre vor Aufregung fast geplatzt, als sie herausfand, was ich bin. Einem kaltschnäuzigeren Menschen bin ich noch nie begegnet. Als sie aber überlegte, was ich sein könnte, bekam sie es mit der Angst zu tun.
Ich wurde aus einem bestimmten Grund erschaffen – doch ist es ein guter oder ein böser Grund?
Wie die Antwort auch lautete, in einer Firmenbroschüre war sie gewiss nicht zu finden. Sie nahm eins der Hefte und verstaute es in ihrem Rucksack, um später noch einmal darin zu lesen, ergriff das Gewehr und ging zur nächsten Tür. So hoch oben in dem Gebäude lauerten vermutlich keine Gefahren, aber … der Drache auf dem Bild hatte sie nervös gemacht. Sie hatte noch nie ein lebendiges Exemplar solcher Geschöpfe gesehen, weder den Drachen noch den Löwen oder etwas anderes, aber sie war besser vorsichtig. Sie befand sich in feindlichem Gebiet. Es sind künstliche Lebewesen, sagte sie sich. Sie wurden als abhängige, fügsame Haustiere erschaffen. Ich habe noch nie eins gesehen, weil sie alle tot sind. Zu Tode gehetzt von echten Tieren, die wissen, wie man in der Wildnis überlebt. Irgendwie bedrückte sie dieser Gedanke, und er beschwichtigte auch ihre Ängste nicht gerade. Sie musste jederzeit damit rechnen, auf Räume voller Leichen zu stoßen – hier waren so viele Menschen gestorben, dass die ganze Stadt im Grunde eine riesige Gruft war. Sie legte eine Hand an die Tür, nahm ihren Mut zusammen und stieß sie auf.
Von der anderen Seite wehte ein frischer Wind herein, der kräftiger roch als die abgestandene Luft im Vorraum und im Treppenhaus. Die Tür führte auf einen kurzen Flur, an dem mehrere Büros lagen. Am Ende des Gangs war eine ganze Fensterfront geborsten, und von dort strömte die Luft herein. Sie spähte in das erste Büro, dessen Tür von einem schwarzen Drehstuhl offen gehalten wurde, und keuchte überrascht auf, als drei gelbbraune Schwalben erschrocken aus ihrem Nest in einem Bücherregal aufflogen. Durch das zerstörte Fenster wehte der warme Wind herein und spielte mit ihren Haarsträhnen, die sie nicht in den Pferdeschwanz eingebunden hatte. Früher hatte der Raum wandhohe Fenster besessen, jetzt war er eine Höhle in einer Klippe. Vorsichtig spähte sie zu den überwucherten Ruinen der Stadt hinunter.
An der Tür stand der Name DAVID HARMON. Er hatte seinen Arbeitsplatz nüchtern eingerichtet: ein durchsichtiger Schreibtisch aus Plastik, ein Bücherregal, inzwischen voller Vogelkot, eine vergilbte weiße Tafel an der Wand. Kira schulterte das Gewehr und trat ein, um nach Akten zu suchen, die sie überfliegen konnte. Dieser Raum enthielt jedoch nichts, nicht einmal einen Computer, den sie ohne Strom allerdings sowieso nicht hätte untersuchen können. Sie trat an das Bücherregal und bemühte sich, die Titel zu lesen, ohne die Exkremente zu berühren. Reihe um Reihe Handbücher für die Buchhaltung. David Harmon war anscheinend Buchhalter gewesen. Kira sah sich noch einmal um und hoffte auf eine Entdeckung in letzter Minute, doch der Raum gab nichts weiter her. Sie kehrte auf den Flur zurück und versuchte es im nächsten Büro.
Zehn Räume später hatte sie immer noch nichts gefunden, was neues Licht auf die Rätsel hätte werfen können, sondern nur einige Kassenbücher und Aktenschränke, die leer oder mit Gewinnberechnungen gefüllt waren. ParaGen hatte unverschämt viel Geld verdient. So viel wusste sie inzwischen mit Sicherheit, aber sonst so gut wie nichts.
Die wirklich wichtigen Informationen steckten offenbar in den Computern, aber dieses Büro besaß keine PCs. Nachdenklich runzelte Kira die Stirn, denn nach allem, was sie über die alte Welt wusste, hatte man dort das meiste mit Computern erledigt. Warum fand sie in diesem Büro weder die Flachbildschirme noch die Metallkästen, auf die sie sonst fast überall gestoßen war? Sie seufzte vor Enttäuschung und schüttelte den Kopf. Selbst wenn sie die Computer fand, konnte sie nichts damit anfangen. Im Krankenhaus hatte sie einige Medicomps und Scanner benutzt, wenn es für eine Behandlung oder eine Diagnose notwendig gewesen war. Das waren aber überwiegend isolierte Maschinen gewesen, die einem einzigen Zweck gedient hatten. In der alten Welt hatten die Computer zu einem riesigen Netzwerk gehört, mit dem es sich augenblicklich quer über die ganze Welt kommunizieren ließ. Bücher, Musik und anscheinend auch ParaGens hinterhältige Pläne steckten in den Rechnern. Aber in diesen Büros gab es keine Computer …
Da steht allerdings ein Drucker. Sie hielt im letzten Büro der Etage inne und starrte einen Beistelltisch an. Dieser Raum war größer als die anderen, und an der Tür stand Guinevere Creech. Wahrscheinlich hatte hier die örtliche Vizepräsidentin residiert oder wie man ihren Posten sonst bezeichnet hatte. Auf dem Boden lagen leere Blätter. Das Papier war faltig und verfärbt, nachdem Regengüsse ungehindert durch die geborstenen Fenster eingedrungen waren. Den kleinen Kasten auf dem Beistelltisch hatte sie sofort als Drucker erkannt. Im Krankenhaus standen Dutzende davon herum, die jedoch nutzlos waren, weil es keine Tinte mehr gab. Einmal hatte man sie damit beauftragt, die Drucker von einem Lagerraum in einen anderen zu schaffen. Früher hatte man die Drucker benutzt, um die Dokumente direkt vom Computer auszugeben. Wenn hier ein Drucker stand, dann musste es folglich mindestens einen Computer geben. Sie hob das Gerät auf und untersuchte es genauer. Kein Kabel, nicht einmal ein Anschluss, an dem ein Kabel angebracht werden konnte. Also hatte der Drucker drahtlos funktioniert. Sie stellte ihn ab und kniete nieder, um unter den Beistelltisch zu spähen. Auch dort fand sie nichts. Warum hatte sich jemand die Mühe gemacht, alle Computer zu entfernen? Um die Daten zu verstecken, während die Welt bereits auseinanderfiel? Kira war sicher nicht die Erste, die hierhergekommen war. Teufel auch, ParaGen hatte die Partials gebaut, und sie waren die führenden Experten für Biotechnologie gewesen! Selbst wenn man ihnen nicht den Ausbruch des Partialkriegs vorgeworfen hatte, hatte die Regierung wegen RM sicherlich Verbindung mit ihnen aufgenommen. Natürlich immer vorausgesetzt, die Regierung wusste nicht, dass die Partials das Heilmittel in sich trugen. Sie schob den Gedanken beiseite. Sie war nicht hergekommen, um Verschwörungstheorien auszubrüten, sondern um Fakten auszugraben. Waren die Computer vielleicht beschlagnahmt worden?
Sie blickte nach oben und sah sich in dem Raum um, während sie auf Händen und Knien hockte. Aus diesem Blickwinkel heraus entdeckte sie etwas, das ihr vorher entgangen war: einen heller glänzenden schwarzen Kreis im schwarzen Tischrahmen. Als sie den Kopf bewegte, fing der Kreis das Licht ein und schien zu blinken. Mit gerunzelter Stirn stand sie auf und schüttelte den Kopf, weil des Rätsels Lösung so einfach war.
Die Tische selbst waren die Computer.
Jetzt, da sie es sah, war es offensichtlich. Die Schreibtische bestanden aus durchsichtigem Plastik und waren, wenngleich größer, exakte Nachbildungen der Medicomp-Bildschirme im Krankenhaus. Die Bauteile – vor allem die CPU und die Festplatte des Computers – waren im Metallrahmen untergebracht. Sobald das Gerät eingeschaltet wurde, verwandelte sich der Schreibtisch in einen Touchscreen, der die Tastatur und alles andere anzeigte. Wieder ging sie auf die Knie, überprüfte die Beine des Metallrahmens und stieß einen triumphierenden Schrei aus, als sie ein kurzes schwarzes Kabel entdeckte, das zu einer in den Boden eingelassenen Steckdose führte. Ein aufgeschreckter Spatzenschwarm flog davon. Kira lächelte, aber ein Sieg war es nicht – die Entdeckung der Computer nutzte ihr überhaupt nichts, wenn sie die Geräte nicht einschalten konnte. Sie brauchte ein Ladegerät, doch bei ihrem hastigen Aufbruch aus East Meadow hatte sie keins eingesteckt. Es war eine dumme Unterlassungssünde, aber daran konnte sie nichts mehr ändern. Vielleicht fand sie in Manhattan in einem Baumarkt oder Elektronikladen ein solches Teil. Seit dem Zusammenbruch galt die Insel als gefährlich, kaum jemand hatte sich noch dorthin gewagt. Deshalb waren die meisten Geschäfte nicht geplündert worden. Trotzdem, der Gedanke, einen fünfzig Pfund schweren Generator zwanzig Stockwerke hochzuschleppen, behagte ihr überhaupt nicht.
Kira atmete tief durch und sammelte sich. Ich muss herausfinden, wer ich bin, dachte sie. Ich muss klären, wie mein Vater und Nandita mit allem hier verbunden sind. Ich muss den Trust entdecken. Wieder einmal zog sie das Foto hervor, das sie selbst, ihren Vater und Nandita vor ParaGen zeigte. Irgendjemand hatte eine Botschaft auf das Bild geschrieben: Finde den Trust. Sie wusste weder, was der Trust überhaupt war, noch, wie sie ihn aufspüren sollte. Sie wusste nicht einmal, wer die Nachricht geschrieben und ihr das Foto hinterlassen hatte. Der Handschrift nach war es höchstwahrscheinlich Nandita gewesen. Die vielen Zusammenhänge, die sie nicht durchschaute, bedrückten sie wie eine gewaltige Last. Sie schloss die Augen und bemühte sich, ruhig zu atmen. Auf dieses Büro hatte sie ihre ganze Hoffnung gesetzt, war es doch der einzige Teil von ParaGen, der für sie erreichbar war. Es enttäuschte sie zutiefst, dass sie hier nichts Nützliches und nicht einmal eine neue Spur gefunden hatte.
Rasch stand sie auf und trat ans Fenster, um frische Luft zu atmen. Unter ihr breitete sich Manhattan aus, halb Stadt, halb Wald, eine weitläufige Ansammlung emporschießender Bäume und von Ranken eroberter bröckelnder Gebäude. Es war so groß, so ungeheuer groß, und dies war nur eine einzige Stadt. Dahinter lagen weitere Städte, andere Staaten und Nationen, sogar ganze Kontinente, die sie nie gesehen hatte. Sie fühlte sich verloren, niedergeschlagen und entmutigt, weil sie in einer so riesigen Welt nicht das kleinste Geheimnis zu lüften vermochte. In der Nähe flog ein Vogelschwarm vorbei, der sich nicht um sie und ihre Probleme kümmerte. Die Welt war untergegangen, und sie hatten es nicht einmal bemerkt. Wenn die letzten intelligenten Lebewesen auf dem Planeten verschwanden, würde die Sonne immer noch aufgehen, und die Vögel würden immer noch über den Himmel fliegen.
Welche Bedeutung hatte da ihr Erfolg oder ihr Versagen?
Schließlich hob sie den Kopf, reckte das Kinn und sprach es laut aus.
»Ich gebe nicht auf«, verkündete sie. »Es ist mir gleichgültig, wie groß die Welt ist. Je größer sie ist, desto mehr Platz habe ich für die Nachforschungen, das ist alles.«
Kira wandte sich zum Büro um, ging zum Aktenschrank und zog die erste Schublade auf. Falls der Trust irgendetwas mit ParaGen zu tun hatte, vielleicht über ein besonderes Projekt, das mit den Anführern der Partials zusammenhing, wie Samm angedeutet hatte, dann gäbe es in dieser Finanzabteilung vermutlich Hinweise auf Geldflüsse. Vielleicht existierten sogar Akten über die Vorgänge. Sie wischte den Schmutz vom Tischbildschirm und zog einige Ordner aus dem Schrank. Zeile für Zeile, Dokument um Dokument, Zahlung um Zahlung ging sie durch. Sobald sie mit einem Hefter fertig war, legte sie ihn in einer Ecke auf den Boden und nahm sich den nächsten vor. So ging es Stunde um Stunde, bis es zu dunkel zum Lesen wurde. Die Nachtluft war kalt, und sie spielte mit dem Gedanken, in einer überwachbaren Ecke ein Feuer zu entfachen, entschied sich jedoch dagegen. Die Lagerfeuer unten auf den Straßen hatte sie vor etwaigen Beobachtern verbergen können, aber ein Feuer in dieser Höhe war kilometerweit sichtbar. So zog sie sich lieber in den Vorraum an der Treppe zurück, schloss alle Türen und schlug ihr Nachtlager im Schutz des Empfangstischs auf. Zum Abendessen öffnete sie eine Dose Thunfisch und aß den Inhalt im Dunkeln, pickte den Fisch mit den Fingern aus der Dose und redete sich dabei ein, es sei Sushi. Sie schlief nur leicht, und als sie am Morgen aufwachte, machte sie sich sofort wieder an die Arbeit und durchsuchte die Akten. Am Spätvormittag fand sie endlich etwas.
»Nandita Merchant«, las sie. Nachdem sie so lange vergebens geforscht hatte, zuckte sie zusammen, sobald sie den Beleg entdeckte. »Einundfünfzigtausendeinhundertzwölf Dollar, ausgezahlt am 5.Dezember 2064 per Überweisung, Arvada, Colorado.« Die Aufstellung der recht hohen Gehaltszahlungen erfasste offenbar die leitenden Angestellten des gesamten internationalen Konzerns. Kira runzelte die Stirn und las die Eintragung noch einmal. Es war nicht zu erkennen, welcher Tätigkeit Nandita nachgegangen war, sondern nur, wie viel Gehalt sie bezogen hatte. Allerdings hatte Kira keine Ahnung, was die Zahlen zu bedeuten hatten – war dies eine monatliche oder eine jährliche Vergütung? Oder ein einmaliges Honorar für eine bestimmte Leistung? Kira kehrte zu den Kontenbüchern zurück und fand die Dokumente des vorhergehenden Monats. Rasch blätterte sie die Seiten durch und stieß erneut auf Nanditas Namen. »Einundfünfzigtausendeinhundertzwölf Dollar am 21.November«, las sie dort. Das Gleiche noch einmal am 7.November. Also handelt es sich um vierzehntägige Zahlungen. Damit verdiente Nandita … etwa eins Komma zwei Millionen im Jahr. Das war sicher eine Menge Geld. Kira hatte keinen Bezugsrahmen für die Gehälter der alten Welt. Als sie jedoch die Liste überflog, stellte sie fest, dass die 51.112Dollar eines der höchsten Gehälter überhaupt darstellten. »Demnach hat sie in der Firma eine leitende Funktion bekleidet«, murmelte Kira halblaut, während sie nachdachte. »Sie hat mehr als die meisten anderen verdient. Aber was genau hat sie getan?«
Dann wollte sie ihren Vater nachschlagen, aber sie wusste nicht einmal seinen Nachnamen. Ihren eigenen Namen, es war nur ein Spitzname, verdankte Kira den Soldaten, die sie nach dem Zusammenbruch gefunden hatten, als sie auf der Suche nach Lebensmitteln Kilometer um Kilometer durch die leere Stadt gelaufen war. Kira Walker, so hatte man sie genannt. Sie war so klein gewesen, dass sie sich nicht einmal an ihren Nachnamen oder den Arbeitsplatz ihres Vaters hatte erinnern können, erst recht nicht an die Stadt, in der sie gelebt hatte …
»Denver!«, rief sie, als ihr der Ort auf einmal einfiel. »Wir haben in Denver gewohnt. Das war doch in Colorado, oder?« Wieder betrachtete sie Nanditas Eintragung: Arvada, Colorado. Lag das in der Nähe von Denver? Sie faltete das Blatt sorgfältig zusammen, steckte es in den Rucksack und nahm sich vor, später einen alten Buchladen aufzusuchen und einen Atlas aufzutreiben. Dann betrachtete sie wieder die Gehaltsabrechnung und suchte nach einem Armin, der ihr Vater sein konnte. Allerdings waren die Zahlungen nach den Nachnamen sortiert, und es war so gut wie unmöglich, unter Zehntausenden einen bestimmten Armin zu entdecken. Außerdem – wenn sie den Namen fand, würde sich doch nur bestätigen, was sie sowieso schon wusste: Nandita und ihr Vater hatten an ein und demselben Ort für eine bestimmte Firma gearbeitet. Daraus ließ sich freilich nicht entnehmen, was sie aus welchen Gründen getan hatten.
Ein weiterer Tag mit Nachforschungen erbrachte nichts Verwendbares. Schließlich knurrte sie wütend und warf den letzten Aktenordner durch das geborstene Fenster hinaus. Gleich danach machte sie sich Vorwürfe, weil sie so dumm gewesen war, die Aufmerksamkeit jener zu erwecken, die in der Stadt umherschlichen. Sehr wahrscheinlich war dies nicht, aber sie wollte das Schicksal nicht herausfordern. Sie hielt sich vom Fenster fern und hoffte, dass ein zufälliger Beobachter die fliegenden Papiere dem Wind oder einem wilden Tier zuschrieb. Es wurde Zeit für ihr nächstes Projekt: das zweite Stockwerk.
Natürlich war es die einundzwanzigste Etage, sagte sie sich, als sie die Treppe hinaufstieg. Seltsamerweise war die Tür nur angelehnt, und dahinter befand sich ein Ozean von Büroverschlägen. Hier gab es keinen Empfangsbereich und nur eine Handvoll abgetrennter Büros. Überall sonst unterteilten niedrige Trennwände den gemeinsamen Bereich. In vielen Nischen standen Computer oder Andockbuchten, in die man tragbare Computer hineinschieben konnte. Die raffinierten Schreibtischbildschirme fehlten hier, aber was sie wirklich verblüffte, waren die Abteile, in denen sie frei hängende Kabel entdeckte. Irgendjemand hatte die Computer entfernt.
Kira blieb stehen und überblickte den Raum. Hier war es zugiger als unten, weil eine lange Fensterfront zerstört war und keine Zwischenwände den Luftstrom blockierten. Hier und dort flatterte ein Blatt Papier an den Verschlägen vorbei. Kira achtete nicht weiter darauf, sondern konzentrierte sich auf die sechs Schreibtische, die ihr am nächsten standen. Vier davon wirkten völlig alltäglich – Monitore, Tastaturen, Terminplaner, Familienfotos –, doch bei zweien fehlten die Computer. Die Geräte waren nicht einfach ausgebaut, sondern in aller Eile herausgerissen worden. Terminplaner und Fotos waren zur Seite gerutscht oder gar zu Boden gefallen, als wäre jemand in großer Eile vorgegangen und hätte sich nicht um das angerichtete Durcheinander gekümmert. Kira hockte sich hin, um den ersten Schreibtisch zu untersuchen, von dem ein Foto heruntergefallen war. Auf dem Bild und ringsum hatte sich eine Staubschicht abgelagert, in der schließlich sogar Feuchtigkeit liebende Pilze Fuß gefasst hatten. Das war nicht überraschend. Nachdem sie elf Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen waren, hatte sich in vielen Gebäuden in Manhattan eine Schicht Erde gesammelt. Hier jedoch fiel ihr ein kleiner gelber Stängel auf, der an einen Grashalm erinnerte. Er schlängelte sich unter dem Foto hervor. Sie blickte zum Fenster hinauf und schätzte den Winkel ab. Richtig, diese Stelle bekam jeden Tag ein paar Stunden lang das volle Sonnenlicht ab. Das war genug, damit eine Grünpflanze gedeihen konnte. Ringsum waren andere Halme gewachsen, aber darum ging es ihr nicht. Interessant war die Art und Weise, wie das Gras unter dem Foto hervorkroch. Sie hob den Rahmen hoch und kippte ihn um. Darunter kamen ein kleiner Trupp Käfer, einige Pilze und kurzes totes Gras zum Vorschein. Mit offenem Mund setzte sie sich auf. Die Folgerungen, die sie aus dieser Entdeckung ziehen musste, waren atemberaubend.
Das Foto war vom Tisch gefallen, nachdem das Gras gewachsen war.
Allerdings lag auch dieser Zeitpunkt schon eine ganze Weile zurück. Der Staub und Unrat auf dem Bilderrahmen ließ vermuten, dass er schon mehrere Jahre dort lag, aber eben nicht die vollen elf Jahre. Der Untergang war gekommen und gegangen, das Gebäude war verlassen worden, Erde und Unkraut hatten sich gesammelt, und dann hatte jemand den Verschlag heimgesucht. Wer kam dafür infrage? Menschen oder Partials? Kira untersuchte den Raum unter dem Schreibtisch und entdeckte eine Handvoll weiterer Kabel, aber keinen klaren Hinweis darauf, wer den dazugehörigen Rechner mitgenommen hatte. Sie kroch in das nächste Abteil, das ebenfalls ausgeplündert worden war, und stieß auf ähnliche Überreste. Irgendjemand war bis in den einundzwanzigsten Stock hochgestiegen, hatte zwei Computer gestohlen und sie wieder nach unten geschleppt.
Welchen Grund gab es für ein solches Vorgehen? Kira setzte sich wieder auf und wog die Möglichkeiten ab. Wenn jemand Informationen suchte, war es vermutlich einfacher, die Computer nach unten als einen Generator nach oben zu schleppen. Sie wandte sich um und stellte fest, dass die beiden Verschläge den Aufzügen am nächsten lagen. Das bedeutete aber nichts, denn nach dem Zusammenbruch mangelte es an Strom für die Aufzüge. Da gab es also keinen Zusammenhang. An den Wänden der Abteile standen nicht einmal Namen. Wenn jemand es auf diese beiden Computer abgesehen hatte, dann hatte er über Insiderwissen verfügt.
Kira stand auf und untersuchte die gesamte Etage. Sie ging langsam hin und her und hielt nach Veränderungen Ausschau, die ungewöhnlich waren oder auf eine Plünderung hinwiesen. Ein Drucker fehlte, es war jedoch nicht zu erkennen, ob er vor oder nach dem Zusammenbruch entwendet worden war. Als sie im zentralen Raum fertig war, nahm sie sich die Büros an der Rückwand vor. Überrascht stellte sie fest, dass eins von ihnen völlig ausgeräumt war: Der Computer fehlte, die Regale waren leer, buchstäblich alles war verschwunden. Die Rückstände – ein Telefon, ein Papierkorb, verschiedene kleine Papierstapel und weiteres Zubehör – legten den Verdacht nahe, dass der Raum früher einmal ein voll eingerichtetes Büro gewesen war, aber mehr war nicht erkennbar. In diesem Raum gab es erheblich mehr Aktenschränke als in den anderen, doch sie waren alle leer. Kira fragte sich, wie viel genau gestohlen worden war.
Schließlich hielt sie inne und starrte den leeren Schreibtisch an. Es gab noch einen anderen Unterschied, den sie jedoch nicht genau benennen konnte. Genau wie in den Verschlägen war auch hier ein kleiner Terminplaner auf den Boden gefallen. Also war auch dieses Büro mit der gleichen Eile ausgeraubt worden. Wer auch immer den Diebstahl begangen hatte, hatte alles in größter Hast mitgenommen. Die von den Rechnern befreiten Kabel hingen herab, allerdings gab es hier mehr Leitungen als in den Verschlägen. Sie zermarterte sich das Hirn, um herauszufinden, was sie misstrauisch machte, und endlich fiel es ihr auf: In dem kleinen Büro gab es keinerlei Fotos. Die meisten Schreibtische, die sie in den letzten zwei Tagen untersucht hatte, waren mit Bildern geschmückt gewesen: mit lächelnden Paaren, Gruppen von Kindern in Schuluniformen, Momentaufnahmen aus dem Leben von Familien, die längst gestorben waren. Hier entdeckte sie dagegen kein einziges Foto. Dafür gab es zwei Erklärungen. Erstens: Der ehemalige Besitzer des Arbeitsplatzes hatte keine Angehörigen, oder sie waren ihm nicht so wichtig gewesen, dass er ein Foto aufgestellt hatte. Zweitens, weitaus beunruhigender: Die Diebe hatten nicht nur die Ausrüstung, sondern auch die Fotos mitgenommen. Am wahrscheinlichsten aber war die Vermutung, dass der Unbekannte, der die Fotos mitgenommen hatte, auch jener war, der einmal in diesem Raum gearbeitet hatte.
Kira betrachtete die Tür. AFA DEMOUX stand darauf, darunter in Blockbuchstaben: IT. War IT ein Spitzname? Das Wort kam ihr irgendwie abfällig vor, aber ihr Wissen über die Kultur der alten Welt war mehr als begrenzt. Sie untersuchte die anderen Türen und stellte fest, dass alle auf ähnliche Weise mit einem Namen und einem weiteren Begriff beschriftet waren, wenngleich die meisten anderen Bezeichnungen erheblich länger waren: BETRIEBSLEITUNG,VERKAUF,MARKETING. Handelte es sich um Titel? Waren es Abteilungen? Der Begriff IT war offenbar eine Abkürzung, deren Bedeutung Kira allerdings nicht kannte. Interne … Testanlage. Sie schüttelte den Kopf. Dies war kein Labor, und Afa Demoux war kein Wissenschaftler gewesen. Was hatte er hier getan? War er wirklich hergekommen, um die eigene Büroausstattung zu bergen? Oder war seine Arbeit so wichtig oder gefährlich gewesen, dass ein anderer sich die Mühe gemacht hatte, die Gegenstände zu stehlen? Um eine willkürliche Plünderung hatte es sich gewiss nicht gehandelt. Niemand stieg einundzwanzig Stockwerke hoch, um ein paar Computer mitzunehmen, die er auch im Erdgeschoss hätte finden können. Wer auch immer hier gewesen war, hatte in voller Absicht genau diese Computer mitgenommen – weil etwas Wichtiges darin gespeichert war. Aber wer? Afa Demoux? Jemand aus East Meadow? Ein Partial?
Wer sonst hatte sich hier eingemischt?
3
»Hiermit ist die Sitzung eröffnet.«
Marcus stand hinten im Saal und verrenkte sich den Hals, um die Menschenmenge zu überblicken, die sich hier versammelt hatte. Die Senatoren konnte er gut erkennen – Hobb, Kessler und Tovar, dazu ein neuer, dessen Namen er nicht kannte. Sie saßen an einem langen Tisch auf der Bühne, die beiden Angeklagten waren jedoch nirgends zu sehen. Das Rathaus, das sie früher für solche Sitzungen benutzt hatten, war vor zwei Monaten einem Angriff der Stimme zum Opfer gefallen, lange bevor Kira das Heilmittel für die RM-Seuche entdeckt und die Stimme sich wieder dem Rest der Gesellschaft angeschlossen hatte. Da der alte Saal zerstört war, mussten sie nun die Aula der alten East Meadow High School benutzen. Die Schule war vor einigen Monaten geschlossen worden, also warum nicht? Natürlich, dachte Marcus. Die Gebäude bleiben, auch wenn sich alles andere verändert. Der ehemalige Anführer der Stimme zählte jetzt zu den Senatoren, und zwei ehemalige Senatoren waren angeklagt. Marcus stellte sich auf die Zehenspitzen, aber die Aula war gerammelt voll, und alle Zuschauer mussten stehen. Anscheinend waren sämtliche Einwohner von East Meadow gekommen, um Weists und Delarosas Verhandlung zu verfolgen.
»Mir wird schlecht.« Isolde hielt sich an Marcus’ Arm fest. Er stellte sich vorsichtshalber wieder mit dem ganzen Fuß auf den Boden und grinste über Isoldes Morgenübelkeit. Dann schnitt er eine schmerzliche Grimasse, weil sie energisch zupackte und ihm die Fingernägel in die Haut bohrte. »Hör auf, mich auszulachen!«, zischte sie.
»Ich habe doch gar nicht laut gelacht.«
»Ich bin schwanger«, erklärte Isolde. »Ich besitze unglaublich scharfe Supersinne und rieche deine Gedanken.«
»Du riechst sie?«
»Es ist eine stark eingeschränkte Superkraft«, gab sie zu. »Aber ehrlich, bring mich rasch an die frische Luft! Sonst wird es in diesem Raum noch unerträglicher, als es ohnehin schon ist.«
»Willst du ganz nach draußen?«
Isolde schüttelte den Kopf, schloss die Augen und atmete tief durch. Einen Bauch sah man noch nicht, aber die Morgenübelkeit war schrecklich – sie hatte sogar Gewicht verloren, statt zuzulegen, weil sie nichts im Magen behalten konnte. Schwester Hardy hatte ihr mit stationärem Aufenthalt im Krankenhaus gedroht, falls sich ihr Zustand nicht bald besserte. Sie hatte eine Woche freigenommen, um auszuspannen, und das hatte ein wenig geholfen. Allerdings war sie viel zu stark politisch interessiert, um einer solchen Verhandlung fernzubleiben. Marcus sah sich in der Aula um, bemerkte in der Nähe einer offenen Tür einen Sitzplatz und schob sie hinüber.
»Entschuldigung, Sir«, sagte er leise, »dürfte meine Freundin den Stuhl besetzen?«
Obwohl der Mann nicht einmal darauf saß, funkelte er Marcus böse an. »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst«, entgegnete er leise. »Und jetzt halt den Mund, damit ich zuhören kann!«
»Sie ist schwanger.« Er nickte erfreut, als sich das Verhalten des Mannes schlagartig änderte.
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?« Der Flegel trat sofort zur Seite und bot Isolde den Stuhl an. Dann entfernte er sich, um sich einen anderen Stehplatz zu suchen. Das funktioniert jedes Mal, dachte Marcus. Auch nach der Aufhebung des Zukunftsgesetzes, das Schwangerschaften für alle Frauen verbindlich gemacht hatte, wurden werdende Mütter immer noch wie Heilige behandelt. Seit Kira ein Heilmittel für die RM-Seuche entdeckt hatte, bestand eine echte Hoffnung, dass die Kinder tatsächlich länger als nur ein paar Tage überlebten, und seitdem hatte sich die Hochachtung vor schwangeren Frauen sogar noch verstärkt. Isolde lächelte und fächelte sich frische Luft ins Gesicht. Marcus stellte sich hinter sie, um ihr den Zugang zur frischen Luft frei zu halten. Dann blickte er nach vorn.
»… genau das, was wir prinzipiell unterbinden sollten«, sagte Senator Tovar.
»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein«, erklärte der neue Senator. Marcus musste sich konzentrieren, um ihn zu verstehen. »Sie waren der Anführer der Stimme«, sagte der Mann zu Tovar. »Sie haben mit dem Ausbruch eines Bürgerkriegs gedroht, und man könnte sogar behaupten, dass Sie ihn tatsächlich begonnen haben.«
»Gewalt gelegentlich für notwendig zu erachten, bedeutet noch lange nicht, Gewalt für etwas Gutes zu halten«, entgegnete Tovar. »Wir kämpfen, um Grausamkeiten zu verhindern, aber nicht, um sie im Nachhinein zu bestrafen …«
»Die Todesstrafe ist im Grunde doch eine Präventivmaßnahme«, unterbrach ihn der neue Senator. Marcus blinzelte erschrocken – er hatte nicht geahnt, dass man für Weist und Delarosa die Todesstrafe in Betracht zog. Da es nur noch sechsunddreißigtausend Menschen gab, musste man mit Hinrichtungen zurückhaltend sein, ob es sich um Verbrecher handelte oder nicht. Der neue Senator wies auf die Gefangenen. »Wenn diese beiden für ihre Vergehen sterben müssen, wird in einer so kleinen Gemeinschaft zwangsläufig jeder davon erfahren, und deshalb werden sich die Verbrechen nicht wiederholen.«
»Die Angeklagten haben als Senatoren ihre Macht missbraucht«, erwiderte Tovar. »Wem genau möchten Sie denn eine Botschaft schicken?«
»Jedem, der ein Menschenleben wie einen Pokerchip behandelt«, sagte der Mann. Die Zuschauer wurden unruhig. Der neue Senator starrte Tovar kalt an, und selbst Marcus, der ganz hinten stand, erfasste die unausgesprochene Drohung: Wenn er dazu fähig wäre, würde dieser Mann Tovar am liebsten gleich zusammen mit Delarosa und Weist hinrichten.
»Die beiden haben getan, was sie für das Beste hielten«, warf Senatorin Kessler ein. Sie zählte zu den wenigen Amtsinhabern, denen es gelungen war, den Skandal zu überstehen und ihre Stellung zu behalten. Nach allem, was Marcus gesehen hatte, und aufgrund der internen Details, die er von Kira erfahren hatte, waren Kessler und die anderen ebenso schuldig wie Delarosa und Weist – sie hatten die Macht ergriffen, das Kriegsrecht verhängt und die winzige Demokratie auf Long Island in einen totalitären Staat verwandelt. Sie hatten es getan, um die Einwohner zu schützen. Jedenfalls hatten sie dies behauptet, und am Anfang hatte Marcus sie unterstützt. Die Menschheit hatte vor der Auslöschung gestanden, und angesichts eines solchen Risikos ließ sich die Behauptung, die Freiheit sei wichtiger als das Überleben, kaum aufrechterhalten. Tovar und die anderen Mitglieder der Stimme hatten jedoch rebelliert, der Senat hatte reagiert, und die Stimme hatte abermals zurückgeschlagen. So war es weitergegangen, bis die Amtsinhaber das eigene Volk belogen, das Krankenhaus in die Luft gesprengt und insgeheim einen ihrer eigenen Soldaten getötet hatten, um die Furcht vor einer fiktiven Invasion der Partials zu schüren und die Insel zu vereinen. Offiziell hieß es, Delarosa und Weist seien die Köpfe der Verschwörung gewesen, alle anderen hätten nur Befehle ausgeführt. Dafür, dass sie ihrem Anführer gefolgt war, konnte man Kessler so wenig bestrafen wie einen Abwehrsoldaten, der seinerseits Kesslers Befehlen gehorchte. Marcus war nicht sicher, was er von diesem Urteil halten sollte, aber es war offensichtlich, dass es dem neuen Senator nicht gefiel.
Marcus bückte sich und legte Isolde eine Hand auf die Schulter. »Sag mir doch mal, wer der neue Mann ist!«
»Asher Woolf«, flüsterte Isolde. »Er hat Weist als Vertreter der Abwehr ersetzt.«
»Das erklärt so einiges.« Marcus richtete sich wieder auf. Man kann keinen Soldaten töten, ohne sich jeden anderen Soldaten in der Armee zum Todfeind zu machen.
»Was sie für das Beste hielten«, wiederholte Woolf. Sein Blick wanderte über die Menge, dann zurück zu Kessler. »Was sie für das Beste hielten. In diesem Fall war das Beste offenbar die Ermordung eines Soldaten, der bereits seine Gesundheit und Sicherheit aufs Spiel gesetzt hatte, um die Geheimnisse dieser Verbrecher zu schützen. Wenn sie den gleichen Preis zahlen wie der Junge, dann werden die nächsten Senatoren vielleicht nicht mehr denken, so etwas sei das Beste.«
Marcus blickte zu Senator Hobb hinüber und fragte sich, warum der noch nicht das Wort ergriffen hatte. Er war der fähigste Redner im Senat, aber Marcus empfand ihn inzwischen als oberflächlich und manipulativ, sogar als opportunistisch. Außerdem hatte er Isolde geschwängert. Marcus bezweifelte, diesen Mann jemals wieder achten zu können, der keinerlei Interesse für sein ungeborenes Kind gezeigt hatte. Jetzt ging Hobb ebenso gleichgültig mit dem Urteil um. Warum hatte er sich noch nicht entschieden?
»Ich glaube, Sie haben Ihren Standpunkt nun dargelegt«, sagte Kessler. »Weist und Delarosa wurden vor Gericht gestellt und verurteilt. Sie sind mit Handschellen gefesselt und werden in ein Straflager gebracht, wo sie für ihre …«
»Sie werden auf ein idyllisches Anwesen auf dem Land geschickt, wo sie Steaks essen und für einsame Bauernmädchen den Deckhengst spielen dürfen«, fiel Woolf ihr ins Wort.
»Hüten Sie Ihre Zunge!« Marcus zuckte zusammen, als er sah, wie zornig die Frau war. Er war mit Kesslers Adoptivtochter Xochi befreundet und hatte schon oft von diesem Zorn gehört. Woolf befand sich in einer wenig beneidenswerten Lage. »Wie auch immer Ihre frauenfeindliche Einstellung zu unseren bäuerlichen Gemeinschaften aussehen mag«, fuhr Kessler fort, »wir überstellen die Angeklagten keineswegs in ein Urlaubsdomizil. Sie sind Gefangene und kommen in ein Lager, in dem sie härter arbeiten werden, als Sie es je in Ihrem Leben getan haben.«
»Wollen Sie die Gefangenen denn nicht ernähren?«, fragte Woolf.
Kessler kochte. »Natürlich werden sie ernährt.«
Woolf legte in gespielter Verwirrung die Stirn in Falten. »Werden Sie ihnen den Zugang zu frischer Luft und Sonnenschein verwehren?«
»Wie sonst sollen sie auf einer Gefängnisfarm arbeiten, wenn nicht draußen auf dem Feld?«
»Dann bin ich verwirrt«, entgegnete Woolf. »Bisher kommt mir das nicht wie eine Strafe vor. Senator Weist hat kaltblütig die Tötung eines seiner eigenen Soldaten befohlen. Es war ein junger Kerl, der seinem Befehl unterstand. Zur Strafe bekommt er nun ein weiches Bett, drei Mahlzeiten am Tag, frischere Lebensmittel als wir hier in East Meadow und alle Mädchen, die er sich nur wünschen kann …«
»Sie reden immer wieder von Mädchen«, unterbrach ihn Tovar. »Was genau stellen Sie sich darunter vor?«
Woolf hielt inne und starrte Tovar an, nahm ein Blatt Papier zur Hand und überflog es, während er sprach. »Vielleicht missverstehe ich auch den Grund dafür, dass die Todesstrafe abgeschafft wurde. Wir können niemanden töten, weil Ihren eigenen Worten zufolge nur noch fünfunddreißigtausend Menschen auf dem Planeten leben und weil wir nicht noch mehr Menschen verlieren dürfen.« Er hob den Kopf. »Trifft das zu?«
»Wir haben mittlerweile ein Heilmittel für RM«, erklärte Kessler. »Das bedeutet – wir haben eine Zukunft. Wir können es uns nicht erlauben, auch nur einen Menschen zu verlieren.«
»Weil wir die Menschheit erhalten wollen.« Woolf nickte. »Wir wollen uns vermehren und die Erde neu besiedeln. Selbstverständlich. Können Sie mir erklären, woher die Babys kommen? Oder sollen wir eine Tafel holen, damit ich es Ihnen aufmalen kann?«
»Es geht nicht um Sex«, widersprach Tovar.
»Damit haben Sie verdammt recht.«
Kessler hob beide Hände. »Und wenn wir den Verurteilten einfach die Fortpflanzung verbieten? Sind Sie dann glücklich?«
»Wenn sie sich nicht fortpflanzen dürfen, haben wir keinen Grund, sie am Leben zu lassen«, gab Woolf sofort zurück. »Nach Ihrer eigenen Logik sollten wir sie töten und fertig.«
»Sie sollen arbeiten«, meinte Kessler. »Sie können Felder bestellen, sie können Weizen für die ganze Insel mahlen, sie können …«
»Wir lassen sie nicht am Leben, damit sie sich fortpflanzen«, sagte Tovar leise. »Und wir halten sie auch nicht als Sklaven am Leben. Wir lassen sie am Leben, weil es falsch wäre, sie zu töten.«
Woolf schüttelte den Kopf. »Verbrecher zu töten, ist …«
»Senator Tovar hat recht.« Hobb stand auf. »Es geht nicht um Sex, Fortpflanzung, Hilfsarbeiten oder andere Themen, über die wir gestritten haben. Es geht nicht einmal um das Überleben. Wie gesagt, die Menschheit hat eine Zukunft, und Nahrung und Kinder sind für diese Zukunft überragend wichtig. Aber sie sind nicht das Allerwichtigste. Sie sind notwendig für unsere Existenz, aber sie dürfen nicht der Grund für unsere Existenz werden. Wir dürfen uns nicht auf die Ebene des rein körperlichen Überlebens reduzieren lassen.« Er trat zu Senator Woolf hinüber. »Unsere Kinder werden nicht nur unsere Gene und unsere Infrastruktur erben. Sie werden auch unsere Moral übernehmen. Die Zukunft, die wir dank dem Heilmittel für RM gewinnen, ist ein kostbares Geschenk. Wir müssen uns Tag für Tag und Stunde um Stunde bewähren, indem wir die Menschen sind, die es verdienen, eine Zukunft zu haben. Wollen wir, dass unsere Kinder einander töten? Natürlich nicht. Daher geben wir ihnen ein Beispiel, dass jedes Leben wertvoll ist. Einen Mörder zu töten, könnte eine zweideutige Botschaft aussenden.«
»Für einen Mörder zu sorgen, ist ebenso zweifelhaft«, widersprach Woolf.
»Wir sorgen nicht für einen Mörder«, wandte Hobb ein. »Wir sorgen für alle – ob alt oder jung, gebunden oder frei, männlich oder weiblich. Wenn einer von ihnen ein Mörder ist – oder wenn zwei oder drei oder einhundert Mörder sind –, sorgen wir immer noch für sie.« Er lächelte humorlos. »Natürlich lassen wir nicht zu, dass sie weiterhin Schuld auf sich laden. Wir sind nicht dumm. Aber wir richten sie nicht hin, weil wir besser sein wollen als sie. Wir bemühen uns, höheren Prinzipien zu folgen. Wir haben mittlerweile eine Zukunft, also lasst uns darauf zugehen, ohne Menschen zu töten.«
Vereinzelt erhob sich Applaus im Raum, auch wenn Marcus das Gefühl hatte, einer Pflichtübung beizuwohnen. Eine Handvoll Menschen widersprach mit lauten Rufen, doch die Stimmung der Zuschauer hatte sich geändert, und Marcus wusste, dass der Streit damit entschieden war. Woolf war nicht zufrieden, aber nach Hobbs Rede verzichtete er darauf, noch einmal eine Hinrichtung zu fordern. Marcus hätte gern die Reaktionen der Gefangenen beobachtet, konnte sie jedoch immer noch nicht entdecken. Isolde murmelte etwas. Er bückte sich zu ihr hinunter.
»Was hast du gesagt?«
»Ich sagte, er ist ein aalglatter Dreckskerl«, fauchte Isolde. Marcus zuckte erschrocken zurück. Damit wollte er nichts zu tun haben. Sie hatte beteuert, ihre Affäre mit Hobbs habe auf beiderseitigem Interesse beruht. Sie war seine Assistentin gewesen, er sah gut aus und war charmant. Inzwischen war sie jedoch nicht mehr gut auf ihn zu sprechen.