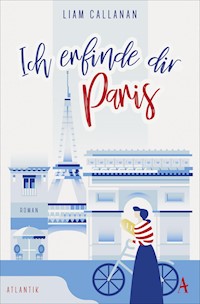
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine Ode an die Bücher und das ewige Paris. Liam Callanan nimmt uns mit auf ein charmantes Verwirrspiel.« Antoine Laurain Es beginnt in Paris. In Paris, Wisconsin. Robert und Leah sehnen sich nach der Stadt der Liebe, doch glauben sie kaum noch daran, dass dieser Traum je in Erfüllung gehen wird. Als Robert eines Tages verschwindet, finden Leah und ihre Töchter nur eine Flugnummer und ein Manuskript. Es führt sie nach Paris, Frankreich; in eine Stadt, die Robert für sie erfunden zu haben scheint. Auf den Spuren seines Romans, der ihnen wie ihr eigenes Leben vorkommt, wandeln sie durch die Straßen, kaufen einen Buchladen, der offenbar nur auf sie gewartet hat und beginnen ein neues Leben – stets in der Hoffnung, das so schmerzlich vermisste Gesicht in der Menge zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Liam Callanan
Ich erfinde dir Paris
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Juliane Zaubitzer
Atlantik
Für die, die ich fand
»Wenn wir jemanden wirklich brauchen, ist es unvermeidlich, dass wir ihn finden. Der Mensch, den wir brauchen, zieht uns an wie ein Magnet. Ich kehrte nach Paris zurück, nach all den Jahren auf dem Land, und ich brauchte einen jungen Maler – einen jungen Maler, der mich inspirierte. Paris war phantastisch, doch wo war der junge Maler?«
Gertrude Stein
Paris, 1945
Prolog
Einmal in der Woche folge ich Männern, die nicht mein Ehemann sind.
(Trotz allem tue ich das noch immer.)
Das sollte ich nicht, aber ich tue viele Dinge, die ich nicht tun sollte – rauchen, eine Buchhandlung besitzen, Französischunterricht bezahlen, den zu schwänzen ich immer einen Grund finde –, und eben das. Ich bringe meine Töchter zur Schule, starre an den Eltern vorbei, die an mir vorbeistarren, und beginne meine Suche nach dem Mann des Tages.
Manchmal fange ich direkt dort an und verfolge einen Vater, der sich gerade aus der Schar vor dem massiven Schultor löst. Meistens begebe ich mich in die belebte Rue Saint-Antoine und durchsiebe die vorbeiziehende Menge. An manchen Tagen finde ich ihn ganz schnell. An manchen Tagen brauche ich den ganzen Vormittag. An manchen Tagen folge ich jemandem eine Weile, normalerweise jemandem, der meinem Mann ähnelt, oder ihm so ähnlich ist, wie es eben geht oder wie ich es ertrage – das tintenschwarze Haar, die schmalen Schultern, die Hände, die nicht in den Taschen bleiben können, der Kopf, der nicht aufhören kann, sich nach allem außer nach mir umzudrehen –, nur um das Interesse zu verlieren, wenn mich ein unstimmiges Detail ablenkt. Mein Mann würde nie eine blaue Brille tragen. Mein Mann würde nie einer schwangeren Frau nicht das Taxi überlassen. Mein Mann würde nie eine Zeitschrift vom Kiosk klauen, einen Apfel vom Gemüsehändler, ein Buch von einem bouquiniste. Mein Mann würde nie eine Frau küssen, die nicht seine ist.
An manchen Tagen finde ich ihn nicht. Das überrascht mich jedes Mal, obwohl mich eher all die Tage überraschen sollten, wenn alles passt, wenn ich im Radius von einem halben Kilometer einen Mann finde, dem ich eine Weile folgen möchte.
Diesen Männern zu folgen sollte schwieriger sein, als es ist. Ist es nicht. In Paris ist es voll. Voller, als Werbespots und Poster vorgaukeln, und ich – na ja, obwohl ich hübsch bin, lange Beine habe und unfreiwillig die Distanz ausstrahle, die Männer so lieben, bin ich zweiundvierzig, ungefähr doppelt so alt wie jede beliebige Frau, für die Männer sich hier interessieren.
So ist es eben. Unsichtbarsein gefällt mir, kommt mir entgegen.
Gelegentlich, zu oft, spricht die Polizei Warnungen aus, Ermahnungen: Wir sollen wachsam sein. Und das bin ich, und andere sind es auch, doch ich habe festgestellt, dass ich nie unsichtbarer bin als im Windschatten solcher Warnungen. Ich sehe nicht aus wie jemand, den irgendjemand glaubt, im Auge behalten zu müssen.
Auch an solchen Tagen, an allen Tagen, kann es heikel werden, wenn der Mann, dem ich folge, von den Hauptstraßen in schmalere einbiegt. Auf den belebten Boulevards habe ich mich jemandem schon auf ein oder zwei Meter genähert, nah genug, um die Dichte seines Haars zu erkennen (das von meinem Mann, so dicht), sein Rasierwasser einzuatmen (mein Mann, keins, niemals), den Rauch in seinen Kleidern zu riechen (mein Mann leugnete immer, dass er geraucht hatte, doch ich entlarvte seine Lüge auf diese Weise, ein Schnüffeln, ein Schnuppern – aber ich war gewarnt: Ja, er konnte lügen).
In den ruhigeren Gassen gehe ich einen Block oder mehr auf Abstand. Dann überlege ich, was ich tun würde, wäre es wirklich mein Mann: ihn umarmen, seine Hand nehmen, ihn festhalten, während ich ihn trete, ohrfeige, frage warum und wie und wo.
Aber er ist es nicht, er ist es nie, deshalb schaue ich in die Schaufenster, ich schaue auf mein Handy, ich lese die Gedenktafeln, damit der Mann, den ich verfolge, keinen Verdacht schöpft: C’est juste une autre touriste perdue.
Einmal (und nur einmal) passierte es schließlich. Ein Mann, dem ich folgte, stellte mich.
Das war sechs Monate nach unserer Ankunft. Gar nicht lange her. Lange genug; damals war ich anders. Paris auch.
Trotzdem hätte ich es wissen müssen. Ich wusste es – ich hatte von Anfang an gewusst, dass es Ärger geben würde, weil er meinem Mann zu sehr ähnelte. Dasselbe Haar, dieselbe Brille, dasselbe Lächeln. Dieses Lächeln schenkte er einer Frau im Apple Store unter dem Louvre (fast so beliebt, so überfüllt wie das Museum darüber), und da sprang es mir ins Auge, das schiefe Grinsen. Ich hatte nicht bemerkt, dass er der Doppelgänger meines Mannes war, bis ich es sah, und dann konnte ich nicht anders, als ihm zu folgen. Er umkreiste den Zwilling der Louvre-Pyramide, die wie ein Pfeil nach unten zeigt (als wollte sie sagen: hier spielt die Musik – was ja auch stimmt), dann lief er unbeeindruckt an allen anderen Versuchungen des unterirdischen Einkaufszentrums vorbei (Kaffee, Spielzeug, Luxustoilettenpapier), bevor er die Stelle erreichte, wo man sich entscheiden muss: tiefer runter in die Métro oder hoch an die Oberfläche?
Und wäre er nach unten gegangen, hätte ich ihn ziehen lassen, denn ich war an jenem Tag nicht auf eine Verfolgungsjagd in der Métro eingestellt. Die Mission war nicht geplant. Ich hatte meinen Töchtern – Ellie, damals sechzehn, und Daphne, vierzehn – nur neue Ladekabel kaufen wollen. Die Billigkopien, die ich ihnen besorgt hatte, funktionierten nicht. Ich wollte zur Abwechslung mal etwas richtig machen und mit den Kabeln in der Hand zu Hause sein, wenn sie aus der Schule kamen.
Doch er ging nicht runter, er ging hoch, und oben angekommen tat er etwas, das keinen Sinn ergab. Statt auf die belebte Rue de Rivoli ging er zurück ins Einkaufszentrum zwischen den weiten Flügeln des Louvre. Er wollte wohl noch einen letzten Blick hinein werfen.
Und ich auch.
Nach ein oder zwei Minuten schaute er auf die Uhr und wählte dann ein anderen Weg zurück in die Welt, die Passage Richelieu, ein Säulengang durch die Galerie mit den französischen Skulpturen. Glaswände erlauben den Passanten einen Gratisblick ohne Schlangestehen.
Würde er hinsehen? Nein.
Ich konnte nicht anders, doch durch mein Zögern hätte ich ihn beinahe verloren, und ich musste meinen Schritt kurz beschleunigen, um ihn einzuholen, als er auf die Straße trat, sie überquerte und auf der Rue de Valois Richtung Norden ging.
Ich stellte mir erneut ein Ultimatum. Wenn er rechts zur Banque de France abbog, würde ich die Verfolgung sofort abbrechen. Wenn er links in den Palais Royal ging mit seinen prächtigen Gärten und stattlichen Baumreihen, würde ich ihm folgen.
Er ging nach links. Ich auch. Er ging schneller. Ich versuchte, es nicht zu tun. Er verließ das Gebäude durch einen Säulenwald in der nordöstlichen Ecke. Erst nach Westen, dann nach Norden. Wir gingen durchs Tor der Bibliothèque Nationale Richelieu, auf deren Hof schwarz gekleidete Wissenschaftler und Mitarbeiter plauderten, rauchten und aus winzigen Plastikbechern Kaffee tranken. Weiter. Die alte Börse. Banken. Cafés. Münzhändler und philatélistes, und ich dachte schon, er würde bis Montmartre laufen, und ich auch. Einfach so.
Selbst ich gebe zu, dass Paris ein Theater ist, verschnörkelt, vergoldet (obschon an den Ecken leicht abgestoßen), und wenn man hier lebt, verbringt man die meiste Zeit damit, draußen zu warten, dass man reingelassen wird, oder, wenn man drin ist, zu warten, dass sich der schwere rote Vorhang hebt. Und dann passiert etwas. Das Licht verdunkelt sich, ein Raunen geht durchs Publikum, irgendwo regt sich etwas, und man weiß, die Vorstellung beginnt endlich.
Ich rede von den üppigen Blumen, die hoch oben in den versteckten Seitenstraßen aus Balkonkästen quellen. Vom überfüllten Museumsflur, in dem du das Gefühl hast, dass eine Statue dich anstarrt, nur dich, und dass ihr Lächeln auch nach Jahrhunderten noch verschmitzt ist. Von der Mahlzeit, deren einfachste Zutaten vor dir auf dem Teller (vielleicht hast du sie selbst zubereitet, bist den überschwänglichen Anweisungen des Metzgers aufs Genaueste gefolgt) sich zu dem Besten vereinen, was du je gegessen hast. Man wartet und wartet, dass der Vorhang sich hebt, gerade weil man nicht weiß, wann er sich hebt, wo er sich hebt oder was zum Vorschein kommen wird.
Ein Mann, vielleicht. Dein Ehemann.
Ich schrieb Ellie eine SMS. Dass ich mich verspäte, dass sie den Laden aufschließen soll, das Schild auf OUVERT – GEÖFFNET drehen, um einen der seltenen Kunden anzulocken.
Und an dieser Stelle unterbrach mich der Mann, dem ich folgte.
Oui?, fragte er.
Kein Hallo. Ich war mit meinem Handy beschäftigt gewesen. Ich war zwar weitergegangen, aber unaufmerksam. Und da stand ich nun, und dieser Mann sprach mich an, was noch nie vorgekommen war.
Er kam zu nah. Sein Atem roch scharf. Passanten, Hunde, Lieferanten, Trottinettes wirbelten um uns herum, Felsen in der Brandung.
Non, sagte ich. Non, obwohl ich Verzeihung hätte sagen sollen, und zwar auf Englisch. Aber non war mir vertrauter als jedes andere französische Wort, und deshalb hielt er mich für eine Einheimische. Er senkte die Stimme, als er auf Französisch fragte, warum ich ihm folgte.
Was ich nicht sagte: dass ich meinen Mann verloren hatte, dass ich in den ersten Monaten die von diversen Broschüren und Internetseiten und zu vielen Büchern prophezeiten Phasen der Trauer durchlaufen hatte – Schock, Leugnen, Verhandeln, Schuld, Zorn, Verzweiflung – nur dass ich sie immer und immer wieder durchlief und doch nie die versprochene Akzeptanz eintrat.
Bis ich es doch zu dieser letzten Phase schaffte, oder sagen wir eher, bis ich schließlich etwas anderes akzeptierte, nämlich dass die provisorische Lösung, die ich für meine Familie gefunden hatte – eine Pariser Buchhandlung zu betreiben, über der wir wohnten –, möglicherweise von Dauer war.
Und so begannen neue Phasen. Französische Phasen. Die, wie so vieles hier, den amerikanischen zu entsprechen scheinen, sich aber als etwas völlig anderes entpuppen. In Amerika siehst du einen Mann, der deinem ähnelt, und lächelst traurig. In Frankreich stellst du ihm nach.
In Amerika denkst du: Natürlich bist du neugierig – es fühlt sich an wie ein unvollendetes Buch.
In Frankreich wusste ich, es war wegen eines unvollendeten Buches.
In Amerika sagst du: Ich habe meinen Mann verloren, und alle glauben, sie wüssten, was du meinst.
In Frankreich wissen sie es besser. Wenn ich sage, ich habe ihn verloren, sagt niemand: Das tut mir sehr leid.
Sie fragen: Wo ist er hin?
Und daher antwortete ich dem Mann, dem ich gefolgt war, und erzählte ihm, was ich der Polizei erzählt hatte, als ich noch mit der Polizei redete.
Ich sagte: Ich suche meinen Mann.
Was ich nicht sagte, weil ich es zu der Zeit, zur Zeit dieser Geschichte, meiner Geschichte, noch nicht wusste?
Mein Mann sucht mich.
Paris, Wisconsin
Kapitel Eins
Ich habe die Fassade unserer Buchhandlung lange als raffinierte Falle betrachtet.
Das soll auch so sein. Zwar befinden wir uns im beliebten Marais, aber im unteren Teil nahe der Seine, weit weg von Falafel-Ständen und crêperies, Fußgängerzonen und somit Menschenmassen und somit Kunden. Eine Seite unseres Häuserblocks wird fast vollständig von der nackten Wand eines Klosters eingenommen, das vielleicht bewohnt ist, vielleicht auch nicht. Trotz des ganzen Glockengeläuts habe ich noch nie einen Mönch gesehen. Gegenüber des Klosters eine Reihe Läden wie unserer, die aus dem Parterre anonymer Gebäude mit glatten Fassaden in gelbstichigen Pastelltönen spähen. Hoch oben schwarz angelaufene Zinkdächer und verwitterte Fensterläden, hier und dort Blumen oder ihre Überreste, sowie schmiedeeiserne Gitter oder ihre Überreste.
Und unser Laden, knallrot wie ein Apfel, eine Wunde.
Der Laden ist immer rot gewesen, doch es war dunkler, bläulicher, eher in Richtung Cabernet, als ich ihn zum ersten Mal sah. Es war meine Idee, ihn kirsch-, fast feuerwehrrot anzustreichen. Das verursachte einen kleinen Skandal, obwohl ich es mit unserer Vermieterin, der ursprünglichen Besitzerin Madame Brouillard, abgesprochen hatte. Ein Maler sprang ab, noch bevor er angefangen hatte, und ein anderer kündigte nach der Grundierung. Auf Empfehlung meines Paketboten (und inoffiziellen Wachmanns) Laurent, heuerte ich schließlich einen Polen an, der fast so wenig Französisch sprach wie ich und dem es daher egal war, was die Leute dachten. Ich fragte Laurent, was er dachte, als es fertig war. Laurent blickte die Strauße rauf und runter. Der Maler hatte nicht nur genau das Knallrot getroffen, das ich haben wollte, er hatte auch, so sah es jedenfalls aus, ungefähr sechsunddreißig Schichten Lack darüber gepinselt. Der Laden glänzte, als wäre er mit geschmolzenen Lutschern überzogen.
Laurent sagte, die solle ich lieber verkaufen, Lutscher.
Ich schüttelte meinen Kopf.
Er schüttelte seinen.
Wir verkaufen Bücher. Das steht in goldenen Buchstaben auf dem Schaufenster. BUCHHANDLUNG auf der einen Seite, LIBRAIRIEANGLOPHONE auf der anderen. In der Mitte der Name, eine Debatte. Ursprünglich war der Laden nach der Straße benannt, die nach der heiligen Lucia benannt ist. Das verwirrt die Leute, denn am anderen Ende der Stadt gibt es noch eine Straße, die nach ihr benannt ist. Noch verwirrender: Lucia ist die Schutzheilige der Schriftsteller, aber Madame Brouillard meinte, der Name locke gelegentlich religiöse Kunden an und meistens niemanden. Früher einmal, behauptete sie, hätten sich die Menschen hier gedrängt, nicht nur Buchkäufer, sondern ebenso Buchhändler. Ein Laden nach dem anderen war verschwunden, und viele überließen ihren Bestand Madame. Die englischen Ausgaben, nicht die französischen. Den Ramsch, nicht die Schätze. Und natürlich die Toten, nicht die Lebenden. Sie hatte kaum Bücher von lebenden Autoren.
Ich schlug vor, den Laden in The Late Edition umzubenennen, eine Anspielung darauf, dass wir uns fortan auf Autoren spezialisieren würden, die, im Gegensatz zu ihren Büchern, tot waren.
Es gefiel ihr nicht, aber sie ließ mich machen, denn nachtragend zu sein, gehört zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Manchmal denke ich, nur deshalb hat sie mir, die kaum etwas vom Buchhandel versteht (und noch weniger Französisch), eine Buchhandlung überlassen, die jahrzehntelang in ihrem Besitz war. Und deshalb verfolgte sie wahrscheinlich auch mit Interesse, wie der Tote-Autoren-Ansatz sich als genau die Art Pariser Schrulle entpuppte, nach denen die Autoren von Reiseführern lechzen (die gern darauf hinweisen, dass ich bei Kinderbüchern und jeder Art Bücher von Frauen Ausnahmen mache).
Madame beschäftigt Laurent schwarz, um Nachschub aus den Lagerräumen vor den Toren von Paris zu holen, wo sie die Hinterlassenschaften ihrer Vorgänger lagert. Laurent sagt, auf der ganzen Welt gibt es nicht genug Kunden für all die Bücher dort.
Und Madame hatte nur einen sehr kleinen Anteil an der weltweiten Kundschaft. Als wir den Laden übernahmen, war der Running Gag, dass nur noch drei übrig waren: zwei Amerikaner und eine Neuseeländerin, die gleichzeitig auch meine einzigen Freunde in Paris waren. Auch so ein Witz. Wann immer meine Töchter ihn rissen, lächelte ich, um zu kaschieren, wie weh es tat. Es war nicht nur eine Übertreibung, die drei Kunden zu nennen, sondern mehr noch, sie Freunde zu nennen. Trotzdem war ich dankbar, dass sie gelegentlich bei mir Bücher kauften.
Die Wahrheit ist, im modernen Frankreich, ebenso wie im modernen Überall, verkauft Amazon Bücher (und Winterreifen). Buchhandlungen verkaufen Kaffee. Die profitablen jedenfalls. Für die Buchhandlungen, die nur Bücher verkaufen, ist es hart. In Frankreich ist es geringfügig leichter, auch wenn Amazons Feixen hier ebenso allgegenwärtig ist wie in Milwaukee, wo meine Mädchen und ich bis vor kurzem gelebt haben. (Oder sind zwei Jahre keine kurze Zeit? An manchen Tagen fühlt es sich an wie zwanzig Jahre. An anderen wie zwanzig Minuten.) Das aufgeklärte Frankreich jedenfalls reglementiert das Verramschen von Büchern (oder versucht es) und gewährt, was noch erfreulicher ist, unabhängigen Buchhandlungen gelegentlich finanzielle Unterstützung. Eigentlich soll damit der Verkauf neuer Bücher gefördert werden, aber Madame hatte eine Möglichkeit gefunden, davon zu profitieren, indem sie eine zweite, kleinere Buchhandlung betrieb, die neue französische Titel verkaufte. Sie befand sich rein zufällig in einer anderen Buchhandlung, die gebrauchte englische Bücher verkaufte. Der französische Laden war auf Kinderbücher spezialisiert und befand sich im vorderen Teil des ersten Stocks, der in Wahrheit nur ein enges Zwischengeschoss war.
Der hintere Teil vom Zwischengeschoss diente, notdürftig abgetrennt, als Schlafzimmer für meine Töchter und musste, wenn sie beim Gehen die Tür offen ließen, als Abteilung für englischsprachige Kinderbücher herhalten. Daphne beklagte sich einmal, jemand würde ihre alten Beverly-Cleary-Bücher stehlen. Ich hatte sie verkauft, ohne zu fragen, wo sie gestanden hatten.
Küche, Wohnbereich und mein Schlafzimmer liegen im Stockwerk über den Mädchen, der étage noble mit höheren Decken und aufwändigeren architektonischen Details. Doch über die beiden obersten, wesentlich helleren Stockwerke herrscht die noble Madame Brouillard. In dem einen wohnt sie, und in dem darüber ihre Privatsammlung an Büchern, jedenfalls hat sie mir das einmal erzählt. Lange Zeit bin ich nie weiter in ihre Wohnung vorgedrungen als bis in das kleine Wohnzimmer direkt hinter der Tür (das, ebenso wie das Gebäude und wie so vieles in Paris, genauso aussieht, wie Schriftsteller und Künstler uns seit jeher vorgaukeln: gelbes Dämmerlicht, feine Möbel, Spitze, eine alte Kristalllampe auf einem winzigen Tischchen).
Paris ist im Grunde wie Madames müßige Versprechen, mir das oberste Stockwerk zu zeigen, eine Verlockung, eine Aufforderung. Vielleicht endeten meine Unterhaltungen mit Madame deshalb oft so abrupt. Oder weil sie lange vor mir wusste, dass die Falle nicht für Kunden gedacht war, sondern für meinen verschwundenen Mann – und dass ich stattdessen selbst hineingetappt war.
Es ist ein bisschen ironisch, dass ich eine Buchhandlung führe, denn vor zwanzig Jahren wurde ich in einer zum Klauen verführt. Ironisch ist auch, dass ich in Paris Männer verfolge, denn an jenem längst vergangenen Abend verfolgte mein Mann mich.
Kulissenwechsel! Neuer Bürgersteig, andere Ladenfront, frischer Hintergrund. Fort mit dem Eiffelturm, und stattdessen – nichts. Blauer Himmel, Wolken, wenn Sie wollen. Eine schlichte Skyline. Hier und da ein Kirchturm, ein paar Schornsteine, aber ansonsten Clipart-Gebäude. Schließlich sind wir nicht länger in Paris, sondern in Milwaukee.
Und dort, an meiner linken Hand, kein Ring. Wir sind noch nicht verheiratet, mein Mann und ich. Zwei Menschen aus dem Mittleren Westen, bleich wie der Mondschein, die sich noch nicht einmal kennen, als er mich auf offener Straße anspricht – eine Abfolge von Heys!, die immer näher kommen, bis ich mich umdrehen muss – wegen etwas, das ich in der rechten Hand halte. Ein Buch. Wohlgemerkt, ich verstecke es nicht. (Ich verstecke es nicht, weil ich es nicht kann – es ist etwa fünfundzwanzig mal dreißig Zentimeter groß, ein Kinderbuch mit einem knallroten Luftballon auf dem Cover.)
»Hi«, sagte er mit einem verhaltenen Lächeln. »Ich glaube, du hast vergessen zu bezahlen.« Jetzt runzelte er passend zu seinem verhaltenen Lächeln verhalten die Stirn, was ihm stand. So bekam er ein paar Falten, die ihn ein paar Jahre älter machten. Er war klein, hübsch, schlank, aber sportlich. Ich hatte ihn für siebzehn gehalten. Unterwegs mit dem Geländelauf-Team seiner Highschool. Jetzt fügte ich vier Jahre hinzu. Später fügte er vier weitere hinzu: fünfundzwanzig. Unglaublich.
»Oh, ich bezahle«, sagte ich. »Ich bezahle jeden Tag.« Ich wollte gerade ausholen und mich über Männer auslassen, die mich auf offener Straße belästigen, über Männer auf der ganzen Welt, die Frauen auf der ganzen Welt auf offener Straße belästigen – doch das traf gar nicht zu, nicht auf mich.
In Wahrheit war es mir peinlich. Es war mir peinlich, dass ich etwas geklaut hatte – ich hatte noch nie etwas geklaut – und dass ich ein Kinderbuch geklaut hatte. Und es war mir peinlich, dass ich so arm war. Ich war fast vierundzwanzig, und genauso viele Dollar hatte ich noch auf dem Konto. Montag kam das Geld von meinem Stipendium, doch bis dahin besaß ich lediglich vierundzwanzig Dollar, zwei gesperrte Kreditkarten und ein Übermaß an Frust. Die Universitätsbibliothek hatte unerklärlicherweise früher geschlossen, und ich meinte, in genau diesem Moment das Buch zu Albert Lamorisses Film Der rote Luftballon von 1956 zu brauchen, um meine Magisterarbeit über diesen großen (und ziemlich kuriosen) Mann zu beenden, obwohl ich jede Einstellung des klassischen Paris-Films und jede Seite des Begleitbuchs auswendig kannte – ja sogar jeden Pflasterstein und jede Katze (eine echte, schwarz, eine auf einem Poster an einer Häuserwand, weiß).
Viele Leute meines Alters teilten meine Obsession als Kinder kurzzeitig, dank der Regenpausen-Vorführungen an amerikanischen Grundschulen in den Siebzigern und Achtzigern. Ich bemerkte, dass die anderen Kinder sich im Lauf der Jahre weiterentwickelten. Ich nicht. Dieses Buch war meine erste große Liebe. Ein Schwarm, ein Gefährte, ein Geliebter, wie ich ihn nie haben würde. Dieses Buch, dieser Film verstand mich. So empfand ich es jedenfalls. Ich wusste, dass ich ihn verstand. Und darüber hinaus verstand ich sein Paris. Für andere Mädchen (und vereinzelte Jungs) bedeutete Paris Blumen und Romantik und keuchende Akkordeons. Der rote Luftballon war nichts davon. Der Film ist wunderschön, aber bitter. Manche finden ihn süß, aber ich mochte schon als Kind nichts Süßes und mache mir bis heute nicht viel daraus. Mich überrascht, dass nicht mehr Leute – wie die Buchhändler in Milwaukee, aus deren Laden ich das Buch geklaut habe – das Offensichtliche sehen. Rot ist eine Warnfarbe.
Ich wünschte, ich selbst hätte auf die Warnung gehört. Damals studierte ich Filmwissenschaft – Filmkritik –, aber angefangen hatte ich mit Filmemachen, weil ich etwas machen wollte, und bei Lamorisse sah es so einfach aus. Das war es nicht, vor allem als ich entdeckte, dass mein Studiengang nichts vom Geschichtenerzählen hielt. Wie viel besser wäre Der rote Luftballon gewesen, hieß es, wenn er einzig und allein das gewesen wäre: die Nahaufnahme eines Ballons für dreißig Minuten – oder dreißig Stunden! Kein Dialog. Keine Schauspieler. Nur Ballon. Was denkst du, Leah? Ich dachte, ich wechsle zur Filmwissenschaft, und das tat ich. Es hieß, ich müsse mich auch für andere Filme interessieren als Der rote Luftballon und für andere Stadtbilder als Paris. Eine Weile ließ ich sie in dem Glauben, dass ich das täte. Doch ich konnte die Fiktion nicht aufrechterhalten. Nach sehr kurzer Zeit war ich ausgebrannt, ich gab auf. Oder, wie ich es gern sehe, ich gab nach, und zwar einer persönlichen Wahrheit: Ich interessierte mich hauptsächlich dafür, meinen eigenen Film zu machen. Ich wusste nicht wie, wann oder worum es gehen würde. Ich wusste jedoch, wo er spielen würde: weit weg von Wisconsin.
Und weit weg von diesem Jungen, der mich auf der Straße vor einem Buchladen belästigte.
Ich rannte.
Doc Martens eignen sich nicht zum Laufen, vor allem nicht, wenn man sie anderthalb Nummern zu groß bei Goodwill gekauft hat. Ich machte mir Sorgen, mein Verfolger könnte glauben, die hätte ich auch geklaut. Ich machte mir Sorgen, weil ich mir Sorgen machte, was er dachte.
Als er mich endlich einholte, war das erste Wort aus seinem Mund dasselbe, das auch ich hatte sagen wollen.
»Verzeihung?«
Er war schön. Ich weiß, das Wort impliziert eine gewisse Zartheit. Er besaß eine gewisse Zartheit.
»Macht nichts«, erwiderte ich und verzieh ihm großzügig etwas, das ich getan hatte.
Er hatte in der Schlange an der Kasse gestanden, als er sah, wie ich mit dem Buch aus dem Laden ging. Er hatte die Kassiererin gebeten, es auf seine Rechnung zu setzen, und war mir dann gefolgt. »Behalte es«, sagte er jetzt, obwohl ich das sowieso vorgehabt hatte.
»Ich bin nicht sicher, ob ich es noch will«, log ich.
»Darf ich dich zu einem Kaffee einladen?«
»Wie wär’s mit einem Bier?«, fragte ich. »Es sei denn, du hast Angst, dass ich es dir klaue.«
Hatte er nicht, oder vielleicht doch, denn er hielt in der Bar, in der wir uns später trafen, die ganze Zeit sein Glas umklammert. Er war nervös oder durstig oder wusste, dass seine Hände, wenn sie nichts zu tun hatten, flatterten, sich hoben, senkten, Umrisse malten, vertraut oder nicht. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und nickte oder rieb sich das Gesicht und runzelte die Stirn oder zeichnete einen Buchstaben auf den Tisch, einen weiteren in die Luft. So sprach er. So lächelte er. Es waren die Nerven, aber ganz allgemein, zumindest zu dem Zeitpunkt, und ich legte es darauf an, dass er meinetwegen nervös wurde. Ich wollte sehen und fühlen, was diese Hände konnten.
Und er hatte diese Augen. Grau, aber die rechte Iris hatte einen winzigen orangeroten Klecks, und ich konnte mir nicht verkneifen, ihn darauf anzusprechen.
Zur Antwort schloss er kurz die Augen. »Er hat keine Bedeutung«, sagte er, »bei Menschen. Aber bei Tauben. Wenn man sie an Wettkämpfen teilnehmen lässt, was ich nicht tue, unterscheidet man sie dadurch, so weißt du, welche deine ist.«
Und in diesem Augenblick wusste ich es.
»Paris, also«, sagte er und tippte auf Der rote Luftballon, das zwischen uns auf dem Tisch lag. Ich zuckte zusammen, unmerklich, glaube ich. Klopf, klopf. Es fühlte sich an wie kleine Schläge auf meine Brust.
Robert erklärte, sein Lieblingskinderbuch sei Ludwig Bemelmans’ Madeline-Reihe.
Da gab’s in Paris ein altes Haus,
Dort gingen zwölf Mädchen ein und aus.
Sie saßen zu Tisch in zwei graden Reihn …
Ich schüttelte den Kopf. Vor langer Zeit – erste oder zweite Klasse – wären diese Worte eine Kampfansage gewesen. Die Hüte, die Schleifen, die Uniformen? Zwei grade Reihen?
Doch mein Mann ließ nicht locker. Er dachte, wegen meiner Verehrung von Lamorisse müsste ich Bemelmans-Fan sein: »Beide vor – und nach – allem Künstler!« In seiner Hand materialisierte sich ein Exemplar des ersten Madeline-Buchs. Er hatte es für mich gekauft. Passend zu dem Buch, das ich geklaut hatte.
Er legte Madeline neben Der rote Luftballon, beide Bücher gleichberechtigt auf dem winzigen Tisch zwischen uns. Ich schaute auf die Cover und dann zur Bar.
»Es sind definitiv alle neidisch auf mein Rendezvous«, sagte ich.
Das stimmte nicht. Aber ich war definitiv nervös. Ich wollte meine Passion, mein Paris schützen. So sehr, dass ich die Reise dorthin immer wieder aufschob. Geldmangel spielte eine Rolle, ebenso aber die zynische Gewissheit, dass ich von dem Paris, das ich vorfinden würde, enttäuscht sein würde. Es wäre nicht das Fünfzigerjahre-Paris aus Der rote Luftballon. Es wäre nicht auf so euphorische Weise trostlos. Der Ballon, sollte ich einen finden, sollte mich einer finden, würde platzen, bevor ich die letzte Seite erreicht hätte.
(Es gibt viele Definitionen für Feigheit. Dies ist eine.)
»So wie ich es sehe«, fuhr er fort, als hätte ich nichts gesagt, »und ich sehe es tatsächlich erst jetzt, wo die beiden Bücher nebeneinander liegen: Ist schon komisch, oder?«
Er war komisch, und das faszinierte mich erst recht. An der Uni begegneten wir jeder Normalität mit Skepsis. Als entmutigte, verarmte, nachtaktive Wesen, die wir waren, begeisterten wir uns für jede Art von Illumination, selbst wenn sie seltsam flackerte. Vor allem dann. Ich betrachtete ihn eingehend. Er betrachtete die Bücher.
»Es sind zwei verschiedene Weltsichten«, fuhr er fort. »Eine Stadt …«
»Das sehe ich anders«, sagte ich.
»Entweder bist du ein Madeline-Mensch oder eine Roter-Luftballon-Mensch«, sagte er. (Auch das sah ich damals anders, doch die Genetik bestätigt ihn: Unsere beiden Töchter sollten seine Augen und seine Vorliebe für Bemelmans erben.) »Zeichnungen oder Fotos. Paris in Farbe oder schwarzweiß.«
»Der rote Luftballon ist in Farbe. Das ist das Thema.«
»Aber seine Palette – sein Paris – besteht nur aus grau«, sagte er.
»Du kennst nur das Buch. Die Fotos sind Standbilder. Der Film ist anders.« Und so outete ich mich als ehrgeizige (bald vergessene) Filmstudentin, deren ehrgeizige (bald vergessene) These war, dass Der rote Luftballon nicht nur irgendein Film war und sein auteur Lamorisse nicht nur irgendein Filmemacher, sondern der französische Filmemacher Frankreichs seiner Zeit. In seinem zweibändigen Klassiker Was ist Film? lässt André Bazin sich seitenlang über Lamorisse aus. Und ich zitierte den Kritiker, der den berühmten Regisseur René Clair zitiert, einen gebürtigen Pariser, der angeblich gesagt hat, er hätte seine ganze Karriere »dafür gegeben, diesen einen Kurzfilm gedreht zu haben«.
»Dann kapierst du es!«, sagte Robert.
Tat ich nicht, doch ich nickte vorsichtig.
»Mit Bemelmans ist es genauso«, sagte er, nicht zu mir, sondern zu dem Buch. »Er ist so … Ich meine, das hab ich immer an ihm geliebt … Kennst du seinen Hintergrund?«
Was gab es da zu kennen? Man brauchte nur einen Blick in sein Buch werfen. Das war der Unterschied zwischen Roberts Helden und meinem.
»Vermutlich wäre er entsetzt, dass sein Buch als Bierdeckel herhalten muss«, sagte ich.
»Er hat es in einer Bar geschrieben«, sagte er und blickte auf. »Pete’s Tavern. Manhattan. Gibt es immer noch, glaube ich.«
»Bist du … kein Student?«, fragte ich.
Jetzt ein Lächeln.
»War ich«, sagte er. »Kreatives Schreiben. Aber ich hab aufgehört als ich ein paar Sachen verkauft habe.«
»Möbel?«
»Ein Buch. Bücher. Die ich geschrieben habe.«
Ja, ich hörte den Plural. Bücher. Und jetzt seinen Namen, Robert Eady – so lange hatte er gebraucht, ihn mir zu sagen. Ich beschloss, noch damit zu warten, ihm zu sagen, dass meiner Leah war. Er sollte ihn sich erst verdienen, oder wenigstens fragen.
Ich schüttelte den Kopf. Aus Unwissenheit, nicht Gehässigkeit, aber sollte er das ruhig glauben.
»Du gehörst nicht zu meinem Publikum«, sagte er. »Momentan, meine ich.«
»Eigentlich schon. Momentan.«
»Eigentlich«, sagte er, »sind es Bücher für Kinder – Jugendliche.« Er beschrieb eine Buchreihe, die in einer »Mittelschule in der Mitte des Landes« begann. Das erste hieß Central Time, und zentral für die Handlung war die absolute Abwesenheit jeglicher Erwachsener – keine Lehrer, keine Eltern.
»Clever«, sagte ich. Er antwortete mit einem neuen Lächeln, irgendwie gezwungen – oder unerschrocken. »Was kommt als nächstes?«, fragte ich. »Mountain Time?«
»Egal«, sagte er. »Damit bin ich durch. Ich möchte etwas anderes machen.«
Ich lehnte mich zurück und musterte ihn, seine Augen: seltsam und schön, stolz und nervös, begeistert und besorgt, alles zugleich. Als ich später herausfand, dass er, wie ich, beide Eltern verloren hatte, dachte ich: Daher kommt er, dieser Blick. Er begleitet auch mich.
»Bemelmans etwa«, sagte er. Ich hörte zu. Ich konsumierte ihn, nahm einen kräftigen Zug von ihm, wurde ein kleines bisschen high. Er war anregend, elektrisierend und seltsam und drahtig, und was steckte unter seinem Hemd? Ich wollte eine Zigarette. Ich wollte, dass er sie mir anzündete. Ich hatte noch zwei übrig. Rauchte er? Wir könnten uns eine teilen. Aber wie bekam ich ihn dazu, mit mir nach draußen zu gehen?
Er redete immer noch. »Bemelmans hat sicher fünfzehn verschiedene Sachen gemacht in seinem Leben – Kellner, Autor, Illustrator. Eine Million Sachen. Bis er begreift, was er eigentlich machen will – echte Kunst, Ölgemälde. Die Herausforderung bringt ihn an seine Grenzen – und er sprengt sie. Er tut es. Nebenher hat er jede Menge geschrieben, Madeline-Fortsetzungen, und er hat diese Arbeit respektiert – er hat seine Leser respektiert – er hat nie aufgehört, für sie zu schreiben, ich meine, nicht einmal auf dem Sterbebett – aber gelebt hat er für seine Bilder.«
»Versteh mich nicht falsch«, sagte ich, in der Hoffnung, das würde er, »aber … war das richtig von Bemelmans?«
»Versteh mich nicht falsch«, sagte Robert, »aber war es richtig von dir, das Buch zu klauen? Du brauchst gar nicht zu antworten, denn offensichtlich war es das – das Buch, der Film, Lamorisse, die Kunst – all das bedeutet dir viel.«
»Bei dir klingt das hochtrabender als es ist«, sagte ich.
»Bei mir klingt es nicht hochtrabend genug! Ich kenne Lamorisse nicht so gut wie du, aber er … er hat nach diesem einen Film nicht aufgehört, oder?«
Hatte er nicht, doch ich zuckte die Schultern. »Er ist jung gestorben. In einem Hubschrauber.« Robert nickte. »Nördlich von Teheran«, fügte ich hinzu, weil es stimmte und weil ich vom Thema ablenken wollte.
»Iran!«, rief Robert. Die Leute in der Bar drehten sich nach uns um. Robert nickte noch eifriger, als wären Hubschrauberabstürze in Nahost genau das, worauf er die ganze Zeit hinausgewollt hatte. »Ganz ähnlich wie Bemelmans, oder?«, sagte er. »Rastlos.«
Ich wollte widersprechen. »Rastlos« war nicht meine These. Doch es war Roberts – und ich erkannte erst dunkel, dann klarer, dass es vor langer Zeit auch die von Lamorisse gewesen sein mochte. Er hatte einen wunderschönen Film gemacht. Und eine Handvoll weitere. Und er hatte Wein und Keramik und gemusterte Stoffe hergestellt, gemeinsam mit seiner Familie in den Bergen hinter Saint-Tropez. Er hatte das Brettspiel Risiko erfunden. Und ein Luftbildkamerasystem namens Helivision, das die Macher des James-Bond-Films Goldfinger verwendet hatten, ebenso wie Lamorisse selbst über der Amir-Kabir-Talsperre in Iran, wo er eine Dokumentation für den letzten Schah drehte. Ich hatte keine Ahnung, was Lamorisse danach vorgehabt hatte.
»Ich bringe das Buch in den Laden zurück«, sagte ich.
»Welches?«, fragte er.
»Beide«, sagte ich.
»Sie sind bezahlt«, sagte er.
Behutsam nahm Robert Bemelmans’ Madeline und steckte es in meine Tasche. Wie gesagt, ich war nie ein Bemelmans-Fan gewesen, nicht einmal als Kind, doch als dieses heitere Buch in meine Tasche rutschte, verrutschte irgendetwas in mir.
Der rote Luftballon zeigt ein phantastisches, aber auch trostloses Paris: Ein kleiner Junge freundet sich mit einem verzauberten Luftballon an, groß und rund wie ein Wasserball. Ungefähr zweiunddreißig Minuten erkunden sie gemeinsam die Stadt. Dann lassen böse Jungs mit Steinschleudern den Ballon platzen. Selten ist im Kino jemand so qualvoll gestorben wie der Ballon, dessen einst glatte Oberfläche scheußliche Runzeln wirft, als er schrumpft und zu Boden fällt. Das Ganze dauert nur Sekunden oder, wie jedes Kind, das den Film gesehen hat, sagen wird, länger als eine Ewigkeit.
In den Madeline-Büchern dagegen strahlt Paris, selbst bei Regen oder Schnee, selbst neben einem Jungen in einer Bar. Hätte Bemelmans’ Buch reden können, wusste ich, was es sagen würde: Macht nichts, dass du keinen Abschluss und keine Aussicht auf einen Job hast – komm spielen nach Montmartre! Ich liebte Bemelmans.
Ich hatte seit einer Woche nicht geschlafen. Ich hinkte mit meiner Arbeit hinterher. Ich hinkte, so kam es mir irgendwie vor, mit meiner Trauer hinterher. Zwei Jahre waren meine Eltern damals tot und sie erschienen mir immer noch regelmäßig, wenn ich schlief und auch, was noch verstörender war, wenn ich wach war. Sie konfrontierten mich nie direkt, sondern blitzten stets im Hintergrund auf, wie Stars, die inzwischen als Statisten auftreten. Ich hatte Angst, sie könnten mich jetzt sehen: Ich hatte ein Buch gestohlen, das ich eigentlich nicht brauchte, nur um festzustellen, dass ich es viel zu sehr brauchte. Da ich mir gerade geschworen hatte, nicht mehr vor anderen zu weinen, entschuldigte ich mich, deutete vage zur Toilette, und schloss mich ein.
Als ich später, zu spät, an den Tisch zurückkehrte, stellte ich fest, dass er gezahlt hatte, dass er gegangen war, dass er das Buch da gelassen hatte, mein Buch, Der rote Luftballon. Mein Bier, halb ausgetrunken, wartete auch noch. Ich bat eine Kellnerin, mir etwas Stärkeres zu bringen. Ich schlug das Buch auf und blätterte es durch, Seite für Seite, um mein ganzes Projekt zu überdenken. Wie hatte ich übersehen können, wie sehr die Kamera – Lamorisse – den kleinen Protagonisten Pascal liebte, der von seinem eigenen Sohn Pascal gespielt wurde? Wie sehr Lamorisse Paris liebte? Das Fliegen liebte?
Auf Seite 13 stutzte ich. Dort auf dem ganzseitigen Foto von dem Mietshaus, in dem Pascal wohnt, stand in sauberer Handschrift: 2559Downer Avenue. Das Foto war aus Paris, doch die Adresse war gleich um die Ecke.
Weiter oben auf der Seite, über dem Fenster, aus dem sich Pascals Mutter oder Großmutter lehnt, um den lästigen Ballon zu entsorgen, hatte Robert geschrieben: 5A.
Und schließlich im Luftballon selbst, fünf Worte: Wir sehen uns in Paris!
Paris. Ich war dort aufgewachsen. Oder besser gesagt hatte ich durch Lamorisses Film und Buch das Gefühl gehabt. Dabei kam ich aus einem Kaff in Wisconsin, so klein, dass es nur eine Kneipe gab, die zufällig uns gehörte und über der wir wohnten. Wenn ich die Buchversion von Der rote Luftballon aufschlug (die ich dem Film vorzog, weil ich mir das Buch auch allein und immer wieder ansehen konnte, während der Film die Hilfe eines Bibliothekars, Lehrers oder Elternteils erforderte), verschwanden die Bar und die Straßenkreuzung mit der blinkenden Ampel. Ich war in Frankreich.
Ich liebte die Welt von Der rote Luftballon, weil sie so anders war als meine. Die Straßen waren eng und exotisch, holprig vom Kopfsteinpflaster, bevölkert von seltsamen Fahrzeugen und, auf einer unvergesslichen Seite, von Polizisten auf Pferden. Vielleicht würde jedes Kind, das tagein, tagaus auf eine ruhige Kreuzung im mittleren Westen blickt, das faszinierend finden. Doch ich liebte das Buch aus ganz persönlichen Gründen. Einen Großteil meiner Kindheit war ich allein gewesen. Genau wie der kleine Protagonist des Buches. Der Ballon war sein einziger Freund. Dieses Buch war mein einziger Freund. Ich weiß nicht, ob ich geschnitten wurde, weil meine Eltern eine Bar betrieben, oder selbst daran schuld war – das Mädchen, das wusste, wann der französische Nationalfeiertag war, das Mädchen, das sich für Französisch in der Mittelstufe aussprach (die einzige Fremdsprachenoption in der Schule war Deutsch). Tag für Tag sah ich zu, wie Pascal durch Paris lief. Er folgte dem Ballon, der Ballon folgte ihm, und ich versuchte beiden zu folgen, enttäuscht, dass ich nicht näher als 4127 Meilen an sie herankam.
Doch Roberts Wohnung lag nur ein paar Straßen entfernt, kaum eine Zigarettenlänge. Wir sehen uns in Paris, hatte er geschrieben. Als ich ankam, fand ich eine spartanische Einzimmerwohnung vor, ohne Möbel, bis auf einen Sperrholztisch und eine Matratze auf dem Boden. Der verblichene Fetzen der Tibetfahne eines Vormieters hing aus dem Fenster wie eine Feuerleiter.
Robert wirkte überrascht, mich zu sehen. Ich war überrascht, überall Bücher gestapelt zu sehen, schwankend, kurz vorm Umstürzen wie Stalaktiten (er korrigierte mich: Stalagmiten), verteilt über den ausgetretenen Dielenboden, der vor Lust zu stöhnen schien, so wie ich es später tat.
Halb Paris sieht aus wie Pascals Wohnhaus, vor allem in der Straße, in der ich jetzt lebe und die ich oft entlanggehe, um einen klaren Kopf zu kriegen. Oder besser gesagt, um ihn zu füllen. Vielleicht geht das nur Buchhändlern so, aber wenn ich spazieren gehe, sammle ich so viele Geschichten ein, wie ich tragen kann. Ich beobachte und lausche, frage mich: Woher kommen die Sirenen? Wer hat diesen orangefarbenen Handschuh fallen lassen? Das Pärchen, das mir entgegenkommt: Ist sie mit ihm verheiratet – oder haben die beiden, wie sein verhuschter Blick vermuten lässt, eine Affäre? Warum ist dieses Fenster voll verstaubter Filmposter? Rieche ich Zwiebeln, Schalotten oder Knoblauch? Aus diesem Fenster? Aus allen Fenstern? Olivenöl oder Butter? (Sicherlich Butter, der Treibstoff der Stadt.) Führen jene Tibetfahnen zu einer so bücherverrückten Wohnung wie der damals in Milwaukee?
Ich weiß es nicht. Ich gehe nicht mehr in fremde Wohnungen.
Aber meine Straße! Meine hübsche morbide Straße, mein knallroter Laden und zwei Türen weiter ein strahlend weißer, der Wischmopps verkauft. Sehr schöne Wischmopps, aber trotzdem: nur Wischmopps. Einmal fragte ich die Besitzerin, eine Italienerin, Römerin, Madame Grillo, warum sie sich so beschränke. Sie sah mich an und sagte: Aber Sie verkaufen nur Bücher?
Hinter jeder Ladenfront eine Geschichte.
Auch wenn man die Straße weiter hinuntergeht, Richtung Seine, wo die meisten Läden verrammelt sind oder leer. Nicht lange, nachdem wir die Buchhandlung übernommen hatten, sah es aus, als würde ein neues Geschäft aufmachen. Die Fenster wurden geputzt und drinnen tauchte ein Maler auf. Und tauchte nie wieder auf. Er ließ eine alte Trittleiter aus Holz zurück, abgewetzt und mit Jahrzehnten von Farbklecksen bedeckt: Rostrot, Goldbraun, ein Dutzend verschiedene Blaus. Und obendrauf ein einziger Apfel. Ich kam zu dem Schluss, dass es ein Kunststudent gewesen sein musste, der als Maler jobbt – ein Maler, so stelle ich mir vor, der als Maler jobbt –, denn die Platzierung des Apfels war so perfekt wie sein Aussehen: klein, rund, rotbraun mit blassgrün gesprenkelter Tonsur um den Stiel. Das Tableau war perfekt, ein Stillleben und der Beweis, dass es in jeder Straße von Paris mindestens einen Laden, ein Tor, Fenster, Schild oder einen Mauerstein gibt, dessen Erlesenheit zum Nachdenken verleitet. Nicht umsonst sagt man auf Französisch für Schaufensterbummel lèche-vitrine, Schaufensterlecken.
Was eklig klingt. Außer in Paris.
Jede Falle braucht einen Köder. Monatelang hatte meiner im Schaufenster unten links gelegen. Ein Buch. Nicht Madeline oder Der rote Luftballon, sondern eins von Roberts, sein erstes, Central Time, ein so gut wie neues Exemplar, das versehentlich zwischen die USA-Reiseführer gerutscht war. Ohne es auch nur aufzuschlagen oder Madame zu fragen, woher sie es hatte, legte ich das Buch ins Schaufenster und versuchte, nicht darüber nachzudenken, was ich damit bezweckte. Eine brennende Kerze, ein angelassenes Verandalicht, eine hochgeklappte Briefkastenfahne, ein Signal. Ab und zu wollte es jemand kaufen, doch ich lehnte ab.
Acht Monate nach unserer Ankunft in Paris, zwölf Monate nach Roberts Verschwinden, war es die potenzielle Käuferin, die ablehnte. Sie reichte es mir und fragte, ob ich hinten noch ein anderes »sauberes« Exemplar hätte. In dieses sei etwas hineingekritzelt. Ich schüttelte den Kopf. Ich hätte netter zu ihr sein sollen. Wie gesagt, es gab immer etwas Laufkundschaft, aber nur drei Stammkunden. Einen älteren Amerikaner aus der Botschaft, der jede Woche Krimis kaufte. Eine junge Mutter aus Neuseeland, die wegen der Kinderbücher kam, aber vorrangig, um zu plaudern. Und eine pensionierte Kunstlehrerin aus New Orleans, die auf einem Hausboot wohnte und malte und von mir jede Woche etwas Neues wollte, Geld spielte keine Rolle. Doch weder ihr noch den anderen gab ich jemals Roberts Buch.
Ich hätte freundlicher sein sollen, war es aber nicht. Ich war abgelenkt von dem, was diese Kundin – eine Fremde – auf der ersten Seite gefunden hatte. Eine Notiz, zwei Wörter.
Verzeih mir.
Roberts Handschrift ähnlich genug, zittrig genug, um mich stutzig zu machen.
Als ich endlich meine Stimme wiederfand, überraschten mich meine Worte: »Ich gebe es Ihnen für die Hälfte, weil ich …«
Weil ich was? Ich war selbst gespannt. Doch ich konnte den Satz nicht beenden, und als ich aufblickte, war die Kundin verschwunden.
Kapitel Zwei
Meine Töchter betrachten den Laden nicht als Falle, doch als Passant könnte man das glatt annehmen, wenn man sieht, wie die Mädchen morgens aus dem Haus stürmen, als würde die Fassade gleich zuschnappen.
In Wahrheit ist es die pünktliche Schließung des Schultors, die sie fürchten, deshalb rennen sie los, und ich hinterher, oft begleitet von Glockengeläut. Jeden Morgen, weit nach sieben Uhr, ertönen sieben Glockenschläge im Kloster auf der anderen Straßenseite, und dann sieben Minuten später sechs Glockenschläge in einer Kirche, die wir Sankt Irgendwer nennen. Es klingt, als wäre sie nur wenige Straßen entfernt, doch wir haben sie nie gefunden. Vielleicht liegt sie in einer anderen Zeitzone. Wenn wir beim Klang dieser Glockenschläge noch nicht aus dem Haus sind, kommen wir zu spät. »Ihr Süßen!«, rufe ich, das letzte Kosewort, das mir die Mädchen noch erlauben, und auch nur auf Englisch, damit es niemand versteht.
»Mom!«, ruft Daphne. Sie ist meine jüngere Tochter, zwölf bei unserer Ankunft, und immer auf der Suche nach einem Haargummi. Doch wenn ich eins hervorzaubere, protestiert sie: »Das ist nicht das gute. Das sitzt zu locker …«
»Dein Gehirn ist geschrumpft!« Das ist ihre Schwester Ellie, zwei Jahre älter als Daphne. Ellie ärgert sie mit der Legende von einer Lehrerin, die angeblich mit dem Lineal durch die Schule gegangen ist und die Schädel der schlechten Schüler gemessen hat: Wenn ihr nicht lernt, schrumpfen eure Gehirne. Zu Hause in den Staaten haben wir die Größe der Mädchen mit Bleistift am Türrahmen markiert. Als ich diese Tradition in Paris fortsetzen wollte, bestand Daphne darauf, dass ich ihren Kopfumfang messe. Da habe ich von der Geschichte erfahren. Fürs Protokoll: Daphnes Lehrerin – jung, hinreißend, nett, aber nicht nachgiebig, äußerst ernst – tut so etwas nicht. Und Daphnes Gehirn ist völlig in Ordnung. Wenn überhaupt, ist vielleicht ihr Herz einen Tick zu groß.
»Courez!«, ruft Ellie. Das heißt übersetzt lauft, ist aber auch einer unserer Witze: In den Staaten haben die Mädchen jahrelang Französisch gelernt. Daphne jedenfalls. Ellie sehnte derweil das Ende der Stunde herbei, das die erschöpfte Lehrerin stets mit einem Wort verkündete, diesem Wort: Courez!
Wir gehen aus der Tür und die Straße entlang. Ellie voran, ich dahinter, und Daphne trödelt hinter uns beiden her.
Ellie ist groß, schlank, als wären Konsonanten – das langbeinige Doppel-L – ihr Schicksal. Daphne ist kleiner, kompakter: nicht weniger hübsch als ihre Schwester, auch wenn sich erst noch jemand finden muss, der sie davon überzeugen kann. Sie ist schüchtern, schlau und liest Bücher, für die sie eigentlich noch viel zu jung ist. Einmal erzählte sie mir, Edith Wharton sei ihre beste Freundin, und weinte, als ich ihr sagte, Edith sei vor fast einem Jahrhundert gestorben. An Tagen wie diesen rumpelt Daphne die Straße hinauf, die Hälfte ihres Körpergewichts in Büchern dabei. Ellie belastet sich nie mit mehr als einem Telefon.
Madame Grillo wischt oft den Weg vor ihrem Laden, wenn wir vorbeigehen. Sie findet großes Vergnügen an unserer Morgenroutine: »Courez, les filles, courez!« Sie hat Daphne und Ellie eigene Wischmopps geschenkt, als wir eingezogen sind. Ellie hat ihren an mich weitergereicht. Daphne hat ihren so oft benutzt, dass sie sich zu Weihnachten einen neuen wünschte.
»Bonjour, Madame«, rufe ich im Vorbeilaufen.
»Les Américains toujours passionnants!«, ruft sie zurück, obwohl ich nicht recht weiß, was sie damit meint. Französisch ist weder ihre noch unsere Muttersprache. Ellie behauptet, wir sind nicht passionnants, sondern pressés. Aber ich mag Madame. Ich glaube, sie mag uns auch, oder zumindest unsere tägliche Show.
Wenn wir uns sehr beeilen und die Ampel mitspielt – obwohl auch die Ampel zu wissen scheint, dass wir Amerikaner sind, und uns gern das Leben schwermacht – schaffen wir es zur Schule, kurz bevor die Türen sich schließen. Es ist ein heikler Moment, egal welcher Nationalität man ist. Niemand möchte ausgeschlossen werden. Und wenn man mehr als zwanzig Minuten zu spät kommt, wird man in einen Aufenthaltsraum geschickt, zu einer Art Nachsitzen, doch auf Französisch klingt es düsterer: permanence. Heute jedoch: succès. Die Mädchen verschwinden im Gebäude, ohne auch nur einen Blick in meine Richtung zurück zu werfen, so peinlich ist es ihnen, dass ich sie begleitet habe. Eltern gehören hier nicht her. Nur wenige tauchen auf, und die gehen fast nie hinein. Bis auf wenige Ausnahmen erwartet man von den Eltern, dass sie draußen bleiben.
Und so kommt es, dass ich dort stehe und den Aushang für das Mittagsmenü lese. Cassoulet. Und zum Abendessen? In der Schule gibt es zwar kein Abendessen, doch manchmal macht die Schulleiterin Vorschläge, was les parents auf Basis dessen, was unseren Kindern mittags vorgesetzt wurde, kochen könnten. Heute: Poulet, Huhn. Non frit, steht da, wahrscheinlich extra für mich: nicht gebraten.
Ich glaube nicht an Verschwörungen – Carl, der alte Mann von der Botschaft, der Krimis liebt, sagt, es gibt immer eine –, aber die boucherie, an der ich auf meinem Nachhauseweg vorbeigehe, baut schon den Grillspieß vor dem Laden auf, die Hühner fangen an sich zu drehen, das Fett beginnt auf die glänzenden Kartoffeln und Zwiebeln darunter zu tropfen. Ellie war kurzzeitig Vegetarierin – eben diese Kartoffeln und Zwiebeln haben ihren Weg zurück zum Fleisch gepflastert. Ich biege in unsere Straße ein, und je nach Tages- und Jahreszeit blockiert eine Schar verirrter Touristen den Weg. Ellie sagt (vermutlich weil es ihr jemand gesagt hat), solche Touristen in unserer Mitte bedeuten, dass wir kein »echtes« Pariser Leben führen, aber ich bin nicht sicher, ob sie weiß, was sie damit meint. Carl, Mitte fünfzig, Single, sagt, das echte Paris gibt es nicht mehr, weshalb er dreißig Minuten außerhalb wohnt, in einem bezaubernden Dorf, wo ich ihn unbedingt besuchen muss. Shelley, die pensionierte Lehrerin, die froh ist, dass ihr Mann in New Orleans weilt, und noch froher, dass er ihr jeden Monat Geld überweist, sagt, Paris ist nur echt, wenn es regnet. Molly, der Neuseeländerin, ist es egal, ob Paris echt ist oder nicht. Sie macht sich nicht mal die Mühe, Französisch zu lernen, da sie nur das »Anhängsel« ist und ihr Mann in zwei Jahren sowieso versetzt wird. »Alle gehen weg«, sagt sie und macht Witze darüber, ihre Kinder – drei unter drei – zurückzulassen.
Wenn ich an manchen Tagen im matten Licht nach einem Regen aufwache und ein Motorrad vorbeituckern höre und dann einen Vogel, dann zwei, dann ganz viele, und dann jeden menschlichen Geruch von Pâtisserien bis Pisse rieche, frage ich mich: Bin ich wirklich, nach all den Jahren, wirklich in Paris?
Denn ich wurde schon einmal reingelegt.
Zwei Monate nach dem Abend, als Robert mich beim Klauen erwischt hatte – zwei Monate, in denen wir wenig anderes taten, als uns zu lieben (wobei jedes Mal Bücherstapel umkippten), in Bars Bier zu teilen und etwas zu essen, wenn genug Geld da war –, erfuhr ich, dass ich ein Reisestipendium, um das ich mich beworben und mit dem ich fest gerechnet hatte, nicht bekommen würde. Ich würde in einem anderen Jahr nach Paris gehen müssen. Ich tobte, ich weinte, ich wartete zur verabredeten Zeit am Straßenrand auf Robert, der gesagt hatte, er würde mit mir nach Europa fahren.
Denn Robert hatte gesagt, es sei lächerlich, dass ich noch nie in Paris gewesen sei.
Und ich hatte gesagt: Ist es.
Und er hatte gesagt: Das müssen wir sofort ändern.
Und ich hatte gesagt: Müssen wir.
Es entstand eine Pause, und wir saßen beide einfach da und schürten das Schweigen, als wäre es ein Feuer, und als es heiß wurde, zu heiß, sprach er: »Ich hol dich morgen um fünf ab.«
Es gibt viele Dinge, über die eine junge Frau nachdenkt, wenn sie für Paris, für ihre erste Reise nach Übersee packt. Ich dachte darüber nach, dass ich, seit ich acht war, davon geträumt hatte, seit der verregneten Woche, als die Lehrerin uns in der Pause an vier von fünf Tagen Der rote Luftballon gezeigt hatte. Ich dachte darüber nach, wie der Film mich gefesselt und verfolgt hatte, was diesem anderen Pariser Kinderbuch, Madeline, nie gelungen war, weil ich – jedenfalls als Kind – mich immer so gefühlt hatte, wie das Paris im Film: grau und traurig und von Hoffnung gebeutelt. Ich dachte darüber nach, wie einsam ich aufgewachsen war, und dass diese Einsamkeit nichts war im Vergleich dazu, wie ich mich heute fühlte, mit vierundzwanzig, meine Eltern tot.
Mom, Dad, ich habe einen Jungen kennengelernt, und er fährt mit mir nach Paris. Und meine Eltern, lieb und nicht nachtragend, Eltern, so nett, so spießig, dass es mich irre machte, die wow gesagt hätten, weil sie, im Gegensatz zu mir, geglaubt hätten, dass er wirklich mit mir nach Paris fuhr. Das tat er natürlich nicht.
Das sagte ich mir selbst. Das sagte ich meinen toten Eltern – manchmal gingen sie unter meinem Balkon vorbei, geschäftig, zerstreut, ohne je hochzuschauen. Ich sagte es laut. »Es macht nichts, dass wir nicht wirklich nach Paris fahren. Es wird ein Abenteuer, egal, wohin wir fahren.« Ich behielt für mich, dass ich am selben Tag im Drogeriemarkt gewesen war, um ein Foto zu machen, und dann bei der Post, um einen Pass zu beantragen, wo man mir sagte, was ich bereits wusste, dass es unmöglich war, innerhalb von einer Stunde einen Pass zu bekommen. Was sie nicht wussten, nicht wissen konnten, war, dass es keine Rolle spielte, was irgendjemand dachte, der Postbeamte, der Fotograf oder die Geister meiner Eltern. Ich wusste es einfach, denn in meinem ganzen Leben gab es nur eine Wahrheit: Ich würde nach Paris fahren.
Und da war der Junge, der mich hinbringen würde. Punkt siebzehn Uhr hielt er in zweiter Reihe unter meinem Fenster. Er hupte und winkte und schwang eine Flasche Wein. »Ah Pariiiie!« Er erklärte mir, was das hieß, doch das brauchte er gar nicht. Niemand beherrschte Französisch-für-Anfänger besser als ich.
Allerdings fuhren wir an jenem Nachmittag nicht à Paris, wir fuhren nach … Belgien. Und dann nach Wales. Und dann Norwegen. Berlin. Montreal. Dünkirchen. Gibraltar. Stockholm. Moskau. Sogar, an einem Freitag Monate später, nach Kuba.
Wir fuhren an all diese Orte, ohne Wisconsin je zu verlassen. Das Dorf Belgien liegt gleich südlich von Sheboygan, Kuba südlich von Platteville. Montreal, eine alte Bergarbeiterstadt, liegt in der Nähe des Oberen Sees. Wales, eine Wildnis aus Vorstadt-Sackgassen, westlich von Milwaukee. Und so weiter. Verschiedene Städte, verschiedene Wochenenden. Seine Idee, und ich ließ mich davon verzaubern, auch wenn es nur darüber hinwegtäuschte, dass wir es uns nicht leisten konnten, den Staat zu verlassen.
Und manche der Orte waren bezaubernd: Stockholm, Wisconsin, alle fünf Straßen, ist fast so hübsch wie die Postkarten, die ich von seinem Namensvetter kenne. William Cullen Bryant meinte sogar, dass »jeder Dichter und Maler im Land« das Stockholm von Wisconsin am breiten, gemächlich dahinfließenden Mississippi gesehen haben sollte. So stand es auf einer Gedenktafel. Und hier bin ich nun, sagte Robert.
Und hier bin ich nun, dachte ich dort und an anderen Orten, darunter Städte, deren weite grüne Fluten (aus Mais und Soja) William Cullen Bryant nicht geadelt hatte, ebenso wenig wie die Schaukeln auf den leeren, vergessenen Spielplätzen, auf denen wir uns manchmal wiederfanden, oder die ruhigen Hauptstraßen, die wir entlanggingen, Hand in Hand. (Ich liebte es, mit ihm Händchen zu halten – er war gut darin. Mit ihm kam es mir vor wie der Kern des Menschseins, was es vermutlich auch ist.) Ich war vierundzwanzig, die Abenteuer waren billig, die Ausflüge ein Jux. Robert hatte Erfolg. An seiner Seite würde auch ich Erfolg haben. Auf meine Art würde ich ihm sogar helfen. Seine Kinderbücher waren nur der Anfang. Ein guter Anfang. Damals finanzierten sie das Benzin und manchmal ein billiges Motel oder einen Campingplatz. Seine Bücher verkauften sich, soviel ich wusste, aber ich wusste auch, dass er nicht viel damit verdiente. Jedenfalls nicht genug, um nach Paris zu fahren.
Paris in Frankreich. Paris, Wisconsin, wagten wir zweimal, zwei verschiedene Parise in unterschiedlichen Ecken des Staates. Das erste im Südosten an der Fernstraße nach Chicago, enttäuschend. Flach und braun, gebleichte Häuser, verrammelt gegen die Hitze der letzten Sommertage. Die Bibliothekarin erzählte uns, dieses Paris sei vom ersten weißen Siedler so benannt worden, einem Mann namens Seth. Er hatte es nach Paris, New York, benannt, das zehn Meilen vor Utica liegt, falls es jemanden interessiert. Mich interessierte es nicht.
Im zweiten Paris von Wisconsin jedoch, im einsameren, hügeligeren Südwesten, verlobten wir uns.
Es war nicht geplant, doch als wir durch dieses zweite Wisconsin-Paris schlenderten – wir hatte es auf einer Landkarte entdeckt, ganz klein gedruckt, aber als wir dort waren, fanden wir keine Ortsschilder –, dachte ich: Ich werde diesen Mann heiraten. Nur fünf Wörter, aus denen achtzehn Jahre wurden, zwei Töchter und, bis jetzt, zwei Kontinente. Wie soll man das erklären? Es war die Magie der Landkarte. Dass die ganze Welt, einst so fern, plötzlich in Reichweite war. Ich wusste, es war nicht sein Werk – es war das Werk des Siedlers Seth, das Werk so vieler anderer –, doch es fühlte sich an wie Roberts Magie, wie unsere Magie, als könnten wir alles tun, selbst Paris erfinden.
Wir taten es unter dem Vollmond nicht weit von der westlichen Staatengrenze. Das zweite Paris, Wisconsin, nichts weiter als ein Kiesparkplatz am Straßenrand, ein Picknicktisch, ein Baum, eine verrostete Zweihundert-Liter-Tonne mit Müll – hier sagte ich: »Mach mir einen Heiratsantrag.«
Er schwieg.
»Jetzt oder nie«, fügte ich hinzu, denn ich wusste (jeder Liebhaber von Der rote Luftballon weiß), dass Magie vergänglich ist.
»Heiraten?«, fragte Robert.
Bat er um meine Hand oder um Klarstellung?
Ich tat, als würde ich nicht verstehen, dass es Letzteres war.
»Ja!«, sagte ich.
Er wandte den Blick ab, zum Mond, der, wie sich herausstellte, doch nicht ganz voll war, aber fast, ein Ei ohne Dotter. Und dann sagte er etwas Seltsames. »Aber Leah … wie soll das funktionieren?«
Funktionieren, das war das Verb, das Wort, auf das ich hätte hören sollen, das ich hätte erwähnen sollen, wenn wir in späteren Jahren die Geschichte unserer Verlobung erzählten. Doch das taten wir nicht, wir konzentrierten uns auf andere Aspekte jener Nacht. Wir sagten, wie schön es gewesen wäre, wenn wirklich Vollmond gewesen wäre, denn dann wäre es vielleicht hell genug gewesen, um seine Autoschlüssel zu finden, die wir irgendwie verloren hatten und erst in der Morgendämmerung wiederfanden. Und wir sagten, wir hätten jene dunklen Stunden davor gefüllt, so gut wir konnten, wobei wir das Niveau unserer versteckten Anspielungen dem Niveau unserer Zuhörer anpassten. Doch die Wahrheit ist, dass wir im Dunkel vor der Morgendämmerung vor allem die Einzelheiten unseres zukünftigen Lebens besprachen, die ich prosaisch fand, er sie dagegen (stets Lektor, besonders bei mir) als poetisch bezeichnete. Meine Forderungen: Wir würden Kinder haben, zwei. Er durfte nicht vor mir sterben. Eines Tages würde er mit mir nach Paris fahren, das echte Paris. Und er sollte am Schreiben dranbleiben. Und an mir.
Er dachte nach. Vermutlich darüber, ob er mit dem, was ich gerade gesagt hatte, einverstanden war oder nicht, dachte ich damals. Doch inzwischen glaube ich, dass er nach den richtigen Worten für das suchte, was dann kam: dass er »etwas Halbfertiges« sei. Dass er nicht ganz der aufgeräumte Junge sei, der mir aus einem Laden gefolgt und anschließend mit mir zum Anwesenheitsappell der Weltstädte durch Wisconsin gereist war. Dass er immer noch etwas verfolgte. Dass er noch nicht wusste, was es war. Dass er, wenn wir uns zu einem gemeinsamen Leben verpflichteten, dennoch seine Ruhe brauchte, einen Tag, eine Stunde, ein Wochenende, Zeit für sich, für seine Arbeit, das Schreiben, um seiner Berufung zu folgen. Er sei ein geborener Einzelgänger, sagte er großspurig.
»Ich weiß, wonach du strebst«, sagte ich, und er sah mich so erleichtert an, dass ich instinktiv erkannte, was ich damals in meiner Naivität an ihm liebte – dass er jederzeit bereit war zu springen, dass seine Arbeit, sein Werk eine Art freier Fall war, und die Herausforderung war nicht, den Aufprall hinauszuschieben, sondern gut zu fallen, brillant zu fallen, den Himmel dabei zu erleuchten wie der Mond.
Doch damals fehlten mir die Worte dafür, und so küsste er mich, und ich küsste ihn, die Sonne ging auf, und ein Laster hupte und die Schlüssel tauchten wieder auf und ich dachte: Ich habe keine Ahnung, wonach er strebt, und ich dachte: Ich kann es kaum erwarten, es herauszufinden, und dann hörte mein Hirn auf zu denken und mein Herz hörte auf zu schlagen, und ich war nur noch Bauch, und der wusste nur, dass wir schwebten, dass wir trieben, schwerelos, immer höher, ohne zu wissen, wie lange dieses Gefühl anhalten würde.
Wir heirateten, wir gingen auf Hochzeitsreise (nach Sevastopol natürlich, einer kleinen Stadt am See in Door County, Wisconsin), und dann machte Robert »Flitterwochen von unseren Flitterwochen«, ein kurzer Abstecher, während ich nach Hause zurückkehrte.
Das störte mich nicht. Es gefiel mir sogar. Gab mir Kraft. Es bestätigte meine Prognose, oder deutlicher gesagt, meinen Wunsch: Ich hatte den Jungen mit dem Lächeln, dem Traum, der Rastlosigkeit einer Künstlerseele an Land gezogen. Er gehörte mir, mir allein. Hätte er nach den Flitterwochen vor dem Fernseher (meiner) die Füße hochgelegt und die Schüssel (seine) über den Kopf gehalten, weil er mehr Popcorn wollte, während ich in der Wohnung (seine) herumhantierte, hätte ich ihn vermutlich erschossen.
Ich weiß weder, was er bei diesem ersten, noch was er bei irgendeinem seiner späteren Ausflüge tat. Ich weiß nur, dass er ständig verschwand. Ich nannte diese Spritztouren »Schreibfluchten«, was ihn wurmte. Mich jedoch wurmte es keineswegs, wenn er fort war. Es gehörte zu unserer Abmachung. Er hätte sagen können: »Ich hab’s dir gesagt«, doch das tat er nie, weil ich mich nie beklagte. Denn an alles andere hielt er sich, sogar die Sache mit den Kindern, obwohl er sich damit nicht leichttat. Nicht weil er keine wolle, sagte er, sondern weil er nicht sicher sei, ob das Universum für ihn vorgesehen habe, welche zu bekommen. Dann lass das Universum entscheiden, sagte ich, und das tat es. Wir bekamen zwei Töchter, und wir erwiesen uns als überraschend gute Eltern.
Mein Erfolg in der Kindererziehung war zufällig, glaube ich, seiner jedoch erarbeitet. Bücher aus der Bibliothek kamen und gingen. Er machte Kurse beim Roten Kreuz und beim YMCA





























