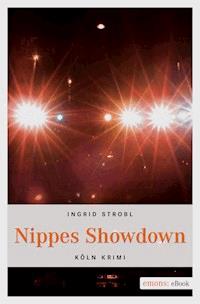9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Sterben der eigenen Mutter zu erleben ist einer der größten Einschnitte im Leben. Töchter erleben deren Tod nicht nur als großen Verlust, sondern sind darüber hinaus mit ambivalenten und verwirrenden Gefühlen konfrontiert, mit denen sie vorher oftmals nicht gerechnet hatten. Ingrid Strobl begleitet die Leserin einfühlsam und ehrlich und bietet Trost in dieser schweren Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dr. Ingrid Strobl
Ich hätte sie gerne noch vieles gefragt
Töchter und der Tod der Mutter
Über dieses Buch
Zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter begann Ingrid Strobl, dieses Buch zu schreiben. Sie befragte zwanzig Frauen zu ihrer Beziehung zur Mutter und zu deren Tod. Sie fragte, wie sie das Sterben der Mutter erlebten, was sie dabei empfanden. Sie fragte, ob sich durch den Tod der Mutter ihre Beziehung zum Vater und den Geschwistern wandelte, und vor allem: ob sie selbst sich dadurch veränderten.
Töchter erleben den Tod der Mutter nicht nur als großen Verlust, sondern sind darüber hinaus mit ambivalenten und verwirrenden Gefühlen konfrontiert, mit denen sie vorher oftmals nicht gerechnet hatten: Liebe und Wut, Vertrautheit und Entfremdung, Dankbarkeit und Trauer, Sehnsucht und Schuldgefühle.
Ingrid Strobl stellt in diesem berührenden und bewegenden Buch auch Gedichte und Prosastücke vor, die berühmte Autorinnen zum Thema geschrieben haben. Sie setzt sich mit feministischen Texten über Mütter und Töchter auseinander, und sie erzählt vom Sterben und dem Tod ihrer eigenen Mutter. Die Autorin bleibt in diesem Buch nie außen vor. Sie bringt ihre Erfahrungen und Emotionen mit ein und verwebt das eigene Erleben mit dem der anderen Frauen zu einem vielfältigen und lebendigen Muster.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2002 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger
Coverabbildung: Bavaria Bildagentur
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490130-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Danksagung
Teil 1: Eine unendliche [...]
1 – Einleitung
2 – Mütter und Töchter
3 – Der Tod der Mutter in der Literatur der Töchter
Teil 2: »Sie war [...]
4 – Requiem für meine Mutter
5 – Mütter und Töchter
Margot
Bettina
Monika
Sonia
Renate
Marion
Ulrike
Susanne
Martina
Lieselotte
Nina
Danuta
6 – Das Sterben
7 – Tod und Abschied
8 – Leiche und Begräbnis
9 – Trauer und Totengedenken
10 – Widersprüchliche Gefühle
11 – Vater und Geschwister
12 – Auftrag und Erbe
13 – Die Anwesenheit der toten Mutter
14 – Die Person hinter der Mutterfigur
Für meine Schwester Gerda
Danksagung
Ich hätte dieses Buch nicht schreiben können, wenn mir nicht so viele Frauen ihr Vertrauen geschenkt und so ausführlich auf meine Fragen geantwortet hätten. Ich danke allen meinen Interviewpartnerinnen für ihre Offenheit und ihre Bereitschaft, auch über schmerzliche Gefühle und selbstkritische Überlegungen zu sprechen. Ich danke ihnen auch dafür, dass sie es riskierten, über einiges unzensiert mit mir zu reden und über manche Fragen, die sie sich selbst noch nicht gestellt hatten, während des Interviews laut nachzudenken.
Ich danke meiner Freundin Martina Domke, die nicht nur die Interviews für mich transkribiert hat. Ich konnte mit ihr über alle Fragen, die ich mir beim Schreiben dieses Buches stellte, reden, und sie hat mir durch ihre klugen Anmerkungen und ihre differenzierte Kritik häufig dazu verholfen, in der verwirrenden Fülle des Materials wieder klar zu sehen.
Ich danke meiner Agentin Erika Stegmann und meinen Lektorinnen Ingeborg Mues und Karin Herber-Schlapp dafür, dass sie alle drei sofort daran glaubten, dass dieses Buch es wert ist, geschrieben zu werden.
Ich danke meiner Schwester Gerda Müller dafür, dass sie mir durch ein langes und offenes Gespräch über unsere Mutter den emotionalen Anstoß gab, endlich mit dem Schreiben dieses Buches zu beginnen. Und ich danke meinem Vater dafür, dass er mir sein uneingeschränktes Vertrauen schenkte: Ich schreibe in diesem Buch über Gefühle und Ereignisse, die auch ihn betreffen.
Last but not least danke ich meinem Mann Gert Levy dafür, dass er mich auch noch in der letzten Arbeitsphase an diesem Buch geduldig ertrug, und dafür, dass er jedes Kapitel, das ich schrieb, aufmerksam las und mir durch seine kompetente Kritik wichtige Anregungen gab. Vor allem aber danke ich ihm dafür, dass er mich ermutigte, mich auch persönlich sehr viel stärker in diesen Text einzubringen, als ich es ursprünglich vorhatte.
1Einleitung: »Willkommen im Klub«
Als meine Mutter im Sterben lag, fuhr ich zu ihr und beschloss, so lange zu bleiben wie nötig. Es war zu diesem Zeitpunkt für mich nicht abzusehen, wann ich meine beruflichen Verpflichtungen wieder erfüllen könnte. Und so musste ich einige Leute anrufen und sie bitten, einen Termin verschieben oder absagen zu dürfen. Ein derart unprofessionelles Verhalten fiel mir nicht leicht, wurde mir aber unerwartet leicht gemacht. Mehrere Frauen, mit denen ich in dieser Situation zu tun hatte, eine Disponentin im Sender, eine Pressefrau im Verlag und noch andere, sagten spontan: »Ich kann Sie so gut verstehen! Meine Mutter ist auch gestorben.« Und dann begannen sie, vom Tod ihrer Mutter zu erzählen, von ihren Gefühlen und wie sie damit fertig wurden. Oder auch nicht. Ich hörte zu, erstaunt, dankbar. Es war, als sagten sie mir: »Welcome to the club, willkommen im Klub.«
Als ich in meinen Alltag zurückgekehrt war, erzählte ich gelegentlich, dass meine Mutter gestorben war. Und ich erlebte eine ähnliche Reaktion wie zuvor am Telefon: Frauen, mit denen ich befreundet war, aber auch solche, mit denen ich nur beruflich Kontakt hatte, berichteten mir vom Tod ihrer eigenen Mutter, von ihrer Beziehung zur Mutter und ihren oft sehr ambivalenten Gefühlen. Als ich mit meiner Freundin über diese unerwartete Erfahrung sprach, sagte sie: »Das ist doch ein Thema für ein Buch!« Damals konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass ich tatsächlich ein Buch darüber schreiben würde. Das Geschehene war mir noch zu nahe, ich stand noch zu sehr unter dem Eindruck des Sterbens und des Todes. Die Intensität, die ich in den letzten Wochen mit meiner Mutter erlebt hatte, hatte sich noch nicht aufgelöst. Aber die Idee verhakte sich in meinem Kopf.
Meine Mutter starb im September 1998. Im Januar desselben Jahres war mein Schwiegervater in einer Klinik gestorben, und wir waren bei ihm gewesen, hatten seine Hand gehalten, ihn gestreichelt und zum Abschied geküsst. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Tod eines Menschen miterlebte, und ich war erstaunt über die Selbstverständlichkeit, mit der ich alles hinnahm. Ich war weder verwirrt noch geängstigt, nur voller Sorge, ob er uns hören konnte, ob er wahrnahm, dass wir bei ihm waren, dass er nicht allein war. Er hatte kurz nach unserem letzten Besuch in der Klinik das Bewusstsein verloren und mehrere Tage im Koma gelegen. Die zuständige Krankenschwester hatte das Beatmungsgerät abgestellt, nachdem wir, sein einziger Sohn und ich, wieder eingetroffen waren, und er hörte nach einer Weile einfach auf zu atmen. Es war ein im Wortsinne sanfter Tod, dem eine völlige Ungewissheit und böse Albträume vorausgegangen waren. Niemand konnte sagen, woran der Mann erkrankt war, und einige Zeit bestand noch Hoffnung auf Heilung.
Er hat sich, als er noch bei Bewusstsein war, von uns verabschiedet, aber wir hatten nicht den Mut, in ein Adieu einzustimmen. Wir erklärten, dafür sei es viel zu früh, und erzählten ihm, was wir alles noch mit ihm unternehmen wollten. Als junger Mann war er auf der Flucht vor den Nazis in einem Lager der französischen Kollaborationsregierung interniert gewesen, sein Vater war von dort in ein Vernichtungslager deportiert worden, er selbst war davongekommen. In seinen letzten Nächten auf der Intensivstation war der alte Mann nun wieder im Lager, er quälte sich, wollte weglaufen und war, wenn er aus diesen Träumen erwachte, lange Zeit nicht zu beruhigen. Ich wurde an seinem Sterbebett mit einer Hilflosigkeit konfrontiert, die ich bisher nicht gekannt hatte. Die Macht der Vergangenheit und die Macht des Todes schwemmten alle gut gemeinten Tröstungs- und Besänftigungsversuche hinweg, wie das Meer kleine Muscheln und Schnecken an den Strand spült, als wären sie ihm lästig. Es war nichts zu machen, und ich sah – widerstrebend – ein, dass nichts zu machen war. Diese Erfahrung bereitete mich ein wenig auf das vor, was ich beim Tod meiner Mutter ein drei viertel Jahr später erleben sollte. Und doch war es ganz anders. Meine Mutter starb keinen sanften Tod. Und sie war meine Mutter.
Nachdem ich mich von der direkten Erfahrung ihres Sterbens ein wenig gelöst hatte, begann ich zu lesen, was ich an Literatur zum Thema »Tod der Mutter« fand. Ich erinnerte mich daran, dass Virginia Woolf in ihren Romanen darauf einging, ich kannte die Gedichte, die Nelly Sachs für ihre Mutter geschrieben hatte, ich suchte »einschlägige« Texte im Werk von Else Lasker-Schüler, Ingeborg Bachmann und Hilde Domin, las Margaret Atwood wieder, Simone de Beauvoir und die Autobiographien von so unterschiedlichen Frauen wie der französischen Anarchistin Louise Michel und Angelica Garnett, der Tochter der englischen Malerin Vanessa Bell. Ich arbeitete mich durch Biographien, Briefe und Tagebücher bekannter und unbekannter Autorinnen.
Der Tod der Mutter ist kein gängiges Thema der Literatur. Es gibt nur wenige Romane oder Gedichte, in denen eine Autorin oder ein Autor sich damit auseinander setzt. Dasselbe gilt in noch stärkerem Maße für die Musik und die bildende Kunst. Der Tod der Geliebten oder des Gatten sind ein häufiges und in bestimmten Epochen sogar beliebtes Sujet für Schriftsteller, Maler und Komponisten. In der Romantik siechen die holden Schönen reihenweise dahin, und ihre vom Schmerz überwältigten Verehrer schwelgen in der Vorstellung, ihnen nachzufolgen. Der Tod und das Mädchen taumeln eng umschlungen in einem erotischen Tanz. Mütter sterben in der Literatur meist als sehr junge Frauen und vorzugsweise im Kindbett. Die von ihnen hinterlassenen Waisen leiden an dem Verlust, können ihn aber nicht reflektieren. Ohnehin stehen die Kinder in diesem Fall im Mittelpunkt des Geschehens. Mütter wie Liesbeth Crespahl in Uwe Johnsons »Jahrestagen« und Peter Handkes Mutter in »Wunschloses Unglück«, die eine eigene Geschichte aufzuweisen haben und ihren Tod selbst wählen, sind die Ausnahmen in der Literaturgeschichte.
Bei meiner Suche nach literarischen Mutter-Tochter-Geschichten fiel mir auf, dass es in der Literaturgeschichte insgesamt nur wenige ältere Frauen und Frauen im mittleren Alter gibt und somit auch nur wenige Mutter-Tochter-Beziehungen zwischen erwachsenen Frauen. Ich habe keine wissenschaftliche Recherche angestellt, sondern einfach nur darüber nachgedacht, welche Protagonistinnen mir einfallen, die ältere oder alte Mütter sind, und welche Heldinnen, die sich dem Klimakterium nähern oder bereits im Wechsel befinden. Da gibt es die Konsulin in den Buddenbrooks, eine durchaus beeindruckende Figur. Fontane lässt Frau Briest ihre Tochter in den Tod treiben, und auch Grimmelshausens und Brechts Courage-Figuren gehen mit ihrer Tochter nicht gerade pfleglich um. Die Mütter von Jane Austens Heldinnen – so sie denn eine (lebende) Mutter haben – werden realistisch und differenziert gezeichnet, sind jedoch selbst, wie auch die Courage, vergleichsweise junge Frauen, ihre Töchter befinden sich noch im »heiratsfähigen« Alter.
In den Sagen der griechischen Antike tauchen große Muttergestalten auf, doch sie sind problematische Heldinnen. Medea rächt sich für den Verrat ihres Geliebten Jason, indem sie die gemeinsamen Kinder umbringt. Klytämnestra tötet ihren Mann Agamemnon, um dessen – vermeintliche – Ermordung der Tochter Iphigenie zu rächen, und wird selbst auf Betreiben von Elektra, ihrer anderen Tochter, von ihrem Sohn Orest umgebracht. Jokaste heiratet unwissentlich ihren Sohn Ödipus und erhängt sich, als sie die schreckliche Wahrheit erfährt. Die griechische Mythologie kennt Muttergottheiten wie Gaia, Rhea und Demeter, doch sie spielen, im Vergleich etwa zu den Muttergottheiten des Vorderen und Mittleren Orient, keine bedeutende Rolle. Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, tut zwar alles, um ihre von Hades geraubte Tochter Persephone wiederzugewinnen, doch ihre Macht reicht nicht aus, um sie dem – konkurrierenden – männlichen Gott völlig zu entreißen. Persephone selbst verhält sich nicht eindeutig, und Demeter kann zwar der Natur gebieten, nicht aber den Göttern. Sie ist schließlich gezwungen, mit Hades einen Kompromiss zu schließen: Persephone darf die eine Hälfte des Jahres bei der Mutter auf der Erde verbringen, die andere Hälfte aber muss sie in die Unterwelt zurückkehren.
Die literarischen beziehungsweise mythologischen Vorbilder, die wir aus der europäischen Kulturgeschichte kennen, sind also eher zweifelhafte oder zumindest ambivalente Figuren, und sie sind rar gesät. Eine direkte Beziehung zwischen Mutter und Tochter, wie zwischen Demeter und Persephone oder zwischen Leto und Artemis, findet sich sowohl unter Göttinnen als auch unter Roman- oder Dramenheldinnen selten. Seit Homer interessieren sich männliche Autoren kaum für das, was sich zwischen zwei Frauen abspielt, es sei denn, die beiden Frauen konkurrieren um einen Mann. Und auch Schriftstellerinnen befassen sich anscheinend lieber mit der Beziehung zwischen den Geschlechtern, als mit der zwischen Mutter und Tochter. Doch hier gibt es wenigstens einige beeindruckende Ausnahmen. Jane Austen und Virginia Woolf schreiben über die Wirkung, die eine Mutter auf ihre Tochter ausüben kann und die sich nach dem Tod der Mutter fortsetzt und verändert. Margaret Atwood führt diese Tradition fort, und auch im Bereich der Unterhaltungsliteratur habe ich Beispiele für eine differenzierte Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter gefunden. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist für mich Barbara Havers, die Kollegin von Inspektor Thomas Linley in den Kriminalromanen von Elizabeth George. Sie kümmert sich um ihre pflegebedürftige Mutter und quält sich mit endlosen Schuldgefühlen, weil sie beschließt, sie schließlich doch in ein Pflegeheim zu geben. Die Ambivalenz zwischen Liebe und Überforderung wird hier so realistisch und einfühlsam beschrieben, wie ich das Thema sonst kaum je bearbeitet fand. Abgesehen davon, dass dieses Thema ohnehin kaum je bearbeitet wurde. Im dritten Kapitel dieses Buches gehe ich genauer auf die Art und Weise ein, in der einige Autorinnen über Mütter und Töchter und insbesondere über den Tod der Mutter schreiben.
Nach der »schönen« und der populären wandte ich mich der Fachliteratur zu, in der Erwartung, ich würde nun ganze Berge aus der Bücherei nach Hause schleppen können. Das erwies sich allerdings als Irrtum. Ich fand lediglich zwei Anthologien, die sich explizit auf das Thema »Töchter und der Tod der Mutter« beziehen. Ruth Eder veröffentlicht in ihrem Band »Ich spür noch immer ihre Hand. Wie Frauen den Tod ihrer Mutter bewältigen« die Protokolle von 15 Gesprächen, die sie mit Töchtern unterschiedlichen Alters in Deutschland geführt hat.[1] Rosa Ainley bat mehrere Frauen aus dem englischen Sprachraum, über den Tod der Mutter zu schreiben. Sie erhielt »Beiträge in Form von Briefen, Kurzgeschichten, Tagebüchern, Essays, persönlichen oder eher theoretischen Berichten«.[2] Sie stellt fest, dass sich ihr selbst und den meisten Frauen, die für das geplante Buch Beiträge verfassten, damit erstmals »die Möglichkeit bot, mit anderen Menschen über meine Mutter zu sprechen, die nicht das Thema wechselten, herumdrucksten oder mich mit Mitgefühl zum Schweigen brachten. Außerdem hat die Einstellung ›daraus wird ein Buch‹ meinem Thema einen seltsamen neuen Wert verliehen – noch nie zuvor war es so akzeptabel, wurde es so gut aufgenommen, den Tod der Mutter zu diskutieren.«[3] Als Rosa Ainley ihr Buch 1994 veröffentlichte, stellte sie fest: »Es gibt zwar bereits eine Reihe von Büchern über die Beziehung zwischen Frauen und ihren Müttern – Briefesammlungen, Bekenntnisse und Erfahrungsberichte, feministische Analysen – und eine Menge über Tod und Sterben, aber so gut wie nichts über den Tod der Mutter.«[4] Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert.
Vielleicht ist erst jetzt die Zeit reif geworden für diese schwierige Auseinandersetzung. Die Anthologien von Ainley und Eder, Sally Clines programmatische Abhandlung »Frauen sterben anders« und Verena Stefans »Bericht vom Sterben meiner Mutter« erschienen in den letzten sieben Jahren. Die Frauengeneration, die den Feminismus ins Leben rief und sich in der neuen Frauenbewegung engagierte, ist jetzt in das Alter gekommen, in dem die Eltern sterben. Diese Frauen haben sich zum ersten Mal in der Geschichte explizit und kritisch mit der Beziehung zwischen Mutter und Tochter auseinander gesetzt und vor allem mit dem Rollenbild, das die Mutter an die Tochter weitergibt und das die Töchter dieser Generation häufig ablehnten.
In den frauenbewegten Siebzigerjahren entstanden Bücher mit Titeln wie »Von Frauen geboren«, »My mother myself« und »Ich schaue in den Spiegel und sehe meine Mutter«. Die Thesen der frühen Psychoanalytikerinnen wie Anna Freud, Karen Horney, Helene Deutsch und Melanie Klein wurden neu diskutiert und bewertet, adaptiert oder verworfen. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter wurde in einem neuen Zusammenhang als prägend erkannt und thematisiert. Die Mütter, die wir damals ablehnten, nach deren Anerkennung wir uns verzehrten, denen wir um keinen Preis der Welt gleichen wollten und denen wir in so vielem ähnlich waren, diese Mütter sind inzwischen tot, oder ihr Tod ist in absehbare Nähe gerückt. Und damit wird ein neues Kapitel in einer Beziehung eröffnet, die mindestens so kompliziert ist wie die zum Partner oder zur Partnerin, häufig aber noch um einiges komplizierter.
Nachdem ich festgestellt hatte, dass die Literatur über Töchter und den Tod der Mutter noch nicht einmal ein halbes Bücherregal füllt, freundete ich mich mit dem Gedanken an, selbst darüber zu schreiben. Ich war neugierig geworden auf die Geschichten, die sich hinter den Andeutungen verbargen, die so viele Frauen mir gegenüber bereits gemacht hatten. »Weißt du, das war eine zwiespältige Angelegenheit für mich«, sagten sie oder: »Ehrlich gesagt, ich war nicht nur traurig, als sie starb.« Aber auch: »Ich war fassungslos über die Heftigkeit meiner Trauer.« Ich rief erst einmal die Freundinnen an, von denen ich annahm, sie hätten genügend Vertrauen zu mir, um über dieses schwierige Thema ehrlich zu sprechen. Dann fragte ich Bekannte, Freundinnen von Freundinnen und Bekannte von Bekannten. Ich habe nur wenige Frauen interviewt, die ich gar nicht kannte, und das führte zu einer bestimmten Auswahl an Berufen, Altersgruppen und politischer Bewusstheit. Ich hatte das so nicht intendiert. Ich wollte mit Frauen reden, über deren Person und Geschichte ich zumindest ein wenig wusste, denn das erleichterte mir die Fragen und bot mir eine gewisse, wenn auch sehr eingeschränkte Überprüfbarkeit der Antworten.
Ich habe nur eine (polnische) Immigrantin interviewt und eine Tochter jüdischer Remigranten, die als junges Mädchen aus Israel nach Deutschland kam. Das hat sowohl zufällige als auch methodische Gründe. Die Mütter zweier Migrantinnen, die ich persönlich kenne, starben, als ihre Töchter auf der Flucht oder bereits im Exil waren. Der Schmerz dieser Töchter darüber, dass sie ihrer sterbenden Mutter nicht beistehen, ja nicht einmal Kontakt zu ihr aufnehmen konnten, die Bedingungen, unter denen sie ihre Mütter betrauern, und die Schuldgefühle, die ihre Erinnerungen an die Mutter mit prägen, wären es wert, in einem eigenen Buch beschrieben und untersucht zu werden. Ich könnte ihnen hier nicht gerecht werden. Die Mütter anderer Migrantinnen, die ich kenne, leben noch.
Ich hätte also mir völlig fremde Personen zu Gefühlen, Verhaltensweisen, Ritualen befragen müssen, die sich möglicherweise in einigen Aspekten von denen unterscheiden, die mir als Mitteleuropäerin vertraut sind. Unbekanntes wirkt rasch »exotisch«, wenn man den Zusammenhang, in dem es steht, nicht kennt. Bekanntes wiederum kann sich durch die Einwanderungssituation verschieben oder verstärken. Für nicht wenige meiner deutschen Interviewpartnerinnen stellte zum Beispiel die räumliche Entfernung zwischen ihrem Wohnort und dem der sterbenden Mutter ein Problem dar. Wie viel schwieriger muss erst die Situation einer Migrantin sein, deren Mutter sich tausend und mehr Kilometer weit entfernt von ihr befindet. Kurzum, die Gefahr von Oberflächlichkeit, Ungenauigkeit und Missverständnissen erschien mir zu groß, und ich habe deshalb darauf verzichtet, nach Immigrantinnen als Interviewpartnerinnen zu suchen.
Ich habe auch, aus Zufall, nicht aus Absicht, keine Frau interviewt, deren Mutter unter der Alzheimerschen oder einer von den Auswirkungen her vergleichbaren Krankheit gelitten hatte. Die Probleme, die sich daraus ergeben, lassen sich mit der Sorge um eine zum Beispiel krebskranke Sterbende nicht vergleichen. Die physische und psychische Überforderung derer, die Alzheimer-Patienten pflegen, ihre Erleichterung nach deren Tod und ihre eventuellen Schuldgefühle haben eine andere Qualität als das, was die Frauen, die ich interviewte, berichten, und auch als das, was ich selbst erlebte.
Insgesamt habe ich für dieses Buch 20 Frauen interviewt und darüber hinaus mit zwei Psychologinnen und einem Bestattungsunternehmer gesprochen. Fast alle Frauen, die ich darum bat, waren ohne zu zögern bereit, mir ein Interview zu geben. Viele gaben allerdings zu bedenken: »Du wirst enttäuscht sein, denn ich habe nicht viel zu sagen. Das Thema ist für mich abgehakt.« Sie sollten sich in jeder Hinsicht täuschen. Sie hatten enorm viel zu sagen, und das Thema erwies sich zumindest in einzelnen Aspekten als immer noch virulent. Mehrere Frauen, die dachten, sie seien längst darüber hinweg, begannen während des Interviews zu weinen und waren darüber so erstaunt wie erschrocken. Diese Erfahrung beschreibt auch Ruth Eder in Bezug auf ihre Gesprächspartnerinnen. Mit der Erinnerung, sagt sie, kamen auch die Tränen, sogar wenn der Abschied von der Mutter schon 40 Jahre zurücklag.
Meine Gesprächspartnerinnen vertrauten mir vieles über sich an, das man sonst nur engen Freundinnen oder der Therapeutin, dem Therapeuten erzählt. Ich habe deshalb allen angeboten, die Interviews zu anonymisieren. Die meisten waren darüber erleichtert, einige meinten, in ihrem Falle sei das nicht nötig. Ich nenne daher in diesem Buch alle Interviewpartnerinnen nur mit dem Vornamen, wobei die Mehrheit der Vornamen fiktiv ist. Die Beziehungen, die diese Töchter zu ihren Müttern hatten, waren sehr unterschiedlich. Es ist natürlich etwas anderes, ob man zehn Jahre alt ist, wenn die Mutter stirbt, oder ob man selbst schon Großmutter ist. Um eine warmherzige und tolerante Mutter trauert die Tochter anders als um eine herrschsüchtige Frau, die selbst immer im Mittelpunkt stehen wollte. Töchter, die Feministinnen wurden, bringen häufig mehr Verständnis für die Probleme der Mutter auf und mehr Aufmerksamkeit für die Person, die hinter der Mutterfigur steckt, als Frauen, die sich für geschlechtsspezifische Fragestellungen nicht sonderlich interessieren. Ruth Eder beschreibt in Bezug auf ihre Interviewpartnerinnen eine Erfahrung, die auch ich gemacht habe: »Wie die Beziehung – so der Abschied. (…) Je wärmer und interessierter die Mütter früher auf die noch hilfsbedürftigen Töchter eingehen konnten, umso größer scheint die Wahrscheinlichkeit zu sein, dass auch sie Trost und Unterstützung erfahren, wenn sie selbst hilflos geworden sind.«[5]
Einige der Frauen, die mir für dieses Buch Auskunft gaben, konstatierten, dass ich sie mit Fragen konfrontierte, die sie selbst sich noch nicht gestellt hatten. Manche von ihnen baten darum, erst einmal in Ruhe darüber nachdenken zu dürfen. Andere waren sofort neugierig und dachten laut nach, sodass ich ihren Reflektionsprozess mit aufzeichnen konnte. Wieder andere Gesprächspartnerinnen riefen mich ein paar Tage nach dem Interview an und erzählten mir etwas, das ihnen erst nachträglich eingefallen war und das sie für wichtig genug hielten, um mich darüber zu informieren. Beinahe alle interviewten Frauen teilten mir mit, sie hätten nach unserem Gespräch noch lange darüber nachgedacht. Und auch fast alle sagten mir hinterher, es habe ihnen gut getan, über dieses Thema zu reden beziehungsweise so lange und ausführlich darüber zu reden. Ruth Eder schreibt in der Einleitung zu ihrer Textsammlung »Wie Frauen den Tod ihrer Mutter bewältigen« über ihre eigene Erfahrung: Als ihre Mutter starb, verloren gleichzeitig auch zwei Freundinnen die ihre. »Wir fingen an, darüber zu sprechen. Unter vier Augen, beinahe verschämt. Das Thema war und ist nicht populär.«[6]
Das Sprechen oder Schreiben über den Tod der Mutter ist nicht zuletzt deshalb so schwierig, weil unsere Beziehung zur Mutter meist ambivalent ist. Über Tote soll man nichts Schlechtes sagen, schon gar nicht über die eigene Mutter. Aber kaum eine Frau hat ein ungetrübt liebevolles Verhältnis zu ihrer Mutter. Selbst Töchter, die ihre Mutter innig liebten, haben sie auch ab und zu gehasst oder waren zumindest wütend auf sie, enttäuscht von ihr, haben Verletzungen von ihr erfahren und ihr Verletzungen zugefügt. Umgekehrt empfinden Töchter, die ihre Mutter kaum oder wenig liebten, die sie ablehnten und sich von ihr abgelehnt fühlten, dennoch oft Schuldgefühle ihr gegenüber. Ich habe kaum mit einer Frau gesprochen oder von einer Frau gelesen, die ihrer Mutter beziehungsweise dem Tod ihrer Mutter mit Gleichgültigkeit oder mit völlig eindeutigen Gefühlen gegenüberstand. Und bei einigen war das Erstaunen darüber groß, dass in den letzten Momenten Zärtlichkeit in ihnen aufstieg für eine Mutter, für die sie, wie sie dachten, längst nichts mehr empfunden hatten, dass sie plötzlich Liebe und Fürsorglichkeit für eine Frau verspürten, von der sie sich schon vor Jahren innerlich wie äußerlich distanziert hatten.
Dieses unerwartete Gefühl der Nähe kann schon früher auftreten, beim ersten Hinfälligwerden der Mutter etwa. Simone de Beauvoir schreibt in »Ein sanfter Tod«: »(…) mir wurde bewußt, daß der Unfall meiner Mutter mich schwerer traf, als ich angenommen hatte. Ich wußte nicht recht, warum. Er hatte sie aus ihrem gewohnten Rahmen, aus ihrer Rolle und den starren Vorstellungen gerissen, in die ich sie zwängte. Ich erkannte sie in dieser bettlägerigen Frau wieder, aber das Mitleid und die merkwürdige Verwirrung, die sie in mir erregte, erkannte ich nicht wieder.«[7]
Als ihre Mutter schließlich stirbt, stellt Beauvoir fest: »Normalerweise dachte ich mit Gleichgültigkeit an sie. (…) Unsere frühere Beziehung lebte (…) in ihrer ganzen Stärke wieder auf, als Mamas Unfall, ihre Krankheit und ihr Tod die Routine durchbrachen, die sonst unsere Beziehungen bestimmte. (…) Die ›liebe kleine Mama‹, die sie in meinem zehnten Lebensjahr für mich war, unterscheidet sich nicht mehr von der feindseligen Frau, unter deren Druck meine Jugend stand. Als ich meine alte Mutter beweinte, beweinte ich alle beide. Das Traurige am Scheitern unserer gegenseitigen Beziehung, mit dem ich mich abgefunden zu haben glaubte, wurde mir wieder beklemmend deutlich.«[8]
Die Generation der Mütter, die nun sterben, hatte meist kein leichtes Leben. Krieg, Flucht, der Verlust des Mannes oder des sozialen Status, Mangel prägten die Erfahrung vieler Frauen der 1920er und 1930er Jahrgänge. Einige wurden dadurch verbittert und ließen ihre Enttäuschung und Ernüchterung auch an den Töchtern aus. Diese Frauen erlebten zudem ihre Jugend in der Zeit des Nationalsozialismus. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass die meisten der von mir befragten Frauen aussagten, ihre Mutter sei gegen die Nazis oder zumindest keine Anhängerin des Regimes gewesen.
Barbara Dobrick, die bei den Gesprächen für ihr Buch »Wenn die alten Eltern sterben« mit derselben Generation von Müttern und Vätern zu tun hatte, schreibt in Anlehnung an die Erkenntnisse von Margarete und Alexander Mitscherlich:
»Die Drohung, die in der Erkenntnis der Schuld der Eltern liegt, kann so groß sein, daß sie gar nicht gewagt werden kann.«[9] Da es in diesem Buch um Mütter und nicht um Väter geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Töchter die Taten ihrer Mütter verdrängen, nicht ganz so hoch. Frauen hatten im Nationalsozialismus keine bedeutenden Posten inne, sie waren an den Massenmorden zu einem deutlich geringeren Prozentsatz beteiligt als Männer und an den Entscheidungsprozessen gar nicht. Dennoch gab es Frauen, die in der NS-Frauschaft aktiv waren, die als KZ-Wärterin arbeiteten, die in ihrer Funktion als Fürsorgerin an der »Auslese unwerten Lebens« beteiligt waren, die Juden und Regimegegner denunzierten. Und es gab auch viele andere, »unpolitische« Frauen, die während der NS-Herrschaft eine unrühmliche Rolle spielten, sei es, dass sie sich auf Kosten jüdischer Nachbarn bereicherten, sei es, dass sie Selbstbewusstsein und Befriedigung aus dem Irrglauben zogen, sie gehörten einer »höheren Rasse« an, sei es, dass sie »nur« wegsahen, wenn sich Unrecht und Gewalt vor ihrer Nase abspielten.
Einige wenige der von mir befragten Töchter sagen, ihre Mutter oder Großmutter sei eine Anhängerin der Nazis gewesen. Andere, vor allem Frauen, die politisch aktiv sind oder waren, äußern ein gewisses Misstrauen gegen die Beteuerungen der Eltern, sie hätten damit nichts zu tun gehabt oder nichts davon gewusst. Einige wissen, dass ihre Eltern Sozialdemokraten waren oder dass die Mutter aus einem sozialdemokratischen Elternhaus stammt. Andere schließen aus den Ansichten, die ihre Mutter nach dem Krieg zu »einschlägigen« Themen wie Antisemitismus, Rassismus oder Nationalismus vertrat, oder aus einer allgemeinen Toleranz der Mutter auch ungewöhnlichen Lebensformen gegenüber, dass sie keine Nazifrau gewesen sein könne. Wieweit diese Aussagen auf der Realität beruhen und wieweit sie dem Wunschdenken der Töchter entspringen, kann ich nicht nachprüfen und somit auch nicht beurteilen.
»Wer sich entschließt, über den Tod zu schreiben, hat sich gleichzeitig entschieden, als Außenseiterin angesehen zu werden. Eine verdienstvolle Außenseiterin zwar, aber eben eine Außenseiterin«, schreibt Sally Cline in ihrem Buch »Frauen sterben anders«[10]. Nicht nur die Auseinandersetzung mit dem Tod der Mutter, sondern ganz generell das Nachdenken und Sprechen über das Sterben und den Tod werden in der einschlägigen Literatur als etwas Seltenes und geradezu Gefährliches beschrieben. Fast alle Bücher über das Thema beginnen mit einem Lamento darüber, dass Sterben, Tod und Trauer Tabus in dieser Gesellschaft seien, und dass es äußerst schwierig sei, das Schweigen darüber zu brechen. Gleichzeitig stellt Sally Cline fest: »650 Bücher zum Thema Tod listet Simpson’s English Language Bibliography aus dem Jahr 1979 auf; die aktualisierte Version von 1987 fügt weitere 1700 Bücher hinzu, die alle zwischen 1979 und 1986 geschrieben worden sind. (…) Die Veranstalter erster Kurse über Tod und Sterben (…) vertrauen trotz des allgemeinen Widerstandes gegen den Themenkreis auf eine große Resonanz.«[11]
Was stimmt denn nun? Herrscht allgemeines Schweigen oder großes Interesse? Meike Hemschemeier zitiert in ihrer Studienarbeit »Tabu und Faszination. Zur ambivalenten Einstellung zum Tod in westlichen Gesellschaften«[12] einen Friedhofsmanager, der über das öffentliche Interesse am Tod folgende Vermutung anstellt: »Im Fernsehen haben sie ihren Spaß daran und in jeder Situation aus zweiter Hand sozusagen – aber, Junge, komm ihnen bloß nicht wirklich damit. Sie wollen nichts davon wissen.« Dieselben Menschen, die täglich Tote im Fernsehen sehen, die sich an den Anblick von Erschossenen, Verhungerten und tödlich Verunglückten in den Nachrichten und von inszenierten Leichen in Spielfilmen gewöhnt haben, werden im realen Leben kaum je mit dem Sterben eines konkreten Menschen oder mit einer »echten« Leiche konfrontiert. Meike Hemschemeier stellt fest: »Schon der Anblick eines Toten ist für viele unerträglich. ›Behalten Sie ihn als Lebenden in Erinnerung‹, rät oft das Krankenhauspersonal, das die Verwandten benachrichtigt. Dieser Rat wird gern befolgt. Kaum ein Toter wird deshalb noch zu Hause aufgebahrt. Stirbt jemand zu Hause, telefonieren die Angehörigen oft hektisch mit Arzt und Bestattungsunternehmen. Carmen Thomas, die als Moderatorin der Sendung ›Hallo Ü-Wagen‹ mehr als dreißig Sendungen über den Tod zusammen mit Hörerinnen und Hörern gestaltet hat, schreibt aus ihrer Erfahrung mit dem Publikum: ›Blitzartig greifen viele zum Telefon und lassen die Leiche – egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit – außer Haus schaffen‹. Ein Bestattungsunternehmer sagt ihr in einem Interview: ›Wie giftigen Sondermüll lassen manche um drei Uhr nachts den Partner oder die Partnerin, mit denen sie ein Leben lang Tisch und Bett teilten, entsorgen.‹«[13]
Die Frauen, die ich für dieses Buch interviewte, reagierten unterschiedlich auf das Sterben und die Leiche ihrer Mutter. Allerdings äußerte sich keine von ihnen auf so ablehnende Weise, wie die von Carmen Thomas zitierten Hinterbliebenen. Es berichtete auch keine der Frauen, sie habe Angst oder Ekel vor der Toten empfunden. Manche befolgten den Rat, »Behalten Sie sie so in Erinnerung, wie Sie sie zuletzt gesehen haben«. Einige bereuen diese Entscheidung inzwischen und wünschten, sie hätten sich »richtig« von der toten Mutter verabschiedet. Andere waren beim Sterben zugegen, und jede von ihnen ist dafür dankbar. Andere kamen erst, nachdem die Mutter bereits gestorben war, konnten aber noch eine Weile von ihr Abschied nehmen, ehe sie weggebracht wurde. Fast alle jedoch betrachteten es als selbstverständlich, dass die Tote von professionellem Personal aus dem Haus geschafft beziehungsweise aus dem Sterbezimmer im Krankenhaus entfernt und für die Beerdigung »hergerichtet« wurde.
Nur eine Einzige unter meinen Interviewpartnerinnen, eine Immigrantin aus Polen, bereitete ihre tote Mutter eigenhändig auf ihren letzten Weg vor. Auch für mich war diese Versorgung meiner gestorbenen Mutter ein letzter Liebesdienst, ein Ritual, das mir ganz natürlich und selbstverständlich erschien. Ich tat es gerne. Es tat mir selber gut, auf diese Weise noch einmal Abschied von ihr zu nehmen, und ich kam gar nicht auf die Idee, dass es als etwas Ungewöhnliches oder gar Absonderliches wahrgenommen werden könnte. Erst als ich später anderen davon erzählte, merkte ich an ihren Reaktionen, dass mein Verhalten anscheinend gar nicht selbstverständlich war. Die einen sahen mich voller Bewunderung an, andere schienen eher abgestoßen, aber kaum jemand sagte wie meine polnische Freundin: »Ja, klar, das habe ich auch getan.«
»An mir selbst erfuhr ich bis ins Mark, daß man in die letzten Augenblicke eines Sterbenden das Absolute legen kann.«[14] Simone de Beauvoirs Satz bestätigt die Erfahrung vieler Frauen, die beim Tod ihrer Mutter anwesend waren. Prioritäten, die man bis dahin für unverrückbar hielt, verschieben sich wie Pappwände. Wir haben vergessen, schreibt Sally Cline in ihrem Buch »Frauen sterben anders«, dass »Tod ebenso wie Liebe ein gewaltiges, geheimnisvolles Erlebnis ist, das die Phantasie von Generationen von Dichtern, Dramatikern und Malern gefangen genommen hat.«[15] Dieses Wissen ging tatsächlich verloren. Der Umgang mit Sterbenden und dem Tod bewegt sich (in Europa und Nordamerika) zurzeit zwischen zwei Extremen: Das Unbegreifliche wird ausgegrenzt, verdrängt und steril entsorgt, oder es wird zum emotionalen Erlebnispark umfunktioniert. Es gibt in den USA eine Bewegung, die sich für eine Art »Schöner Sterben« einsetzt. Auch hierzulande bieten einzelne Bestattungsunternehmer Formen der Aufbahrung, Beerdigung und »Trauerarbeit« an, die eine Alternative zu dem gewohnten konventionellen Zeremoniell darstellen: Die Angehörigen dürfen zum Beispiel den Sarg bemalen oder schmücken, sie dürfen Gegenstände verfertigen, die sie dem oder der Toten mitgeben möchten, sie können die Verstorbene, den Verstorbenen malen, fotografieren, filmen und in Trauerräumen, die ihnen eigens dafür zur Verfügung gestellt werden, so viel Zeit mit ihr oder ihm verbringen, wie sie möchten. In anschließenden Trauerseminaren können sie unter der Anleitung eines »Trauerbegleiters« über ihre Gefühle sprechen und sie mit anderen teilen. Es werden sogar »Trauerreisen« angeboten, auf denen sie sich im Kreise von Leidensgenossen erholen oder weiterbilden können. Das Begräbnis wird nach den Vorstellungen und Wünschen der Angehörigen gestaltet, es darf dabei gesungen, geredet, eine Diashow gezeigt oder, im entgegengesetzten Fall, auf dem Grab herumgetrampelt werden. Alles ist möglich …
Diese Art der Befreiung von erstarrten und konventionellen Trauerritualen ist sicher in vielen Fällen hilfreich. Sie passt aber auch in das umfassende Konsumangebot einer Gesellschaft, in der man sich – sofern man über das nötige Geld verfügt – alles kaufen kann, sogar die Bewältigung von Schmerz und Trauer und die Verheißung, dass eine »gelungene« Verarbeitung des Verlustes zu einer positiven Entwicklung der Persönlichkeit und einer größeren Lebendigkeit des Trauernden führe.[16] Ich weiß nicht, ob diese Rechnung aufgeht. Trauergefühle und die Versuche, diese Gefühle zu bewältigen, sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie empfinden, die Kulturen, von denen diese Menschen geprägt sind, und die psychische Verfassung, in der sie sich gerade befinden. Ich habe Frauen kennen gelernt, die sich durch die beschriebene Art der »Trauerbegleitung« ernst genommen und getröstet fühlten. Von den Frauen, die ich für das Buch interviewt habe, wünschten sich einige einen persönlicheren Umgang mit der Leiche und einen weniger formalisierten Ablauf des Begräbnisses. Keine allerdings konnte sich vorstellen, sich an ein »Haus der Begleitung« zu wenden oder ein »Trauerseminar« zu besuchen. Sie zogen es alle vor, mit ihrer Trauer alleine zu sein oder bei den Menschen Trost und Unterstützung zu suchen, die ihnen am nächsten stehen.
Schweigen muss nicht immer Verschweigen und Verdrängen bedeuten. Und Trauer ist bis zu einem bestimmten Grad nicht »teilbar«, sie beinhaltet immer ein, je nachdem, größeres oder kleineres Moment von Einsamkeit. Die Lücke, die ein Mensch hinterlässt, kann durch niemanden gefüllt werden. Das Sichbewusstwerden der eigenen Endlichkeit löst neben Nachdenklichkeit auch Erschrecken, wenn nicht Entsetzen aus. Nicht umsonst haben sich alle bekannten Kulturen Vorstellungen darüber gemacht, ob und wie die Toten weiterleben, wohin ihre Seelen sich begeben und ob die – noch – Lebenden ihnen wiederbegegnen werden oder nicht. Der Tod hat seine eigene Gewalt, er ist ein Mysterium, und diejenigen, die ihn erlebt haben, können uns nicht mehr davon berichten. Ob die Menschen in verschiedenen Epochen und Kulturen den Tod annahmen oder fürchteten, ob sie ihn als selbstverständlichen Teil des Lebens oder als unvermeidliche Katastrophe betrachteten, niemand konnte je sein Geheimnis ergründen, niemand weiß, was »danach« geschieht.
Die verschiedenen Religionen haben dieser Tatsache Rechnung getragen, die Sterbezeremonien und Trauerrituale aller Zeiten und Völker haben versucht, die Lebenden für die Konfrontation mit dem Tod zu wappnen und den Toten den Weg, den sie nun einschlagen würden, zu erleichtern. Man legte den Verstorbenen eine Münze in den Mund, wenn man glaubte, sie müssten den Fährmann, der sie ins Totenreich übersetzte, bezahlen. Man gab ihnen Speisen und Getränke mit, wenn man davon überzeugt war, sie würden in einer anderen Welt weiterleben. Man legte sie in geweihte Erde, damit sie am Jüngsten Tag teilhätten, man verbrannte ihren Körper, damit die Seele frei wäre, sich einen neuen zu suchen.
Auch Menschen, die an keinen Gott und an kein Weiterleben nach dem Tod glauben, »vergessen« ihre agnostische oder atheistische Haltung, wenn es um geliebte Verstorbene geht. Sally Cline zitiert zum Beispiel die Tochter einer katholischen Romanautorin, die ihr sagte: »Ich, die ich bis vor kurzem an nichts geglaubt hatte, (…) setzte die ganze, über Jahre als Agnostikerin aufgestaute, frustrierte, leidenschaftliche Geisteskraft ein, um Gott inständig anzuflehen: ›Bitte, laß sie nicht länger leiden. Bitte, laß sie jetzt sterben.‹«[17] Die Philosophin Hannah Arendt, die ihr Judentum als ethnisch und kulturell begriff, nicht aber als religiös, erfuhr in New York durch ein Telegramm ihrer Cousine Eva Beerwald vom Tod der Mutter. Martha Arendt hatte sich auf eine Reise nach England begeben und war auf dem Schiff gestorben. Als Hannah Arendt auf einer Europareise ihre Cousine nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder sah, lautete ihre erste Frage: »Wer hat ein Kaddisch (das Totengebet, Anm.d.Autorin) für Mutter gesprochen?«[18]
Ich habe alle meine Interviewpartnerinnen gefragt, ob ihre Mutter für sie noch irgendwo existent sei. Viele von ihnen, auch intellektuelle Frauen, die sich als »ohne jedes religiöse Bekenntnis« bezeichnen, antworteten mit »ja«, auch wenn die meisten nicht sagen konnten, wo und in welcher Form. Mich hat diese Antwort nicht sonderlich erstaunt, denn auch ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter ganz und gar verschwunden sein soll.
Ich stelle im ersten Teil dieses Buches dar, wie sich Historikerinnen und Feministinnen, Memoirenautorinnen und Schriftstellerinnen mit der Beziehung zwischen Müttern und Töchtern und dem Tod der Mutter auseinander gesetzt haben. Die einzelnen Kapitel im zweiten Teil, dem Hauptteil des Buches, habe ich nach den Fragen geordnet, die ich meinen Gesprächspartnerinnen stellte. Sie beziehen sich auf reale Situationen wie das Sterben der Mutter, den Abschied von ihr, Trauerrituale und Begräbnissituation, die Übernahme von Schmuck, Kleidern, Fotos und anderen Erinnerungsstücken und so weiter. Und sie handeln von Gefühlen und Beziehungsmustern wie dem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, den Gefühlen beim Tod der Mutter und nach der ersten Trauer, von den – veränderten – Beziehungen zum Vater und den Geschwistern, vom angenommenen oder abgelehnten »Erbe« an Aussehen, Eigenschaften, Charakterzügen der Mutter und so weiter. Ich habe die Töchter auch gefragt, ob sie etwas über die Person hinter der Mutterfigur in Erfahrung bringen wollten und konnten, ob sie mit ihrer Mutter sprechen – mit ihrem Foto etwa oder an ihrem Grab –, ob sie sich mit ihrer Mutter versöhnt haben und ob sich, ganz allgemein, ihr Leben oder ihre Einstellungen durch den Tod der Mutter verändert haben.
Bevor ich jedoch über die Erfahrungen und Erlebnisse von so vielen unterschiedlichen Töchtern berichte, erzähle ich vom Tod meiner Mutter. Ich schreibe dieses Buch nicht als neutrale Beobachterin, sondern als Tochter, die aus eigener Erfahrung heraus fragte und die beim Fragen und Zuhören auch eigene Emotionen bewältigen musste. Nicht nur meine Gesprächspartnerinnen haben bei den Interviews geweint, auch mir kamen manchmal die Tränen. Ich habe für dieses Buch viel Material gesammelt und bearbeitet. Dass ich es schreiben konnte, verdanke ich der Bereitschaft all der Frauen, die sich von mir interviewen ließen, offen und ungeschützt über ihre Erfahrungen und Gefühle zu sprechen. Das Buch geht somit weit über meine individuelle Wahrnehmung und Erfahrung hinaus. Dennoch gibt es auch den subjektiven Aspekt darin. Ich habe ihn bewusst nicht herausgehalten, denn meiner persönlichen Erfahrung mit dem Thema verdanke ich nicht nur den Antrieb, das Buch zu schreiben, sondern auch die Empathie, mit der ich meine Gesprächspartnerinnen befragen konnte und die einigen von ihnen geholfen hat zu antworten.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, daß ich vollkommen sein müsse, um mir die Liebe und Achtung meiner Mutter zu erhalten. (…) Wir schaffen uns unsere eigenen Gespenster.
Nancy Friday
2Mütter und Töchter: »Die Stärke dieser Beziehung«
In den frauenbewegten Siebzigerjahren wussten wir eines ganz genau: Wir wollten nicht wie unsere Mütter werden. Wir wollten starke, autonome, selbstbewusste und selbstbestimmte Frauen werden. Aber wie sah so eine Frau aus? Unsere Mütter waren uns keine Vorbilder, aber wir hatten auch kaum andere. Wir fragten uns: Gab es starke Frauen in der Geschichte (jenseits von Jeanne d’Arc und irgendwelchen Königinnen)? Und wir entdeckten, dass wir nach allem, was wir wissen wollten, selbst suchen mussten. Eine Geschichte interessanter Frauen existierte ebenso wenig wie eine weibliche Sozialgeschichte. Frauen haben selbst sehr viel weniger über sich geschrieben als Männer, und es wurde auch von anderen sehr viel weniger über sie geschrieben. Wir wissen daher auch nicht allzu viel darüber, wie die Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern in früheren Jahrhunderten aussahen. Sie scheinen jedoch, wenn man den vorhandenen Quellen trauen kann, eher harmonisch als konfliktreich gewesen zu sein.
Die autobiographischen Texte von Frauen früherer Epochen vermitteln ein Bild weiblicher Zusammengehörigkeit und gegenseitiger Unterstützung. Die Mutter lehrte die Tochter, was diese als Frau wissen musste, und stand ihr in den entscheidenden Momenten eines Frauenlebens bei: bei ihrer Heirat und bei den Geburten der Kinder. Die Tochter wiederum kümmerte sich um die Mutter, wenn diese krank war oder im Sterben lag. Dieses Bündnis scheint im Alltag der Frauen über hunderte von Jahren funktioniert zu haben. Die Zärtlichkeit, mit der Töchter in Briefen und Tagebüchern vergangener Jahrhunderte über ihre Mütter schreiben, kann nicht nur geheuchelt und der Konvention geschuldet sein.[19] Adrienne Rich verweist auf eine Forschungsarbeit von Carol Smith-Rosenberg, die Briefe amerikanischer Frauen aus der Zeit von 1760 bis 1880 untersuchte. Sie fand darin eine »weibliche Welt«, die »klar getrennt von der größeren Welt männlicher Interessen« war, und »in der (…) Frauen eine vorherrschende Wichtigkeit im Leben einer jeden einnehmen.«[20]
Im »Herzen dieser weiblichen Welt« entdeckte Smith-Rosenberg eine »innige Mutter-Tochter-Beziehung«.[21] Die Autorin, die selbst zu einer Generation gehört, für die diese Innigkeit nicht mehr selbstverständlich ist, zieht durchaus in Betracht, dass der Mangel an Konflikten auch daher rühren könnte, dass eventuelle Aggressionen zwischen Mutter und Tochter unterdrückt werden mussten. Doch sie gelangt zu dem Schluss: »Diese Briefe scheinen so lebendig und das Interesse der Töchter an den Geschichten ihrer Mütter so vital und ursprünglich, dass sich ihre enge Beziehung schwerlich nur in Begriffen wie Verdrängung und Ablehnung interpretieren lässt.«[22]