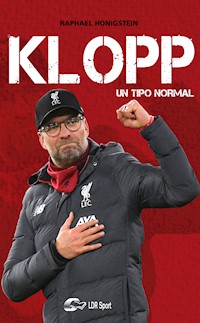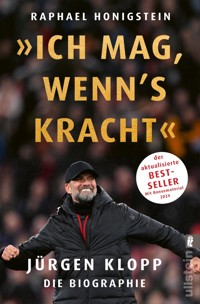
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Aktualisierte Ausgabe 2024: mit Bonuskapitel zu Klopps Finale beim FC Liverpool Jürgen Klopp ist eine Marke. Wie eine Naturgewalt braust er seit seiner Zeit beim FSV Mainz über die Fußballlandschaft hinweg und begeistert dabei mit seiner herzlichen und selbstironischen Art nicht nur deutsche Fans: Seit 2015 mischt er auch den englischen Fußball auf und führte den angeschlagenen FC Liverpool wieder auf Erfolgskurs. In dieser packend erzählten Biographie lässt der renommierte Sportjournalist Raphael Honigstein zahlreiche Wegbegleiter, Freunde und die Familie des Trainers zu Wort kommen und schildert mitreißend den Werdegang des sympathischen »Normal One«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
"Ich mag, wenn's kracht."
RAPHAEL HONIGSTEIN, Jahrgang 1973, lebt seit vielen Jahren als Journalist, Fernsehexperte und Autor in London. Er berichtet u.a. für Der Spiegel, The Athletic, SKY Deutschland und BT Sport über den englischen und deutschen Fußball. Sein internationaler Bestseller über Jürgen Klopp erschien erstmals 2017.
»Die 90 Minuten sind Adrenalin pur. Ich mag diese totale Zuspitzung, wenn es überall kracht und knallt. Eine Phase von ›Alles oder nichts‹, in der man das Gefühl hat, die Leute atmen nicht.« Jürgen Klopp ist ein Trainer zum Anfassen – authentisch und humorvoll nimmt er Medien und Fans mühelos für sich ein. Doch nicht nur in Deutschland liebt man »Kloppo« – auch in England hat der Schwabe mit seiner unnachahmlichen Art für Furore gesorgt: Unter tosendem Beifall wurde er im Oktober 2015 zum Trainer des traditionsreichen FC Liverpool ernannt. »I’m the normal one«, sagte Klopp zum Einstand. Doch was er mit dem angeschlagenen Traditionsverein in der Folge anstellen würde, war außergewöhnlich: Unter anderem gewann er die Champions League (2019), wurde englischer Meister (2020) und holte den FA Cup (2022); insgesamt acht Titel in neun Jahren.Der renommierte Sportjournalist und Fußballexperte Raphael Honigstein zeichnet ein umfassendes Portrait von der Herkunft und dem Werdegang des beliebten Trainers.
Raphael Honigstein
"Ich mag, wenn's kracht."
Jürgen Klopp. Die Biographie
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Erweiterte und aktualisierte Ausgabe Oktober 2024© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH,Berlin 2017 / Ullstein extraWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.© 2017 by Raphael HonigsteinTitel der englischen Originalausgabe:Jürgen Klopp – Bring The Noise, erschienen 2017bei Yellow Jersey Press, an imprint of Penguin Random House UKCovergestaltung: zero-media.net, MünchenCoverabbildung: getty images / © Justin SetterfieldAutorenfoto: © Peter SchiazzaE-Book by pepyrusISBN 978-3-8437-3530-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1Die Überraschung
2Rosenmontag: Stunde null
3Revolution 09
4Der Weg nach Anfield
5In den Fußstapfen des Vaters
6Wolfgang Frank: Der Lehrmeister
7»Schönen guten Tag. Hier ist Jürgen Klopp.«
8Pump up the Volume
9Starts und Stopps
10Feuer am Rhein
11Zum Ersten, zum Zweiten und – beinahe – zum Dritten
12Chaos und Theorie
13Kleine Triumphe auf dem Bildschirm
1460 000 Tränen
15In Zeiten des abnehmenden Lichts
16Boom!
17Ein Titel für die Ewigkeit
18I’m so glad that Jürgen is a red
Danksagung
Bildteil
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1Die Überraschung
Widmung
Für Mama und Papa
1Die Überraschung
Glatten 1967
Der Schwarzwald ist nicht schwarz. Genau genommen ist er nicht mal ein Wald. Jedenfalls heute nicht mehr. Vor 1800 Jahren drangen als Erste die Alemannen in diese düstere, überwucherte Wildnis vor, die den Römern so viel Furcht eingeflößt hatte. Sie rodeten den Wald, um Platz zu schaffen für Kühe und Siedlungen. Keltische Missionare aus Schottland und Irland, bewaffnet mit Äxten und ihrem Glauben, stießen weiter in das Landesinnere vor, bis die Natur bezwungen und das Böse gezähmt war. Heute liefern die Reste der Dunkelheit nur noch den Rohstoff für Alpträume von Kindern und für Kuckucksuhren.
Aus allen Teilen des Landes und auch aus dem Ausland strömen Touristen in diese Mittelgebirgslandschaft in der südwestlichen Ecke Deutschlands, um ihre Lungen und Seelen vom städtischen Schmutz zu reinigen. Nach dem Krieg wurde der Schwarzwald eine beliebte Anlaufstelle für die Filmbranche, die auf der Suche nach schönen, idyllischen Kulissen war, und ein idealer Standort für echte oder imaginäre Kliniken. Einer dieser Orte, an denen Phantasie und Realität auf magische Weise miteinander verschmelzen konnten.
Tatsächlich ist sie noch heil, die Welt – im schmucken Städtchen Glatten im Nordschwarzwald. Die blitzsauberen weißen Häuser mit ihren lebkuchenförmigen Dächern und Holzbalkonen, die sich an die Hänge schmiegen, wachen hier über den unendlichen grünen Hügeln. »Andere bauen ihr Haus auf dem Hügel, damit man die Pracht auch gut sehen kann. Der Schwabe dagegen baut das Haus in den Hang hinein, damit die Nachbarn nicht sehen können, wie viele Quadratmeter er wirklich hat«, so erklärt der frühere Grünen-Politiker Rezzo Schlauch die Bescheidenheit der Einheimischen, seiner Landsleute. »Beim Schwaben steht der neue Mercedes in der Garage und der VW vor dem Haus.«
Der Fluss Glatt (althochdeutsch für »klar, glänzend, rein«) kommt aus dem Nordwesten und fließt an der stahlverkleideten Fassade der J. Schmalz GmbH (Vakuumtechnologie) vorbei, hinein in das Städtchen, das ihm seinen Namen verdankt. Er ist ein diskreter Begleiter der Hauptstraße (an der sich ein Autohändler, eine Bank, eine Bäckerei, ein Metzger, ein Blumenladen und ein Döner-Imbiss befinden), speist etwas widerwillig ein Freibad und verlässt die Stadt hinter dem Sportplatz in Böffingen, einem kleinen Dorf, das nach Glatten eingemeindet wurde.
Das Klima ist schwierig, im Sommer regnet es viel. Die Idylle musste der Natur abgerungen werden. Es gibt grüne Weiden hier, Getreidefelder, Schweinezuchtbetriebe und Menschen mit furchterregender Entschlossenheit und großer Genügsamkeit, ein außergewöhnlich zäher deutscher Menschenschlag, der härter als hart arbeitet und sich durch nichts aus der Bahn werfen lässt. »Schaffe, schaffe, Häusle baue« – wohl in keinem anderen Landstrich kann dieses Motto größere Gültigkeit beanspruchen.
»Tag und Nacht zu schaffen gehört zum Schwaben, das hat seinen Ursprung in der Geschichte«, sagt Schlauch. »Und darin lassen sich auch die Gründe finden, warum Schwaben solch erfolgreiche Tüftler und Erfinder sind. In anderen Gegenden erbten immer die Ältesten die Höfe der Eltern. In Schwaben wurde gerecht und real geteilt. Das bedeutete, die Erbstücke wurden immer kleiner, und irgendwann konnte man davon nicht mehr leben. Die Nachkommen mussten sich in anderen Berufen üben, was die Tüftler und Erfinder hervorbrachte, also Leute, die nach neuen Lösungen suchen für alte Probleme.«
Hier ist es üblich, dass man alles gewissenhaft und ernsthaft macht. Das gilt auch für Spaß und Unterhaltung. Einer der vierzehn aktiven Vereine in Glatten widmet sich dem Karneval. In einem anderen sammeln sich die Freunde des Deutschen Schäferhunds.
Schuppen säumen eine kleine Straße, auf der dicke Erdklumpen liegen, die von Traktoren hinterlassen wurden, und dann taucht es auf, unmittelbar neben einem Feld: das »Haarstüble« von Isolde Reich. Ein kleiner Friseursalon und Treffpunkt, wo auch Socken verkauft werden, die eine Freundin der Inhaberin selbst strickt. Die Erlöse werden für den Kauf von Schuhen für Obdachlose gespendet.
Isolde Reich wurde 1962 als jüngere von zwei Schwestern in Glatten geboren. Ihr Vater Norbert, ein talentierter Fußballtorwart, der beim 1. FC Kaiserslautern ein Probetraining absolvierte, war ein Sportbesessener. Da er von seinem Vater in seinem Eifer gebremst wurde – dieser habe darauf bestanden, dass Norbert einen anständigen Beruf lernte und nicht versuchen solle, Profifußballer zu werden, erzählt Isolde Reich –, war seine Fußballkarriere schon vorbei, bevor sie richtig begonnen hatte. Doch seine Begeisterung für den Sport ließ er sich nicht nehmen. Er spielte Amateurfußball, Handball und Tennis und versuchte auch seiner Familie diese Leidenschaft zu vermitteln. Als seine Frau Elisabeth und seine erste Tochter Stefanie keinerlei Neigung zeigten, irgendeinen Sport zu betreiben, richtete Norbert seine Hoffnungen ganz auf Isolde. »In mein Kinderalbum schrieb er ›Isolde, eigentlich solltest du ein Junge werden‹«, erzählt sie lächelnd. »Ich war das erste Mädchen in Glatten, das Fußballtraining machte.«
Norbert war ihr Trainer, seine Methoden waren anspruchsvoll und fordernd. Er ließ die fünfjährige Isolde auf einem Sportplatz am Fluss, wo ein schwerer alter Ball an einem Seil an einem grünen Eisenbalken hing, Kopfbälle üben. Wenn ihre Körperhaltung nicht richtig war oder sie die Arme zu weit oben hielt, musste sie eine Strafrunde um den Platz laufen. »Er war hart, aber gerecht. Ein Mann mit Prinzipien und extrem leidenschaftlich«, erzählt sie heute.
Im Sommer 1967 musste Mutter Elisabeth die Familie für einen Monat verlassen. Sie war abermals schwanger. Weil bei der Geburt Komplikationen drohten, fuhr sie in ein Krankenhaus in Stuttgart, achtzig Minuten nordöstlich von Glatten. Das nächste Krankenhaus in Freudenstadt, nur acht Kilometer entfernt, war nicht ausgerüstet für Geburten per Kaiserschnitt. Stefanie und Isolde fiel es schwer, so lange ohne ihre Mutter zurechtzukommen. »Uns wurde daher versprochen: Wenn die Mutter wiederkommt, bringt sie was ganz, ganz Tolles mit.«
Doch als Norbert und Elisabeth wieder zu Hause ankamen, hielten sie ein kleines Baby auf dem Arm, das wie am Spieß brüllte. Nach einer Stunde fragten sich die beiden Schwestern, ob man dieses Wesen nicht zurückbringen und gegen etwas anderes umtauschen könnte. Ein kleiner, schreiender Bruder – was für eine miserable Überraschung!
Aber Isolde wurde schnell klar, dass sie an diesem Tag mehr als nur ein zweites, unerträglich lautes Geschwisterchen bekommen hatte. »Ab sofort stand Jürgen im Sport-Fokus des Vaters. Ich wurde vom Training am Kopfball-Pendel entbunden und durfte stattdessen Ballett tanzen und Leichtathletik machen. So gesehen war die Geburt von Jürgen mein Glück. Ich war befreit.«
2Rosenmontag: Stunde null
Mainz 2001
Christian Heidel gefällt die Geschichte so sehr, dass er sich allmählich fragt, ob sie so wirklich stimmt. »Ich könnte als Mainzer jetzt ja sagen, wir denken uns das mal aus. Das war aber so«, sagt er und nimmt Anlauf für einen großen Sprung: weg von seinem eher kargen Büro in der Geschäftsstelle von Schalke 04, mitten rein in eine Stadt, die lustvoll durch den Konfettiregen torkelt, während eine kleine, erfolglose Zweitligamannschaft die Party vierzig Autominuten entfernt im provinziellen, gewollt unprickelnden Exil verpasst.
Am 25. Februar 2001, einen Tag vor Rosenmontag, hatte der FSV Mainz 05 bei seinem Angstgegner SpVgg Greuther Fürth im Playmobilstadion mit 1 : 3 verloren. »Kloppo war leicht verletzt und war der schlechteste Mann auf dem Platz. Er musste zwanzig Minuten vor Spielende ausgewechselt werden«, erzählt Heidel. Durch die Niederlage rutschte Mainz auf einen Abstiegsplatz. »Wir waren mal wieder am Arsch«, erinnert sich der ehemalige FSV-Manager. Es gab keine Hoffnung mehr da ganz unten, kein Licht. »Wir hatten 3000 Zuschauer im Schnitt. Keiner hat sich mehr für Mainz interessiert. Alle waren überzeugt, dass wir absteigen.«
Eckhard Krautzun, der weitgereiste Trainer der Mainzer (man nannte ihn den »Weltenbummler«), hatte befürchtet, dass die Verlockungen der Fastnacht die Mannschaft vor dem schweren Spiel in Duisburg am Aschermittwoch zu sehr ablenken könnten. Das Team wurde ausquartiert. »Nachdem wir das Spiel in Fürth verloren haben, kochte die Stimmung in Mainz. Da war klar, entweder gibt es jetzt einen Trainerwechsel, oder die Mannschaft kriegt ordentlich Feuer. Wir haben uns dann drei Tage in einem Hotel in Bad Kreuznach abgeschottet, damit keiner draußen unterwegs ist«, erinnert sich der Mainzer Mittelfeldspieler Jürgen Kramny, damaliger Zimmergenosse von Jürgen Klopp.
Christian Heidel war zu Hause in Mainz geblieben. Nach Feiern war ihm jedoch nicht zumute. Die Lage war viel zu düster, um sich ins närrische Treiben zu stürzen. Dass der Trainer würde gehen müssen, war klar. Krautzun war durchaus ein angenehmer Mensch, ein erfahrener Fußballlehrer, der in einem Jubiläumsspiel von Al-Ahli in Saudi-Arabien auch schon Diego Maradona trainiert hatte, abgesehen von den Nationalmannschaften von Kenia und Kanada und zahlreichen Klubs weltweit. Aber sechs Punkte in neun Spielen seit seinem Amtsantritt im November waren eine sehr magere Ausbeute. 05 belegte wieder einen Abstiegsrang. Darüber hinaus wusste Heidel, dass sich Krautzun den Job gewissermaßen erschlichen hatte.
Krautzuns Vorgänger, der ehemalige belgische Nationalspieler René Vandereycken, war ein mürrischer, einsilbiger Mann, dessen Weigerung, mit den Spielern und den Vorstandsmitgliedern zu reden, nur noch durch seinen Widerwillen übertroffen wurde, ein stimmiges Spielsystem zu entwickeln. Er wurde in der Saison 2000/01 nach zwölf Spielen entlassen, die nur mickrige zwölf Punkte eingebracht hatten, Mainz war damit bereits mitten im Abstiegskampf. Heidel wollte einen Nachfolger, der das erfolgreiche System der Viererkette und Raumdeckung wiederbelebte, das der ehemalige Mainzer Trainer Wolfgang Frank vor sechs Jahren eingeführt hatte, eine Taktik, die in der Bundesliga damals als so modern und fortschrittlich galt, dass niemand so richtig wusste, wie man sie praktisch umsetzen konnte.
Heidel erzählt: »Ich habe jedem erzählt, dass ich einen Trainer brauche, der versteht, wie die Viererkette funktioniert. Einen, der das den Spielern beibringen kann. Und irgendwann ruft Krautzun an. Ich muss gestehen, dass ich an den überhaupt nicht mehr gedacht habe. Er war vorher bei Kaiserslautern, und das hat nicht funktioniert. Aber er hat mich so lange überredet, bis ich eingewilligt habe, mich mit ihm in Wiesbaden zu treffen. Und da hat er mir dann alles genaustens über die Viererkette erklärt. Ich dachte: Leck mich am Arsch, der weiß das ja wirklich! Ich wusste ja von Franks Training, wie die Übungen dazu aussahen. Also hab ich ihn zum Trainer gemacht. Zwei Wochen später kam Klopp zu mir und erzählte: ›Der Krautzun hat mich vor einem Monat angerufen und drei Stunden mit mir telefoniert. Der wollte wissen, wie die Viererkette geht.‹ Und so hat sie dann auch ausgesehen: Am Anfang haben wir noch ein, zwei Spiele gewonnen, und dann ging es bergab.«
Sich von Krautzun zu trennen war die vernünftige und leichte Entscheidung. Den richtigen Nachfolger zu finden war wesentlich schwieriger. Heidel durchstöberte einen ganzen Berg von Kicker-Jahresheften in der Hoffnung, einen geeigneten Kandidaten ausgraben zu können. »Damals gab es ja noch kein Internet. Du hast nicht gewusst, wer ist denn eigentlich Trainer in Brügge gerade. Die waren sowieso fünf Nummern größer als wir zu diesem Zeitpunkt. Das war damals einfach anders. Es gab auch kaum ausländische Trainer in Deutschland. Du hast immer im selben Teich gefischt.« Nach einer Weile legte Heidel die Zeitschriften beiseite und gestand sich sein Scheitern ein. »Dann habe ich gedacht, die einzige Chance wäre, dass wir wieder so spielen wie beim Wolfgang. Aber ich fand niemanden.«
Vielleicht kam Heidel der zündende Einfall, als er die Narren beobachtete, die an diesem Tag durch die Straßen von Mainz zogen. Der einzig logische, noch verbleibende Schritt in dieser ausweglosen Lage war, das offenkundig Verrückte zu probieren. Wenn sich kein geeigneter Trainer auftreiben ließ, sollte man es mal ohne einen Trainer versuchen?
»Und dann habe ich überlegt: Machen wir doch etwas völlig Spektakuläres. Trainieren wir uns selbst.« Es gab ja schon »ein paar richtig gute Jungs in der Mannschaft, intelligente Typen«, erzählt er, diese mussten nun jene Spieler, die nach Franks Zeit zum Verein gekommen waren, eben selbst unterweisen. Aber Fußball war immer noch Fußball, und einer musste das Sagen haben. Heidel überlegte, ob er selbst den Posten übernehmen sollte. »Ich hätte es denen durchaus beibringen können, so viele von Wolfgangs Trainingseinheiten habe ich erlebt. Aber ich hatte ja weder ein Bundesligaspiel noch ein Oberligaspiel in meiner Karriere absolviert. Das hätte doof ausgesehen. Deshalb habe ich dann Kloppo im Trainingslager in Bad Kreuznach angerufen. Der wusste überhaupt nicht, was auf ihn zukam.«
Heidel informierte den erfahrenen Rechtsverteidiger, dass es mit Krautzun nicht weiterging und dass ein Trainerwechsel unabdingbar war. »Ich habe ihm ganz ehrlich gesagt: Ich glaub, wir sind untrainierbar. Das, was wir spielen wollen, versteht hier in Deutschland keiner. Ihr, also du und die Mannschaft, ihr habt das verstanden. Aber mit den Trainern geht es wirklich nicht. Klopp hat überhaupt nicht gewusst, worauf ich hinauswill. Dann habe ich gesagt: ›Was hältst du davon, wenn wir uns selbst trainieren? Aber einer muss da vorne stehen, und das machst du.‹ Er zögerte ein paar Sekunden. Dann sagte er: ›Geile Idee. Das machen wir.‹«
Heidel rief Mannschaftskapitän Dimo Wache an, den Torwart. »Eigentlich war ja Kloppo Kapitän, aber Dimo trug die Binde. Dietmar Constantini (der Vorgänger von Krautzun) hatte sie Klopp abgenommen, weil der sich immer über die Taktik beschwerte. Der hat ihn auch auf die Bank beordert. Das geht gar nicht, Kloppo auf der Bank. Wenn der heute meckert, dass seine Spieler meckern … Man hätte ihn mal erleben sollen, als er selbst auf der Bank saß.«
Harald Strutz, damals der Präsident des FSV Mainz, ging gerade seinen karnevalistischen Pflichten als führendes Mitglied der Ranzengarde nach, als sein Telefon klingelte. »Heidel hat mich angerufen: ›Pass auf, wir müssen den Trainer dringend wechseln‹«, erzählt Strutz in seinem Büro im Verwaltungsgebäude des Vereins, in einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadt. In der Eingangshalle steht eine Vitrine mit Fanartikeln des FSV, darunter eine Monopoly-Version mit Heidel und Klopp auf der Schachtel. »Eckhard Krautzun hat sich da sehr fair verhalten. Er wollte zwar Trainer bleiben, aber wir haben gesagt, dass es nicht mehr geht. Dann habe ich meine Uniform ausgezogen, und wir sind nach Bad Kreuznach gefahren. Am Rosenmontag feiert eigentlich jeder in Mainz, das bedeutet aber nicht, dass jeder hier betrunken ist. Ich war jedenfalls nicht betrunken, sonst wäre ich nicht mehr gefahren. Wir haben Kloppo gefragt: ›Traust du dir das zu?‹ Er hat keine Sekunde gezögert: ›Klar, mach ich.‹«
Strutz hält kurz inne, noch immer erstaunt über die Tragweite der wichtigsten Entscheidung, die er je in seinem Amt getroffen hat. Er ist Kommunalpolitiker, Mitglied der FDP und arbeitet als Rechtsanwalt, auf seinem Konferenztisch steht ein Exemplar des Bürgerlichen Gesetzbuchs: Strutz ist ein grundseriöser Mann. Eigentlich nicht die Art von Fußballboss, die sich von einer Schnapsidee des Sportdirektors mitreißen lässt. »Es ist schon eine besondere Geschichte«, sagt er. »Aber so hat das eben angefangen. Wenn Sie wüssten, wie es damals hier ausgesehen hat … Es war ja schon eine große Leistung, dass die ganze Mannschaft überhaupt zusammengeblieben ist. Ein außerordentlicher Start für so eine Trainerkarriere. Und diese Außergewöhnlichkeit sprudelt mir immer noch ins Gedächtnis.«
Die zehn Lokaljournalisten, die sich am nächsten Tag zur Pressekonferenz in Bad Kreuznach einfanden, waren weniger euphorisch gestimmt. Heidel: »Die haben schon gewusst, was los ist. Wir haben dann die Trainerentlassung bestätigt. Und dann sagt der eine, Reinhard Rehberg, der ist heute noch Journalist in Mainz: Was macht denn Klopp hier? Die haben gedacht, wir machen mit dem Co-Trainer eine Übergangslösung. Und dann habe ich gesagt: ›Der Kloppo wird jetzt Trainer.‹ Der ganze Tisch hat gegrölt. Alle haben gelacht. Am nächsten Tag sind wir in den Zeitungen verarscht worden. Man glaubt ja immer, dass wegen Klopp alle jubeln, aber das war noch nicht der Klopp von heute, sondern der Kloppo von damals. Er war nur Spieler, er hatte keine Trainerlizenz und Sportwissenschaften studiert.«
Klopp wusste, dass die Reporter ihm nicht zutrauten, Mainz vor dem scheinbar unvermeidlichen Abstieg zu retten. Er machte sich über seine Unerfahrenheit lustig. »Ihr müsst mir sagen, was ich hier sagen soll«, verlangte er von den Pressevertretern mit breitem Grinsen.
»Und dann, das werde ich nie vergessen«, fährt Heidel fort, »als die Journalisten raus waren, sagte Kloppo: ›Wir gehen jetzt trainieren.‹ Dann sind wir zum Friedrich-Moebus-Stadion in Bad Kreuznach gefahren, und ich habe gedacht: ›Ah, das ist wieder Leben in der Bude.‹ Überall haben wieder Stangen auf dem Feld gestanden. Die Mannschaft hat wieder verschoben. Da war mir klar: Wir kehren zurück zu alten Zeiten.«
Die Spieler waren ebenso überrascht wie die Journalisten, dass Klopp ihr neuer Chef war. »Da stand auf einmal der Kloppo im Sitzungsraum. Da war der Kloppo Trainer«, erinnert sich Mittelfeldspieler Sandro Schwarz, der heute Mainz 05 trainiert. »Trotzdem war er noch immer einer von uns. Es war nicht so, dass du von nun an ›Sie‹ sagen oder auf Distanz gehen musstest. Kloppo griff mit einer natürlichen Autorität durch und traf Entscheidungen. Und die Mannschaft hatte damit kein Problem. In der schwierigen Situation, wir waren ja im Abstiegskampf, haben wir das komplett angenommen. Die Jungs, die schon länger da waren, haben danach gelechzt, wieder das 4-4-2-System zu spielen, das uns früher so stark gemacht hatte. Er hat es wieder eingeführt und ist mit seiner positiven Art voranmarschiert.«
Die erste Mannschaftssitzung unter dem neuen Trainer hinterließ einen bleibenden Eindruck bei Heidel. »Ich weiß noch, wie der Raum ausgesehen hat. In diesem Hotel in Bad Kreuznach. Der Mann hatte noch nie eine Mannschaftssitzung abgehalten, noch nie. Damals war ich noch ein bisschen schlanker und fitter, und wenn man mir Fußballschuhe gegeben hätte, wäre ich gegen Duisburg sofort aufgelaufen … Ich kannte ja schon zehn oder elf Trainer, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Du wolltest raus und sofort spielen. Ich habe zu meinen Vorstandskollegen gesagt, dass wir hundertprozentig gewinnen. Und ich habe mir gedacht, wenn die Spieler genauso sicher sind wie ich, dann werden wir das Spiel gewinnen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was Kloppo genau gesagt hat. Aber es war eine Mischung aus Taktik und Motivation. Wir hätten sofort spielen können. Das war diese Fähigkeit, die Mannschaft starkzureden.«
Diesen Job anzunehmen, sei »ein gefühltes Himmelfahrtskommando« gewesen, räumte Klopp zehn Jahre später auf spox.com ein. »Es ging nur um die Frage: Was kann man tun, damit wir nicht weiterhin jedes Spiel verlieren? Über Gewinnen habe ich gar nicht nachgedacht. In der ersten Trainingseinheit habe ich Stangen in den Boden gerammt und taktisch laufen lassen. Für die allermeisten waren diese Abläufe noch im Langzeitgedächtnis abgespeichert, weil wir sie ja bis zum Erbrechen unter Wolfgang Frank trainiert haben. Wir wollten das Spiel so aufziehen, dass es unabhängig war vom Gegner.« Auch im Motivationsteil seiner Ansprache klang eines von Franks Themen wieder an: dass es entscheidend darauf ankommt, »die letzten fünf Prozent zu geben« (Klopp).
Klopp habe »ganz einfache Dinge« gemacht, erzählt Kramny. »Mich zum Beispiel hat er von der rechten Position ins Zentrum genommen. Und dann gab es noch eine oder zwei Veränderungen in der Mannschaft. Heidel sagte uns, wir müssten zusammenhalten, nachdem wir es den Trainern zuvor so schwergemacht hatten. Wir fühlten uns alle verantwortlich. Viel Zeit hatten wir nicht, also was konnten wir tun? Ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß reinbringen, Standards üben. Und dann haben wir gesagt: Okay, auf geht’s. Rennen, rennen, rennen. Am Spieltag hat es gegossen wie aus Kübeln.«
Heidel erzählt: »Wir hatten 4500 Zuschauer. Es war Aschermittwoch, das ist in Mainz etwas Besonderes. Wir haben gegen den MSV Duisburg gespielt, die waren Zweiter oder Dritter. Also ein ganz heißer Aufstiegskandidat. Und ich muss ehrlich sagen: Wir haben die an die Wand gespielt. Wir haben zwar nur 1 : 0 gewonnen, aber die kamen überhaupt nicht vor unser Tor. Die kamen mit unserem System überhaupt nicht klar. Und die Leute im Stadion sind ausgerastet.«
Die Zuschauer auf der Haupttribüne hatten eine Menge Spaß. Sie sahen einen Mainzer Trainer, der »wie ein zwölfter Feldspieler um die Bank rumgelaufen ist, er hat ja quasi mitgespielt«, fährt Heidel fort. »Auf die Haupttribüne passten damals ja nur tausend Leute. Die haben sich alle kaputtgelacht über den da unten. Ich weiß gar nicht mehr, wo der hingerannt ist, als das Tor fiel. Vielleicht wurde er vom Schiedsrichter vom Platz verwiesen? (Wurde er nicht – in diesem Fall). Das alles war schon sehr, sehr besonders. Man kann sagen: Das war seine Geburt. Danach ist er seinen Weg gegangen.«
3Revolution 09
Dortmund 2008
Ein kalter Winterabend in Marbella im Januar 2017. Die Eingangshalle des Don Pepe Gran Melia-Hotels sieht aus wie der Traum eines »Denver-Clan«-Bühnenbildners: weißer Marmor, goldverkleidete Säulen, Töpfe mit Palmen. Und ein Mann, der Saxophon spielt.
Mitarbeiter von Borussia Dortmund tragen Körbe mit schmutziger Wäsche vom Abendtraining an der leeren Hotelbar vorüber. Auf einem cremefarbenen Sofa sitzt Hans-Joachim Watzke und beobachtet die Szenerie mit zufriedenem Nicken. Der 58-jährige Geschäftsführer des BVB ist ein erfolgreicher Unternehmer; seine Firma Watex setzt mit Arbeitsschutzkleidung jährlich 250 Millionen Euro um. Er ist der Mann, der den Verein 2005 vor dem Konkurs gerettet hat, der Mann, der den schönen, guten Fußball ins Westfalenstadion zurückbrachte, indem er Jürgen Klopp anheuerte. Aber wie jeder echte Anhänger scheint er am allermeisten glücklich und stolz darüber, einfach nur hier sein zu dürfen beim zehntägigen Wintertrainingslager der Mannschaft in Andalusien.
»Wieso Klopp? Das ist einfach zu beantworten«, sagt Watzke und stellt seine Espressotasse ab. »Weil ab 2007 klar war, dass wir überleben würden, aber weil genauso klar war, dass wir kein Geld hatten.«
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund, Deutscher Meister 1995 und 1996, Champions-League-Sieger 1997 und erneut Deutscher Meister 2002, hatte einen schmerzhaften finanziellen Niedergang erlebt. Die Einnahmen von 130 Millionen Euro durch den Börsengang im Jahr 2000 waren für teure Spieler ausgegeben worden, um im Wettrüsten mit Bayern München mithalten zu können. Doch als das Team zweimal hintereinander die Qualifikation für die Champions League verpasste, wäre der Verein 2005 unter seiner Schuldenlast von 240 Millionen Euro beinahe zusammengebrochen. »Wir waren in der Geschäftsstelle und wussten nicht, ob wir am nächsten Tag noch einen Job haben würden«, sagt der Stadionsprecher und frühere BVB-Stürmer Norbert »Nobby« Dickel. »Es war eine fürchterliche Zeit.«
»Dortmund ist eine Stadt, die für diesen Verein lebt, die extrem mit diesem Verein lebt«, sagt Sebastian Kehl. Der frühere Mannschaftskapitän erinnert sich, dass in der Stadt große Anspannung herrschte, alle hatten Angst, dass die Borussia untergehen könnte. »Taxifahrer, Bäcker, Hotelangestellte – jeder hatte Angst um seine Existenz. Und wir Spieler wussten nicht, ob es am Ende vielleicht gar keine Rolle mehr spielt, ob wir das Spiel am Wochenende gewinnen oder verlieren.«
Es war Watzke, der frühere Schatzmeister des Vereins, der schließlich den Klub rettete, als er nach dem Abtritt des buchstäblich diskreditierten Duos von Sportdirektor Michael Meier und Präsident Gerd Niebaum die Geschäftsführung übernahm. Watzke sanierte den Verein mit Unterstützung der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley, die ein Darlehen bereitstellte. Mehrere Kapitalerhöhungen ermöglichten es dem Verein, sein Stadion zurückzukaufen. Doch der radikale Kostensenkungsplan bedeutete auch, dass kein Geld für teure Spielertransfers mehr vorhanden war.
»Sportdirektor Michael Zorc und ich hatten uns darauf verständigt, eine junge Mannschaft aufzubauen. Marcel Schmelzer war schon da, Kevin Großkreutz kam bald danach. Wir wollten auch eine andere Art Fußball spielen. Unter Bert van Marwijk und Thomas Doll lief der Ball in der Viererkette rauf und runter, zehnmal hintereinander. Wir hatten zwar 57 Prozent Ballbesitz, aber es fehlte die Action. So kann man in Dortmund nicht spielen. Wir wollten den Leuten eine Mannschaft bieten, die bis zur Erschöpfung rannte. Das hatten wir in Mainz gesehen, als wir in den Jahren zuvor dort spielten. Man hatte immer das Gefühl, die sind eigentlich nicht besonders gut. Trotzdem haben sie es einem schwergemacht und manchmal sogar gewonnen. Weil die eine Mörder-Mentalität hatten. Und sie waren taktisch sehr gut eingestellt. Es musste also am Trainer liegen. Heute wäre es schwierig, in Dortmund einen Trainer aus der Zweiten Liga einzustellen. Damals ging das aber.«
In Dortmund war man nicht sicher, so Heidel, ob Klopp der Umstieg gelingen würde, vom Mainzer Säulenheiligen zum Erneuerer eines gefallenen Bundesliga-Giganten. Im Oktober 2007 nahm Watzke zum ersten Mal Kontakt mit dem Mainzer Geschäftsführer auf, kurz vor einem Treffen des DFB, das in Mainz stattfand. Heidel erzählt: »Watzke rief mich an und fragte, ob er bei mir mal zum Kaffeetrinken vorbeikommen könnte. Ich weiß noch, wie wir zusammensaßen. Das Thema kam schnell auf Jürgen. Ich sagte: ›Wenn ich jetzt sage, dass er top ist, dann schnappen Sie ihn mir ja weg. Ich könnte auch lügen und behaupten, er kann gar nichts. Aber dann erzählen Sie es ihm, und er wäre sauer auf mich.‹ Dann sagte ich: ›Der Kerl ist ein Bundesliga-Trainer.‹« Watzke bohrte weiter, ohne explizit über Dortmund zu sprechen. War Klopp fähig, einen großen Bundesligisten zu trainieren? »Ich sagte ihm: ›Er kann jeden Klub der Welt trainieren‹«, erzählt Heidel. »›Weil er einen Riesenvorteil vor jedem anderen hat: Er ist wirklich intelligent. Und wenn er zu einem großen Klub geht, wird er sich darauf einstellen. Wenn Sie einen in Anzug und Krawatte brauchen, holen Sie Jürgen Klopp besser nicht. Aber wenn Sie einen Top-Trainer haben wollen, holen Sie ihn.‹ Es ging nicht darum, sofort eine Entscheidung zu treffen, aber die Dortmunder haben von da an ein bisschen genauer auf ihn geguckt. Aber sie waren noch nicht überzeugt. Watzke rief mich immer wieder an, ich weiß gar nicht mehr, wie oft. Ich sagte immer: ›Machen Sie’s, machen Sie’s. Sie werden den Tag nie bereuen, an dem Sie Klopp unter Vertrag genommen haben.‹«
Zeitgleich wuchsen in der Dortmunder Strobelallee die Zweifel, ob es richtig gewesen war, Thomas Doll zu engagieren. Der frühere Mittelfeldspieler der deutschen Nationalmannschaft, seit März 2007 Trainer in Dortmund, konnte die Spieler und das Publikum mit seinem quälend langweiligen Fußball nicht mitreißen. Dortmund stand näher an den Abstiegsrängen als an der Tabellenspitze und beendete die Saison auf Platz 13, der schlechtesten Platzierung seit zwanzig Jahren. Ein guter Lauf im DFB-Pokal, wo die Dortmunder im Finale im April schließlich Bayern München nach Verlängerung mit 1 : 2 unterlagen, konnte die Mängel nicht verdecken. »Das war vielleicht die wertvollste Finalniederlage in der Geschichte des Vereins«, schrieben Sascha und Frank Fligge in ihrem Buch Echte Liebe, einer Chronik des Comebacks von Borussia Dortmund in den vergangenen zehn Jahren. »Bei einem Sieg hätte sich die Vereinsführung sehr schwergetan, Thomas Doll zu entlassen, an dessen Befähigung keiner mehr glaubte. Jürgen Klopp wäre dann nie nach Dortmund gekommen. Aber die Geschichte hat eine andere Wendung genommen.« Watzke meinte später scherzhaft, die Niederlage sei Teil eines strategischen Plans gewesen, Jürgen Klopp den Weg freizumachen. Klopp hatte das Spiel in Berlin als Experte des ZDF kommentiert und gegenüber Redakteur Jan Döhling bekannt, dass er »eines Tages einmal selbst da unten an der Seitenlinie stehen« wolle. Zurück in seinem Berliner Hotel, empfingen Dortmunder Fans ihn in der Eingangshalle mit »Jürgen Klopp, du bist der beste Mann!«-Gesängen. Sie wollten, dass er den Job übernahm.
Watzke erklärt, er sei immer überzeugt gewesen, dass Klopps Persönlichkeit stark genug war, um diese Herkulesaufgabe zu bewältigen: »Seine Fernsehauftritte haben uns das Gefühl gegeben, dass er die Fähigkeit besitzt, ein großes Projekt in Angriff zu nehmen. Wir haben über keinen anderen Trainer nachgedacht, wir wollten Klopp.« Nachdem Doll am 19. Mai zurückgetreten war, brachte ein geheimes Treffen im Büro eines Freundes von Watzke im Rheinland weitere Klarheit. »Das Gespräch war großartig«, erzählt Watzke. »Wir haben ihm gesagt, wie wir es uns vorstellen, und das deckte sich ziemlich gut mit seinen Vorstellungen. Michael Zorc hatte ihn bereits einen Tag vorher getroffen. Wir wollten uns unabhängig voneinander eine Meinung bilden. Wir sind uns ja häufig einig, aber in diesem Fall waren wir uns sehr schnell einig. Die Chemie stimmte von Anfang an.«
Klopp war damals aber auch an einer anderen Art von Chemie interessiert. Bayer 04 Leverkusen, die Werks-Elf des gleichnamigen Pharmakonzerns, hatte ebenfalls ein Auge auf den Trainer geworfen. Bayer verfügte zwar nicht über das Prestige der Schwarzgelben, hatte dafür aber keine Geldprobleme und besaß einen guten, ausgewogenen Kader, dem die Qualifikation für die Champions League zuzutrauen war. »Kloppo wollte zuerst nicht nach Dortmund, er wollte nach Leverkusen«, erzählt Heidel. »Ich habe ihm gesagt, er muss nach Dortmund, schon wegen der starken Emotionen dort. Er hatte ein Gespräch mit Wolfgang Holzhäuser, dem Sprecher der Geschäftsführung von Bayer. Die konnten sich nicht entscheiden … dann hat sich Dortmund gemeldet. Aber am Anfang war sich Kloppo nicht sicher.«
Auch die Gehaltsfrage zog sich ein wenig in die Länge, ergänzt Heidel schmunzelnd. »Eine lustige Geschichte. Als Dortmund ihm das erste Angebot gemacht hat, hat Kloppo mir gesagt: ›Du, die bieten weniger an, als ich in Mainz hatte.‹ Da habe ich gesagt: ›Keine Sorge, ich helfe dir.‹ Die Dortmunder konnten sich im Traum nicht vorstellen, dass er bei uns so viel verdient. Dann meldet sich der Watzke wieder: ›Was verdient der denn bei euch?‹ Darauf habe ich gesagt: ›Der verdient richtig Geld bei uns, er ist der wichtigste Mann. Eher würde ich bei einem Spieler sparen.‹ Watzke wollte das erst überhaupt nicht glauben. Dann haben sie sein Gehalt aufgestockt.« Klopp unterschrieb am Freitag, dem 23. Mai, morgens im Lennhof-Hotel in Dortmund einen Zweijahresvertrag und wurde um 11 Uhr im Stadion öffentlich vorgestellt.
Die Borussia hatte mehr als nur finanzielle Anreize zu bieten. Mit Josef Schneck beschäftigte sie beispielsweise einen Mediendirektor, mit dem Klopp sehr gut auskam. »Wir haben uns schon im April 2004 bei einer Veranstaltung in Köln kennengelernt«, erzählt Schneck. An diesem Abend wurde Klopp der Fairness-Preis des Verbands Deutscher Sportjournalisten verliehen als Anerkennung für sein sportliches Verhalten während des nervenaufreibenden Schlussspurts und der Nicht-Aufstiege in den beiden vorangegangenen Spielzeiten. Matthias Sammer, der damalige Trainer von Borussia Dortmund, sollte die Laudatio halten. »Wir sind mit Matthias und seiner Frau Karin hingefahren und saßen mit Klopp an einem Tisch. Es war ein sehr netter Abend«, erinnert sich Schneck.
»Ich kannte Jürgen auch von Pressekonferenzen nach den Spielen gegen Mainz«, fährt Schneck fort. »Einmal hat Mainz unter Klopp in Dortmund 1 : 1 gespielt. Und wie selbstverständlich gehe ich hin und sage ›Herzlichen Glückwunsch‹. Da guckt er mich an und sagt: ›Ja, dir auch.‹ Das war so ein echter Klopp. Und nachdem er hier angekommen war, während seiner ersten Wochen im Verein, hat er einmal scherzhaft zu Michael Zorc gesagt: ›Ich konnte mich lange nicht entscheiden, ob ich hier unterschreiben soll. Aber ihr habt einen anständigen Pressesprecher, da konnte der Verein ja so schlecht nicht sein.‹«
Dazu kam, dass nur wenige Vereine auf solch leidenschaftliche Anhänger zählen konnten. Die berühmte »Gelbe Wand« im Signal Iduna Park, die größte Stehplatztribüne Europas mit knapp 25 000 Plätzen, bringe die Fußballleidenschaft zum Ausdruck, die in ihm brenne, erklärte Klopp den Reportern bei seiner Vorstellung als Trainer. »Wer schon einmal da unten auf dem Platz gespielt hat, der weiß, dass die Gelbe Wand etwas ganz Besonderes ist, mit das Eindrucksvollste, was man im Fußball findet. Es ist für mich eine Ehre, Trainer des BVB zu sein und dem Verein dabei zu helfen, wieder richtig in die Spur zu kommen. Ich habe eine Riesenlust, hier mit der Arbeit anzufangen.« Ob es ein großer Schritt für ihn sei vom Karnevalsverein Mainz 05 zu einem der traditionellen Schwergewichte der Liga, wollte ein Journalist wissen. »Wir sind in Mainz nicht von einer Prunksitzung zur nächsten geschwankt«, antwortete Klopp und lächelte. »Wir haben mit großer Disziplin gearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass ich gut vorbereitet bin.«
In der Stadt kursierten Gerüchte, dass einige der Sponsoren, die an der Sanierung des Vereins beteiligt waren, auf einen bekannteren Trainer gehofft hätten, einen großen Namen mit internationaler Zugkraft.
Klopp, der wahrscheinlich über diese Bedenken informiert war, trug bei seiner Vorstellung ein Jackett. Aber keine Krawatte. Still und heimlich habe er in den vergangenen Monaten an der Aufwertung seiner Garderobe gearbeitet, schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Klopps temperamentvolle Ausdrucksweise passte jedoch exakt zu der in dieser Arbeiterregion tief verwurzelten Liebe zum Fußball als ausgelassene Unterhaltung, als identitätsstiftende Kraft und als quasi-religiöses Erlebnis.
»Es geht immer darum, den Zuschauern Spaß zu bereiten, es geht darum, Spiele mit einem unverwechselbaren Stil zu bieten«, bekannte er. »Wenn die Spiele langweilig sind, verlieren sie ihre Berechtigung. Rasenschach hat noch keine meiner Mannschaften gespielt. Ich hoffe, wir kriegen hier die Gelegenheit, öfter richtig Vollgas zu geben. Die Sonne wird nicht jeden Tag scheinen in Dortmund, aber wir haben die Chance, dafür zu sorgen, dass sie öfter scheint.« Fußballreporter Freddie Röckenhaus von der Süddeutschen Zeitung war beeindruckt von diesem forschen Optimismus. Wenn Klopp die Mannschaft so trainiere, wie er rede, dann werde Dortmund bald reif sein für die Champions League, schrieb er. »Klopp hat genau 45 Minuten einer Pressekonferenz gebraucht, um die BVB-Fans mit seinem ansteckenden Funkeln und seiner Schlagfertigkeit im Sturm zu erobern. Wenn man je das Gefühl haben konnte, dass die Mentalität eines Trainers zur fußballverrückten Ruhrpott-Metropole Dortmund passt, dann bei Klopp.«
Die Begeisterung beschränkte sich nicht auf die Anhänger der Borussia. Auf der persönlichen Homepage von Klopp bekundete ein Besucher seine Zustimmung. »Es ist toll, dass Sie zum BVB kommen«, schrieb er. »Dieser Klub ist zwar gar nicht mein Verein, aber ich besitze viele seiner Aktien. Da ich großes Vertrauen in Sie und Ihre Fähigkeiten habe, freue ich mich schon darauf, bald mehr Geld in der Tasche zu haben.« Das Vertrauen des anonymen Anlegers sollte sich als berechtigt erweisen. Dortmunds Aktienkurs stieg um 132 Prozent: von 1,59 Euro am 23. Mai 2008 auf 3,70 Euro am Tag von Klopps Abschied, sieben Jahre später.
4Der Weg nach Anfield
Liverpool 2012–2015
Am 11. April 2014 traf sich Jürgen Klopp gegen 22 Uhr mit Hans-Joachim Watzke zu einem Drink im Münchner Park Hilton Hotel und teilte ihm mit, dass er sich entschlossen habe. Er werde bleiben.
Bis vor ein paar Stunden, bis zum Abflug der Mannschaft zu einem Spiel gegen den FC Bayern in der Allianz Arena in München war Klopp noch uneins mit sich selbst gewesen. Ihm lag ein verlockendes, höchst lukratives Angebot aus dem Nordwesten von England vor, es war die Chance, einen der berühmtesten Fußballklubs der Welt zu übernehmen und umzubauen. »Wir haben uns freitagmorgens bei mir in der Küche getroffen«, erzählt Watzke. »Und das war, ohne Einzelheiten zu nennen, ein ganz interessantes Gespräch. Am Nachmittag im Flieger hat Klopp dann gesagt: ›Wir müssen uns heute Abend noch treffen.‹ … Meine Tochter studierte damals in München, ich habe mich mit ihr zum Abendessen verabredet, und deshalb konnte ich ihn erst um 22 Uhr treffen. Da hat er dann sofort gesagt: ›Ich kann mit diesem Druck nicht mehr leben. Ich habe denen abgesagt.‹«
Kurz zuvor war Ed Woodward, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Manchester United, nach Deutschland geflogen, um mit Klopp zu sprechen. Die kurze Amtszeit von David Moyes in Old Trafford näherte sich dem Ende, und Klopp war der Wunschnachfolger der Verantwortlichen. Sie trauten ihm zu, dass er dem Spiel der »Red Devils« wieder mehr Biss verleihen würde. Woodward erklärte Klopp, dass das Theater of Dreams, das Theater der Träume, wie das Stadion auch genannt wird, »eine Art Disneyland für Erwachsene« sei, ein mythischer Ort, an dem erstklassige Unterhaltung geboten werde und Träume wahr werden würden. Klopp war nach diesem Verkaufsgespräch nicht überzeugt – er fand das Ganze ein bisschen »unsexy«, wie er gegenüber einem Freund erklärte –, doch er lehnte das Angebot nicht sofort ab. Nach knapp sechs Jahren als Trainer von Dortmund war es vielleicht an der Zeit, den Arbeitsplatz zu wechseln.
Da Watzke wusste, dass die Engländer Interesse zeigten, wollte er von Klopp die Erfüllung seines Vertrages verlangen, der erst im vorhergehenden Herbst bis 2018 verlängert worden war. Er spürte allerdings, dass der 46-jährige Trainer mit sich rang, und entschied sich für eine sehr riskante Strategie. Wenn Klopp zu Manchester United gehen wolle, werde er ihm nicht im Weg stehen, erklärte er und setzte dabei auf das gegenseitige Vertrauen und eine Verbundenheit, die sich schon seit langem über den geschäftlichen Rahmen hinaus zu einer Freundschaft entwickelt hatte. Nach längerer Überlegung – und dem Gespräch an Watzkes Küchentisch – kam Klopp zu dem Schluss, dass seine Mission im Signal Iduna Park noch nicht zu Ende war.
Manchester United aber glaubte, es gebe noch immer die Möglichkeit, ihn wegzulocken. Als David Moyes am 22. April von seiner unvermeidlichen Entlassung erfuhr, avancierte Klopp bei den Buchmachern schnell zum Favoriten für die Nachfolge des Schotten. Die hartnäckigen Spekulationen in den englischen Medien veranlassten den Schwaben, am nächsten Tag über die Zeitung The Guardian eine Erklärung abzugeben, die den Gerüchten den Boden entzogen. »Manchester United ist ein toller Verein, und ich fühle mich seinen wunderbaren Fans eng verbunden«, schrieb er, »aber meine Verpflichtung gegenüber Borussia Dortmund und den Menschen dort ist unerschütterlich.«
Dennoch zog Klopp weiterhin das Interesse der englischen Premier League auf sich. Ein halbes Jahr nachdem er Woodwards Angebot abgelehnt hatte, unternahm Manchester City, der Lokalrivale von United, einen Versuch. Auch Tottenham Hotspur erkundigte sich nach seinen Diensten. Zur selben Zeit nutzte Klopp ein Interview mit dem englischen Fernsehsender BT Sport vor dem Champions-League-Spiel Dortmunds gegen Arsenal, um seine langfristigen Absichten bekanntzugeben. Auf die Frage, ob er nach England kommen werde, wenn seine Zeit bei Borussia Dortmund vorüber sei, gab er eine eindeutige Antwort: »Das ist das einzige Land, in dem ich arbeiten möchte, wenn ich aus Deutschland weggehe. Es ist das einzige Land, dessen Sprache ich ein bisschen beherrsche. Und ich brauche die Sprache für meine Arbeit. Also, man wird sehen. Wenn mich jemand anruft, werde ich mit ihm darüber reden.«
Das war ein klares Zeichen, erzählt Watzke. Dortmund erlebte seine erste – und einzige – schlechte Bundesliga-Saison unter der Leitung von Klopp, dass er in ein wesentlich regenreicheres Land wechseln könnte, erschien plötzlich wahrscheinlicher als jemals zuvor. »Für uns war die Saison bereits im Arsch, und man hatte so ein Gefühl …«, fährt Watzke fort. »Für mich war klar, dass er nach Dortmund zu keinem anderen deutschen Verein gehen würde, das hätte er nicht gekonnt. Aber sein Englisch hatte er schon ein bisschen aufpoliert. Das hatte ich ja beobachtet. Es war klar, dass es in die Premier League geht. Das ist auch genau sein Fußball, der da gespielt wird.«
Der Fußballromantiker Klopp war seit langem ein glühender Anhänger der echten, intensiven und kampfbetonten Variante dieses Sports, die auf der anderen Seite des Kanals gespielt wird. Als Trainer von Mainz hatte er 2007 im Wintertrainingslager in Spanien Nick Hornbys Buch Fever Pitch verschlungen (und vor einer Fernseh-Crew eine Eidechse mit der Zahnbürste durch sein Zimmer gejagt); seine Begeisterung für diese Art von leidenschaftlichem Fußball wie auch die Idee, dass sich seine Mannschaften von der Energie einer begeisterten Zuschauermenge mitreißen lassen sollten, stammten aus dem Mutterland des Fußballs. In Mainz wie auch in Dortmund intonierten die Zuschauer passable Versionen von »You Never Walk Alone« und erzeugten eine emotionsgeladene Atmosphäre, die unmittelbar von (idealisierten) englischen Traditionen inspiriert war. »Ich mag das, was wir in Deutschland als ›englischen Fußball‹ bezeichnen: ein regnerischer Tag, ein schwerer Platz, alle sind schmutzig im Gesicht, und dann gehen alle nach Hause und können die nächsten vier Wochen nicht mehr spielen«, sagte Klopp dem Guardian 2013. In dem Jahr hatte seine junge Dortmunder Mannschaft die europäische Elite aufgemischt und war bis in das Finale der Champions League gestürmt, während Klopp eine Baseballmütze trug, auf der die Aufschrift »Pöhler« prangte – im Ruhrpottjargon eine Bezeichnung für jemanden, der Fußball auf die alte Art spielt: »am Sonntagmorgen auf einem Grasplatz, einfach nur, weil man das Spiel liebt«.
Fast genau ein Jahr nachdem Klopp Manchester United einen Korb gegeben hatte, zeigte sich, dass seine Verbundenheit mit Dortmund nicht gänzlich unerschütterlich war. Er gab bekannt, dass er nach der Saison 2014/15 seinen Abschied nehmen werde, und machte zugleich klar, dass er nicht die Absicht habe, eine Auszeit einzulegen.
In einer Jugendstilvilla im grünen Bremer Stadtteil Schwachhausen läutete einige Wochen nach Beginn der folgenden Saison in der englischen Premier League häufiger das Telefon. Als sich die Zeit von Brendan Rodgers in Anfield ihrem Ende näherte, nahmen mehrere Leute mit Klopps Agenten Marc Kosicke Kontakt auf und boten ihm an, Klopp bei Liverpool ins Gespräch zu bringen. Einer der Anrufer, ein deutscher Spielervermittler, erzählte, er kenne Kenny Dalglish sehr gut. Kosicke aber wollte lieber noch ein bisschen warten. Schließlich rief ein Mann an, der sich als Ian Ayre vorstellte, der Geschäftsführer des FC Liverpool. Er fragte, ob man über einen möglichen Wechsel von Klopp an die Anfield Road sprechen könne. Das könne man, erwiderte Kosicke, aber bitte in einem Videotelefonat über Skype. Als Ayre auflegte, um erneut über Skype anzurufen, suchte Kosicke schnell nach Fotos der Verantwortlichen in Liverpool. Um sicherzugehen. Es gibt genügend Witzbolde und Leute, die einem die Zeit stehlen wollen.
»Wer einmal in Dortmund Trainer war, wohin kann der noch gehen?«, fragt Martin Quast, der seit den 1990er Jahren mit Klopp befreundet ist. »In Deutschland kommt für Klopp nur noch die Nationalmannschaft in Frage. Alles andere wäre ein Abstieg. Selbst der FC Bayern. Weil der Kloppo so tickt. Das Emotionale und diese Empathie, dieses Mitreißende, dieses Mitnehmen. Im Vergleich zu Dortmund kann Bayern das nicht bieten. Ich konnte mir nur vorstellen, dass er so einen Klub nimmt, einen Klub wie Liverpool.«
Christian Heidel erzählt, dass Klopp nur in einer Hinsicht Bedenken hatte: wegen seiner Englischkenntnisse. »Ich habe lange mit ihm darüber gesprochen. Er hat mich gefragt: ›Soll ich das machen?‹ Ich habe gesagt: ›Deine Stärke ist deine Sprache. Du musst jetzt für dich entscheiden, ob du das, was für dich wichtig ist, auf Englisch rüberbringen kannst. Wenn du andere für dich sprechen lassen musst, dann wird es nicht funktionieren. Dann bist du nämlich nur zu siebzig Prozent Klopp.‹ Und darauf hat er geantwortet: ›Das kriege ich hin. Es wird jetzt gepaukt, das krieg ich hin.‹ Und da er ja sehr intelligent ist, hat er das sehr schnell auf die Reihe bekommen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt (als sich der FC Liverpool meldete) hätte kein anderer Verein kommen können. Für Liverpool hatte er sich schon immer interessiert … Das ist Emotion, das ist wie Dortmund. Ich glaube, er wäre nicht zu Manchester City oder einem anderem Klub gegangen, auch wenn die ihn unbedingt wollten.«
Klopps Name war in Anfield erstmals im Frühjahr 2012 zur Sprache gekommen, als die möglichen Nachfolger von Kenny Dalglish ins Auge gefasst wurden. Ein Mittelsmann setzte sich mit dem Dortmunder Trainer in Verbindung, doch ihm wurde unmissverständlich beschieden, dass Klopp nicht die Absicht habe, den Verein zu verlassen. Er war gerade dabei, ein historisches Double zu gewinnen.
Im September 2015 wurde die Sache dann sehr schnell wesentlich ernster. Der schlechte Saisonstart von Brendan Rodgers veranlasste die in Boston ansässige Fenway Sports Group (FSG), die Eigentümer des FC Liverpool, nach einem neuen Trainer Ausschau zu halten. »Wir haben an jemanden gedacht, der Erfahrung hatte und Erfolge auf höchstem Niveau«, erläutert Mike Gordon, der 52-jährige Chef von FSG. »Jürgen hatte das in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Er hatte das auch in der Champions League gezeigt, er war im Finale nur ganz knapp gescheitert. Ich glaube, allen war klar, dass er einer der besten Fußballtrainer ist, wenn nicht der beste überhaupt. Und uns gefiel die Art von Fußball, die er spielen ließ. Die Energie und der Offensivgeist, die Impulsivität, der attraktive Hochgeschwindigkeitsfußball. Aus fußballerischer Sicht war es eine relativ einfache und klare Entscheidung.«
Obwohl viel für Klopp sprach, nahm Gordon den Deutschen genauer unter die Lupe, um zu prüfen, ob der Hype um den Trainer eine objektive Grundlage besaß. »Ich habe versucht, seine Popularität in der Fußballwelt und sein Charisma außen vor zu lassen, um eine unvoreingenommene Analyse durchzuführen«, sagt der ehemalige Hegdefondsmanager, der als Junge Popcorn bei Baseballspielen verkaufte. »Ich habe zusammen mit Leuten im Verein ausführliche Erkundigungen eingezogen, um festzustellen, wie er einzustufen ist, in rein analytischer und fußballerischer Hinsicht. Das ist eine ganz ähnliche Herangehensweise wie beim Investment-Geschäft, bevor man einen größeren Kauf tätigt. Ich freue mich sagen zu können – und das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch offensichtlich –, dass die Fakten uns noch viel stärker überzeugten als sein an sich schon enorm hohes Ansehen in der Fußballwelt.«
Gordons Recherchen ergaben, dass Klopps Arbeit in Mainz und Dortmund »einen eindeutig positiven Effekt« gehabt hatte, »und zwar in einem quantifizierbaren Sinn, im Verhältnis zu dem, was man üblicherweise hätte erwarten können«. Einfacher gesagt: Der Schwabe hatte alle Erwartungen übertroffen. Gerade das machte ihn für Liverpool interessant, einen Klub, der im Vergleich zu seinen finanzkräftigeren Rivalen in der Premier League auf den effizienteren Einsatz seiner Ressourcen achten musste. »In fußballerischer Hinsicht war die Sache ziemlich eindeutig«, erklärt Gordon. »Aber ich wusste natürlich nicht, ob die Philosophien und die Persönlichkeiten – des Klubs und von Jürgen – zusammenpassen würden. Sie mussten miteinander harmonieren. Wir mussten auch wissen, ob Jürgen bereit war, den Kurs von Liverpool mitzutragen. Das waren wichtige Dinge, die geklärt werden mussten.«
Für den 1. Oktober wurde ein Treffen in New York vereinbart. Klopps und Kosickes Bemühungen um Geheimhaltung waren nicht sonderlich erfolgreich. In der Lufthansa-Lounge am Münchner Flughafen fragte einer der Mitarbeiter Klopp – dessen Baseballkappe nur bedingt als Tarnung taugte –, warum er nach New York fliege. »Wir wollen uns ein Basketballspiel anschauen«, antwortete er. Eine durchaus plausible Erklärung – abgesehen von der Tatsache, dass die NBA-Saison erst in vier Wochen begann.
Wenige Stunden nach ihrer Ankunft in Manhattan flogen die Deutschen abermals auf. Wie es der Zufall wollte, stammte der Mitarbeiter an der Hotelrezeption aus Klopps Fußballheimat. »Meine Güte, der Kloppo!«, entfuhr es dem Mann in breitem Mainzer Dialekt. Dennoch drang die Nachricht von der geheimen Reise nicht an die Öffentlichkeit.
John W. Henry, der Hauptanteilseigner von FSG, und Tom Werner, der Präsident des FC Liverpool, empfingen Klopp und seinen Agenten im Büro der Anwaltskanzlei Shearman & Sterling in der Lexington Avenue im Osten der Stadt. »Mein erster Eindruck war, dass er ziemlich groß ist. Im Gegensatz zu mir«, erzählt Gordon und lacht. »Es war schon reichlich spät, aber wir hatten ein ausführliches und fundiertes Gespräch, dann haben wir uns für den nächsten Tag verabredet und im Hotel ein weiteres Gespräch geführt. Ich möchte betonen: Das waren Gespräche, in denen beide Seiten ihre Vorstellungen eingebracht haben. Es ging darum, ob Jürgen der geeignete Trainer für den FC Liverpool war und ob der FC Liverpool und wir als Eigner der richtige Partner für Jürgen waren.« Wie erwartet entsprach Klopps Charisma seiner Statur (»er nutzt seine persönlichen Fähigkeiten und seine Art, auf Menschen zuzugehen, um seine Botschaft rüberzubringen«), doch was Gordon am meisten beeindruckte, war die »enorme Substanz«, die er hinter dem breiten Lächeln und der übergroßen Persönlichkeit entdeckte.
»Es war nicht so, dass man gedacht hätte: ›Mensch, dieser Bursche ist ja wirklich beeindruckend, er wird eine tolle Figur abgeben bei Pressekonferenzen und als Repräsentant eines Klubs.‹ Vielmehr zeigte sich sehr schnell die Vielschichtigkeit seines Talents: Da ist nicht nur die persönliche Seite, sondern auch die Intelligenz, das analytische Denken, die Logik, die Klarheit und Aufrichtigkeit, seine Fähigkeit, effizient zu kommunizieren, obwohl Englisch nicht seine Muttersprache ist. Diese Seite von ihm wird wahrscheinlich nie richtig gewürdigt, weil die Leute so stark von ihm als Person eingenommen sind.«
Klopp erklärte den Verantwortlichen des FC Liverpool, dass Fußball »mehr als ein System« sei, sondern immer auch »Regen, intensive Zweikämpfe, der Lärm im Stadion«. Am wichtigsten sei es, führte er aus, das Publikum in Anfield durch die Art der Darbietung »zu aktivieren«, das Team anzufeuern und dadurch einen sich selbst verstärkenden Kreislauf der Begeisterung zu erzeugen.
Gordon erzählt: »Es war schwer, bei ihm auch nur irgendeinen Schwachpunkt zu finden, wirklich wahr. Was ich damit sagen möchte: Es war klar, dass sich Jürgen als Fußballtrainer auf dem gleichen Niveau bewegte wie ein Unternehmenschef, wie ein Mann, dem man gern die Leitung einer Firma anvertrauen würde. Ich sage das als jemand, der 27 Jahre als Investor tätig gewesen ist und mit vielen Top-Unternehmensführern und Managern in Amerika und Europa zu tun hatte. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass er der Richtige war. Also beschlossen wir, über die Konditionen zu sprechen, aber da hat sich Jürgen verabschiedet.«
Während Kosicke die Gehaltsverhandlungen führte, machte Klopp einen Spaziergang im Central Park. Der Ausflug ins Grüne dauerte länger als erwartet. Die beiden Seiten waren zunächst finanziell weit auseinander, aber nach einer Weile wurde der Rahmen für einen Vertrag gefunden.
Als Klopp nach Deutschland zurückgekehrt war, schickte ihm Gordon eine SMS. »Worte können nicht ausdrücken, wie sehr wir uns auf die Zusammenarbeit freuen«, schrieb er. Klopp entschuldigte sich, dass auch er nicht die richtigen Sätze parat hatte. Er kannte jedoch ein Wort, das seine Gefühle zum Ausdruck brachte: »Woooooooooooow!!!«
5In den Fußstapfen des Vaters
Im Sommer 1940 endeten die Schulbesuche für Norbert Klopp. Sein Vater Karl, der sich als Tagelöhner auf Bauernhöfen und Weinbergen im Umkreis der Stadt Kirn in Rheinland-Pfalz verdingte, brauchte den Sechsjährigen – den einzigen Sohn in einer Familie mit vier Kindern – als Helfer bei der Arbeit.
Das Beackern der fruchtbaren Böden im Südwesten hielt die Familie Klopp in den dunkelsten Jahren Deutschlands am Leben. Auch der berühmteste Fußballverein dieser Region, der 1. FC Kaiserslautern, war noch auf die regionalen Erzeugnisse angewiesen, als 1945 die Sonne wieder zu scheinen begann. Die »Roten Teufel«, die den berühmten und erst vor kurzem aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Fritz Walter in ihren Reihen hatten, bestritten eine Vielzahl von Freundschaftsspielen gegen Dorfvereine, wofür sie Kartoffeln und Zwiebeln als Gegenleistung erhielten.
Norbert Klopp wollte Fußballer werden. Wer wollte das nicht? Er war schon als junger Mann 1,91 Meter groß und zu einem starken, reaktionsschnellen Torwart herangewachsen. Er spielte beim örtlichen VfR Kirn, einem der besten Fußballklubs in der Region, und dank seines Talentes wurde er 1952 zu einem Probetraining bei Kaiserslautern eingeladen. »Ich war schon sehr beeindruckt«, erzählte der damals 18-Jährige später Ulrich Rath, einem Freund der Familie. »Ich stand mit all diesen legendären Spielern auf dem Platz.« Lautern war in der vorhergehenden Saison Deutscher Meister geworden und sollte den Titelgewinn 1953 wiederholen. Fünf ihrer Spieler – Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Liebrich, Horst Eckel und Werner Kohlmeyer – wurden 1954 in die deutsche Nationalmannschaft berufen, die in Bern den Weltmeistertitel errang.
Norbert Klopp konnte trotz seines beachtlichen Könnens nicht ganz mithalten. Beim VfR Kirn, der in die (damals noch regional aufgeteilte) erste Liga aufgestiegen war und gegen Mannschaften wie Kaiserslautern und Mainz 05 spielte, kam er an Alfred Hettfleisch nicht vorbei, der Nummer eins im Tor. Als Reservetorwart von Kirn wurde Klopp der neugeschaffene Status eines Vertragsamateurs angeboten, durch den in Westdeutschland der Berufsfußball eingeführt wurde, ohne jedoch so bezeichnet zu werden. Bei einem monatlichen Grundgehalt von 40 bis 75 D-Mark waren die Spieler stark auf Siegprämien angewiesen (die zwischen 10 und 40 D-Mark betrugen). Klopp hatte aber kaum Chancen, diese zu beziehen: Auswechslungen waren damals nicht erlaubt, und er schaffte nie den Sprung in die erste Mannschaft. Er spielte weiter in der Reservemannschaft gegen andere Amateure, aus reiner Freude am Sport.
Karl Klopp bestand darauf, dass der Junge einen »richtigen Beruf« lernte. Norbert begann eine Lehre bei Müller & Mairer, einem kleinen lederverarbeitenden Betrieb. Ungefähr die Hälfte der Einwohner von Kirn, etwa 5000 Menschen, arbeiteten Anfang der 1950er Jahre im Leder- und Gerbereigewerbe, als das deutsche Wirtschaftswunder zu einer raschen Verbesserung der Lebensverhältnisse führte. »Ein Lederarbeiter verdiente zwischen 250 und 300 D-Mark im Monat, das war damals ein sehr guter Job«, erzählt Horst Dietz (80), der in derselben Abteilung wie Norbert Klopp arbeitete und eine Reihe hinter ihm saß. Eine Reihe bestand aus drei Personen: einem Lehrling, einem »Kleber« (oft ein junges Mädchen) und einem Gesellen, und in jedem Raum gab es zwanzig Reihen, die jeweils von einem Meister überwacht wurden, der vorne stand. Es war teilweise Fließbandarbeit: Jede Reihe produzierte am Tag bis zu hundert Brieftaschen, Geldbörsen oder ähnliche Erzeugnisse; die Arbeitszeit dauerte von 7 Uhr früh bis 17 Uhr nachmittags, mit einer Stunde Mittagspause.
Das Dachgeschoss im Haus von Horst Dietz in Kirn gleicht einer Sportkneipe. Gerahmte Trikots und Pokale aus seiner Spielerzeit beim VfR Kirn reihen sich an den Wänden; es gibt ein Foto von ihm mit Franz Beckenbauer, einen großen Bildschirm zum Fußballschauen und eine Bar. Dietz lebte als junger Mann auf dem Land, die Familie Klopp wohnte in der Stadt. Norbert nahm ihn an den Werktagen oft zum Mittagessen mit zu seiner Familie. »Er war wie ein großer Bruder für mich. Die Klopps waren damals eine bekannte Familie in Kirn, aber sie führten ein normales Leben«, erzählt Dietz. »Strebsam zu sein war einer ihrer Grundsätze.« Es war üblich, dass man Arbeit, die während der Arbeitszeit nicht fertig geworden war, abends mit nach Hause nahm. »Die haben wir allerdings oft an die Oma weitergegeben, weil wir Fußball spielen wollten oder in der Stadt unterwegs waren. Wir haben uns ja auch für Mädchen interessiert mit 14, 15 Jahren«, sagt er und lächelt. Im Unterschied zum drei Jahre älteren Klopp schaffte es Dietz, als Stürmer in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen, und spielte ein paar Jahre in der zweithöchsten Spielstaffel, bevor er eine Arbeitsstelle bei Coca-Cola antrat. »Norbert war sehr ehrgeizig, wollte immer ganz weit nach oben«, erinnert sich Dietz. »Er war ein Draufgänger, nicht nur im Sport. Ein charismatischer Typ, der in einen Raum kam und schnell alle für sich einnahm. Er war ein Typ voller Energie und Charme. Ein richtiger Frauenschwarm. Wir haben uns oft den ganzen Tag lang über Fußball unterhalten.«