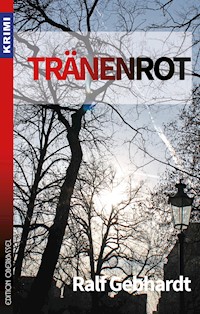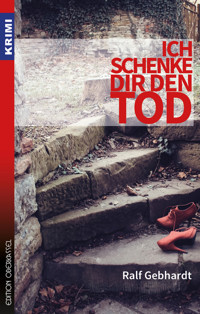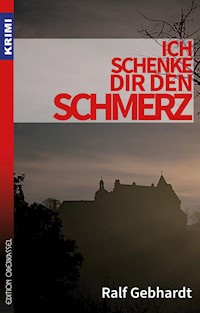
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition oberkassel
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Böse ist zurück und zwingt mit Entführungen, Folter und Tod den halleschen Kriminalhauptkommissar Richard Störmer auf eine gnadenlose Jagd durch das Mansfelder Land. Ohne zu wissen, dass sich der Psychopath mit einer Bestie verbündet hat, muss Störmer gleichzeitig ein Rätsel um die unbekannte Macht einer noch aktiven DDR-Seilschaft der Staatssicherheit lösen. Als der Kommissar selbst zur Zielscheibe wird, läuft die Zeit davon …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ich schenke dir den Schmerz
Ralf Gebhardt
#MitteldeutschlandKRIMI
edition oberkassel
Inhaltsverzeichnis
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
EPILOG
DANKSAGUNG
Dank an die LeserInnen
Ralf Gebhardt
Impressum
Landmarks
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch ist ein Werk der Fantasie.
Die nachfolgenden Figuren und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten sowie lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. Bei Orten und Örtlichkeiten habe ich mir die Freiheit genommen, sie den Erfordernissen der Geschichte anzupassen.
EINS
Es wurde schlimmer. Irgendwann hörte sie auf, ihre Beine zu spüren. Die Mischung aus eisigem Wind, Nebelregen und dem Quietschen der Fahrradpedale hatten Sandra zermürbt. Über den Punkt, aufzugeben, war sie längst hinweg. Wegen Malika. Ihr Gehirn schaltete in einen Überlebensmodus und ihr Körper gehorchte wie eine Maschine.
Sie traute sich nicht, nach hinten zu fassen, um Malikas Stirn zu berühren. Ihre Angst war groß, dass sie gleich an Ort und Stelle zusammenbrechen könnte. Malika strahlte spürbar Hitze aus. Die Kleine hatte extrem hohes Fieber.
Dabei hatte heute alles so gut angefangen. Es sollte ihr Tag werden, ihr Geburtstag, der vierte. Wie Malika sich darauf gefreut hatte. Nicht Party, nein, Riesenfeier bei Oma und Opa hatte sie es genannt. Mit vielen Spielen, Girlanden, Luftballons und ihren Freunden.
Sandra hatte nur eine Wohnung in der Stadt. Sie war froh, dass ihre Großeltern so vernarrt in Malika waren. Und eigentlich hatte sie selbst keine Zeit gehabt, den Kindergeburtstag vorzubereiten. Leider gab es keinen Mann an ihrer Seite, der sich für sie oder Malika interessierte. Sie kannte weder Malikas noch ihren eigenen Vater. In all den Jahren war sie auch deswegen eine Fremde, eine Außenstehende in der Familie geblieben. Sie fühlte sich nicht wohl in der Rolle als Alleinerziehende. Es schmeckte bitter, wenn sie daran dachte. Aber Malika sollte davon nichts spüren.
Deshalb also die Feier im Garten. Heute waren sie nur mit dem Fahrrad da, Malika würde später im Bett bei Oma und Opa schlafen, sie selbst mit dem Rad nach Hause fahren. Das Holzhaus war zu klein, um auch dort zu übernachten.
Das Wetter spielte mit und der Geschenketisch war riesig. Jedes neue Päckchen wurde aufgeregt entgegengenommen und im Jubel der anderen geöffnet. Das Kuchenbuffet war gigantisch. Sandra war sich allerdings nicht sicher, ob die Großmutter extra weiche Schokolade für die Glasur verwendet hatte. Die Kinder sahen umso lustiger aus, verschmiert, glücklich.
Am späten Nachmittag wurde Malika auffällig ruhiger. Fast schien es, als würde sie sich zurücklehnen, um den Rummel um die eigene Person zu genießen. Schließlich spielte sie nicht mehr mit, saß nur noch auf der Gartenschaukel. Sie fror, aber ihr Glück hatte ein bleibendes Lächeln über ihr Gesicht gelegt. Sandra war hin und her gerissen, einerseits beunruhigt, andererseits abwartend. An einem Tag wie heute wollte sie ihre Tochter nicht mit Fragen quälen. Sie fühlte sich beobachtet und versuchte, ihre Besorgnis zu verbergen. Sonst kuschelte Malika eher nicht, wenn andere es sehen konnten. Diesmal suchte sie ihre Nähe, gab ihr einen Kuss und hielt ungewöhnlich lange ihre Hand.
Gegen Abend, als es schon dunkel wurde und die Gäste gingen, hatte sie bereits zwei Hosen und vier Pullover an. Ihre Füße steckten in selbstgestrickten Socken.
»Mama, mir ist immer noch so kalt, können wir nach Hause?« Sie war blass. Dunkle Ringe hatten sich unter den Augen gebildet. Als Sandra die Stirn ihrer Tochter berührte, schrak sie zurück. Malika hatte Fieber.
»Schatz, du wolltest doch bei Oma und Opa schlafen, oder?«
»Ja, aber jetzt nach Hause, zu Waldi.« Sie griff beide Hände und sah ihre Mutter mit großen Augen an. Sie wusste genau, was sie tun musste, um ihren Willen zu bekommen.
»Schau mal, Prinzessin, es ist schon spät und dunkel. Lass uns hier schlafen, du darfst auch zu Oma und Opa ins Bett, ja?« Sie hatte diesen Satz ausgesprochen, ohne darüber nachzudenken, was wohl die Großeltern, eigentlich ihre Pflegeeltern, dazu sagen würden. Fragend blickte sie zu ihnen hinüber und sprach weiter. »Bitte, Schatz, der Wind zieht auf, vielleicht gibt es Regen. Wir sind ja heute nur mit dem Fahrrad da.«
Sandra hatte geplant, allein mit dem Rad nach Hause zu fahren und morgen dann zum Feierabend mit dem Auto zurückzukommen.
Doch das Flehen half nicht.
»Zu Waldi, ja?«
Waldi war ihr liebstes Kuscheltier, größer als sie selbst, eine Mischung aus Bär und Förster, dick, weich und kuschlig. Und im Laufe der Zeit schon ziemlich verfilzt.
»Malika …«
»Bitte, bitte, Mama, zu Waldi!«
Sandra sah zuerst auf ihre Uhr und dann zum Himmel. In der Zwischenzeit war die Nacht fast vollständig heraufgezogen. Es bereitete ihr Unbehagen, als sie an die Strecke durch den Stadtwald dachte. Und außerdem hätte sie die ganze Zeit die kranke Malika hinter sich im Kindersitz.
In diesem Moment legte der Großvater seine Hand auf Sandras Schulter. Er gab ihr eine Mütze für die Tochter und eine Taschenlampe. Sein Nicken sollte beide aufmuntern. Malika lächelte müde ihren Opa an, sie wusste die Geste zu schätzen. Er hätte sie wohl gern nach Hause gebracht, früher, als er noch gesund genug war, um Auto zu fahren.
Notgedrungen willigte Sandra ein. »Okay, dann wickelst du dich aber in eine Decke und gibst Ruhe da hinten, ja? Nimm Opas Lampe und pass schön auf unterwegs.« Sie war keinesfalls beruhigt, auch wenn sie ahnte, dass die Kleine gleich einschlafen würde.
Nach einem kurzen Abschied radelten sie los. Malika war tatsächlich schnell eingeschlafen. Ihre Hände krallten sich in die Wolldecke und zuckten ab und zu. Später fing sie an, zu fantasieren. Das Fieber stieg.
Noch schneller hatten sich die Wolken vor den lilaschwarzen Himmel geschoben. Dann die ersten Schauer. Noch bevor sie das Ende des Dorfes erreichten, zog Nebel auf und bildete dicke Schichten. Es wurde immer schwerer, die Straße zu erkennen. Sandra versuchte, stärker in die Pedalen zu treten. Trotzdem bekam sie kalte Hände. Das feuchte T-Shirt klebte unangenehm.
Der funzelig-schwache Lichtkegel des Fahrrades jagte ihr bei jeder Unebenheit Angstschauer über den Rücken. Es gab kein anderes Licht, nicht einmal den Schein des Mondes. Oft konnte sie den Weg nur erahnen. Als sie kurz vor der Kreuzung zum Waldweg hinter sich greifen und nach der Taschenlampe tasten wollte, traf sie eine Windböe. Nur mit Mühe und unter Nutzung der gesamten Straßenbreite gelang es ihr, einen Sturz zu vermeiden.
Ihr Körper zitterte wegen der Überanstrengung, ein Krampf wanderte durch ihre Arme. Sie hatte sich auf Zunge und Lippe gebissen. Das Blut vermischte sich mit dem Regen, tropfte eine mahnende Spur auf Jacke und Hose. Aufgeben und schieben war keine Option, dazu war es noch zu weit. Sie trat stärker, in der Hoffnung, dass sich das Rad stabilisierte. Es funktionierte. Meter für Meter. Sie wusste, dass der Weg später nicht mehr anstieg. Jetzt galt es, tapfer zu sein, sich zusammenzureißen.
Die Schauer verwandelten sich in Dauerregen. Eine erneute Böe schlug ihr Äste ins Gesicht. Sie schrie auf. Im nächsten Moment wurde die getroffene Stelle angenehm warm. Regentropfen und Tränen konnte sie nicht mehr unterscheiden. Der Schmerz war nichts im Gegensatz zu dem in ihren Beinen. Hysterisch lachte sie auf. Erst als das Adrenalin nachließ, bemerkte sie ihre Schwäche.
Wann hatte sie eigentlich das letzte Mal so geweint?Sie schluchzte, weinte und betete leise zu Gott. Für Malika. Und für sich, damit sie die Kleine nach Hause bringen konnte. Ihr fester Glaube war es, der sie antrieb, weiterzutreten, Umdrehung für Umdrehung.
Sie wusste nicht genau, ob sie bereits die Hälfte der Strecke geschafft hatte, als ein gewaltiger Blitz die Nacht zerriss. Alles um sie herum zeichnete sich in einer Mischung aus Grellrot, Blau und Weiß gegen den Himmel ab, als wäre die Landschaft in einem Feuerfoto eingefroren.
Malika hatte die Helligkeit wohl unbewusst wahrgenommen, sie wimmerte. Dieses Wimmern durchbrach die erschöpfte Schockstarre ihrer Mutter und verhinderte, dass sie stürzten. Warum, Gott, warum? Sandra betete. Es klang wie eine Hymne, immer wieder von Weinen und Schreien durchsetzt. Aber es hörte sie sowieso niemand und irgendwann hatte sie schließlich auch keine Tränen mehr.
Als sie das letzte Zeitgefühl verloren hatte, kamen sie endlich an die Stelle, von der an es nur noch bergab ging. Der Wald trat in den Hintergrund, die Wege wurden schmaler, aber besser. Sandra war erleichtert, wusste, dass sie es schaffen konnte, trotz der dunkelgrauen Nebelschwaden und des Regens. Falls sie durchhielt. Alle Gebete, die sie kannte, waren längst gesprochen. Jetzt sang sie Kinderlieder. Auch wenn sie sich nun getraut hätte, nach hinten zu fassen, um Malikas Stirn zu fühlen, es wäre nicht gegangen. Sie war viel zu schwach, um die Hände vom Lenker zu nehmen. Sie hoffte, dass kein Gegenverkehr kam, denn dann wäre sie gezwungen, auszuweichen.
Als sie über eine Brücke in eine enge Rechtskurve fuhr, bemerkte sie das Licht eines Scheinwerfers. Es kam von hinten, verschwand nicht wie vorhin der Blitz, wurde größer und kam näher.
Verdammt, ausgerechnet hier, an einer der engsten Stellen! Das Donnergrollen verstärkte sich, schwoll an, blieb direkt hinter ihr. Was war das, hatte sie den Verstand verloren? Ein Donner, der ihr folgte? Dann erkannte sie im Scheinwerferlicht das Chromblitzen eines Motorrades, ahnte das Vorderrad, das bereits ein Stück neben ihr war.
Sie drehte den Kopf, wollte dem Fahrer zurufen, dass man hier an der viel zu engen Stelle nicht überholen konnte. Das war der Moment, in dem sie endgültig verlor. Ihre Kraft reichte nicht mehr, das Fahrrad zu halten. Sie erstarrte, sah den Straßengraben, die Bäume und den Zaun. Keine Chance, zu reagieren. Mit brutaler Gewalt fuhr sie gegen einen Betonpfeiler, blieb für einen verzögernden Moment an den Resten eines rostigen Gitterzauns hängen, zerriss sich ihre Jacke und wurde auf den Weg zurückgeschleudert. Mindestens eine Rippe brach. Dumpfe Stiche wanderten zuckend durch ihren Körper, Blut sickerte.
Malika! War sie noch im Fahrradsitz? Doch sie war zu schwach, um nach ihr zu greifen, blieb einfach liegen, mitten auf dem Waldweg, unter ihrem eigenen Fahrrad begraben. Dann wurde es schwarz um sie.
Der Motorradfahrer hatte Mühe, zu bremsen. Er schlingerte über das feuchte Gras neben dem Weg, hielt an, klappte den Seitenständer herunter und stieg langsam ab. Den Motor ließ er laufen. Der Regen hatte nachgelassen, tropfte ab und zu zischend auf den Auspuff. Das Rücklicht war hell genug, um den Unfall zu beleuchten.
Der Lederanzug des Bikers knarzte, als er zu der Schwerverletzten zurückging. Er schob sein Helmvisier nach oben, zog den rechten Handschuh aus, bückte sich und versuchte, den Puls der Frau zu fühlen. Er nickte zufrieden und wischte schließlich seine blutigen Finger im regennassen Gras ab. Als er dabei das ebenfalls leblose Kind sah, seufzte er nur. Er stand langsam auf und ging zurück zu seinem Motorrad.
Dort griff er zum Handy. Es war eine kurze SMS: »Auftrag erledigt«. Dann fuhr er los.
ZWEI
Der Nebel lag wie zäher Wattedampf auf den nassen Gräbern. Es war Samstag, kurz nach acht Uhr morgens. Eine Zeit, zu der man lieber unterwegs war, um frische Brötchen vom Bäcker zu holen.
Staatsanwalt Bernhard Nagel und Kriminalhauptkommissar Richard Störmer bummelten schweigend über den halleschen Südfriedhof. Sie betrachteten die Steine der Erinnerung, hatten ihre Hände hinter dem Rücken verschränkt und ihre Mantelkragen hochgeschlagen. Im Schutz der Bäume versuchten sie, dem Nieselregen auszuweichen. Die Sonne nutzte die Wolken als Versteck. Es mochten kaum acht Grad sein, die sich aber deutlich kälter anfühlten. Trotz Frühling roch es nach Herbst und Moder.
Störmer räusperte sich. »Wir haben ein Problem. Wahrscheinlich.«
»So was vermutete ich schon. Du hast bestimmt einen trefflichen Grund, mich am frühen Morgen hierher zu bitten.«
»Ich bin auf dem Weg zur Polizeidirektion. Und ja, einen Grund habe ich.«
Sie waren an einem Doppelgrab angekommen. Störmer kniete sich hin, wischte verwelkte Blätter von der Marmorplatte und ordnete das schmückende Tannengrün neben dem schlichten Holzkreuz. Er wandte sich Staatsanwalt Nagel zu.
»Hier ruhen zwei deiner ehemaligen Mitschülerinnen, Bernhard. Ich befürchte, sie erhalten bald Gesellschaft.«
»Du meinst … «
»Ja. Hör zu, ich bin gestern Abend in der Dienststelle kurz vor Feierabend noch die Vermisstenlisten durchgegangen, reine Routine. Normalerweise schaue ich, ob mir der eine oder andere Name etwas sagt. Wäre unser letzter Fall länger her, hätte ich sicher nichts bemerkt.«
Jetzt hatte er die volle Aufmerksamkeit von Nagel. »Wegen dem entkommenen Entführer und Serientäter Michels? Habt ihr eine neue Spur?«
»Wie man es nimmt. Also, du kennst doch das Einkaufszentrum in Halle-Peißen. Dort ist neben dem Eingang zum Elektronikmarkt eine öffentliche Toilette.«
»Wo man erst den endlosen Gang hinuntergeht?«
»Genau, da sind in den letzten Tagen vier Frauen, die sich zum Schlussverkauf getroffen haben, spurlos verschwunden.« Er zog eine Kopie der Liste mit den Namen der Vermissten aus seiner Innentasche und hielt sie Nagel hin. Der zog tief mehrmals zischend Luft ein.
»Verdammt. Was wissen wir schon?«
»Also, zu den Toiletten geht es links in einen kleineren Seitengang. Es gibt Zeugen, die haben hier einen Angestellten mit blauem Kittel und Basecap gesehen. Unser Problem ist, dass dort ausschließlich weibliches Personal mit der Toilettenreinigung beauftragt ist.«
»Okay, und was hat das mit dem Verschwinden der vier Frauen zu tun?«
»Im Papierkorb haben wir ein weggeworfenes Sperr-Schild gefunden. Es war am Computer selbst gebastelt. An den Ecken hing das Klebeband noch dran.«
Er reichte ihm Fotos.
»Du meinst, der Täter hat eine Art selbstgemachtes Plakat angebracht und die Frauen damit einfach vom stillen Örtchen umgeleitet? Mit einem so billigen Trick? Getreu dem Motto: Tür geschlossen, bitte die nächste? Da lässt sich doch keiner darauf ein. Ich fasse es nicht.«
»So muss es gewesen sein. Wie damals in Mansfeld, da hat er auch einfach VIP-SHUTTLE-SERVICE auf ein Schild geschrieben und von innen an die Frontscheibe seines Transporters geklebt. Die Menschen glauben, was sie sehen, und steigen ein. Dazu kommt, dass die Außentür des Einkaufscenters neben den Sanitäranlagen sonst verschlossen ist. Diesmal stand sie offen. Wir vermuten, dass er dahinter rückwärts mit seinem VW-Bus parkte. Die Frauen mussten auf die Toilette, sind den gefälschten Hinweisen gefolgt. Nachdem sie die falsche Tür geöffnet haben, muss er sie in seinen Bus gezogen oder gestoßen haben. Tür zu und los. Sie hatten keine Chance zu begreifen, was da passiert. Dank der selbsterstellten Hinweisschilder war es die perfekte Entführungsfalle.«
»Verdammt!« Nagel stampfte. Er öffnete seinen Mantel. Ihm war heiß.
»Wenn das bekannt wird, traut sich doch nie wieder jemand dort auf die Toilette, dann gibt es Angst und Panik unter den Leuten! Das darf nicht passieren. Keine Frau wird je wieder einfach so in Ruhe aufs Klo gehen können! Nicht dort und nicht woanders. Umgeleitet, wo gibt’s denn so was.«
Das schwache Morgenblau des Himmels war jetzt komplett verschwunden und hatte eine tiefgraue, schlierige Schattierung bekommen.
»Genau deshalb fand ich, solltest du es wissen.«
Staatsanwalt Nagel nickte ihm dankbar zu. »Wir müssen etwas unternehmen. Ich werde mit der Oberstaatsanwältin reden, damit sie uns den Fall überträgt. Niemand kennt Michels so wie du, deshalb will ich dich bei den Ermittlungen dabei haben.« Störmer war bereits einige Schritte weitergegangen. Er hatte vermutet, dass es so laufen würde.
»Verschon mich damit. Für mich ist es noch zu früh. Außerdem wissen wir nicht, ob es überhaupt Michels war.«
»Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Also gut, lass die Toilette sperren, schieb bauliche Gründe vor.« Nagel sah auf die Uhr, bevor er weitersprach. »Ich muss los, bin spät dran, es geht nach Berlin zu einer Weiterbildung. Bitte stell eine Akte zusammen, schreib einen Bericht und mail ihn mir. Du erreichst mich auf dem Handy.«
Sie gaben sich zum Abschied die Hand. »Ich muss jetzt wirklich los, noch die neue Referendarin abholen. Ich mache euch bei Gelegenheit miteinander bekannt. Wir sehen uns am Dienstag, okay?«
Samstag zu einem Seminar? Das entsprach nicht den Abläufen einer Staatsanwaltschaft. Ein schöner Versuch, ein Alibi für das Wochenende zu finden. Nagel und die Frauen. Das würde sich wohl nie ändern.
Störmer schob die Hände tief in die Manteltaschen und lief los. Seine verletzte Schulter war immer noch wetterfühlig. Er vorzog das Gesicht, als er daran dachte, wie Michels sie im Kampf mit einem Holzbalken bearbeitet hatte.
War das jetzt eigentlich sein neuer Fall?
Die Wunden tief in ihm drin waren zu groß und er noch nicht bereit, überhaupt einen Fall zu übernehmen. Das musste er nur noch Nagel beibringen.
Samstags in die Polizeidirektion. Egal, er hatte sowieso nichts Besseres vorgehabt.
DREI
Das feuchtkalte Wetter hatte sich auf seine Atmung gelegt. Wild hob und senkte sich der Brustkorb. Das lag daran, dass er heute schon fast den gesamten Tag durch die Wälder des Mansfelder Landes gestreift war. Falk Michels genoss es, frei zu sein und gehen zu können, wohin er wollte. Ab und zu gönnte er sich eine Rast, wenn er zufällig eine Bank an einem Wanderweg fand. Das Wenige, was er brauchte, trug er im Rucksack mit sich. Ansonsten nahm er seit seiner Kindheit, was ihm die Natur bot. Prüfend sah er zu den Baumkronen. Wenn der Wetterbericht stimmte, würde es erst in einigen Stunden regnen. Aber bis dahin wollte er längst zu Hause sein. Michels wandte sich nach rechts, um den Rückweg anzutreten. Er bewegte sich leise, nur ab und zu knackte ein trockener Zweig unter seinen Schritten. Hier kannte ihn niemand und er wollte, dass es so blieb. Jede größere Baumgruppe nutzte er, um sich aus der Sicherheit heraus umzuschauen. Am liebsten war ihm der geschlossene Wald, denn hier verschmolz er mit seiner Umgebung. Wütend wurde er, wenn jemand ganze Stücke gerodet hatte, da er dann Umwege machen musste, um im Dickicht bleiben zu können. Wahrscheinlich brauchte der Wald diese Pflege, aber das war ihm egal.
Michels blieb erneut für eine kurze Rast stehen. Den Wanderstab stellte er gegen einen Baum. Dabei lächelte er, denn er wusste, wie scharf die Klinge war, die sich im Inneren des Stabes verbarg. Er selbst war stark genug, um sich mit bloßen Händen zu verteidigen. Aber die versteckte Waffe gab ihm zusätzliche Sicherheit. Er griff in den Rucksack und zerrte das letzte Stück Brot mit Salami aus seiner Aluminiumdose hervor, schlang es hinunter und spülte mit einem Schluck dünner Weinschorle nach. Die Schorle schmeckte abgestanden, angewidert spuckte er aus. Für einen kurzen Moment blieb er unkonzentriert. War da ein unbekanntes Geräusch oder hatten ihm seine Sinne einen Streich gespielt? Schnell verstaute er alles im Rucksack und griff zum Wanderstab. Dann legte er den Kopf schief und sog die Luft mehrmals ein. Schon oft hatte er das, was er nicht sehen konnte, mit Hilfe seiner Nase gefunden. Michels war ein guter Spurenleser, der sich sein Wissen selbst beigebracht hatte. Auch wenn er jetzt den Ursprung des fremden Geräusches nicht konkret ausmachen konnte, beschloss er, vorsichtig zu sein.
In geduckter Haltung passierte er mehrere Senken abseits des Weges, nutzte jede Erhöhung, um sich umzuschauen. Auf einem Hügel, von dem er den Kirchturm und einige Häuser von Blumerode in der Ferne sehen konnte, blieb er stehen. Er wartete, bis sich sein Puls beruhigt hatte. Dann hörte er wieder ein feines Klicken. Er vermutete die Geräuschquelle hinter den nächsten beiden Hügelketten und ahnte, dass sie keinen natürlichen Ursprung hatte. Der schwache Wind drückte allenfalls Äste gegen die alten Stämme. Oder ein Tier trat im Unterholz auf etwas Morsches. Aber nichts würde gleichzeitig knacken und klicken. Es war sehr leise und unregelmäßig. Jetzt erwachte Michels Jagdinstinkt. Er griff in die Außentaschen des Rucksackes und befestigte sich links und rechts am Gürtel je ein Messer. Außerdem entfernte er die Hülle seines Wanderstabes und stopfte sie zurück in den Rucksack. Um sich besser anschleichen zu können, versteckte er das Gepäck unter einer Laubschicht, um es später abzuholen. Die Klinge, die jetzt sichtbar wurde, hatte er in einer Mischung aus Braun und Grau gestrichen und so vorsichtig angeschärft, dass sie möglichst wenig Licht reflektierte. Sein Puls beschleunigte sich, als er dem Geräusch näher kam.
Also hatte er sich nicht getäuscht. Aus sicherer Entfernung sah er die Umrisse eines Fremden. Dieser hatte sich am Rande einer Lichtung hingekniet und bearbeitete dort einen größeren Gegenstand. Jedes Mal, wenn er sich bewegte, klickte es unnatürlich. Michels war erfahren genug, um sich heranzuschleichen. Es war einer jener Momente, in denen er bedauerte, nicht in die alte Zeit der Indianerkriege hineingeboren worden zu sein. Er wäre gut gewesen, verdammt gut! Nicht so wie der Fremde, der zwar zu seiner Tarnung eine Art militärische Kleidung trug, aber ansonsten unvorsichtig war. Was bearbeitet er dort? Dessen Hände bogen rostiges Metall um ein Holzgestell. Jedes Mal, wenn er eine der Stangen umwickelte, klickte der Draht gegen die Rolle. Michels war zufrieden, dass sein feines Gehör reagiert hatte. Jetzt konnte er, im Unterholz liegend, die Szene beobachten.
Der Fremde trug Turnschuhe und eine Wollmütze. Seine Haut war braun, zumindest an den Stellen, die der Kampfanzug offen ließ. Alle Bewegungen wirkten in der Ausführung sparsam und dennoch kräftig. Es ist besser, wenn ich vorsichtig bleibe. Was bastelt der da bloß? Geduldig wurde eine Drahtschlinge nach der anderen verlegt und verknotet. Die zwei Latten waren leicht gebogen. Zusammen mit dem Drahtgeflecht ergaben sie eine erstaunlich gleichmäßige Fläche, was auch an den exakt geführten Schlingen lag. Als die Arbeit beendet war, wurde das Geflecht auf ein Rohrgestell gelegt und angeheftet. Es sah aus wie eine Liege. Als Michels sich streckte, um besser sehen zu können, raschelte es. Der Fremde wickelte eine weitere Schlinge, bevor er den Draht zu Seite legte. Dann griff er mit der gleichen Bewegung, mit der er aus der Hocke aufstand, eine Holzlatte und drehte sich in Michels Richtung. Unmöglich, dass er ihn sah.
»Komm raus. Wer sich versteckt, führt ganz bestimmt nichts Gutes im Schilde.«
Michels beschloss, vorerst nicht zu reagieren.
»Verdammt, du Feigling, was soll das? Falls du nicht kommst, werde ich dich holen. Das hier ist mein Gebiet, mein Wald. Und ich hasse es, wenn sich jemand anschleicht. Deshalb zum letzten Mal: Komm raus!«
Es war die Arroganz, auf die Michels reagierte. Er stand auf und trat langsam hinter einem Stamm hervor. Er lächelte, da er an der Blickführung seines Gegenübers erkannte, dass dieser ihn fünf Meter weiter links vermutet hatte. Dann sprach er mit ruhiger und tiefer Stimme: »Wenn du willst, so hol mich. Aber egal wie, das hier ist und bleibt mein Gebiet und mein Wald.«
Für sehr lange Zeit starrten sie sich an, schätzten einander ab. Michels nahm schließlich den Gesprächsfaden wieder auf.
»Was machst du hier? Und was baust du da zusammen? Hinterher liegt dann der ganze Touristenmüll im Wald rum. Dafür habe ich kein Verständnis.«
»Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, liegt hier nichts rum, das kann ich versprechen.«
»Okay, vielleicht. Und was wird das dann?« Als er diesmal keine Antwort bekam, ging er weiter heran. Dabei hielt er mehr als zwei Stablängen Abstand. Er blickte interessiert auf das Gestell, das aus der Nähe aussah wie eine stabile Mischung aus Stuhl und Liege. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass dies die Nachbildung eines Frauenarztstuhles ist.«
»Gut beobachtet, mein Freund.« Die Worte klangen alles andere als freundlich, geschweige denn wie ein Lob.
»Ich habe keine Freunde.«
»Das glaube ich dir wohl.«
Jetzt standen sie sich unmittelbar gegenüber, jeder trug deutlich sichtbar Wut in sich. Plötzlich riss der Fremde die Latte nach vorn und warf sie in Michels Richtung. Als dieser sich instinktiv ducken wollte, folgten zwei schnelle Wurfsterne. Da er damit nicht gerechnet hatte, trafen sie ihn an beiden Armen. Sie waren höllisch scharf und bohrten sich in sein Fleisch. Er schrie auf. Der Jackenstoff färbte sich rot. Das Adrenalin ließ Michels nach vorn stürmen. Der Klinge des Stabes konnte der Fremde ausweichen, dem umgehend gezogenen Messer aber nicht.
Ein tiefer Schnitt, mit dem er nicht gerechnet hatte, zog sich über seinen Unterarm. Er spuckte trotzig aus.
»Respekt. Wo hast du kämpfen gelernt?«
Michels lächelte erneut. Alles, was er konnte, hatte er auf der Straße und in der Wildnis gelernt. Hier war er zu Hause, hier war seine Heimat. Und sein Wald.
»Das Leben war mein Lehrer.«
»Dann hatten wir wohl den gleichen.«
Sie umkreisten sich, versuchten, durch eine gute Position die Oberhand zu bekommen. Gerade als Michels ausholen wollte, knickte sein Fuß weg und er stolperte. Einen Sekundenbruchteil später spürte er einen stechenden Schmerz, als hätte ihn etwas gebissen. Aber das war es nicht.
»Eigentlich ist das eine Tierfalle, mein Freund. Oder mein Tier?« Im gleichen Moment hatte der Fremde ausgeholt und die Latte mit voller Wucht auf Michels Schädel gedonnert. Dabei nutzte er den Schwung des Schlages aus, um mit einer drehenden Bewegung das eine Ende des Holzes von unten an dessen Kinn und dann das andere Ende erneut von oben auf den Kopf zu schmettern. Das schwere Kantholz wurde zu einer furchtbaren Waffe, gegen die Michels keine Chance hatte. Er versuchte, die Arme schützend vor sich zu halten, um zumindest die schlimmsten Schläge abzuwehren. Haut wurde zerrissen, er heulte auf und spuckte Blut. Der Fremde holte aus, wieder und wieder. Zwei gezielte Stiefeltritte an seine Schläfen folgten. Es wurde schwarz um ihn. Unfreiwillig erschlafften die Muskeln. Er verlor die Stabklinge und fiel in sich zusammen. Der Kampf war entschieden.
Jetzt lächelte der Fremde. Bedächtig legte er seine Waffe an die Seite und holte die Rolle Draht, mit der er vorhin gebastelt hatte, fesselte damit Michels an zwei dicke Holzleisten, die er wie einen Schlitten hinter sich herziehen wollte. Er sah zu seinem Gefangenen hinunter und begann, wild zu lachen.
»Brav, mein liebes Tier!«
Der eisige Abendwind zerriss sein Siegesgeheul.
***
Etwas hämmerte in seinem Kopf. Die Zunge war geschwollen und schien den ganzen Rachen einzunehmen. Vergebens versuchte Michels, die Augen zu öffnen. Da er auch die Hände und Füße nicht bewegen konnte, wurde ihm schnell klar, wie der Kampf ausgegangen war. Routiniert prüfte er im Unterbewusstsein die verbliebenen Optionen. Außer abzuwarten fielen ihm keine ein.
Seine Wut steigerte sich, sodass er schließlich deutlich hörbar Luft durch die Nase einsog.
»Ah, mein freundliches Tier ist wieder unter uns, wie schön.« Es hörte sich an, als würde der Fremde an einem Glas nippen. »Guten Morgen!« Gleichzeitig riss dieser ihm das Klebeband vom Mund. Der heftige Schrei war die Folge des Schmerzes. Michels winselte.
»Hier kann dich niemand hören, sodass du eigentlich schreien könntest, soviel du willst. Aber, und das tut mir leid: Ich habe ein sehr sensibles Gehör, Krach mag ich überhaupt nicht, verstehst du?« Mit den letzten Worten hatte er einen Rohrstock quer über Michels Finger gezogen. Auch wenn dieser sich bemühte, einen Schrei zu unterdrücken, es gelang ihm nicht. Sein gesamter Körper bäumte sich auf, um sich anschließend wie in einer Wellenbewegung zusammenzuziehen.
»Ich möchte, dass wir uns verstehen.« Dann schlug er mit dem Rohrstock x-förmig über die Knöchel an beiden Händen. Er wartete, bis die größten Reaktionen abgeklungen waren.
»Okay, mein freundliches Tier, jetzt lass uns mal in Ruhe unterhalten, ja? Ich glaube, dass das heute ein guter Tag ist. Mit dir habe ich irgendwie einen Seelenverwandten getroffen. Von nun an bist du der Diener meines Schmerzes, verstanden? So lange ich will oder so lange du kannst. Ich freue mich drauf.«
Der Fremde griff zu einem Rotweinglas und prostete Michels zu.
»Der Suhl …«
»Hä? Was?«
»Der St …, der Stu …« Wegen der geschwollenen Zunge und einiger herausgeschlagener Zähne konnte er nicht besser reden.
»Ach so, der Stuhl.« Bevor er weitersprach, schüttete er seinem Gefangenen Wein in den Mund. Das Brennen daraufhin war so heftig, dass dieser sich erbrach. »Ja, der Stuhl, da hast du recht, der sieht mit voller Absicht so aus wie bei einem Frauenarzt. Und es gibt da einige, die darauf warten und sozusagen schon einen Termin in meiner Sprechstunde haben.« Er versuchte, ein Kichern zu unterdrücken. Nach einem Blick auf die Uhr wurde er wieder still. »Es ist spät geworden. Und dich binde ich lieber an einem Haken an der Decke fest. Denn wenn du nur ein wenig so wie ich bist, wirst du jede Gelegenheit nutzen, um zu fliehen.«
Er trank aus, warf das Glas in eine dunkle Ecke des Raumes und begann, vier Ketten durch eine Öse an der Gewölbedecke zu ziehen. Michels sah sich in dem kurzen Moment um. Raue, grob behauene Sandsteine und eine Art einfacher Betonfußboden waren das einzige, was er erkennen konnte. Es gab nur das künstliche Licht einer nackten Glühbirne. Auch der Geruch erinnerte ihn an einen Keller. Dieser hier musste jedoch riesig sein. Als wäre er in einer Burg. Aber das konnte nicht sein, denn er kannte jede Burg und jedes Schloss im Mansfelder Land. Und besonders die großen alten Keller. In denen war er aufgewachsen wie andere in einer warmen Wohnstube. Es machte ihm nichts aus, hier zu sein. Aber nicht zu wissen, wo er war, das beunruhigte ihn.
Je eine Kette wurde um Hand- und Fußgelenke geschlungen. Der Fremde zwang ihn damit in eine aufrechte Haltung. Michels biss die Zähne zusammen, sodass nur ein Stöhnen zu hören war. Seine Atmung und sein Puls jagten um die Wette.
»Du hast dich ja bekotzt, Alter.« Zwei Eimer abgestandenes Wasser wurden ihm ins Gesicht geschüttet. Er konnte den Moder schmecken. Jetzt zitterte er am ganzen Körper.
»So, mein freundliches Tier und Schmerzdiener, dann schlaf mal gut, wir sehen uns morgen.«
Das Licht ging für einen kurzen Moment aus. Dann kam der Fremde zurück.
»Hm, was ist denn das?« Die Wunden von den Wurfsternen waren aufgegangen, Blut lief an Michels Armen herab. »Wir wollen doch nicht, dass sich das entzündet.« Er zerschnitt ihm das Hemd mit dem Messer und riss es herunter. Dann verband er grob die Wunden, um die Blutungen zu stillen. Der Gefangene hechelte vor Schmerz. Sein Zittern verstärkte sich.
Als der Fremde sich erneut abwenden und gehen wollte, stockte er. Etwas an der Innenseite von Michels rechtem Oberarm hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Unerwartet vorsichtig drehte er den Arm so, dass er das Bild besser sehen konnte. Man sah, wie es in ihm arbeitete. Schließlich seufzte er, setzte das Messer an den eigenen Hemdstoff und zeigte auf die Tätowierung an der Innenseite seines Armes.
»Hagen? Hagen Wendt? Bist du es wirklich?«
»Ja, dann bist du Falk Michels.«
Jetzt klang seine Stimme brüchig. »Ich hätte mich wohl besser zu Beginn unseres Gespräches vorstellen sollen, was?« Sein Blick hatte etwas Mildes. Vorsichtig löste er die Ketten. Als er merkte, dass Michels zu schwach war, um allein zu stehen, hielt er ihn mit einer Umarmung fest. Er befreite ihn von den letzten Fesseln und trug ihn zu einem Haufen Strohballen. Dort wickelte er ihn in eine Decke. Er zog seine eigene Jacke aus und rollte sie ihm als Kissen unter den Kopf.
»Blutsbruder.«
»Ja, Blutsbruder. Ich habe die Kreuze erkannt.«
»Die Tätowierung aus unseren Kindheitstagen von zwei hintereinander stehenden Kreuzen? So, als würde eines Schatten auf das andere werfen?«
»Genau, so treu und nah beisammen wie wir beide. Jeder der Schatten des anderen.«
Jetzt hatten sie Tränen in den Augen, Tränen der Freude.
»Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Endlich! Ruh dich aus, du bist zu schwach, um heute Nacht mit mir zu kommen. Ich hole alles, was du brauchst, hab keine Sorge, ich pflege dich wieder gesund, mein Bruder.«
»Danke, Hagen, aber erzähl doch kurz, bevor du gehst.«
»Das ist eine lange Geschichte, Falk. Ich berichte dir davon in Ruhe, deshalb heute wirklich nur ganz kurz. Du erinnerst dich an die Senilen aus dem Altersheim? An meine Gefangenschaft, die Folter und den brennenden Tod der Alten? Damals haben die Bonzen alles unter den Teppich gekehrt, niemand durfte davon erfahren. Irgendwann konnte ich dann entkommen. Aber jetzt du, wo bist du gewesen in all den Jahren?«
»Nun, ich habe meine Erinnerung an die gute alte Zeit kürzlich aufgefrischt, mit einigen Frauen aus meiner Vergangenheit auf Schloss Mansfeld. Und es war so viel besser als damals, das kannst du mir glauben. Abgesehen davon, dass mich ein Kommissar um ein Haar hinter Gitter gebracht hätte. Aber mach dir deswegen keine Sorgen, er wird dafür bezahlen.« Falk Michels schluckte schwer.
Hagen nutzte die kurze Pause. »Ich war in vielen Heimen, in den schlimmen Heimen der DDR. Als ein Gefangener.« Er spuckte aus. »Aber auch dort habe ich Erinnerungen an unsere gemeinsamen Taten mit den Senilen – im Rahmen meiner Möglichkeiten – aufgefrischt.« Ihr gleichzeitiges Lachen klang herzlich. »Lass uns doch deinen Kommissar zusammen suchen, Bruder, ich würde ihm gern unsere Rechnung vorlesen.«
»Prima, da freue ich mich drauf. Es wird alles gut, so wie früher. Dass wir uns heute wiedergefunden haben, ist ein Wunder.«
»So, und jetzt ruh dich aus, ja? Ich bin bald zurück.«
Er wartete, bis Michels eingeschlafen war. Dankbarkeit für das Glück des Tages durchströmte ihn, als er zu ihm flüsterte: »Schlaf gut, mein Bruder.«
VIER
Seine linke Hand schlief ständig ein. Liegt das am Alter? Der Hausarzt hatte ihn an einen Spezialisten überwiesen. Den frühesten Termin beim Neurologen würde er jedoch erst in fünf Monaten bekommen.
»Wenn überhaupt«, hatte sie gestern Nachmittag gesagt.
Störmer wurde wütend, tief im Inneren. Die Schwester an der Arzt-Anmeldung schien sein verwundertes Gesicht im Stillen zu genießen, seinen Frust im Nichtwissen der Diagnose, was eine ständig eingeschlafene Hand bedeutete. Er hatte gewusst, dass es schwer war, einen Facharzttermin zu bekommen. Aber er hatte nicht damit gerechnet, dass es ihn treffen könnte. Ein wenig bedauerte er es, kein Schwerverbrecher zu sein, denn dann hätte die Dame ihre letzten Stunden erlebt. Sie war hochnäsig, dumpf, faul, und im Prinzip schon tot. Fünf Monate! Wortlos legte er die Gefühle in einen eisigen Blick. Eigentlich eine gute Story, er würde sie seiner Nachbarin Magdalena erzählen, vielleicht macht sie ja einen Krimi draus. Zumindest einen Kurzkrimi. In einem Buch von ihm wäre die Arzthelferin jetzt tot. Diese Vorstellung erheiterte ihn ein wenig.
Störmer war froh, dass er sich am frühen Morgen aufgerafft hatte, denn so konnte es nicht mehr weitergehen. Sein Fitnesslevel war im Gegensatz zu ihm deutlich jenseits der Fünfzig. Er öffnete das Fenster, roch den Frühling und ließ sich in seinen Sessel fallen. Das Handy schob er auf die Schreibtischplatte. Heute acht Kilometer gejoggt. Und das auch noch freiwillig. Er schloss die Lauf-App und lächelte. Na, es geht aufwärts, alter Junge. Es hatte sich wirklich gelohnt, langsam anzufangen, zweimal die Woche raus an den See und den Kopf freibekommen. So viel Zeit musste sein, auch für einen Kriminalhauptkommissar. Vielleicht am Montag zehn Kilometer? Nur nicht übertreiben, so wie letztes Jahr, zu schnell die Strecke gesteigert und dann wochenlang Schmerzen im Knie. Okay, zehn, mehr aber nicht. Und irgendwann klappt es dann auch mit dem Abnehmen.
Störmer zog einen Kaffee, bevor er begann, die Berichte der letzten Nacht durchzusehen.
Schlägereien, Einbrüche, Autodiebstahl, das Übliche. Das Meiste war wie immer in der Neustadt von Halle passiert. Scheinbar zog die Anonymität der Plattenbausiedlung die dunklen Gestalten an. Er rieb sich die vom letzten Fall verletzte Schulter und seufzte.
Bevor mich der Arzt weiter krankschreibt, kann ich auch meinen Schreibtisch aufräumen.
»Morgen, Chef!«
»Ah, Sabine. Du hast gute Laune?« Er wusste, dass seine Assistentin den frühen Morgen hasste. Aber ab und zu sticheln machte eben auch Spaß. Sie war die gute Seele, stets zurückhaltend und hilfsbereit. Wahrscheinlich hätte er ohne sie die Hälfte der Fälle nicht gelöst. In ihrer Bescheidenheit spielte sie selbst immer auf ihr Alter an, so, als würde sie bald in Pension gehen.
Heute ließ sie sich nicht auf seine Sticheleien ein, setzte sich an ihren Schreibtisch und fuhr den Computer hoch. Störmer hatte gerade beschlossen, nicht weiter nachzubohren, da fing sie von selbst an.
»Hier ist eine Mail vom Staatsanwalt Nagel, du sollst mal durchklingeln.«
»Okay, mache ich nachher. Steht dabei, warum?«
»Nicht direkt, aber Moment, ja, das Aktenzeichen gehört zu den vier Vermissten vom Einkaufscenter.«
»Das soll er vergessen!« Wütend schlug Störmer auf die Tischplatte. Seine Schulter nahm es ihm umgehend übel. »Ich habe NEIN gesagt, kann der Kerl mich nicht in Ruhe lassen, auch wenn zwei der Vermissten seiner alten Klasse angehören? Ich will mich auskurieren, meine Ruhe haben. Verdammt noch mal.« Er lief mehrere Male um seinen Schreibtisch, um sich zu beruhigen. Nach einigen tiefen Atemzügen ging er zu Sabine Achenbach. »Entschuldigung.«
»Schon gut, Chef.« Sie winkte ab. »Ich verstehe das.« Das tat sie nicht.
Störmer schloss die Zwischentür und setzte sich kerzengerade in seinen Sessel, bevor er die Nummer der Staatsanwaltschaft wählte. Nagel nahm selbst ab.
»Guten Morgen, Richard.«
»Ich glaube kaum, dass das ein guter Morgen wird. Ich hatte dich gebeten, mich aus dem Fall rauszuhalten. Ist das denn so schwer …« Er war laut geworden. Seine Zunge fühlte sich pelzig an.
»Richard, du …«
»… lass mich ausreden ja? Ein anderer soll die Arbeit in dem Fall machen, nur das eine Mal. Ich bin krank und brauche die Zeit. Das kann nicht zu schwer sein, gib den Fall an Schreiber, das LKA müsste ein Interesse haben. Ein Serienmörder auf der Flucht und vier verschwundene Frauen, ist das nicht genug? Sie sollen endlich die Ermittlungen ausweiten. Ich brauche die Auszeit, um mich um meine Tochter und mein eigenes Leben zu kümmern. Ich kann und will den Fall nicht übernehmen!« Er hatte immer schneller gesprochen, ohne die Lautstärke zu reduzieren. Dass er seinem Freund und Staatsanwalt Bernhard Nagel von persönlichen Problemen erzählt hatte, tat ihm im gleichen Moment schon wieder leid.
»Darüber reden wir später, aber …«
»Da gibt es kein Aber, kein Vielleicht. Ich mache das nicht, basta.«
»Beruhige dich, Richard, ich wollte doch nur fragen, ob du mitkommst. Ich habe gerade den neuen Audi A6 als Vorführer, bin nachher auf dem Weg zu Schreiber.«
»Pff.« Er wusste, dass sein Freund in Sachen Frauen kein Kostverächter war und außerdem einen riesigen Auto-Tick hatte. Immer die neuesten und schnellsten Modelle. Er selbst fuhr dennoch gern mit, so hatten sie Gelegenheit, ab und zu Zeit miteinander zu verbringen. »Und was soll ich bei Schreiber? Wenn der was will, kann er mich anrufen, ich werde ihm in dem Fall sowieso keine große Hilfe sein. Dafür fahre ich doch nicht extra zum LKA nach Magdeburg.«
»Er ist …«
»Nein, null Bock, fahr allein, ich habe zu tun. Aber danke, dass du gefragt hast.«
Jetzt war deutlich zu hören, wie Nagel Luft holte.
»Er ist selbst Patient.«
Vermutlich hatte er den Satz entgegen seiner sonstigen Gewohnheit kurz gewählt, damit ihm Störmer nicht sofort ins Wort fallen konnte.
»Was?«
»Ja, mach dir keine Sorgen, das Gröbste hat er hinter sich. Komm zu mir in die Staatsanwaltschaft, ich muss nur noch kurz ein paar Telefonate führen, dann können wir los.«
»Gut, bis gleich.«
Das Stück konnte er zu Fuß gehen. Verdammt. Störmer war wütend auf sich. Wieder einmal waren seine Pläne durchkreuzt.
Er sah aufs Handy. Keine Nachricht von seiner Tochter Verena. Seit der letzten Aktion, als sie das viele Blut eines Opfers im Dienstwagen ihres Vaters gesehen hatte, gab es kaum Kontakt.
Fast hätte er wieder mit der Hand auf die Tischplatte geschlagen, aber der Schmerz von vorhin war noch zu frisch. Wie es aussah, würde er diesmal den ersten Schritt gehen müssen. Doch was soll ich ihr sagen? Einfach nur zuhören? Sie zu mir holen und mit ihr etwas unternehmen? Beim letzten Mal ging das ja gehörig schief. Und genau deshalb will ich keinen neuen Fall. Ich bin kein besonders guter Vater gewesen. Sie ist ein Teenager, aufgewachsen bei der Mutter. Was ich ihr geben müsste, wäre Zeit, das ist mir klar. Okay, erst mal auf zu Schreiber. Um diese Uhrzeit schlafen Siebzehnjährige sowieso noch. Rufe ich halt später an.
Auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft kreisten seine Gedanken um den entkommenen Serienkiller Falk Michels. Man würde hoffentlich eine Ermittlungsgruppe bilden. Er hatte sich geschworen, Michels hinter Gitter zu bringen. Aber keineswegs mehr als Chefermittler.
Mindestens genauso wichtig war ihm, dass niemand aus seinem Freundes- und Verwandtenkreis deswegen je wieder in Gefahr geriet. Bevor das passierte, würde er lieber als Streifenpolizist oder am Schreibtisch enden. Das war der zweite und viel bedeutendere Teil des Schwures. Er hatte seine Lehren aus der letzten Jagd gezogen.
Aber was war nur mit Schreiber?
FÜNF
Es roch extrem nach Desinfektionsmitteln, als sie durch die hellgelben Gänge des Magdeburger Klinikums gingen. Ab und zu mischte sich ein Dufthauch darunter, der schwach an Kaffee erinnerte. Unterwegs hatte Nagel berichtet, was passiert war.
Schwungvoll traten sie in das Zimmer ein, Störmer voran.
»Sie sehen erholt aus, Schreiber.«
Dieser ergriff die angebotene Hand in einem angestrengten Versuch, sie zu drücken. »Alter Schmeichler. Wusste gar nicht, dass Hallenser charmant sein können.« Schreibers Gesicht hatte eine graue Tarnfarben-Tönung bekommen, tiefe Furchen zogen sich über beide Wangen. Unter den Augen bildeten sich grüngelbe Tränensäcke. Störmer klopfte ihm vorsichtig auf die Schulter. Er wirkte nicht nur sichtlich besorgt, er war es auch. Dann legte er ihm einige Zeitschriften auf den Nachtschrank, als Mitbringsel. Ein Mann braucht keine Blumen.
»Haben Sie Fieber?« Er deutete auf die Schweißperlen an dessen Stirn.
»Na ja, sagen wir mal so, ein eitriger Blinddarm-Durchbruch ist kein Kindergeburtstag.«
»Verstehe.«
Jetzt schüttelte Nagel dem Kranken stumm die Hand. Unmittelbar darauf klopfte es an der Tür. Jemand öffnete, ohne ein »Herein« abzuwarten. Störmer drehte sich um, ein Lächeln huschte über sein Gesicht.
»Alida, was machen Sie denn hier?«
Sie umarmten sich. »Alida Walter, lange nicht gesehen, freut mich.«
Die junge Polizistin sah gut aus. In kurzer Zeit hatte sie sich von Michels Folterungen erholt. Zumindest äußerlich sah man ihr nichts mehr an. »Ich habe doch versprochen, dass ich Ihnen von nun an immer helfen werde.« Sie strahlte Störmer an.
»Wenn ich dann auch mal …« Schreiber versuchte, sich im Bett aufzurichten.
»Aber klar doch.« Alida beugte sich herunter, küsste ihm auf die Stirn und legte dabei ein Päckchen Schokolade auf das Kissen. »Damit Sie wieder zu Kräften kommen.«
»Vielen Dank, auch dafür, dass Sie gekommen sind.«
Störmer stand auf, seine gute Laune war schnell verfolgen.
»Krank hin oder her, das sieht mir hier eher nach einer Absprache aus, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse …«
Nagel unterbrach ihn. »Beruhige dich, Richard.«
»Nein, das will ich nicht, egal, wie schlimm es um Schreiber steht …«
Nagel hob die Hand und trat einen Schritt heran.
»Richtig, ihm geht es schlecht, er ist in letzter Minute von der Schippe gesprungen, war dem Tode näher als dem Leben. Und er wird ziemlich lange brauchen, um dahin zurückzufinden. Er darf sich die nächsten Tage nicht bewegen und sich nicht anstrengen, die Ärzte wissen nicht, welche inneren Entzündungen er hat.«
»Ähm, das tut mir leid…«
»Muss es nicht, obwohl, als er hörte, dass du die Angelegenheit nicht übernimmst, hat er seine Bauchschmerzen ignoriert und an dem Fall gearbeitet, bis er zusammengebrochen ist. Und fast wäre er darüber gestorben.« Zum Ende hin hatte Nagel geflüstert.
Schreiber ergriff das Wort. »Hören Sie, Störmer, Sie kennen den Täter, Sie waren am nächsten dran, es ist und bleibt Ihr Fall. Tun Sie mir den Gefallen, ermitteln Sie. Ich unterstütze Sie, wenn ich wieder raus bin aus dem Krankenhaus. Und Sie haben ja noch Alida. All Ihre Freunde helfen Ihnen. Die Oberstaatsanwältin ist im Urlaub, aber Sie können wie immer mit Nagel zusammenarbeiten. Bitte!«
Störmer schluckte und suchte nach Worten, die nicht wie eine Beleidigung klangen. Ihm war klar, dass sie ihn bei seiner Ehre packen wollten.
»Das haben sich die Herrschaften ja fein ausgedacht. Fehlt nur noch, dass Sie meine Assistentin hier zum großen Stelldichein bitten, an die alten Fälle im Mansfelder Land erinnern, an die Verantwortung appellieren! An die offene Rechnung mit Michels! Ein paar freundliche Sentimentalitäten hier und da, etwas schlechtes Gewissen und schon springt der Herr Kriminalhauptkommissar? Haben Sie sich das so ausgedacht, ja? Dass es so einfach wird? Und was ist mit mir, den Verletzungen, meiner Tochter, um die ich mich kümmern muss, damit sie nicht vor die Hunde geht? Was ist mit meinem Leben? Interessiert das hier überhaupt jemanden?«
Es wurde still, unangenehm still. Dann klopfte es erneut an der Tür.
Magdalena, die Schriftstellerin und Nachbarin trat herein.
»Wird das jetzt eine Schmierenkomödie? Vergessen Sie, dass ich den Fall übernehme. Nicht mit mir! Nein, niemals.«
Noch während er es aussprach, wusste er, dass er es nicht so meinte. Er ging zu Magdalena, griff wie selbstverständlich ihre Hand und zog sie mit sich. Krachend warf er die Tür zu.
Hand in Hand verließen sie die Klinik.
Wenigstens meine Liebe hätten sie außen vor lassen können. Mehr verlange ich nicht.
Trotzdem war er froh, denn jetzt wusste er, dass er zurück war, im Leben und im Job.