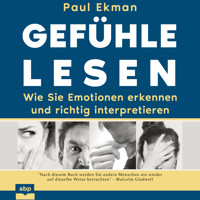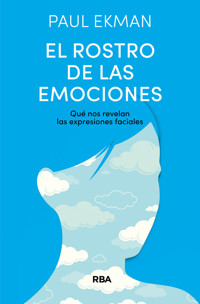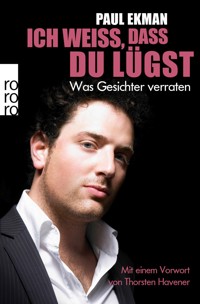
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie Sie Lügen kurze Beine machen Verheimlicht der Mensch an Ihrer Seite eine Affäre? Versucht ein Verkäufer, Sie übers Ohr zu hauen? Sagt der Verdächtige in einem Kriminalfall die Wahrheit? Tagtäglich müssen wir uns fragen, ob wir von unseren Mitmenschen hinters Licht geführt werden. Und niemand vermag Täuschungen besser zu erkennen als Paul Ekman. In diesem bahnbrechenden Buch zeigt der weltweit renommierteste Experte für nonverbale Kommunikation, wie und warum Menschen lügen. Weshalb manche dabei erfolgreich sind, andere nicht. Wie sich eine Lüge in Körpersprache, Stimme und Gesichtsausdruck niederschlägt. Und weshalb trotzdem immer wieder Lügenexperten getäuscht werden können, darunter Richter, Polizisten und Geheimdienstler. Die Wissenschaft hinter der preisgekrönten VOX-Erfolgsserie «Lie to me» «Ein präzises, intelligentes und durchdachtes Buch, das sowohl für den Laien als auch den Wissenschaftler gleichermaßen interessant ist.» New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Paul Ekman
Ich weiß, dass du lügst
Was Gesichter verraten
Über dieses Buch
Wie Sie Lügen kurze Beine machen.
Verheimlicht der Mensch an Ihrer Seite eine Affäre? Versucht ein Verkäufer, Sie übers Ohr zu hauen? Sagt der Verdächtige in einem Kriminalfall die Wahrheit? Tagtäglich müssen wir uns fragen, ob wir von unseren Mitmenschen hinters Licht geführt werden. Und niemand vermag Täuschungen besser zu erkennen als Paul Ekman. In diesem bahnbrechenden Buch zeigt der weltweit renommierteste Experte für nonverbale Kommunikation, wie und warum Menschen lügen. Weshalb manche dabei erfolgreich sind, andere nicht. Wie sich eine Lüge in Körpersprache, Stimme und Gesichtsausdruck niederschlägt. Und weshalb trotzdem immer wieder Lügenexperten getäuscht werden können, darunter Richter, Polizisten und Geheimdienstler.
Die Wissenschaft hinter der preisgekrönten VOX-Erfolgsserie «Lie to me».
«Ein präzises, intelligentes und durchdachtes Buch, das sowohl für den Laien als auch den Wissenschaftler gleichermaßen interessant ist.»
New York Times
Vita
Paul Ekman, geboren 1934, war Professor für Psychologie an der University of California in San Francisco. Er gilt als einer der weltweit führenden Experten für nonverbale Kommunikation. Die American Psychological Association kürte ihn zu einem der einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts. Seit mehr als 40 Jahren erforscht er, wie Gefühle entstehen, wie sie sich äußern und wie man sie bei anderen lesen kann. Außerdem arbeitet er als Lügenexperte für das FBI und die CIA. Die Hauptfigur der Fernsehserie «Lie to me» ist ihm nachempfunden, er selbst hat die Serie wissenschaftlich begleitet.
Thorsten Havener absolvierte ein Studium zum Diplom-Übersetzer für Englisch und Französisch an den Universitäten Saarbrücken und Monterey, Kalifornien. Seine Bestseller erreichen ein Millionenpublikum und wurden in 16 Sprachen übersetzt. Er ist einer der bekanntesten Entertainer Deutschlands. Zurzeit ist er mit seinem Bühnenprogramm «Feuerprobe» auf Tour. Außerdem hält er Vorträge und gibt Seminare. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von München.
Hubert Mania, geboren 1954. Studium der Germanistik und Anglistik. Danach selbstständiger Konzertveranstalter und Manager eines Kulturzentrums. 1987 erschien bei Rowohlt sein Roman «Scintilla Seelenfunke». Übersetzung populärwissenschaftlicher Bücher, Mitredakteur bei Stephen Hawkings Büchern «Eine kurze Geschichte der Zeit» und «Das Universum in der Nussschale». Hubert Mania lebt als Autor und Übersetzer in Braunschweig.
Weitere Bücher bei Rowohlt: «Gauß. Eine Biographie» (2008), «Kettenreaktion. Die Geschichte der Atombombe»(2010).
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1991 unter dem Titel «Telling Lies» bei W.W. Norton, New York. Erweiterte Neuausgaben wurden 2001 und 2009 veröffentlicht.
Zitate auf Seite 7 aus
Erving Goffman, Strategische Interaktion
Aus dem Amerikanischen von Hermann Vetter
© 1981 Carl Hanser Verlag
George Steiner, Nach Babel. Aspekte der Sprache und des Übersetzens
© George Steiner 1975, 1992. © der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1981, 1994.
Michel de Montaigne, Essais
Erste moderne Gesamtübersetzung von Hans Stilett
© AB – Die Andere Bibliothek GmbH & Co KG, Berlin 1998, 2011
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Originalverlage.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2023
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Telling Lies» Copyright © 1985, 1992, 2001, 2009 by Paul Ekman
Redaktion Friederike Moldenhauer
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Cultura RM/Alamy Stock Photo
ISBN 978-3-644-01346-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motti
Vorwort
Eins Einführung
Zwei Lügen, Lecks und Täuschungshinweise
Drei Warum Lügen auffliegen
Eine schlecht zurechtgelegte Geschichte
Gefühle verleugnen
Gefühle beim Lügen
Die Angst, erwischt zu werden
Schuldbewusstsein für den Betrug
Die Freude an der Überlistung
Vier Körper, Worte und Stimme verraten die Täuschung
Die Worte
Die Stimme
Der Körper
Hinweise des vegetativen Nervensystems
Fünf Das Gesicht gibt Täuschungshinweise
Sechs Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen
Vorsichtsmaßnahmen bei der Interpretation von Verhaltenshinweisen auf Täuschungen
Sieben Ein Apparat als Lügenermittler
Wer wendet den Lügendetektortest an?
Funktionsweise des Lügendetektors
Die Kontrollfragentechnik
Der Tatwissenstest
Genauigkeit des Lügendetektors
Feldstudien
Analogstudien
Hybridstudien
Forschungsergebnisse
Der Lügendetektortest bei Bewerbungen
Lügendetektortest für Polizeidienstanwärter
Der Lügendetektortest zur Enttarnung von Spionen
Polygraphische Überprüfung am Arbeitsplatz
Lecks aufspüren und Abschreckungstheorie
Vergleich des Lügendetektors mit Verhaltenshinweisen auf Täuschung
Acht Lügenkontrolle
Neun Lügenermittlung in den 1990er Jahren
Wer kann Lügner fangen?
Neue Resultate zu Verhaltenshinweisen auf Lügen
Widrigkeiten, Lügen im Gerichtssaal aufzudecken
Admiral Poindexters Explorationshinweise
Oliver Norths schauspielerische Fähigkeiten
Zehn Lügen in der Öffentlichkeit
Oliver Norths Rechtfertigung seiner Lügen
Präsident Richard Nixon und der Watergate-Skandal
Präsident Jimmy Carters gerechtfertigte Lüge
Lyndon Johnsons Lügen über den Vietnamkrieg
Das Unglück der Raumfähre Challenger und Selbstbetrug
Der Richter Clarence Thomas und Professorin Anita Hill
Ein Land der Lügen
Elf Neue Resultate und Konzepte zum Thema Lügen
Neue Unterscheidungen
Motive für Lügen
Neue Ergebnisse
Warum können wir Lügner nicht überführen?
Zwölf Flüchtige, subtile und gefährliche Gesichtszüge
Worauf es am meisten ankommt
Mikroexpressionen
Makroexpressionen
Subtile Ausdrucksweisen
Danger Demeanor Detection (D3 – Entdeckung Gefahr signalisierenden Verhaltens)
Warnung
Nachwort
Anhang
Dank
Zur Erinnerung an Erving Goffman, meinen außergewöhnlichen Freund und Kollegen, und für meine Frau Mary Ann Mason, Kritikerin und Vertraute
«Wenn die Verhältnisse genau so zu sein scheinen, wie sie aussehen, dann ist die allernächste andere Möglichkeit die, dass alles von Grund auf Trug ist; wenn der Betrug auf der Hand zu liegen scheint, dann ist die wahrscheinlichste andere Möglichkeit die, dass keine Täuschung vorliegt.»
ERVING GOFFMAN, Strategische Interaktion.
«Von Interesse ist hier nicht die Kategorie der Moral, sondern die des Überlebens. Auf allen Ebenen, von der groben Tarnung bis zur Vision des Dichters, ist die Kraft der Sprache, zu verheimlichen, irrezuführen, im Zwielicht zu lassen, Hypothesen aufzustellen, zu erfinden, für das Gleichgewicht des Bewusstseins und die gesellschaftliche Entwicklung des Menschen unerlässlich …»
GEORGE STEINER, Nach Babel.
«Hätte wie die Wahrheit auch die Lüge nur ein Gesicht, wären wir besser dran. Wir würden dann einfach das Gegenteil von dem, was der Lügner sagt, für gewiß halten. Die Kehrseite der Wahrheit hat jedoch hunderttausend Erscheinungsformen und verfügt über einen unbegrenzten Spielraum.»
MICHEL DE MONTAIGNE. Essais, «Über die Lügner».
Vorwort
von Thorsten Havener
Dieses Vorwort zu verfassen, das ist für mich etwas ganz Besonderes. Denn das Thema «Lügen» ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe in meinen Büchern bislang ganz bewusst nie etwas über das Aufdecken von Unwahrheiten geschrieben. Das liegt ganz einfach daran, dass ich zu diesem Thema nichts zu sagen habe, was Paul Ekman nicht bereits gesagt hätte. Er ist zweifellos einer der bedeutendsten Beobachter und Analysten unserer Zeit.
Ekman ist einer der Köpfe hinter der Erfolgsserie Lie to me. Neben ihm wirkt sogar die Hauptperson Cal Lightman – übrigens herausragend gespielt von Tim Roth – wie ein kleiner Wicht. Ekman ist einfach eine Ikone. Forschungen werden bei ihm stets akribisch durchgeführt und sind, was seine Deutung angeht, einzigartig.
Paul Ekman ist besessen von der Mimik der Menschen und hat sie wie kein Zweiter unter die Lupe genommen. Einige seiner Erkenntnisse gelten noch heute als bahnbrechend: Denn Ekman hat allen Unkenrufen zum Trotz bewiesen, dass die Mimik – also alles, was sich in unserem Gesicht abspielt, während wir reden und denken – bei allen Menschen nach demselben Muster abläuft. Weltweit. Egal, aus welcher Kultur man kommt. Ob Sie mit einem Menschen aus Timbuktu oder Buxtehude reden: Die Emotionen in den Gesichtern sehen bei uns allen gleich aus. Wenn wir traurig sind, weinen wir, und wenn wir Ekel empfinden, rümpfen wir die Nase, das macht jeder so, überall auf der Welt. Ekman ist weit gereist und hat mit zahlreichen Probanden seine Forschungen angestellt, um das notwendige Wissen zu sammeln, zu katalogisieren, zu bewerten und auch weiterzugeben.
Ekman war Schüler des bedeutenden Psychologieprofessors Silvan Tomkins. Dieser hatte eine besondere Fähigkeit: Er konnte anhand der Bewegungen von Pferden erkennen, ob sie das nächste Rennen gewinnen würden oder nicht. Um so weit zu kommen, beobachtete er auf der Rennbahn mit einem Fernglas stundenlang, welche emotionale Beziehung ein Tier zum anderen rechts und links von ihm aufbaute. Aus dieser Erkenntnis zog er Rückschlüsse auf den Erfolg des betreffenden Pferdes im späteren Rennen. In seinen Analysen war Tomkins so treffsicher, dass er fast immer die Wetten gewann. Während er an seiner Doktorarbeit schrieb, engagierten ihn sogar professionelle Wettspezialisten. Er konnte einfach den Motivationsgrad des Rennpferds erspüren und damit auch seine Erfolgschancen im Rennen erahnen.
Ekman hatte Tomkins Anfang der sechziger Jahre kennengelernt und war sofort fasziniert von ihm und seiner Arbeit. Daraufhin machte er sich daran, ein Wörterbuch für das menschliche Gesicht zusammenzustellen. Damals waren die meisten Psychologen der Überzeugung, einen solchen Gesichtsatlas könnte es nicht geben, jedenfalls keinen, der zuverlässige Erkenntnisse lieferte. Die Mimik sei angeboren und unterscheide sich sowieso von Mensch zu Mensch, so argumentierten sie. Die Wissenschaftler glaubten also, die Mimik wäre genetisch fundiert und nur in geringem Maß erlernt.
Ekman war ursprünglich gar nicht am Thema «Mimik» interessiert gewesen. Er erforschte zunächst nur die Gestik und entwickelte eine Methode, mit deren Hilfe man bei Neurotikern bestimmte Störungen entlarven oder Depressive von Nichtdepressiven unterscheiden konnte. Weiterhin ließ seine Erkenntnis Rückschlüsse dahingehend zu, ob ein Patient auf eine zukünftige Therapie ansprechen würde oder nicht.
In dieser Zeit traf Ekman auf Silvan Tomkins, eine Begegnung, die er noch heute als Glücksfall bezeichnet. Zunächst war Ekman davon überzeugt gewesen, die Thesen von Tomkins hätten keinen hohen Erkenntniswert. Umso erstaunter war er von den Ergebnissen seiner eigenen Nachforschungen: Tomkins hatte recht. Die Mimik der Menschen ist als universell anzusehen und lässt zuverlässige Rückschlüsse auf bestimmte Emotionen zu. Ab diesem Moment wurde Ekman endgültig von dem Thema gepackt: Er wollte das Gesicht und seinen Ausdruck entschlüsseln. Die Fundgrube für alle menschlichen Regungen, um die sich bislang noch niemand systematisch gekümmert hatte.
Um das Lexikon der Mimik zu schreiben, ließ Ekman nichts aus. Er wollte jeden, aber auch wirklich jeden Gesichtsausdruck katalogisieren und deuten, also lernte er, alle Muskeln im Gesicht bewusst zu bewegen und bestimmte Mimikspiele immer wieder herbeizuführen und die Reaktionen des Gegenübers zu testen. Wenn er dazu nicht selbst in der Lage war, wandte er sich an eine Universität in Kalifornien und bat einen ihm bekannten Chirurgen, den entsprechenden Muskel mit einem elektrischen Stromstoß bei ihm selbst zu stimulieren. Das nenne ich Einsatz! Und der hat sich gelohnt: Mit seinem Kollegen Wallace Friesen erstellte Paul Ekman schließlich den einzigartigen Gesichtsatlas. Sein Traum wurde wahr. Sie identifizierten jeden Ausdruck, den ein Gesicht zeigen kann, und fanden heraus, dass es insgesamt 43 verschiedene Elemente des Ausdrucks gibt. Diese einzelnen Elemente nannten sie Aktionseinheiten. Darin bestand der erste Teil ihres Mammutprojekts. Anschließend machten sie sich daran, alle Aktionseinheiten verschieden zu kombinieren, und spielten jede Variation durch. Ein Aufwand, der sieben Jahre in Anspruch nahm. Aus all diesen Aktionseinheiten filterten Ekman und Friesen dann dreitausend schließlich noch feinere Aktionseinheiten heraus. Diese ließen dann erst ganz genaue Rückschlüsse auf die Gedankenwelt, die Emotionen eines Menschen zu.
Dieses Werk, lieber Leser und liebe Leserin, ist die Anleitung zum richtigen Gedankenlesen. Es ist unter dem Titel Facial Action Coding System, kurz FACS, zu finden und ist so in die Literatur eingegangen. Der Katalog ist 500 Seiten dick, und fast niemand hat ihn wirklich gelesen. Nur diejenigen, die sich professionell mit Mimik befassen, sollten ihn natürlich gelesen haben. Denn die Erkenntnisse sind zu wertvoll, als dass man darauf verzichten könnte: Sowohl für Therapeuten, Analytiker als auch für Trickfilmstudios sind diese Informationen grundlegend. Wussten Sie, dass Shrek und die Helden aus Toy Story mit Hilfe von FACS animiert wurden? Es muss also was dran sein, an diesem Wissen. Das System bietet in der Tat tiefe Einblicke in die geheime Sprache der Mimik.
Ich selbst befasste mich zum ersten Mal während meines Studiums in Monterey, Kalifornien, mit FACS. Ich hatte gerade mein Diplom in Übersetzen und Dolmetschen abgelegt und kann mich noch genau an den Morgen erinnern, an dem ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, beim Dolmetschen schon vorher zu wissen, was der Professor als Nächstes sagen würde. Ich hatte den Eindruck, vorab zu erkennen, wann er ernst wird, wann er einen Witz macht und wann es melancholisch wird. Immer einen kurzen Moment, bevor es dann wirklich eintraf. Damit hatte ich meinen Kollegen in der Dolmetscherkabine geradezu verängstigt. Wie konnte so etwas gehen? In diesem Buch können Sie die Lösung nachlesen. Durch die Arbeiten von Paul Ekman wurde auch ich inspiriert, mich tiefergehend mit der Sprache des Gesichts auseinanderzusetzen. Das war ein Aspekt, der meine berufliche Laufbahn erheblich beeinflussen sollte: Ich würde heute sicher keine Seminare und Vorträge halten, wenn ich diesen Anstoß nicht erfahren hätte. Von dem Bücher- und Vorwortschreiben ganz zu schweigen …
Letztes Jahr lud ich mir dann über ein amerikanisches iTunes-Konto die erste Staffel der Serie Lie to me herunter. Die Serie erzählt die Geschichte eines Professors, der im Gesicht des anderen erkennen kann, ob dieser lügt. Paul Ekman ist nicht nur der geistige Vater der Hauptfigur, er ist auch ein wichtiger Berater beim Verfassen der Drehbücher. Zum Registrieren des amerikanischen Kontos musste ich einen Wohnsitz in den USA angeben. Hierbei log ich einfach und gab die Adresse eines guten Freundes in New York an. Ich lade mir gern Serien auf meinen Computer. So kann ich auf Zugreisen die Zeit angenehm verbringen und muss keine zusätzlichen DVDs mit mir herumschleppen, denn auf Tour zählt jedes Gramm Gepäck. Ich weiß somit noch genau, wo ich die erste Sendung von Lie to me gesehen hatte: im ICE auf der Strecke zwischen Augsburg und Stuttgart. Ich war von den Socken gewesen! Genau so hatte ich mir die Bilder gewünscht. Bei meiner Ankunft in Duisburg hatte ich die erste Staffel schon halb durch. Wieder zu Hause angekommen, blätterte ich meine alte und zerfledderte Ausgabe des Buchs Telling Lies von Ekman durch, um darin mal wieder ein wenig zu stöbern und einen Bezug zwischen Buch und Film herzustellen. Nachdem ich dann die erste Staffel nach einigen Zugfahrten durchhatte, packte ich auch das Buch ins Reisegepäck. Altes Wissen wieder aufzufrischen, das kann nie schaden.
So kam mir dann auch letztes Jahr im Dezember zwischen Heidelberg und München die Idee, dem Rowohlt Verlag vorzuschlagen, dieses Buch übersetzen zu lassen. Das Buch, das Sie gerade in Händen halten, ist also praktisch ein Abfallprodukt der Deutsche-Bahn-Trips: Lie to me habe ich im Zug geschaut oder Telling Lies – der englische Originaltitel des Buchs – im Zug gelesen. Die Idee für eine deutsche Übersetzung war auf Schienen entstanden. Dann nimmt man auch die ein oder andere Verspätung gelassen hin, oder?
Ich habe das Wissen aus diesem Buch schon in unzähligen Auftritten und auch bei privaten Begegnungen angewendet. In meinen Seminaren und bei meinen Vorträgen gebe ich dem Publikum stets eine halbstündige Anleitung über das Aufdecken von Lügen. Eine spannende Welt. Und allein durch meine kurze Einleitung ist das Publikum oft sofort in der Lage zu entscheiden, welcher meiner Probanden auf der Bühne gelogen hat und wer nicht. Ihre Trefferquote ist erstaunlich hoch. Stellen Sie sich so erst mal Ihre Quote vor, nachdem Sie dieses Buch gelesen haben!
Auch im Fernsehen habe ich bereits mit Know-how aus diesem Buch Lügner überführt. Bei einem Dreh für das Magazin Extra testete ich eine junge Psychologiestudentin auf ihre Glaubwürdigkeit hin. Sie hatte schon einiges von Augenbewegungsanalysen und anderen Deutungsmöglichkeiten der Mimik gehört und sich geschworen, mir auf diese Erkenntnisse keinerlei Hinweise zu liefern. Das tat sie auch nicht. Allerdings war sie derart darauf konzentriert, ihre Regungen zurückzuhalten, dass Sie nach jeder Lüge die Mundwinkel nach oben zog. Diese konstant aufblitzende Bewegung überführte sie schließlich. Ein anderer Mann zog nach jeder seiner Lügen kurz seine Schulter nach oben. Der Sinn seiner Bewegungen war für mich somit offensichtlich. Und als ich ihm auf einem Monitor die Unterschiede in seiner Mimik und Gestik zu vorher zeigte und präsentierte, was passierte, wenn er log, konnte er kaum fassen, wie sehr er sein Verhalten änderte, sobald er log. Ich konnte an dem Drehtag fast alle Probanden überführen. Alles mit dem Wissen aus diesem Buch!
Einen Tag später drehten die Redakteure des Magazins Galileo einen Beitrag zum Thema «Lüge». Ich sollte gegen einen Polygraph, also einen Lügendetektor, antreten. Die Aufgabe: Drei junge Damen treffen sich in einem Café. Bei dem Besuch hat mindestens eine von ihnen – vielleicht haben aber auch zwei oder sogar alle drei – etwas gestohlen. Meine Aufgabe – und somit die des Lügendetektors – bestand nun darin, herauszufinden, welche der Damen etwas entwendet hatte.
Vor meiner Bewertung des Falls fand ein Lügendetektortest statt. Ich hatte keine Ahnung von den Ergebnissen dieses Tests. Ich wollte auch nichts wissen, denn der Schlüssel zum zuverlässigen Aufdecken von Lügen ist die Unvoreingenommenheit. Ich befragte also die drei Frauen nacheinander. Erwartungsgemäß beteuerten alle drei ihre Unschuld. Ich wusste: Es war mindestens eine Lügnerin dabei. Bei einer der Frauen war mir klar: Sie fiel raus. Ich vermutete, dass sie nichts gestohlen hatte und wahrheitsgemäß antwortete. Bei einer weiteren Probandin legte ich mich anschließend ebenfalls fest und behauptete, sie habe mich angelogen. Bei der dritten sah ich mich nicht in der Lage, eine Aussage zu treffen. Für mich war da nichts Besonderes zu erkennen. So erklärte ich meine Erkenntnisse auch den Redakteuren.
Das Ergebnis: Ich lag in meiner Analyse letztlich richtig. Denn die vermeintliche Lügnerin hatte tatsächlich gelogen und die Zweite hatte tatsächlich die Wahrheit gesagt. Jetzt der Clou: Die Undurchschaubare hatte einen Tag vor Drehbeginn ein Training bei einem professionellen Schauspieler absolviert. Er zeigte ihr, wie man durch überzeugendes Schauspielern lügen konnte, ohne dabei erwischt zu werden. Daher gingen für mich von ihr nur undeutbare Signale aus. Die Sachlage war also fast genau so, wie ich vermutet hatte, nämlich dass zwei Frauen gestohlen hatten und eine unschuldig war. Ich hatte jedenfalls keine Fehler gemacht.
Der Lügendetektor hatte sogar weniger Klarheit in die Sache gebracht. Über ihn konnte man zwar die Schauspielerin überführen, aber nicht die andere Lügnerin. Der Grund: Sie war darauf trainiert worden, einen Lügendetektor zu überlisten. Da ich, wie Paul Ekman auch, den Einsatz von Lügendetektoren genau aus diesem Grund nicht für sinnvoll halte, erkläre ich Ihnen, wie Sie ihn auf die falsche Spur bringen können. Wie ein Polygraph nämlich arbeitet, steht in diesem Buch, das werden Sie später nachlesen können. Daher spare ich mir die Erklärung an dieser Stelle. Aber merken Sie sich Folgendes: In der Praxis können Sie einen Lügendetektor überlisten, indem Sie Ihren Schließmuskel anspannen, wenn Sie die Wahrheit sagen, und ihn locker lassen, sobald Sie lügen. Auf gut Deutsch: «Hintern zu und durch …» Natürlich wissen die Hersteller von Lügendetektoren, dass viele Menschen diesen Trick kennen, und haben sich deshalb mittlerweile etwas einfallen lassen: Bei jeder Messung sitzt der Befragte nun auf einem flachen Kissen. Dieses Kissen erkennt, ob der Proband den Hintern zusammenkneift oder nicht. Bitte entschuldigen Sie an dieser Stelle meine etwas grobe und nichtwissenschaftliche Ausdrucksweise. Aber ein deutliches Wort ist mir gerade wichtiger als medizinisch korrekte, aber möglicherweise verwirrende Fachtermini. Der Trick klappt also leider nur bei einigen wenigen veralteten Polygraphen.
Die junge Frau in meinem Fall hatte allerdings einen viel besseren Trick parat: Sie dachte bei den wahrheitsgemäßen Antworten an ihr unangenehme Bilder. Sie stellte sich dann zum Beispiel vor, in einem brennenden Haus zu sitzen oder in einen Autounfall verwickelt zu sein. Sobald sie log, stellte sie sich angenehme Dinge vor, wie zum Beispiel einen schönen Sommertag am Strand, der ihr positive emotionale Regungen garantierte. Denn je aufwühlender eine Visualisierung wirkt, desto widersprüchlicher sind die Ergebnisse des Lügendetektors. Und mitunter damit unbrauchbar: Denn alle Macht kommt von innen.
Leider erklärte die Redaktion von Galileo in ihrem Beitrag nur, wie es die Dame es geschafft hatte, den Lügendetektor zu überlisten. Man erwähnte nicht, dass meine Probandin, mit der ich ein Problem hatte, vor der Befragung Schauspielunterricht genommen hatte. Der Beitrag vermittelte somit den Eindruck, als ob ich einen Fehler gemacht hätte, der Lügendetektor dagegen nur überlistet worden sei. So läuft das halt manchmal beim Fernsehen.
Diese Geschichte zeigt aber dennoch eine der größten Schwierigkeiten beim Thema «Lügen entlarven»: den Faktor Irrtum. Fehler werden vorkommen, solange es Menschen gibt, die etwas bewerten müssen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Ekman in diesem Buch auch auf dieses Thema eingeht und zeigt, wann und wie solche Fehler passieren können. Aber auch wenn man darum weiß, ein Restrisiko bleibt. Jeder Lügenermittler läuft Gefahr, voreingenommen oder vielleicht auch unachtsam zu sein. Beim Polygraph sind die Störer der starke Wille des Befragten oder auch technische Schwierigkeiten. So ist es meines Erachtens gut, dass in Deutschland keine Lügendetektoren vor Gericht zugelassen sind. Das wäre auch unseriös.
In den USA ist das anders. Mit schlimmen Folgen: Aufgrund falscher Analysen von Polygraphen sind dort schon Existenzen vernichtet worden. Manchmal konnten die Betroffenen sogar ihre Unschuld belegen. Trotzdem hatten sie keine Chance auf Rehabilitierung. Die war so aussichtslos wie ein reibungsloser Umzug einer Telefonanlage mit der Telekom – da kämpft man auch gegen Windmühlen.
Das Wissen in diesem Buch wird Ihnen sehr beim Umgang mit anderen Menschen helfen. Ihre Menschenkenntnis wird sich verfeinern. Hier steht, wie Sie es trainieren können, Mikroausdrücke, sprich kleinste Regungen in der Mimik, zu erkennen und zu deuten. Sie lernen also die grundlegenden Emotionen kennen, die hinter einem Gesichtsausdruck stecken können. Allein die Tatsache, dass es dafür zuverlässige Parameter gibt, haut meine Seminarteilnehmer regelmäßig vom Stuhl. Sie müssen sich aber selbst stetig schulen, unvoreingenommen zu bleiben. Das ist sehr schwer, aber möglich. Viele Erkenntnisse Ekmans decken sich mit meinen persönlichen Erfahrungen. Das freut mich ganz besonders, denn auf diesen zentralen Aussagen basieren auch meine Bücher.
Paul Ekman schreibt, dieses Werk sei gedacht für Menschen, die Lügen bei anderen entdecken wollen, es sei weniger ein Buch für diejenigen, die lernen wollten, besser zu lügen. Ganz klar: Talentierte Lügner brauchen kein Training. Die Geschichte kennt mehr als genug davon. Es gab sie schon immer, und es wird sie immer geben. Dagegen heißt der Ratschlag für den angehenden Lügenermittler: üben, üben, üben. Und der Vollständigkeit halber auch noch ein Tipp für den Lügner selbst: «Sag immer die Wahrheit.» Schon der großartige Max Frisch schrieb in Biedermann und die Brandstifter: «Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand.»
Mich hat das Wissen, das dieses Buch bereithält, sehr viel weitergebracht. Vielleicht gilt dasselbe auch für Sie.
München, im Oktober 2010
EinsEinführung
Wir schreiben den 15. September 1938, als eines der infamsten und folgenschwersten Täuschungsmanöver der Geschichte seinen Anfang nimmt. Zum ersten Mal begegnen sich der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler und der englische Premierminister Neville Chamberlain. Die Welt schaut zu und ist sich bewusst, dass dieses Gespräch die letzte Hoffnung sein könnte, einen neuen Weltkrieg zu vermeiden. Nur sechs Monate zuvor sind Hitlers Truppen in Österreich einmarschiert, um den «Anschluss» des Nachbarstaats an das Deutsche Reich zu vollziehen. England und Frankreich haben protestiert, sich sonst aber zurückgehalten. Am 12. September, drei Tage vor seinem Treffen mit Chamberlain, fordert Hitler auch den Anschluss eines Teils der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich und löst damit Unruhen in dem Land aus. Insgeheim hat Hitler bereits die Mobilmachung des deutschen Heeres befohlen, um die Tschechoslowakei anzugreifen, doch die Vorbereitungen werden den Rest des Monats in Anspruch nehmen. Falls es ihm gelingt, die Tschechen so lange von der Mobilmachung ihrer Armee abzuhalten, wird er durch einen Überraschungsangriff im Vorteil sein.
Um Zeit zu gewinnen, verheimlicht Hitler seine Kriegspläne vor Chamberlain und gibt ihm sein Wort, dass der Frieden bewahrt bleibe, sofern die Tschechen seine Forderungen erfüllen. Chamberlain lässt sich täuschen. Er überredet die Tschechen, nicht mobilzumachen, solange es noch eine Verhandlungschance mit Hitler gibt. Nach seinem Treffen mit Hitler schreibt Chamberlain an seine Schwester: «Trotz der Härte und Unnachgiebigkeit, die ich glaubte, in seinem Gesicht zu sehen, hatte ich den Eindruck, dass hier ein Mann vor mir stand, auf den man sich verlassen konnte, wenn er sein Wort gegeben hatte.»[1] Fünf Tage später verteidigt Chamberlain vor dem Parlament seine Politik gegenüber jenen, die Hitlers Wort in Zweifel ziehen, und erklärt, sein persönlicher Kontakt mit Hitler erlaube ihm zu sagen, dass er «meint, was er sagt».[2]
Als ich anfing, Lügen zu erforschen, war mir nicht klar, dass meine Arbeit für diese Art Lügen einmal bedeutsam werden könnte. Ich glaubte, sie wäre lediglich für Menschen interessant, die mit psychisch Kranken arbeiteten. Meine Beschäftigung mit Lügen begann nämlich, als ich Therapeuten meine Erkenntnis vortrug, dass Mimik universell ist, während Gesten kulturabhängig sind, und sie mich fragten, ob diese nonverbalen Verhaltensweisen preisgeben könnten, wann ein Patient lügt.[3] Normalerweise spielt das keine Rolle, aber es gewinnt an Bedeutung, wenn Patienten nach Suizidversuchen in die Klinik eingewiesen werden und behaupten, es gehe ihnen schon viel besser. Jeder Arzt fürchtet, genarrt zu werden, indem der Patient Selbstmord begeht, sobald er die Klinik mit ihren Einschränkungen hinter sich gelassen hat. Die praktische Sorge der Therapeuten warf eine grundlegende Frage zur menschlichen Kommunikation auf: Können Menschen, selbst wenn sie ziemlich aufgeregt sind, die Botschaften kontrollieren, die sie aussenden wollen, oder wird ihr nonverbales Verhalten das ans Licht bringen, was ihre Worte verbergen?
Auf der Suche nach einem Beispiel für eine Lüge sah ich mir meine Interviews mit Psychiatriepatienten noch einmal an. Eigentlich hatte ich sie gefilmt, um Äußerungen und Gesten auszusondern, die dazu beitragen könnten, Art und Schwere der psychischen Störung besser zu diagnostizieren. Da ich mich jetzt auf Täuschung konzentrierte, glaubte ich, Anzeichen von Lügen in den Filmen zu entdecken. Das Problem war: Wie konnte ich mir meines Urteils sicher sein? Nur in einem einzigen Fall gab es wegen des Geschehens nach dem Interview keinerlei Zweifel.
Mary war zweiundvierzig Jahre alt und Hausfrau. Beim letzten ihrer drei Selbstmordversuche meinte sie es ziemlich ernst. Sie hatte eine Überdosis Schlaftabletten genommen und wäre gestorben, hätte sie nicht zufällig jemand gefunden. Ihre Krankengeschichte unterschied sich kaum von der anderer Frauen, die an einer Midlifecrisis leiden. Die Kinder waren erwachsen und brauchten sie nicht mehr, ihr Ehemann schien mit seiner Arbeit ausgelastet zu sein. Mary fühlte sich überflüssig. Als sie in die Klinik kam, konnte sie den Haushalt nicht mehr in Ordnung halten, schlief schlecht und weinte die meiste Zeit vor sich hin. Während der ersten drei Wochen ihres Klinikaufenthalts bekam sie Medikamente und nahm an der Gruppentherapie teil. Darauf schien sie gut anzusprechen: Ihre Stimmung wirkte aufgehellt, und sie sprach nicht mehr davon, Selbstmord begehen zu wollen. In einem der gefilmten Interviews erzählte Mary ihrem Arzt, wie viel besser es ihr jetzt gehe, und bat ihn um eine Ausgangserlaubnis für das Wochenende. Doch bevor ihr die Erlaubnis erteilt wurde, gab sie zu, dass sie gelogen hatte, um sie zu bekommen. Noch immer wollte sie sich unbedingt das Leben nehmen. Nach drei Monaten in der Klinik hatte sich Marys Zustand wirklich gebessert, obwohl sie ein Jahr später einen Rückfall bekam. Inzwischen ist sie lange aus der Klinik entlassen, und es scheint ihr gutzugehen.
Das gefilmte Interview mit Mary führte die meisten jungen und sogar manchen erfahrenen Psychiater und Psychologen, denen ich es zeigte, hinters Licht.[4] Hunderte von Stunden verbrachten wir damit, schauten es uns immer wieder an und untersuchten jede Geste und jeden Gesichtsausdruck in Zeitlupe, um mögliche Täuschungshinweise zu entdecken. In einer kurzen Pause, die Mary machte, bevor sie die Frage des Arztes nach ihren Zukunftsplänen beantwortete, erkannten wir in der Zeitlupe einen flüchtigen verzweifelten Gesichtsausdruck. Er war so schnell verflogen, dass wir ihn bei den ersten Analysen des Films übersehen hatten.
Nachdem wir dann einmal auf die Idee gekommen waren, dass verborgene Gefühle in solchen sehr kurzen Mikroexpressionen sichtbar werden könnten, suchten wir gezielt nach weiteren und fanden jede Menge. Typischerweise wurden sie sofort von einem Lächeln überspielt. Wir stießen auch auf eine Mikrogeste. Wenn Mary dem Arzt erzählte, wie gut sie ihre Probleme im Griff habe, zeigte sie manchmal den Ansatz eines Achselzuckens – nicht die vollständige Gebärde, sondern nur einen Teil davon. Sie zuckte dann bloß mit einer Hand und drehte sie dabei ein wenig. Oder ihre Hände blieben ruhig, und sie hob stattdessen kurz eine Schulter an.
Wir glaubten, noch weitere nonverbale Anhaltspunkte für eine Täuschung zu sehen, waren aber nie sicher, ob wir da tatsächlich etwas entdeckt hatten oder es uns nur einbildeten. Denn jedes noch so unschuldige Verhalten wirkt verdächtig, wenn man weiß, dass jemand lügt. Unsere Befunde ließen sich nur mit objektiven Testverfahren überprüfen, die nicht davon beeinflusst waren, ob man wusste, dass eine Person log oder nicht. Hinzu kam, dass wir eine große Anzahl Menschen untersuchen mussten, um sicherzugehen, dass die gefundenen Anhaltspunkte für eine Täuschung keine Eigenarten der jeweiligen Person waren. Für den «Lügenermittler», also für denjenigen, der eine Lüge aufzudecken versucht, wäre es einfacher, wenn Verhaltensweisen, die das Täuschungsmanöver einer Person verraten, ebenso bei den Lügen anderer zutage treten. Gleichwohl konnte es sein, dass die Anzeichen für eine Täuschung je nach Person unterschiedlich ausfielen.
Wir dachten uns also ein Experiment aus, das Marys Lüge zum Vorbild nahm. Die Versuchspersonen sollten hoch motiviert sein, intensive negative Gefühle, die sie im Augenblick der Lüge empfanden, zu verbergen. Während sie einen grässlichen Film sahen, in dem blutige Operationsszenen gezeigt wurden, sollten sie ihre wahren Gefühle der Bestürzung, des Schmerzes und des Abscheus verheimlichen und einen Interviewer, der den Film nicht sehen konnte, überzeugen, sie sähen einen Film über schöne Blumen. (Unsere Ergebnisse werden in den Kapiteln 4 und 5 beschrieben.)
Ein gutes Jahr verging – noch immer waren wir im Anfangsstadium unserer Lügenexperimente –, bevor Personen an mich herantraten, die sich für ganz andere Lügen interessierten. Ließen sich meine Befunde und Methoden anwenden, um Menschen zu überführen, die unter Spionageverdacht standen? Im Lauf der Jahre, als unsere Erkenntnisse über Verhaltenshinweise auf Täuschungen zwischen Patient und Arzt in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wurden, nahmen die Anfragen zu. Hätten wir nicht vielleicht Lust, die Personenschützer für Regierungsbeamte so zu schulen, dass sie einen Attentäter anhand seines Gangs oder seiner Gesten ausmachen konnten? Wären wir in der Lage, dem FBI entsprechende Ausbildungsmethoden zu liefern, damit die Polizisten besser herausfinden konnten, ob ein Verdächtiger log? So war ich schließlich auch nicht mehr überrascht, als man mich bat, Unterhändler auf Gipfelkonferenzen dabei zu unterstützen, die Lügen ihrer Verhandlungspartner aufzudecken. Außerdem wurde ich gefragt, ob ich anhand der Fotos, die von Patricia Hearst während eines Banküberfalls gemacht worden waren, entscheiden könne, ob sie freiwillig oder gezwungenermaßen zur Räuberin geworden war. Zuletzt weitete sich das Interesse auf die internationale Ebene aus. Repräsentanten zweier mit den USA befreundeter Länder wandten sich an mich. Und als ich Vorträge in der Sowjetunion hielt, sprachen mich Funktionäre an, die angeblich an einem «elektrischen Institut» arbeiteten, wo man sich mit Verhören beschäftigte.
Über diese Art von Interesse war ich ganz und gar nicht erfreut, weil ich befürchtete, dass man meine Erkenntnisse missbrauchen, unkritisch übernehmen und allzu eifrig anwenden werde. Ich ahnte, dass sich nonverbale Täuschungshinweise in den meisten Fällen kriminellen, politischen oder diplomatischen Betrugs nicht deutlich genug zeigen würden. Aber es war nur so ein Gefühl. Als man mich danach fragte, konnte ich es nicht erklären. Deshalb musste ich herausfinden, warum Menschen überhaupt Fehler machen, wenn sie lügen. Denn nicht alle Lügen werden entlarvt, manche gelingen auch fehlerlos. Nichts im Verhalten muss auf eine Täuschung hinweisen – etwa durch einen zu lange zur Schau gestellten Gesichtsausdruck, eine fehlende Geste, eine vorübergehende Veränderung der Stimme. Es gibt nicht immer verräterische Zeichen, die den Lügner entlarven. Dennoch wusste ich, dass es Anhaltspunkte für eine Täuschung geben kann. Auch die entschlossensten Lügner können sich durch ihr eigenes Verhalten verraten. War man sich einmal darüber im Klaren, wann Lügen erfolgreich sind und weswegen sie scheitern, wie man Anhaltspunkte für eine Täuschung aufdeckt und wann man es gar nicht erst versuchen sollte, dann würde man auch verstehen, was Lügen, Lügner und Lügenermittler ausmacht.
Als Hitler Chamberlain anlog und Mary ihren Arzt waren beide Male äußerst schwerwiegende Täuschungen im Spiel – es ging um Leben und Tod. Beide verheimlichten ihre Pläne, und beide heuchelten als wesentlichen Bestandteil ihrer Lüge Emotionen, die sie nicht wirklich empfanden. Aber die Unterschiede zwischen ihren Lügen sind enorm. Hitler ist ein Beispiel für einen später noch zu beschreibenden «geborenen Darsteller». Und abgesehen von dieser natürlichen Begabung, besaß er natürlich sehr viel mehr Übung und Erfahrung im Täuschen als Mary.
Hitler hatte auch den zusätzlichen Vorteil, jemanden zu täuschen, der sich nur zu gern in die Irre führen ließ. Chamberlain war ein williges Opfer, er wollte Hitlers Lüge glauben, dass dieser keinen Krieg anzettelte, wenn nur die Grenzen der Tschechoslowakei seinen Forderungen entsprechend neu gezogen würden. Sonst hätte Chamberlain nämlich zugeben müssen, dass seine Appeasementpolitik gescheitert war und er sein Land sogar geschwächt hatte. Auf diesen Umstand hat die Politikwissenschaftlerin Roberta Wohlstetter in einem ganz ähnlichen Zusammenhang aufmerksam gemacht. Sie analysierte die Rolle von Täuschungsmanövern bei Rüstungswettläufen und kam dabei auf die Verletzung des Deutsch-Britischen Flottenabkommens von 1936 durch Deutschland zu sprechen: «der Betrüger und der Betrogene … haben beide ein Interesse daran, die Illusion aufrechtzuerhalten. Beide müssen so tun, als sei das Abkommen nicht verletzt worden. Die von Hitler geschickt geschürte Furcht der Engländer vor einem Rüstungswettlauf führte zu einem Flottenabkommen, in dem die Engländer (ohne Franzosen und Italiener konsultiert zu haben) den Versailler Vertrag stillschweigend revidierten. Und Londons Angst vor einem Rüstungswettlauf hinderte die Politiker daran, Verletzungen der neuen Vereinbarung wahrzunehmen und einzugestehen.»[5]
Bei vielen Täuschungen ignoriert das Opfer die Fehler des Lügners, interpretiert zweideutiges Verhalten so wohlwollend wie möglich zu dessen Gunsten und trägt so stillschweigend dazu bei, die Lüge aufrechtzuerhalten, um ihre Aufdeckung und die schrecklichen Konsequenzen daraus zu vermeiden. Ignoriert ein Ehemann die Anzeichen für die Affären seiner Frau, kann er die Erniedrigung zumindest aufschieben, als gehörnter Gatte und womöglich mit den Scheidungspapieren in der Hand dazustehen. Sogar wenn er sich insgeheim ihre Untreue eingesteht, macht er das Spiel weiter mit und deckt ihre Lügen nicht auf, um sein Wissen ihr gegenüber nicht einräumen zu müssen oder um eine Auseinandersetzung mit ihr zu vermeiden. Solange nichts offen ausgesprochen wird, kann er sich die wenn auch noch so geringe Hoffnung machen, dass er vielleicht falschliegt und sie doch keine Affäre hat.
Nicht jedes Opfer ist so bereitwillig. Manchmal gibt es nichts zu gewinnen, wenn man eine Lüge ignoriert oder dazu beiträgt, sie aufrechtzuerhalten. Manche Lügenermittler haben nur einen Vorteil, wenn sie die Lüge aufdecken – verlieren können sie dabei nichts. Der Vernehmungsbeamte bei der Polizei kann nur verlieren, wenn er hereingelegt wird. Das trifft auch auf den Kreditsachbearbeiter einer Bank zu. Beide erledigen ihre Arbeit nur dann zufriedenstellend, wenn sie den Lügner entlarven und den Ehrlichen erkennen. Häufig wird das Opfer sowohl zum Verlierer als auch zum Gewinner, wenn es sich in die Irre führen lässt oder die Lüge aufdeckt. Aber Gewinn und Verlust halten sich möglicherweise nicht ganz die Waage.
Für Marys Arzt stand nicht viel auf dem Spiel, wenn er ihrer Lüge glaubte. Litt sie tatsächlich nicht mehr unter Depressionen, konnte er sich selbst einen gewissen Anteil an ihrer Erholung zuschreiben. Aber auch wenn ihre Gesundheit in Wahrheit nicht wiederhergestellt war, hatte er nicht viel zu verlieren. Anders als bei Chamberlain stand hier nicht seine ganze Karriere auf dem Spiel. Er hatte sich eben nicht auf eine bestimmte Einschätzung festgelegt, die widerlegt worden wäre, wenn er Marys Lüge aufdeckte. Er hatte viel mehr zu verlieren, wenn er auf sie hereinfiel, als zu gewinnen, wenn sie ehrlich war. Für Chamberlain jedenfalls war 1938 alles zu spät. Sollte Hitler unehrlich sein und gelänge es nicht, seiner Aggression anders als mit Krieg Einhalt zu gebieten, dann wäre Chamberlains Karriere beendet, und der Krieg, den er zu verhindern gehofft hatte, würde ausbrechen.
Ganz abgesehen von Chamberlains Motiven, Hitler zu glauben, war ein Erfolg der Lüge auch deshalb wahrscheinlich, weil keine starken Emotionen verheimlicht werden mussten. In den meisten Fällen scheitern Lügen, weil gewisse Anzeichen einer verheimlichten Emotion durchsickern. Je stärker die Emotionen sind, die bei einer Lüge eine Rolle spielen, und je mehr unterschiedliche Emotionen im Spiel sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich irgendein Verhalten Bahn bricht, das die Lüge verrät. Hitler hätte mit Sicherheit keine Schuldgefühle gehabt – eine Emotion, die für den Lügner in zweifacher Hinsicht problematisch ist. Denn nicht nur sickern Anzeichen davon durch, sondern die Last der Schuld könnte den Lügner sogar dazu bewegen, Fehler zu machen, um ertappt zu werden. Hitler empfand keine Schuld dabei, den Vertreter eines Landes zu belügen, das zu seinen Lebzeiten Deutschland eine demütigende militärische Niederlage beigebracht hatte. Im Gegensatz zu Mary teilte Hitler auch keine grundlegenden Werte mit seinem Opfer. Er respektierte oder bewunderte Chamberlain nicht. Mary dagegen musste starke Gefühle verheimlichen, sollte ihre Lüge erfolgreich sein. Sie musste die Verzweiflung und die Seelenqual unterdrücken, die sie zum Selbstmord trieben. Und Mary hatte allen Grund, sich schuldig zu fühlen, als sie ihre Ärzte anlog, denn sie mochte sie, bewunderte sie und wusste, dass sie ihr nur helfen wollten.
Aus all diesen und weiteren Gründen ist es normalerweise viel einfacher, im Verhalten eines Suizidpatienten oder eines lügenden Ehepartners Anhaltspunkte für eine Täuschung aufzudecken als bei einem Diplomaten oder bei einem Doppelagenten. Aber nicht jeder Diplomat, Kriminelle oder Geheimdienstmann ist ein perfekter Lügner. Manchmal machen sie auch Fehler. Durch meine Analysen lässt sich besser einschätzen, ob es einem gelingen wird, Täuschungshinweise zu entdecken, oder ob man in die Irre geführt wird. Meine Botschaft an all jene, die ein Interesse haben, Lügen im politischen oder kriminellen Kontext aufzuspüren, lautet freilich nicht, Verhaltenshinweise zu ignorieren, sondern vorsichtiger zu sein und sich sowohl die Grenzen als auch die Möglichkeiten stärker bewusstzumachen.
Obwohl es manchen Beweis dafür gab, dass sich im Verhalten Täuschungshinweise finden lassen, galt ihre Existenz bei der Veröffentlichung des Buches noch nicht als zweifelsfrei nachgewiesen. Meine Untersuchungen, wie und warum die Menschen lügen und wann Lügen auffliegen, wurden durch die Ergebnisse von Lügenexperimenten sowie durch historische und fiktive Berichte bestätigt. Aber noch war keine Zeit gewesen, um zu prüfen, ob diese Ergebnisse neuen Experimenten und der kritischen Auseinandersetzung standhielten. Ich entschied mich, mit der Veröffentlichung des Buches nicht zu warten, bis alle Antworten gegeben waren. Denn diejenigen, die Lügner zu entlarven versuchen, warten nicht. Wo bei einem Fehler am meisten auf dem Spiel stand, wurden bereits Versuche unternommen, nonverbale Anhaltspunkte für Täuschungsmanöver ausfindig zu machen. Sogenannte Experten, die mit der wissenschaftlichen Diskussion nicht genügend vertraut waren, boten ihre Dienste als Lügenermittler bei der Auswahl von Geschworenen und bei Einstellungsgesprächen an. Einige Polizisten und andere, die ebenfalls professionell mit dem Lügendetektor arbeiteten, wurden im Umgang mit nonverbalen Anhaltspunkten für eine Täuschung geschult. Doch ungefähr die Hälfte der Informationen in den Unterrichtsmaterialien, die ich sichtete, war falsch. Zollbeamte nahmen an einem Spezialkurs teil, um nonverbale Hinweise auf Schmuggelaktionen zu entdecken. Man sagte mir, dass meine Erkenntnisse bei diesem Kurs benutzt würden, aber wiederholte Anfragen, das Unterrichtsmaterial einsehen zu dürfen, führten lediglich zu dem wiederholten Versprechen, «wir melden uns umgehend wieder bei Ihnen».
In Erfahrung zu bringen, was die Geheimdienste trieben, war ebenfalls unmöglich. Ich wusste von ihrem Interesse an meiner Arbeit, seit das Verteidigungsministerium mich einmal eingeladen hatte, zu erläutern, welche Möglichkeiten und Gefahren meiner Meinung nach damit verbunden waren. Danach hörte ich immer wieder Gerüchte, dass die Dienste ihre eignen Projekte weiterverfolgen. Ich konnte auch die Namen der Leute ausfindig machen, die damit zu tun hatten, doch meine Briefe an sie wurden entweder nicht beantwortet, oder man speiste mich mit dem Satz ab, man dürfe mir nichts sagen. Ich machte mir Sorgen wegen all dieser «Experten», die sich weder einer öffentlichen Überprüfung noch der beißenden Kritik der Wissenschaftsgemeinde stellten. Dieses Buch sollte ihnen und ihren Arbeitgebern meine Sicht der Gefahren und der Möglichkeiten verdeutlichen.
Als ich das Buch schrieb, richtete ich mich aber nicht nur an diejenigen, die mit lebensbedrohlichen Täuschungsmanövern zu tun haben. Ich bin überzeugt, dass die Beschäftigung damit, wie und wann Menschen lügen, zum Verständnis vieler zwischenmenschlicher Beziehungen beitragen kann. Nur bei wenigen kommt Täuschung oder zumindest potenzielle Täuschung nicht vor. Eltern lügen ihre Kinder an, wenn es um Sex geht, um ihnen ein Wissen zu ersparen, das sie für nicht kindgerecht halten. Genauso werden ihre Kinder, sobald sie Heranwachsende geworden sind, ihre sexuellen Abenteuer geheim halten, weil die Eltern sie sowieso nicht verstehen würden. Lügen gibt es zwischen Freunden (selbst Ihr bester Freund wird das nicht zugeben), zwischen Lehrer und Schülern, Arzt und Patienten, Ehemann und Ehefrau, Zeugen und Geschworenen, Verkäufer und Kunden.
Das Lügen ist ein so wesentlicher Bestandteil menschlicher Existenz, dass ein besseres Verständnis dieses Phänomens für fast alle Lebensbereiche von Bedeutung ist. Vielleicht erschrecken manche über diese Behauptung, weil sie das Lügen als tadelnswert betrachten. Diese Ansicht teile ich nicht. Man macht es sich zu einfach, wollte man darauf bestehen, dass in einer Beziehung niemand jemals lügen darf. Ich würde auch nicht vorschreiben wollen, dass jede Lüge aufgedeckt werden muss. Ratgeber-Kolumnistin Ann Landers trifft ins Schwarze, wenn sie ihren Lesern mit auf den Weg gibt, dass man die Wahrheit als Knüppel benutzen kann, um jemandem auf grausame Weise Schmerzen zuzufügen.
Auch Lügen können grausam sein, aber nicht alle. Manche Lügen haben altruistische Motive, wenn ihr Vorkommen auch geringer ist, als die Lügner behaupten. Manche gesellschaftlichen Beziehungen pflegt man nur deshalb, weil sie Mythen aufrechterhalten. Doch sollte sich kein Lügner allzu gedankenlos anmaßen zu glauben, dass ein Opfer sich wünscht, irregeführt zu werden. Und kein Lügenermittler sollte sich allzu leichtfertig das Recht herausnehmen, jede Lüge aufzudecken. Einige Lügen sind harmlos, ja sogar human. Die Entlarvung mancher Lügen könnte das Opfer oder einen Dritten demütigen. All diese Dinge müssen wir noch eingehender betrachten, wenn wir andere Probleme besprochen haben. Beginnen wollen wir mit einer Definition des Lügens, einer Beschreibung der beiden Grundformen des Lügens und der beiden Arten von Täuschungshinweisen.
ZweiLügen, Lecks und Täuschungshinweise
Acht Jahre nach seinem Rücktritt vom Amt des US-Präsidenten stritt Richard Nixon ab, gelogen zu haben, gestand aber ein, er habe sich, genau wie andere Politiker auch, verstellt. Das sei notwendig, wenn man ein öffentliches Amt erreichen und sich darin behaupten wolle, sagte er. «Sie können nicht einfach sagen, was Sie über diese oder jene Person denken, weil Sie sie vielleicht noch einmal brauchen werden … Ihre Meinung über andere Staatsoberhäupter können Sie nicht zum Ausdruck bringen, weil Sie höchstwahrscheinlich später noch mit ihnen verhandeln müssen.»[1] Nicht nur Nixon vermeidet lieber den Begriff lügen, wenn sich das Zurückhalten der Wahrheit rechtfertigen lässt.[*] Das Oxford English Dictionary definiert die Lüge so: «Im heutigen Sprachgebrauch drückt das Wort [Lüge] in der Regel auf sehr scharfe Weise moralische Missbilligung aus und wird in höflichen Gesprächen tendenziell vermieden, wobei die alternativ gebräuchlichen Synonyme Unrichtigkeit und Unwahrheit relativ beschönigend sind.»[2] Es ist einfach, einen unaufrichtigen Menschen als Lügner zu bezeichnen, wenn er unbeliebt ist, aber es ist sehr schwer, dieses Wort zu benutzen, wenn er populär ist und bewundert wird. Viele Jahre vor Watergate war Nixon für seine Gegner von der Demokratischen Partei der Inbegriff des Lügners – «Würden Sie von diesem Mann einen Gebrauchtwagen kaufen?» –,während seine republikanischen Bewunderer sein Talent, Dinge zu verheimlichen und zu verschleiern, als Beweis politischer Gerissenheit priesen.
Bei meiner Definition des Lügens und der Täuschung – ich benutze beide Worte abwechselnd und synonym – spielen diese Dinge allerdings keine Rolle. Viele Menschen sprechen die Unwahrheit, ohne dabei zu lügen, zum Beispiel jene, die unwissentlich falsche Informationen verbreiten. Eine Frau mit der Wahnvorstellung, sie sei Maria Magdalena, lügt nicht, obwohl ihre Behauptung falsch ist. Und wer als Anlageberater seinem Kunden einen schlechten Rat gibt, lügt ebenso wenig, es sei denn, er wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, dass der Rat falsch ist. Auch wer mit seinem äußeren Erscheinungsbild einen falschen Eindruck vermittelt, muss nicht unbedingt ein Lügner sein. Eine Gottesanbeterin, die sich als Blatt tarnt, lügt genauso wenig wie ein Mann, dessen hohe Stirn mehr Intelligenz verspricht, als er in Wirklichkeit hat.[*]
Ein Lügner kann sich entscheiden, nicht zu lügen. Wenn er das Opfer hinters Licht führt, so geschieht es vorsätzlich: Der Lügner hat die Absicht, das Opfer falsch zu informieren. Die Lüge mag in den Augen des Lügners oder der Öffentlichkeit gerechtfertigt sein oder nicht; der Lügner kann ein guter oder ein schlechter Mensch, beliebt oder unbeliebt sein. Aber er hat die Möglichkeit, sich zwischen Wahrheit und Lüge zu entscheiden, und er kennt den Unterschied.[3] Pathologische Lügner, die wissen, dass sie unaufrichtig sind, aber ihr Verhalten nicht im Griff haben, entsprechen nicht meiner Definition. Auch Personen, die nicht einmal wissen, dass sie lügen – sogenannte Opfer von Selbstbetrug –, gehören nicht dazu.[*] Ebenso könnte ein Lügner im Lauf der Zeit an seine eigene Lüge glauben. Wenn das geschieht, ist er kein Lügner mehr, und seine Unwahrheiten dürften überdies viel schwieriger aufzudecken sein – aus Gründen, die ich im nächsten Kapitel erläutern werde.
Ein Vorfall aus dem Leben Mussolinis zeigt, wie der Glaube an die eigene Lüge nicht immer vorteilhaft sein muss: «1938 war die Zusammensetzung der [italienischen] Heeresdivisionen von drei auf zwei Regimenter reduziert worden. Das gefiel Mussolini, da er nun sagen konnte, dem Faschismus stünden sechzig Divisionen statt nur halb so viele zur Verfügung. Aber die Umstellung verursachte ausgerechnet kurz vor Kriegsausbruch ein heilloses Durcheinander; und weil Mussolini vergaß, was er angeordnet hatte, schätzte er einige Jahre später seine Truppenstärke tragischerweise falsch ein. Abgesehen von Mussolini selbst, hatten sich offenbar nur wenige Leute davon täuschen lassen.»[4]
Nicht nur der Lügner muss bei der Definition der Lüge berücksichtigt werden, sondern auch die Zielperson des Lügners. Bei einer Lüge hat das Opfer weder darum gebeten, hinters Licht geführt zu werden, noch hat der Lügner seine Absicht im Voraus angekündigt. Es wäre grotesk, beispielsweise Schauspieler als Lügner zu bezeichnen. Ihr Publikum ist damit einverstanden, für eine bestimmte Zeit in die Irre geführt zu werden – deshalb sind sie gekommen. Ein Schauspieler gibt sich, im Gegensatz zum Betrüger, nicht als jemand anders aus, ohne vorher anzukündigen, dass dies nur eine Pose ist, die er für eine Weile einnimmt. Dagegen würde ein Kunde kaum wissentlich dem Rat eines Brokers folgen, der ankündigt, er liefere überzeugende, aber falsche Informationen. Wenn die Psychiatriepatientin Mary ihrem Arzt gesagt hätte, sie täusche ihre Gefühle lediglich vor, könnte von Lüge keine Rede sein. Dasselbe gilt auch für Hitler, der Chamberlain hätte raten können, er solle seinen Versprechungen nicht vertrauen.
Ich definiere Lüge oder Täuschung daher so, dass eine Person beabsichtigt, eine andere irrezuführen. Und zwar vorsätzlich, ohne vorherige Ankündigung ihrer Absicht und ohne ausdrücklich von der Zielperson darum gebeten worden zu sein.[*] Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten zu lügen: um zu verheimlichen oder um zu verfälschen.[5] Beim Verheimlichen unterschlägt der Lügner gewisse Informationen, ohne wirklich die Unwahrheit zu sagen. Beim Verfälschen kommt ein zusätzliches Element ins Spiel: Der Lügner unterschlägt nicht nur wahre Informationen, sondern stellt falsche Informationen als Wahrheiten dar. Häufig ist es nötig, Verheimlichen und Verfälschen miteinander zu verbinden, um die Täuschung durchzuziehen, manchmal aber kommt der Lügner allein mit einer Verheimlichung davon.
Nicht jeder betrachtet das Verheimlichen als Lüge; manche Menschen behalten sich dieses Wort für den dreisteren Akt des Verfälschens vor.[6] Wenn der Arzt dem Patienten nicht erzählt, dass seine Krankheit tödlich ist, wenn der Ehemann nicht erwähnt, dass er seine Mittagspause mit der besten Freundin seiner Frau im Motel verbracht hat, wenn der Polizist dem Verdächtigen nicht sagt, dass eine «Wanze» das Gespräch mit seinem Rechtsanwalt aufzeichnet, dann ist keine falsche Information vermittelt worden. Und dennoch erfüllt jedes dieser Beispiele meine Definition von Lüge. Die Zielpersonen haben nicht darum gebeten, irregeführt zu werden, während die Verheimlicher vorsätzlich handelten, ohne zuvor ihre Absicht der Irreführung kundzutun. Hier wurden bewusst und nicht etwa unabsichtlich Informationen zurückgehalten. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn Verheimlichung nicht gleichbedeutend mit einer Lüge ist, weil man im Voraus seine Absicht bekanntgegeben hat oder das Gegenüber sich mit einer Irreführung einverstanden erklärt hat. Falls der Ehemann und seine Frau eine offene Ehe führen, in der beide Seiten ihre Affären verheimlichen, solange sie nicht direkt darauf angesprochen werden, dann ist die Verheimlichung des Schäferstündchens im Motel keine Lüge. Nach juristischer Definition jedoch haben Verdächtiger und Anwalt das Recht auf private Kommunikation; wird die Verletzung dieses Rechts verheimlicht, so ist dies stets eine Lüge.
Wenn Lügner sich aussuchen können, wie sie lügen wollen, ziehen sie normalerweise das Verheimlichen dem Verfälschen vor. Das bietet manche Vorteile. Zunächst fällt das Verheimlichen gewöhnlich leichter als das Verfälschen – man muss sich nichts ausdenken. Andernfalls muss man die ganze Geschichte im Voraus ausgearbeitet haben, um nicht ertappt zu werden. Abraham Lincoln soll gesagt haben, sein Gedächtnis sei nicht gut genug, um ein Lügner zu sein. Liefert ein Arzt eine falsche Erklärung für die Symptome eines Patienten, weil er ihm verheimlichen will, dass seine Krankheit unheilbar ist, so muss er das im Gedächtnis behalten, um sich nicht in Widersprüche zu verwickeln, wenn er ein paar Tage später wieder darauf angesprochen werden sollte.
Vielleicht zieht man das Verheimlichen auch deshalb vor, weil es weniger anstößig zu sein scheint als die Verfälschung. Es ist eher eine passive als eine aktive Angelegenheit. Obwohl die Zielperson gleichermaßen Schaden nehmen kann, fühlt sich der Lügner beim Verheimlichen möglicherweise weniger schuldig als beim Verfälschen.[*] Er kann sich damit beruhigen, das Opfer kenne die Wahrheit in Wirklichkeit, wolle sich ihr aber nicht stellen. Eine solche Lügnerin könnte etwa denken: «Mein Mann muss wissen, dass ich nichts anbrennen lasse, schließlich fragt er mich nie, wo ich meine Nachmittage verbringe. Mit meiner Diskretion nehme ich Rücksicht; ich belüge ihn ganz bestimmt nicht, wenn es darum geht, was ich tue. Ich ziehe es vor, ihn nicht zu erniedrigen. Ich will ihn nicht zwingen, meine Affären abzusegnen.»
Verheimlichende Lügen sind außerdem im Nachhinein viel leichter zu kaschieren, sollten sie entdeckt werden. Der Lügner muss sich dabei nicht so weit vorwagen. Er hat viele Entschuldigungen parat – Unkenntnis, die Absicht, es später bestimmt zuzugeben, ein schlechtes Gedächtnis und so weiter. Wer unter Eid aussagt, «wenn ich mich recht erinnere», hält sich ein Hintertürchen offen für den Fall, dass er später mit etwas konfrontiert wird, das er verheimlicht hat. Behauptet ein Lügner, sich an etwas nicht zu erinnern, obwohl er sich sehr wohl daran erinnert, es aber zurückhält, so befindet er sich auf halbem Weg zwischen Verheimlichung und Verfälschung. Dazu kommt es, wenn er nicht weiter einfach schweigen kann, etwa weil er direkt gefragt wird oder auf Widerspruch stößt. Muss der Lügner dann nur eine Gedächtnislücke vortäuschen, umgeht er es, sich an eine Geschichte erinnern zu müssen, die so nie stattgefunden hat. Das Einzige, woran er denken muss, ist die unzutreffende Behauptung, ein schlechtes Gedächtnis zu haben. Und sollte die Wahrheit später doch noch herauskommen, kann der Lügner immer vorgeben, nicht gelogen zu haben, da er ja lediglich ein Problem mit seinem Gedächtnis habe.
Ein Vorfall während des Watergate-Skandals, der zum Rücktritt Präsident Nixons führte, veranschaulicht diese Strategie. Zunächst hatten die Präsidentenberater H.R. Haldeman und John Ehrlichman zurücktreten müssen, weil die Beweise immer erdrückender wurden, dass die beiden in den Einbruch und die nachfolgende Vertuschung verstrickt waren. Als der Druck auf Nixon selbst zunahm, übernahm Alexander Haig Haldemans Position. «Haig war erst knapp einen Monat wieder zurück im Weißen Haus, als er am 4. Juni 1973 mit Nixon darüber sprach, wie sie auf die schwerwiegenden Anschuldigungen von John W. Dean, einem ehemaligen Berater des Weißen Hauses, reagieren sollten. Eine Tonbandaufnahme dieser Diskussion zwischen Nixon und Haig gelangte im Vorfeld des drohenden Amtsenthebungsverfahrens an die Öffentlichkeit. Darin riet Haig Nixon, Fragen zu den Beschuldigungen auszuweichen, ‹indem Sie sagen, Sie könnten sich einfach nicht daran erinnern›.»[7]
Eine Gedächtnislücke ist jedoch nur unter bestimmten Umständen glaubhaft. Wird der Arzt gefragt, ob die Testergebnisse negativ seien, kann er kaum behaupten, sich nicht daran zu erinnern. Dasselbe gilt für den Polizisten, wenn der Verdächtige ihn fragt, ob das Zimmer verwanzt sei. Auf eine Gedächtnislücke kann er sich nur bei weniger bedeutsamen oder lange zurückliegenden Angelegenheiten berufen. Selbst der Lauf der Zeit kann ein Versagen der Erinnerung nicht rechtfertigen, wenn die Ereignisse so außergewöhnlich waren, dass jeder andere sie niemals vergessen würde, ganz gleich, wann sie geschahen.
Wird der Lügner von seinem Opfer zur Rede gestellt, hat er nicht mehr die Wahl, ob er verheimlichen oder verfälschen will. Wenn die Ehefrau ihren Mann fragt, warum sie ihn in der Mittagspause nicht erreichen konnte, muss er zur Verfälschung greifen, um seine Affäre weiterhin geheim zu halten. Man kann darüber streiten, ob sogar die übliche Frage beim Abendessen – «Wie war dein Tag?» – ein Wunsch nach Information ist, aber eine ehrliche Antwort darauf lässt sich umgehen. Der Mann kann andere Dinge erwähnen, um das Schäferstündchen zu verheimlichen, es sei denn, eine direkte Nachfrage zwingt ihn dazu, sich zwischen verfälschen oder die Wahrheit sagen zu entscheiden.
Bei manchen Lügen ist von Anfang an eine Verfälschung erforderlich, weil Verheimlichen allein nicht genügt. Die Psychiatriepatientin Mary musste nicht nur ihren Kummer und ihre Suizidpläne verbergen, sie musste obendrein vortäuschen, dass es ihr besserging und sie das Wochenende mit ihrer Familie verbringen wollte. Will man Berufserfahrung vortäuschen, um einen Job zu ergattern, kann man sich nicht allein auf Verheimlichung verlassen. Man muss nicht nur seine Unerfahrenheit verbergen, sondern auch einen entsprechenden Lebenslauf erfinden. Wer einer langweiligen Party entkommen möchte, ohne den Gastgeber zu brüskieren, muss nicht nur verheimlichen, dass er lieber zu Hause fernsehen möchte, sondern sollte sich auch eine akzeptable Entschuldigung ausdenken, wie etwa einen frühen Termin am nächsten Morgen, Probleme mit dem Babysitter oder dergleichen.
Auch wenn die Lüge es nicht unmittelbar verlangt, hilft das Verfälschen dem Lügner, alle Hinweise auf das Verborgene zu verschleiern. Diese Anwendung der Verfälschung ist vor allem dann nötig, wenn Emotionen verheimlicht werden sollen. Wird die Emotion nicht mehr wirklich empfunden, ist es nicht schwer, sie zu verbergen. Viel schwieriger ist es, eine Emotion zu verschleiern, die man gerade empfindet, vor allem dann, wenn sie sehr stark ist. Panische Angst ist schwerer zu verbergen als Sorge, so wie man Wut schwerer verheimlichen kann als Verärgerung. Je stärker die Emotion, umso wahrscheinlicher ist es, dass ein Anzeichen dafür durchsickert, auch wenn sich der Lügner nach Kräften um Verheimlichung bemüht. Täuscht er eine andere Emotion vor, die er nicht wirklich fühlt, kann dies dazu beitragen, die tatsächlich empfundene und verheimlichte Emotion zu verschleiern. Die Verfälschung einer Emotion kann das Durchsickern einer verheimlichten Emotion verhindern.
Zur Veranschaulichung dieser und ähnlicher Situationen, die ich bisher beschrieben habe, möge eine Passage aus John Updikes Roman Heirate mich dienen. Ehemann Jerry bekommt zufällig mit, wie seine Ehefrau Ruth mit ihrem Geliebten telefoniert. Bis zu diesem Punkt in dem Buch ist es Ruth gelungen, ihre Affäre zu verheimlichen, ohne zu Verfälschungen greifen zu müssen. Nun aber, da sie direkt von ihrem Mann angesprochen wird, muss sie es tun. Während es bisher das Ziel ihrer Lüge gewesen ist, Jerry nichts von ihrer Affäre wissen zu lassen, zeigt dieses Ereignis, wie schnell bei einer Lüge Emotionen ins Spiel kommen können und wie diese Emotionen, wenn sie sich erst eingeschlichen haben, dafür sorgen, dass noch mehr verheimlicht werden muss.
«Jerry hatte zu ihrem Schrecken die letzten Worte eines Telefongesprächs mit Richard [ihrem Liebhaber] mitgehört. Sie hatte geglaubt, er sei hinten im Garten und harkte. Er tauchte aus der Küche auf und fragte sie: ‹Wer war das?›
Panik befiel sie. ‹Oh, irgendwer. Eine Frau von der Sonntagsschule, die fragte, ob wir Joanna und Charlie anmelden wollen.›»[8]
Panik allein ist noch kein Beweis für eine Lüge, doch sollte Jerry sie bemerken, könnte ihn das misstrauisch machen, weil er glauben würde, dass Ruth nur dann Anzeichen von Panik zeigt, wenn sie etwas zu verbergen hat. Vernehmer berücksichtigen häufig nicht, dass völlig unschuldige Menschen ängstlich werden können, sobald man sie verhört. Ruth befindet sich in einer schwierigen Lage. Sie hat nicht vorausgesehen, dass sie einmal eine Verfälschung brauchen würde, und hat daher keine Ausrede parat. Gefangen in diesem Dilemma, gerät sie in Panik, ertappt zu werden, und da Panik sehr schwer zu verbergen ist, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass Jerry sie erwischt. Sie könnte einen Trick versuchen, indem sie ihre Gefühle eingesteht – zumal sie sie vermutlich ohnehin nicht verbergen kann – und lediglich die Unwahrheit über deren Auslöser sagt. Sie gäbe zu, Panik zu verspüren, weil sie das Gefühl habe, Jerry würde ihr nicht glauben, und nicht etwa, weil sie etwas zu verbergen habe. Das würde höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, es sei denn, es wäre schon oft so gewesen, dass Jerry Ruth keinen Glauben schenkte und sie sich im Nachhinein stets als unschuldig erwies. Sich in diesem Zusammenhang auf seine ungerechtfertigten Vorwürfe zu beziehen, könnte ihn von seinen drängenden Nachfragen ablenken.
Ruth würde wahrscheinlich keinen Erfolg haben, wenn sie versuchte, cool zu bleiben, ein Pokerface aufzusetzen, sich also völlig ungerührt gäbe. Sobald die Hände anfangen zu zittern, ist es viel einfacher, etwas mit ihnen zu tun – sie falten oder eine Faust ballen –, statt sie nur still liegen zu lassen. Wenn sich die Lippen anspannen und dehnen, wenn die oberen Augenlider und Brauen vor Angst nach oben gezogen werden, ist es sehr schwer, ein unbewegtes Gesicht zu zeigen. Solche Regungen lassen sich mit zusätzlichen Muskelbewegungen besser verbergen – Zähne zusammenbeißen, Lippen aufeinanderpressen, Augenbrauen herunterziehen, starren.
Am besten lassen sich starke Emotionen hinter einer Maske verbergen. Wenn man einen Teil des Gesichts mit der Hand bedeckt oder sich von der Person abwendet, mit der man spricht, hat man die Lüge normalerweise bereits preisgegeben. Die beste Maske ist daher eine falsche Emotion. Sie führt das Gegenüber nicht nur auf eine falsche Fährte, sondern stellt die beste Tarnung dar. Es ist furchtbar schwer, ein ausdrucksloses Gesicht zu zeigen oder die Hände ruhig zu halten, wenn einen die Gefühle überwältigen. Generell ist es am schwierigsten, emotionslos, cool und teilnahmslos auszusehen, wenn es um Emotionen geht. Viel leichter ist es, eine Pose einzunehmen und die Handlungen, die Ausdruck der empfundenen Emotion sind, mit völlig anderen Aktionen zu beenden oder zu kontern.
In der nächsten Szene von Updikes Roman macht Jerry Ruth klar, dass er ihr nicht glaubt. Wahrscheinlich steigert das ihre Panik, was es noch schwieriger macht, sie zu verheimlichen. Ruth könnte versuchen, mit Wut, Erstaunen oder Überraschung zu kontern, um ihre Angst zu kaschieren. Sie könnte wütend zum Gegenangriff übergehen und Jerry seine Verdächtigungen vorwerfen. Sie könnte sogar erstaunt tun, dass er ihr nicht glaubt und ihre Gespräche belauscht.
Nicht jede Situation erlaubt es dem Lügner, die empfundene Emotion zu maskieren. Bei manchen Lügen muss man die viel diffizilere Aufgabe lösen, Emotionen zu verschleiern, ohne zu Verfälschungen Zuflucht zu nehmen. Ezer Weizman, der ehemalige israelische Verteidigungsminister, hat einmal eine solch schwierige Situation beschrieben. Um nach Anwar Sadats dramatischem Besuch in Jerusalem 1977 Verhandlungen einzuleiten, gab es Gespräche zwischen israelischen und ägyptischen Militärdelegationen. Während einer solchen Verhandlungssitzung teilte Mohammed el-Gamasy, der Leiter der ägyptischen Delegation, Weizman mit, er habe gerade erfahren, dass die Israelis eine neue Siedlung auf der Sinai-Halbinsel errichteten. Weizman wusste, dies könnte die Verhandlungen gefährden, denn man war sich noch lange nicht einig, ob Israel überhaupt irgendeine der bereits existierenden Siedlungen behalten durfte.
«Ich war empört, auch wenn ich meinen Zorn nicht öffentlich äußern konnte. Hier saßen wir und erörterten Sicherheitsregelungen, im Bemühen, den Friedenskarren etwas vorwärtszuschieben – und meine Kollegen in Jerusalem, anstatt aus der Sache mit den Scheinsiedlungen die richtigen Schlüsse zu ziehen, errichten just in dem Moment, wo die Verhandlungen bestens im Gange waren, eine neue.»[9]
Weizman konnte den Ärger auf seine Kollegen in Jerusalem nicht zeigen. Wenn es ihm gelang, seinen Zorn zu verbergen, konnte er gleichzeitig vertuschen, dass seine Leute sich nicht mit ihm abgesprochen hatten. Er musste also eine starke Emotion verheimlichen, ohne eine andere Emotion als Maske zur Verfügung zu haben. Es würde nicht genügen, glücklich, verängstigt, kummervoll, überrascht oder empört auszusehen. Er musste aufmerksam, aber leidenschaftslos wirken und durfte keinesfalls zu erkennen geben, dass Gamasys Information für ihn eine Neuigkeit war, die irgendwelche Konsequenzen mit sich brachte. Sein Buch gibt keinen Aufschluss darüber, ob er erfolgreich war.
Beim Pokerspiel ergeben sich auch solche Situationen, in denen man keine Maskierungen benutzen kann, um