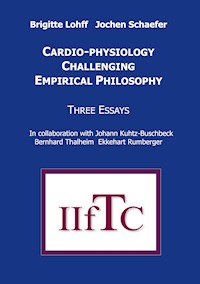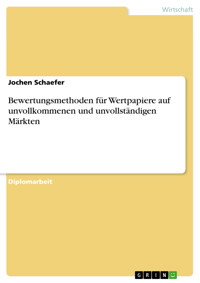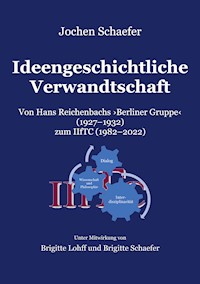
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Anliegen dieses Buches besteht in zwei Zielsetzungen: Zum einen wollen wir in Essay I eine nachlesbare Dokumentation der gesamten Tätigkeit des International Institute for Theoretical Cardiology IIfTC in seinen Symposien, Colloquien, Vorträgen, Stellungnahmen, Publikationen etc. von 1982 bis 2022 vorstellen. Diese stützt sich auf die ausgedruckten und von Claas Lattmann und Katrin Köther zusammengestellten und gepflegten Informationen unserer Website iiftc.de. Zum anderen soll in Essay II diese Dokumentation zu den inzwischen verfügbaren Informationen über die Tätigkeit der Berliner Gruppe innerhalb der Gesellschaft für empirische Philosophie in Beziehung gesetzt werden, die vor allem von Hans Reichenbach geprägt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich widme dieses Buch meinen Eltern, dem Arzt Dr. med. Hans-Oskar Schäfer (1906–1996) und seiner Ehefrau Ilse Schäfer, geb. Grosch (1909–1990), die für mich und meine Brüder Professor Dr. med. Peter Schaefer (1934–2021) und Professor Dr. med. Klaus Schaefer (1939–2015) trotz schwieriger Zeitumstände durch ihr Vorbild im Leben und Arbeiten die Voraussetzungen für die Ergreifung des ärztlichen Berufs schufen – und nicht zuletzt meiner Frau Brigitte, deren stete Unterstützung in all meinen Vorhaben und Lebensumständen, um auch unseren Kindern Anne-Kathrin Dieulangard und Dr. med. Tim Schaefer ein vergleichbares Beispiel zu sein, mich sehr dankbar macht.
Prolog
Das Anliegen des hier vorgelegten Buches besteht in zwei Zielsetzungen: Zum einen wollen wir in Essay I eine nachlesbare Dokumentation1 der gesamten Tätigkeit des International Institute for Theoretical Cardiology (IIfTC)2 in seinen Symposien, Colloquien, Vorträge, Stellungnahmen, Publikationen etc. von 1982 bis 2022 vorstellen. Sie stützt sich auf die ausgedruckten und von Claas Lattmann und Katrin Köther zusammengestellten und gepflegten Informationen unserer Website iiftc.de.
Zum anderen soll in Essay II diese Dokumentation in Beziehung setzen zu den inzwischen verfügbaren Informationen über die Tätigkeit der ›Berliner Gruppe‹ innerhalb der Gesellschaft für empirische Philosophie, die vor allem von Hans Reichenbach geprägt wurde.3 Zu den bislang kaum aufgearbeiteten Bereichen innerhalb der logischempiristischen Bewegung gehört die Beziehung zwischen Wiener Kreis und ›Berliner Gruppe‹. Das mag im günstigsten Fall daran liegen, dass nichts Nennenswertes über diese Beziehung zu berichten ist, im ungünstigsten Fall, dass einfach zu wenig darüber bekannt ist. Während die Literatur zum Wiener Kreis und ihren Repräsentanten beständig wächst, ist aus dem Umfeld der ›Berliner Gruppe‹ allenfalls Hans Reichenbach gut aufgearbeitet.
Darüber hinaus sollen in Essay II persönliche Erfahrungen des Senior-Autors mit dem Werk von Hans Reichenbach geschildert werden. Sie werden als Ausgangspunkt dafür dienen, die Dokumentation von Essay I zu den inzwischen verfügbaren Informationen über die Tätigkeit der ›Berliner Gruppe‹ innerhalb der Gesellschaft für empirische Philosophie, die vor allem von Hans Reichenbach geprägt wurde4, in Beziehung zu setzen.
In der Literatur zum logischen Empirismus wurde die Existenz der ›Berliner Gruppe‹ zwar frühzeitig registriert, dennoch bestand allzu häufig die Neigung, sie mehr oder weniger dem Wiener Kreis zuzuordnen. Erst in jüngster Zeit sind überhaupt Bemühungen zu verzeichnen, die ›Berliner Gruppe‹ bzw. die Internationale Gesellschaft für empirische Philosophie aus der engen Verklammerung und nicht selten der Identifizierung mit dem Wiener Kreis zu lösen und ihr ein eigenständiges wissenschaftshistorisches Profil zu geben. Dass dies erst so spät erfolgt, ist umso verwunderlicher, als Hans Reichenbach immer wieder darauf bestanden hat, die Leistungen der ›Berliner Gruppe‹ angemessen gewürdigt zu sehen.
In den 1920er-Jahren strebten die Mitglieder der Gesellschaft für wissenschaftliche Philosophie (›Berliner Gruppe‹) an, einen konstruktiven interdisziplinären Dialog zu ermöglichen, mit dem Gedanken/Ziel, dass die philosophische Reflexion über aktuelle Ergebnisse der Wissenschaft zum Vorteil beider sein können. Dieser Berliner Kreis ist ja nun durch die Hitlerregierung auseinandergetrieben worden, aber er lebt noch jetzt als virtuelle Einheit fort; und gerade nachdem unsere Arbeit durch die politische Entwicklung so schwer betroffen worden ist, liegt mir daran, dass diese Arbeit wenigstens in der Geschichte unserer Bewegung genannt wird.
Wir hoffen, bei diesem Vergleich zeigen zu können, dass die Zielsetzungen beider wissenschaftlicher Arbeitskreise sich in mancher Beziehung ähneln, mit dem gravierenden Unterschied, dass wir unsere Tätigkeit über 40 Jahre ausüben konnten, während die ›Berliner Gruppe‹ um Hans Reichenbach durch das Aufkommen des Nationalsozialismus in ihrer personellen und örtlichen Zusammensetzung ihre Existenzgrundlage verlor und sich ab 1933 in alle Welt zerstreute.
In dem Zusammenhang ist der Artikel von Thiel für unser Vorhaben besonders aufschlussreich und dient der Veranschaulichung, da er durch die von ihm gelieferten Kurzbiografien der betroffenen Personen den vollzogenen Kulturbruch besonders anschaulich macht.5
Unterstützt wird diese Sichtweise durch einen Brief W. Dubislavs an O. Vogt vom Herbst 1933: »Im Namen des Vorstandes der Gesellschaft für wissenschaftliche Philosophie erlaube ich mir, mit nachstehender dringlicher Bitte an Sie heranzutreten: Die Herren Professoren Hans Reichenbach und Kurt Lewin, beide von der Universität Berlin, haben oder werden ihren Wohnsitz an ausländische Universitäten verlegen unter Annahme an sie ergangener Berufungen. Sie bleiben auswärtige Mitglieder des Vorstandes. Wir sind aber trotzdem genötigt, unseren Vorstand zu erweitern, und zwar durch hiesige Forscher. Ich bitte Sie deshalb, in den Vorstand unserer Gesellschaft einzutreten. Irgendwelche Verpflichtungen würden Ihnen daraus nicht erwachsen, unsere Arbeit würde aber nicht unwesentlich gefördert werden, wenn ein Forscher von Ihrem Ruf und Ihrer Stellung sich nicht nur als Mitglied zu unseren Zielen bekennt, sondern das auch für einen weiteren Personenkreis als Vorstandsmitglied täte. Zu Ihrer Orientierung bemerke ich noch Folgendes: Unsere Gesellschaft ist ein nicht eingetragener Verein. Irgendwelche Wahlen gibt es seit 1927 nicht. Der Vorstand, und zwar lediglich seine hiesigen Mitglieder, leiten die Gesellschaft. Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist die Forderung wissenschaftlicher Philosophie, vornehmlich durch Pflege ihrer Beziehung zu den exakten Wissenschaften. Dem Vorstand gehören gegenwärtig an: hiesige Mitglieder: von Parseval, Herzberg und ich. Auswärtige Mitglieder: Lewin und Reichenbach. Ehrenvorsitzender: Kraus. Nach dem Fortgang von Reichenbach führe ich den Vorsitz. Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Herzberg und mir seit 1927.«6
1 In enger Zusammenarbeit mit Claas Lattmann und Katrin Köther 2009 kompiliert, als Website iiftc.de auf Englisch und Deutsch verfügbar gemacht, betreut und jetzt überarbeitet. Herrn Professor Dr. Heinz Lüllmann ursprünglich als Unikat zu seinem 85. Geburtstag am 10. April 2009 in Dankbarkeit gewidmet und in erweiterter Form 2022 auf den jetzigen Stand gebracht. – In dem seinerzeitigen Privatdruck für Herrn Professor Lüllmann haben wir mit der »Eindeutschung« unserer Institutsbezeichnung »International Institute for Theoretical Cardiology« als »Internationales Institut für Theoretische Cardiologie« einen Fehler begangen, denn das Wort »Cardiologie« gibt es im Deutschen so nicht, sondern wird als »Kardiologie« geschrieben. Dies kollidiert aber mit der international verwendeten Bezeichnung »IIfTC«. Leider haben wir diese unselige Eindeutschung des Wortes in vielen Adressenangaben des Instituts bei zahlreichen Beiträgen benutzt. Um diesen Fehler für die jetzt vorgesehene Buchveröffentlichung zu vermeiden, wurde die falsche deutsche Rechtschreibung durch die international sonst immer benutzte Bezeichnung »International Institute for Theoretical Cardiology« ersetzt.
2 Internationales Institut für Theoretische Cardiologie (IIfTC) e. V., Kurklinik Küppelsmühle, 6482 Bad Orb. Eingetragen beim Amtsgericht Gelnhausen als gemeinnütziger Verein unter VR 602 am 05. Oktober 1984. – Verlegung des Vereins von Bad Orb nach Kiel, eingetragen beim Amtsgericht Kiel am 09. Februar 1999. Die Auflösung des Vereinsstatus des IIfTC erfolgte am 03.07.2017 und wurde am 30.07.2017 in den »Schleswig-Holsteinischen Anzeigen« Teil B Nr. 7/17 vom 30.07.2017 auf Seite 153 veröffentlicht.
3 So beschwert er sich in einem Brief an Ernst von Aster vom 3. Juni 1935 über dessen Darstellung des »Logistischen Neopositivismus« in dem gerade erschienenen Buch »Die Philosophie der Gegenwart«.
»Da muss ich nun zuerst sagen, dass ich es sehr bedauere, dass Sie fast immer nur von dem Wiener Kreis schreiben, sodass es so aussieht, als ob diese ganze philosophische Richtung allein in Wien und Prag entstanden wäre. Ein ebenso aktives Zentrum wie der Wiener Kreis war unsere Berliner Gruppe, und darüber hat es ja im Innern unserer Richtung auch niemals einen Zweifel gegeben. Nicht nur, dass in Berlin ein großer Teil der wissenschaftlichen Arbeiten unseres Kreises geschrieben worden ist […] Unsere Gesellschaft für wissenschaftliche Philosophie hat alle zwei oder drei Wochen einen Kreis von 100 bis 300 Menschen zu Vorträgen und Diskussionen vereinigt, in meinen Seminaren und Kolloquien sind alle unsere Probleme durchdiskutiert worden, und, last not least, die Erkenntnis, wohl das wichtigste Glied unserer Organisationsarbeit, ist in Berlin gegründet worden und auch von dort aus geleitet worden.« (Schwernus, W., S. 33/34, 2005)
4 Vgl. Schernus: Die Gesellschaft für wissenschaftliche Philosophie: Programm, Vorträge, Materialien, in: Schernus, Verfahrensweisen historischer Wissenschaftsforschung, Exemplarische Studien zu Philosophie, Literaturwissenschaft und Narratologie, Diss. phil., S. 15–103 (2005).
5 Christian Thiel, Folgen der Emigration deutscher und österreichischer Wissenschaftstheoretiker und Logiker zwischen 1933 und 1945: Vol. 7, S. 227–256 (1984).
6 D. Hoffmann, S. 29/30 (1994).
Danksagung
Das hier vorgestellte Buch beruht auf meinen persönlichen, beruflichen und wissenschaftlichen Erfahrungen, die ich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten gesammelt habe. Während dieser Zeit des Lernens kam es zu zahlreichen Begegnungen mit Personen aus unterschiedlichen Ländern und Institutionen, die in diesem Werk als Gesprächspartner, Co-Autoren, Mitarbeiter, Mentoren und Schüler Erwähnung finden und, deren Namen aufzuzählen, den verfügbaren Raum überschreiten würde. Ihnen allen bin ich für Anregungen, Klarstellungen und vielfältige Hilfen zu großem Dank verpflichtet.
Stellvertretend für all jene seien die Mitwirkenden des seit mehr als vierzig Jahren existierenden, später als »Donnerstagsrunde« genannten Gesprächskreises angeführt, die in wechselnder Besetzung und Zeitdauer daran teilgenommen haben:
Deppert, Wolfgang; Dieulangard, Anne-Kathrin; Dittmer, Janke-Jörn; Jongebloed, Hans-Carl; Kliegis, Ulrich; Köhnlein, Claus; Köther, Katrin; Kralemann, Björn; Lattmann, Claas; Lohff, Brigitte; Munz, Siegfried; Nordmann, Klaus-Jürgen; Rahnfeld, Michael; Schaefer, Brigitte; Schaefer, Daniel; Schaefer, Martin; Schaefer, Tim; Thalheim, Bernhard; Theobald, Werner; Wilder, Nikolaus; Zick, Günther
Mein ganz besonderer Dank gilt Frau Prof. em. Dr. rer. nat. Brigitte Lohff, Institut für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin der Medizinischen Hochschule Hannover, die als Autorin, Co-Autorin, Ideengeberin, Mitarbeiterin und langjährige Freundin schon in gemeinsamer Kieler Zeit seit mehr als vierzig Jahren durch ihre inhaltsreichen, historisch fundierten Power-Point-Demonstrationen die Entwicklung und die Zielsetzungen des IIfTC anlässlich zahlreicher Symposien und vergleichbarer Anlässe befördert hat.
Kurzbiografien
Der Erst-Autor sowie die hier genannten Mitwirkenden gehörten von Anfang an zu dem Kernteam, das das IIfTC zu dem gemacht hat, wie wir es jetzt in Essay I und Essay II unseres Buches gemeinsam vorstellen.
Jochen Schaefer, geb. 1930; Studium der Medizin in Freiburg/Brsg. und Promotion 1955; anschließend Postdoc in Pathologie und Pharmakologie (FU Berlin); 1960–1962 Ausbildung in der sich entwickelnden Abteilung für Kardiologie, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, unter Richard S. Ross; 1962 Assistenzzeit am I. Med. Universitätsklinikum Kiel zum Aufbau einer Abteilung für moderne Kardiologie; 1966 Habilitation; 1970 Professor und Leiter der Abteilung für Spezielle Kardiologie an der CAU; 1985 Ausscheiden aus dem Dienst des Landes Schleswig-Holstein; 1981–1996 Chefarzt der Rehabilitationskliniken Küppelsmühle, Bad Orb.
Wissenschaftliche Interessen: die Interdisziplinarität von Medizin und Philosophie.
Brigitte Lohff, geb. 1945, emeritierte Professorin für Geschichte der Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover.
Brigitte Schaefer, geb. 1944; Organisatorin der Arbeitstreffen und Symposien des IIfTC seit 1982.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
ESSAY I
EINFÜHRUNG ZUR DOKUMENTATION DER IIFTC-AKTIVITÄTEN
ZIELSETZUNG DES INTERNATIONALEN INSTITUTS FÜR THEORETISCHE CARDIOLOGIE E. V. (IIFTC)
SYMPOSIA
The interval-force relationship in the heart (Initiating Symposium leading to the foundation of the IIfTC: 12.–15.04.1982, Bad Orb)
The Ischemic Myocardium. Definitions, Measurements, and Pathophysiology (I. Symposium: 21.–22.06.1986, Bad Orb)
Epistemology and the heart beat: Some foundational problems in electrocardiology (II. Symposium: 21.11.1987, Palo Alto, Stanford, California)
The Methodology of Clinical Hypothesis Testing: Theoretical Foundations and Practical Clinical Problems (III. Symposium: 19.–20.11.1988, Greenville, East Carolina)
Zu den grundsätzlichen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Wissenschaften unter besonderer Berücksichtigung von Medizin und Kardiologie (IV. Symposium: 22.–24.09.1989, Bad Orb)
Myocardial Optimization and Efficiency and its Evolutionary Aspects (V. Symposium: 14.–16.09.1990, Graz)
The Modern Clinical Trial: Is it Compatible with Common Sense? (VI. Symposium: 20.–21.09.1991, London)
Foundational Issues in Molecular Cardiology. New Avenues at the Interface of Molecular Biology and Cardiology (VII. Symposium: 17.–18.06.1994, Groningen, Netherlands)
Molekulargenetik, Selbstheilungskräfte und Naturheilkunde – Versuch einer Synthese (VIII. Symposium: 6.–8.10.1995, Hannover)
The AIDS Controversy (IX. Symposium, Teil I: 24.05.1996, Berlin-Dahlem)
The AIDS Controversy (IX. Symposium, Teil II: 22.12.1996, Berlin-Dahlem)
Wissenschaftstheoretische Überlegungen zu den philosophischen Grundlagen aktueller Forschungsprogramme in den Biowissenschaften (X. Symposium: 23.–24.03.2000, Kiel)
Synchronisation: Ihre Strukturen und Funktionen (XI. Symposium: 3.–5.07.2003, Kiel)
Krankheit und Gesundheit dynamischer Systeme am Beispiel des Menschen, der Wirtschaft und des Ökosystems (XII. Symposium: 19.–20.08.2005, Kiel)
XIII. Symposium of the IIfTC in Kiel (October 1–2, 2010, Kiel)
XIV. Symposium of the IIfTC (August 29, 2015, Kiel)
XV. Symposium of the IIfTC (October 24, 2020, Nortorf)
SEMINARE
COLLOQUIA & WORKSHOPS
Insecure Science
Methodology and Definition of Cardiac Contractility (1st Colloquium and 2nd General Assembly of the Institute at the Johns Hopkins University, Department of Biomedical Engineering, Cardiovascular Group)
Controversies surrounding the definition of myocardical contractility (Second Colloquium of the Institute at the Johns Hopkins University, the Department of Biomedical Engineering)
Kolloquium des IIfTC anlässlich der Buchvorstellung »Cardio-Physiology challenging Empirical Philosophy«
PUBLICATIONS
COMMENTARIES & OPINIONS
KRITISCHE EINFÜHRUNG ZU DEM BUCH »VIRUS-WAHN« VON TORSTEN ENGELBRECHT UND CLAUS KÖHNLEIN (EMU-VERLAG, LAHNSTEIN 2006)
ESSAY II
EINLEITUNG
ERSTE LITERARISCHE BEGEGNUNGEN MIT HANS REICHENBACH UND VERGLEICH MIT DEN ZIELSETZUNGEN DES IIFTC
FORMALE, ZAHLENMÄßIG BELEGTE DATEN ZUR TÄTIGKEIT DER ›BERLINER GRUPPE‹
Friedrich Kraus
Friedrich Kraus und Hans Reichenbach
LITERATURVERZEICHNIS
NAMENSREGISTER
Essay I
Essay I beruht auf unserer Website iiftc.de, die sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache verfasst ist. Brigitte Schaefer fertigte hierbei sämtliche Fotos an.
Einführung zur Dokumentation der IIfTC-Aktivitäten
Die nachfolgende Zusammenstellung ist eine Dokumentation der Aktivitäten des International Institute for Theoretical Cardiology (IIfTC)7 seit April 1982, also einem Zeitpunkt, zu dem es als solches noch gar nicht existierte. Dennoch wählen wir dieses Datum als den Beginn unserer Unternehmung, weil das vom 12. bis 13. April 1982 stattfindende Treffen zu Fragen der »Kraft-Intervall-Beziehung« (FIR) des Herzens als »initiating symposium« für die dann im Jahre 1984 vollzogene Gründung des IIfTC8 gelten darf.
Die Bad Orber Zusammenkunft hatte – neben der wissenschaftlichen Bedeutung, die sie für die Fortführung von Forschungen auf dem Gebiet der elektromechanischen Kopplung des Herzens, das uns seit vielen Jahren faszinierte, besaß – eine weitere Folge: Sie sollte Ausgangspunkt für einen kontinuierlichen, problemorientierten, interdisziplinären Gedankenaustausch zwischen Geistes- und Naturwissenschaftlern auf dem Gebiet der Wissenschaften des Herz-Kreislauf-Systems werden. Ein aus Sicht der vergangenen 25 Jahre durchaus erfolgreicher Versuch.
Für mich persönlich schien sich damit ein Forum zu verwirklichen, auf dem die Einheit der Wissenschaften im Zusammenhang ihrer Begriffsbildungen und Forschungsmethoden praktiziert werden konnte, ähnlich wie es auf der Frontseite der nach dem Krieg im Oktober 1947 zum ersten Mal erscheinenden Zeitschrift Studium Generale9 zu lesen war.
Mit seiner Gründung wollte das IIfTC auch ein Zeichen gegen den seit einigen Jahrzehnten vorherrschenden »Zeitgeist« des »schnellen Erfolgs« setzen. Es sollte nicht nach dem unmittelbaren ökonomischen Nutzen oder einer praxisnahen Anwendung von Grundlagenforschung gefragt, sondern der nachhaltige interdisziplinäre, bereichernde Gedankenaustausch zu definierten Problemen gepflegt werden. Die daraus resultierenden Anregungen führen ganz selbstverständlich zu einem vertieften Nachdenken, das dann auch in entsprechenden Veröffentlichungen seinen Niederschlag findet. Die unmittelbaren Zielsetzungen des IIfTC formulierten wir in einem Letter to the Editors in der Zeitschrift Basic Research in Cardiology 1987 in folgender Weise:10
The aim of the institute is to create a forum for the examination of controversies in cardiology, with a special focus upon their philosophical and epistemological dimensions. In particular, we wonder whether certain controversies can be clarified by an evaluation of the axiomatic foundations, underlying the disputes, and not simply solved by the perfunctory acquisition of additional experimental results.
Die in den vorhergehenden Abschnitten geschilderten Dilemmata bezüglich der Einschätzung der diagnostischen und therapeutischen Implikationen der Koronararteriografie waren zum Ausgangspunkt der zentralen Frage geworden: Gibt es sicheres Wissen in der Medizin und damit auch in der Kardiologie und wie ist es beschaffen? Diese Frage blieb im Mittelpunkt aller vom IIfTC organisierten Symposien, Colloquien, Workshops und Arbeitstreffen und wurde im Rahmen der jeweiligen speziellen Themen immer wieder erneut gestellt.
Es hatte sich, wie zuvor gezeigt, erwiesen, dass bestimmte Fragestellungen nicht mehr im Rahmen der an einer Universität üblichen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen geklärt oder auch nur diskutiert werden können. Inner- und außeruniversitäre wirtschaftliche, politische sowie standespolitische Zwänge und andere Einflussnahmen, unter anderem auch auf den Handlungsauftrag der Medizin selbst, beeinträchtigen bzw. verhindern dies.
Meine Suspendierung als hauptamtlicher Professor und Direktor der Abteilung für Spezielle Kardiologie mit dem damit verbundenen Hausverbot an der Universität Kiel und die mit dem Datum vom 10. Januar 1983 erfolgte Verurteilung11 durch das Landgericht Köln bedeuteten einen Bruch in meinem beruflichen und akademischen Leben. In Anbetracht des Strafmaßes12 hätte vielleicht die Möglichkeit bestanden – nach Klärung möglicher zivilrechtlicher Fragen –, wieder in die alte Position, wenn auch mit Einschränkungen, zurückzukehren. Ich zog es nach den gemachten Erfahrungen und in Anbetracht der Aussichten auf ein erfülltes ärztliches und wissenschaftliches Leben – auch außerhalb hauptamtlicher Verpflichtungen an der Universität – vor, auf eigenen Wunsch aus dem Landesdienst auszuscheiden.13
Insgesamt jedoch musste nach allen bürgerlichen Maßstäben mein »Fall« als ein Scheitern einer an sich »hoffnungsvoll begonnenen« Karriere gelten. Für mich persönlich jedoch bedeutete dies paradoxerweise eine Befreiung von den Zwängen eines im »Mainstream« gefangenen medizinisch-kardiologischen Denkkollektivs14 und die Möglichkeit, ein wissenschaftliches und ärztliches Leben zu führen, wie ich es mir immer erträumt hatte.
Allerdings wäre dies und unser materielles Überleben unter den seinerzeit vorherrschenden Umständen nicht möglich gewesen, wenn nicht folgender Glücksumstand eingetreten wäre: das Angebot für eine Chefarztposition ab Mitte September 1981 in der Kurklinik Küppelsmühle in Bad Orb durch die Familie Freund.15 Die mit dieser Position verbundenen Einkünfte sicherten mir – trotz der durch den Prozess verursachten bzw. mit ihm einhergehenden Kosten – recht schnell eine nicht unerhebliche finanzielle Unabhängigkeit. Dadurch war ich in der Lage, wesentliche Anteile meines Einkommens für die Aktivitäten des IIfTC zu spenden und damit die anfallenden Kosten für Reisen, Unterbringung, Konferenzausstattung, Bandaufzeichnungen und nachfolgende schriftliche Übertragungen und diverse andere Sachen zu decken. Hinzu kamen großzügige Zuwendungen meines Arbeitgebers, meiner Familie und zahlreicher Patienten, die sich von dem Konzept, das dem Institut zugrunde lag, überzeugen ließen.
So war es möglich, international angesehene Natur- und Geisteswissenschaftler sowie klinisch und überwiegend experimentell tätige Kardiologen zu Vorträgen und Arbeitsbesuchen einzuladen und/oder selbst zu besuchen. Besonderen Wert legten wir dabei auch darauf, dass junge Forscher mit älteren Wissenschaftlern in einen ungezwungenen Gedankenaustausch treten konnten und sich Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten in einer Atmosphäre ergaben, die ohne die Aktivität eines IIfTC so nicht möglich gewesen wären. Es bewährte sich sehr, die Symposien, die selten mehr als 20 Personen umfassten, an unterschiedlichen Orten in diversen Ländern auszurichten. Lokale Gastgeber waren mit der Organisation dieser Treffen betraut. Sie verstanden es ausnahmslos, und dafür bin ich ihnen bis heute sehr dankbar, mit großem Einsatz und Hingabe die Besonderheiten des akademischen Ambiente, in dem sie tätig waren, den Besuchern und ihren Gästen zu vermitteln und lebendig werden zu lassen. Die Themenstellungen der jeweiligen Konferenzen und die damit verbundenen Einladungen wurden sorgfältig vorbereitet und die Referenten auf den besonderen interdisziplinären Charakter unserer Symposien vorbereitet. Alle diese Veranstaltungen und Anstrengungen wären ohne den Einsatz der am Ende dieser Einführung genannten Freunde nicht möglich gewesen.
Die Großzügigkeit meiner Arbeitgeber, insbesondere von Ulrich Freund, machte es möglich, mich zeitweise trotz großer personeller Engpässe freizustellen und damit in die Lage zu versetzen, die langjährigen freundschaftlichen Verbindungen zur kardiologischen Abteilung der Johns-Hopkins-Universität und dem Department of Biomedical Engineering zu nützen und zu stärken. So reisten wir – gelegentlich bis zu viermal im Jahr – zu einwöchigen Arbeits- oder Konferenzaufenthalten nach Baltimore. Manchmal fuhren wir direkt vom Flughafen Baltimore Friendship-International ins Labor, um mit Dan Burkhoff, David Yue, Michael Franz sowie Kiichi Sagawa und seinen Mitarbeitern oder mit Myron L. Weisfeldt an experimentellen Untersuchungen teilzunehmen und an der Abfassung von wissenschaftlichen Publikationen mitzuwirken. Dabei ergab es sich als ganz natürlich, manche seit 1960 bestehenden freundschaftlichen Beziehungen aufzufrischen. Vergleichbare Arbeits- und Konferenzbesuche führten uns nach Halifax, Dartmouth (England), Graz, Kiel, London, Groningen. Die in unserer Dokumentation enthaltenen Fotos bezeugen die Erfüllung dieses Traumes von gelebter Interdisziplinarität.
Meine eigentliche ärztliche Tätigkeit in der Küppelsmühle bestand in der Versorgung von insgesamt ca. 110 Patienten, damals noch Kurgäste genannt, die in drei sehr unterschiedlichen und dadurch mit einem besonderen Reiz versehenen Häusern auf dem parkähnlichen Gelände, das von einem Bach, einem Zufluss zur Orb, durchflossen wird, untergebracht waren. Im »Annenhof«, der unter meinem Vorgänger Dr. Heinrich Freund einen hervorragenden Ruf genoss, waren bis zu 35 Privatpatienten untergebracht, im »Mühlenhof« und im »Birkenhaus« überwiegend Patienten der AOK und der LVA Hessen und Westfalen. Meine unmittelbaren Aufgaben lagen in der Modernisierung nicht-invasiver kardiologischer Diagnostik und in dem Sich-vertraut-Machen mit den Möglichkeiten balneologisch-physikalischer ganzheitlich ausgerichteter Therapieverfahren. Außerdem war der allmähliche Wandel von einem Kurkonzept in ein Reha-Konzept zu organisieren.16
Mich faszinierte der – gegenüber dem an den Universitätskliniken praktizierten recht eindimensionalen »Schulmedizinertum« – auf den ganzen Menschen bezogene Heil- und Betreuungsansatz. Zahlreiche prominente ältere Kollegen wie Professor Dr. H. E. Bock, Th. Ockenga, E. Witzleb oder G. Hildebrandt bejahten diese holistische Sicht. Auch überraschte mich die Vielzahl möglicher alternativer Therapie- und Diagnose-Angebote und deren gesprächs- oder psychoanalytische Begleitung. Viele ärztliche Kollegen, die ich dort kennenlernte, waren dem hippokratischen »Nicht zu schaden« ernsthaft verpflichtet. In einer solchen Umgebung gewannen natürlich nicht-invasive diagnostische und therapeutische Verfahren eine große Bedeutung. Die Erkenntnis, dass die Problematik des erkrankten Menschen auch den geisteswissenschaftlichen Denkkategorien zuzuordnen ist, wie es H. Schipperges17 ausdrückte, wurde immer zwingender. Die Rolle der körpereigenen Selbstheilungskräfte, mit der wir uns später auf molekulargenetischer Ebene auseinandersetzten,18 und deren Unterstützung standen im Vordergrund – und damit auch das interessante Gesamtkonzept der Salutogenese.19
In jüngster Zeit haben wir versucht, nach meiner mit dem 31. Dezember 1996 erfolgten Pensionierung als Chefarzt der Reha-Kliniken Küppelsmühle, uns weiteren Problemstellungen zuzuwenden. Die dafür erforderliche Satzungsänderung des IIfTC erfolgte 1999. Neben ökologischen Gesichtspunkten rückten Fragen der nicht-linearen Dynamik komplexer Systeme und der Chronobiologie sowie des Komplementaritätsprinzips in den Vordergrund. Dr. phil. Björn Kralemann, seit vielen Jahren in unserem Arbeitskreis, widmet sich in Zusammenarbeit mit den Instituten für Theoretische Physik der Universität Potsdam, Nonlinear Dynamics Group (Professor Dr. A. Pikovsky und PD Dr. Michael Rosenblum), dem Joanneum Research Institut für Nichtinvasive Diagnostik, Weiz (Prof. Dr. Maximilian Moser) sowie dem Physiologischen Institut der Universität Graz (Prof. em. Dr. med. Dr. h. c. mult. Thomas Kenner) und dem Lehrstuhl für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Professor Dr. H.-C. Jongebloed) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel diesen Problemen. Unser Gedankenaustausch wird im Rahmen monatlicher Arbeitstreffen mit variierenden Themen durch die Mitwirkung von Professor Dr. W. Deppert, Philosophie und Physik, CAU Kiel, Prof. Dr. Bernhard Thalheim, Lehrstuhl für Datenbanken und Informationssysteme der CAU Kiel, Dr. phil. Claas Lattmann, Institut für Klassische Altertumskunde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Dr. med. Klaus-Jürgen Nordmann und den Theologen und Schauspieler Siegfried Munz ergänzt und vertieft.
Die langfristigen Aussichten für den Erhalt unseres Instituts sind, von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln einmal abgesehen, als nicht zu rosig einzuschätzen. Die Voraussetzungen für die Fortführung unserer Aktivitäten ähneln denjenigen, die für die Existenz der in der bürgerlichen Gesellschaft sehr beliebten schon im 18. Jahrhundert gegründeten literarischen Salons,20 »Gesellschaften«21 oder »Klubs oder Runden«22 galten oder bestehen.23 Ihre »Lebensdauer« ist sehr begrenzt und hängt sowohl vom Zeitgeist als auch von der Natur und dem Charakter der an einem solchen Projekt interessierten Persönlichkeiten ab. Interdisziplinär ausgerichtetes Denken beruht wohl auch auf einer sehr subjektiv geprägten Bereitschaft und Fähigkeit, sich in den anderen hineinzudenken und von anderen auch nachhaltig lernen und Anregungen aufnehmen zu wollen. Ein »Sich-zur-Schau-Stellen« oder Profilierungsabsichten haben hier keinen Platz. Interdisziplinarität lässt sich nicht verordnen oder erzwingen. Sie muss aus dem gegenseitigen persönlichen Respekt erwachsen. Der inflationäre Gebrauch des Wortes »Interdisziplinarität«, z. B. für die tägliche Zusammenarbeit eines Chirurgen mit einem Anästhesisten, täuscht daher einen Tatbestand vor, der dem Inhalt und der Bedeutung des Wortes nicht gerecht wird. Das Schicksal der mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften verbundenen und von W. Doerr, V. Becker und K. Goerttler gegründeten Sektion »Theoretische Pathologie«24 ist dafür ein nachdenkenswertes kürzliches Beispiel. –
Namensliste der Persönlichkeiten, die, überwiegend ab 1982, aber auch schon davor an den Fragen einer theoretischen Fundierung der Kardiologie und den damit erforderlichen interdisziplinären Bemühungen auch in Zusammenarbeit mit Geisteswissenschaftlern, interessiert waren und im Sinne einer theoretischen Kardiologie mitwirkten und mitdachten (ein »S« bezeichnet, dass diese Personen an der Ausrichtung eines IIfTC-Symposions maßgeblich beteiligt waren):
Burkhoff, Daniel, ab 1982, durchgehend
Deppert, Wolfgang, ab 1985 durchgehend
Drake-Holland, Angela, ab 1979 durchgehend (S)
Franz, Michael, ab 1978 durchgehend (S)
Freund, Ulrich (S)
Jongebloed, Hans-Carl, ab 2005 durchgehend
Kralemann, Björn ab 1996 durchgehend (S)
Kenner, Thomas, ab 1975 durchgehend (S)
Köther, Katrin, ab 1999 durchgehend, seit 2007 sporadisch (S)
Lattmann, Claas, ab 1998 durchgehend (S)
Lie, Reidar K., ab 1982 durchgehend (S)
Lohff, Brigitte, ab 1985 durchgehend (S)
Lüllmann, Heinz, ab 1964
Munz, Siegfried ab 1975, erst sporadisch, ab 1981 häufiger, ab 2005 durchgehend
Neitzke, Gerald, ab 1987 bis 1995
Nierhaus, Knud, ab 1993 durchgehend (S)
Noble, M. I. M., ab 1979 durchgehend (S)
Nordmann, Klaus-Jürgen, ab 1967, verstärkt erneut ab 1991 bis 2009
Peters, Thies, ab 1966, verstärkt ab 1993 bis 1996
Pikovsky, Arkady, ab 2003 durchgehend
Reichel, Hans, ab 1965 bis 1995)
Rosenblum, Michael, ab 2003 durchgehend
Ross, Richard S., ab 1960 durchgehend
Rumberger, Ekkehard, ab 1965 bis 1982, danach sporadisch
Sadegh-Zadeh, Kazem, ab 1977 bis 1986 durchgehend, danach sporadisch
Sagawa, Kiichi, ab 1978 bis 1988 durchgehend
Schaffner, Kenneth, zwischen 1984 bis 1995 durchgehend, dann eher sporadisch
Seed, W. A., ab 1979 bis 1991 durchgehend, danach sporadisch (S)
Suga, Hiro, ab 1985 bis 1995 durchgehend
Sunagawa, Kenji, ab 1982 sporadisch
Thalheim, Bernhard, ab 2006 durchgehend
Vos, Rein, ab 1982 durchgehend (S)
Weisfeldt, Myron L., ab 1975 durchgehend
Witzleb, Erich, ab 1970 bis 1991
Yue, David T., ab 1982 durchgehend
Dabei hat die Kommission Theoretische Pathologie mit ihren Symposien und ihren 33 Publikationen (›Blaue Bücher‹) etwas geleistet, was ihre Daseinsberechtigung bewiesen hat. Diese Arbeit hat gezeigt, dass das dauerhafte Problem theoretische Pathologie nicht erledigt ist, vielmehr durch die Fülle der neuen – molekularbiologischen und molekularpathologischen – Detailbefunde mit dem Drang nach einem grundlegenden Konzept nötiger ist als je zuvor.
7 Umfangreiche Textteile aus der »Einführung zur Dokumentation der IIfTC Aktivitäten« wurden auch in anderen Publikationen wie Schaefer et al. (2011) und Lohff & Schaefer (2022) (BoD: https://ishort.ink/V87m) verwendet.
8 Internationales Institut für Theoretische Cardiologie (IIfTC) e. V., Kurklinik Küppelsmühle, 6482 Bad Orb. Eingetragen beim Amtsgericht Gelnhausen als gemeinnütziger Verein unter VR 602 am 05. Oktober 1984. – Verlegung des Vereins von Bad Orb nach Kiel, eingetragen beim Amtsgericht Kiel am 09. Februar 1999.
9 Die Zeitschrift Studium Generale erschien von 1947 (Jahrgang 1) bis 1971 (Jahrgang 24).
10 J. Schaefer, R. K. Lie, Th. Kenner, K. F. Schaffner, D. Burkhoff, K. Sagawa, D. T. Yue: A place for theoretical cardiology. Letter to the Editors. Basic Research in Cardiology 82: 317–318 (1987).
11 Die Verurteilung erfolgte wegen des Straftatbestandes der Untreue und der Vorteilsnahme.
12 Zur Ahndung des Straftatbestands wurde eine Freiheitsstrafe von acht Monaten zur Bewährung verhängt, wegen der Vorteilsnahme eine Geldstrafe von 27.000 DM.
13 Wortlaut der Entlassungsurkunde: »Im Namen des Landes Schleswig-Holstein entlasse ich Herrn Professor Dr. Jochen Schaefer mit Ablauf des Monats Juni 1985 auf sein Verlangen. – Kiel, den 25. Juni 1985. Der Kultusminister P. Bendixen.«
14 Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, 3. Aufl., Frankfurt 1994.
15 Die Kurklinik Küppelsmühle (jetzt Reha-Kliniken Küppelsmühle) ist eine seit über 100 Jahren bestehende Kureinrichtung im Besitz der Familie Freund. Anlässlich der Jubiläumsfeier »100 Jahre erstes Badehaus auf der Küppelsmühle« am 08. Juli 1994 wurde die moderne Konzeption der Reha-Kliniken Küppelsmühle als ein gemeinsames Arbeitspapier, an dem ich mitgewirkt habe, vorgestellt.
16 Siehe neben Anm. 8 auch mslife: https://ishort.ink/RHmU (vorbehaltlich Erlaubnis).
17 Schipperges, H. Konzept einer Theoretischen Pathologie 1997.
18 J. Schaefer et al. (1996), B. Lohff et al. (1996).
19 Das Wort Salutogenese bedeutet svw. »Entstehung (Genese) von Gesundheit«. Der Ausdruck wurde von dem israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923–1994) in den 1970er-Jahren als Gegenbegriff zu Pathogenese geprägt. Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit kein Zustand, sondern muss als Prozess verstanden werden. Aaron Antonovsky wertete 1970 eine Erhebung über die Adaptation von Frauen verschiedener ethnischer Gruppen an die Menopause