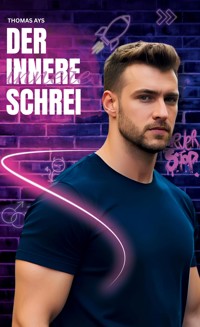Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Zweite Weltkrieg tobt schon ein Jahr, als Katharina, 22 Jahre alt, ihr Elternhaus hinter sich lässt, um in gutem Hause eine Anstellung als Hausmädchen anzutreten. Sie kann unermüdlich arbeiten und hat durch hartes Training gelernt, wie man sich still verhält und ungesehen durchs Leben kommt. Von Männern will sie nichts wissen und eine eigene Familie ist für sie ein unerreichbarer Gedanke. Doch dann schleicht sich Johann in das erkaltete Herz von Katharina. Er ist ein Bauerssohn und beliefert Katharinas Arbeitgeber. Johann merkt schnell, dass er wenig Chancen bei Katharina hat, doch da ist etwas an ihr, was ihn nicht wieder loslässt: Der Schmerz in ihren Augen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Ays
Ihr Versuch zu leben
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Impressum neobooks
Kapitel 1
Prolog
Wenn sie lächelte, lag keine Freude darin.
Es war eine geborgte, vorrübergehende Grimasse.
Sie legte dieses Lächeln an wie eine Halskette, die sie nicht besonders schickte.
Doch dieses Gefühl, in diesem Moment, war echt.
Als stamme es aus einer anderen Zeit, einem anderen Leben.
Es war der Moment, in dem Katharina starb.
Sie war 87 Jahre alt und hatte ihr Leben gelebt.
Ein Leben, in dem sie ihr geborgtes Lächeln öfter gebraucht hatte, als ihr echtes.
Sie spürte einen Sommerregen auf der Haut und
sah einen Bauernjungen mit einer großen Nase und abstehenden Ohren, wie er sie anlächelte.
Sie sah ihr kleines Mädchen und
ihren Jungen,
wie sie beide in ihren Armen lagen,
nach der Geburt blutverschmiert und in eine Decke gewickelt.
Sie sah ihre Schwägerinnen und
sie sah ihre Mutter.
Ihr wollte sie doch noch so viel sagen und hatte die Gelegenheit doch immer verpasst.
Nun gab es eine zweite und sie wusste, dass sie es nun endlich tun konnte.
Dass sie es tun konnte, aber nicht mehr musste.
Weil es gut war.
Weil es nun nichts mehr gab, was ihre Seele schwer machte.
Sie lächelte.
Sie lächelte bis das Leben aus ihr wich und es endlich friedlich in ihr wurde.
Kapitel 2
DAS MÄDCHEN
Bayern, Großdeutschland, 1940
Die Farbe war aus absolut allem gewichen, was sonst selbstverständlich satt und berauschend war. Das Grün der Wiesen, das Blau des Himmels, selbst das abgeblätterte Braun der Ställe. Doch ein Jahr nach Kriegsbeginn gab es diese Art Farben nicht. Das Leben auf dem Land war trist und blass. Trist und blass wie die Menschen.
Ein nicht gelebtes Leben.
Die meisten existierten nur wegen ihrer Höfe, ihrer Tiere und ihrem Geschick der Selbstversorgung. Es ging ihnen nicht schlecht, wohl auch, weil der Führer, Adolf Hitler, sie scheinbar vergessen hatte. Oder sie waren mit ihrem vermeintlich landwirtschaftlichen Intellekt nicht wichtig genug. Der Fokus lag auf den Städten, groß und klein, und nicht auf dem Land, nicht bei den Bauern. Die kamen erst später ins Spiel um Nachschub und Vaterlandsverteidigung. Hier, im Jahr 1940 und ein Jahr nachdem die große Hoffnung NSDAP der Welt den Krieg erklärt hatte, waren viele schon involviert und dabei sich auf Feindkontakt vorzubereiten – wenn sie ihn nicht schon kennengelernt hatten.
In dem Wenige-Seelen-Ort Dürrbrunn war Katharina 1918 zur Welt gekommen. Sie war eines dieser Kriegskinder des Ersten Weltkrieges, die in eine Zeit und in eine Welt hineingeboren wurden, in der das Wort Zukunft keinerlei Bedeutung hatte. Das Hier und Jetzt zählte und wie man den kommenden Winter hinter sich bringen konnte ohne zu erfrieren oder zu verhungern. Ob man innerlich verkümmerte, daran zu denken hatte keinen Platz. Zur Verfügung stand eine erkaltete und mürrische Mutter.
Katharina wusste später nicht mehr, wie ihre Mutter den Gasthofbesitzer Karl kennenlernt hatte. Sie konnte sich weder an die Hochzeit, noch an die ersten Jahre zu Dritt wirklich erinnern.
Es hatte seine Gründe.
Karl ignorierte Katharina. Dessen Sohn Erwin allerdings ignorierte Katharina nicht. Im Gegenteil. Er schubste, ärgerte und beschimpfte sie, wann immer er konnte.
Als ihre Mutter wieder ein Kind bekam, war Katharina acht Jahre alt. Gleichzeitig wurde sie zu einem ärgerlichen Störfaktor, weil es nun andere Kinder gab, die wichtiger waren. Ein Störfaktor, der weg musste. Anni gebar noch weitere zwei Söhne, was Katharinas Stellung immer schwächer werden ließ.
Es gab keine Liebe, noch immer nicht.
Keine Liebe zu Karl, keine zu Katharina und auch keine zu irgendeinem anderen Kind in dieser Familie. Katharina hätte eine Emotion dazu entwickeln können, doch sie wusste nicht, wie das geht und so entschied sie sich dazu, dass es ihr schlichtweg nichts ausmachte. Sie war ein aufgewecktes Mädchen mit klarem Verstand und einem klugen Kopf für die Welt, in der sie lebte. Sie verbrachte wenige, freie Stunden mit Freundinnen, die sie in ihrer viel zu kurzen Schulzeit kennengelernt hatte. Von Lehrern wurde sie nicht gefordert und zuhause hielt man sie bestenfalls für eine dumme Magd. Eine dumme Magd, die keine Wiederworte gab. Katharina spielte die Rolle im Elternhaus mit, schluckte jede gemeine Demütigung und konzentrierte sich darauf den jeweiligen Tag hinter sich zu bringen. Darum ging es: Zu überleben. Sie wuchs auf wie ein Kind zweiter Klasse und ihr Lebensmotto war von Beginn an gewesen:
Du gehörst zu niemandem.
Im Jahr der Machtergreifung, im Januar 1933, Katharina war 15 Jahre alt, starb ihre Mutter. Wie bei jedem anderen Kind auch, war das auch für Katharina ein einschneidendes Erlebnis. Doch sie fühlte nichts. Sie schaffte es zwar, ein paar Tränen zu vergießen, doch das Mädchen begriff nicht, welchen Verlust sie gerade erlebt hatte. Sie hatte auch keine Zeit es zu realisieren, denn nur kurze Zeit später begann sie im stiefväterlichen Gasthof zu arbeiten. Doch auch hier war sie nichts wert.
Die Mutter tot, wollte Karl nicht für immer ein Kind in seinem Haus haben, dessen Vater er nicht war. Im Sommer 1940, mit 22 und ihm nicht mehr nutze, zog sie deshalb in das 18 Kilometer entfernte Forchheim. Ihr Stiefvater hatte ihr, nicht ganz uneigennützig, eine Stellung bei Fabrikfamilie Schmid verschafft. Katharina sollte dort als Hausmädchen das heimische Familienleben zuhause nicht weiter stören. Es hatte Karl einiges gekostet, das ungebetene Balg derart effizient loszuwerden, wohl auch, weil Familie Schmid nichts von ihm und seinem Gasthaus hielt. Sie hatten eine gute Menschenkenntnis.
Es fiel Katharina nicht schwer, ihr Zuhause zu verlassen. Ganz im Gegenteil: Der Wunsch war groß in ihr, auf zumindest einigermaßen eigenen Beinen zu stehen, in Lohn und Brot zu stehen und der Familie, zu der sie nicht gehörte, zu entfliehen. Sie war fleißig, das wusste sie. Sie konnte hart anpacken und war sich für keine Aufgabe zu schade. Bereits als ihre Mutter ihr noch Arbeiten zu erledigen gab, fand sie das heraus. Man musste ihr in dieser Hinsicht nichts beibringen. Die gemeinsame Arbeit verband die Frauen – wenn auch sonst nichts.
Ihr Stiefvater gab ihr ein wenig Geld mit auf den Weg, so dass sie sich wenigstens etwas in der Stadt kaufen konnte. Es war nicht viel und Katharina sollte es auch nie ausgeben.
Katharina wurde von Christel in Empfang genommen. Sie arbeitete hier ebenfalls als Dienstmädchen und führte ihre neue Kollegin erst einmal in den Dienstbotentrakt des Hauptgebäudes, der sich im oberen Teil des Hauses befand. Das mehrstöckige Gebäude war umringt von Bäumen und einem grün-bewachsenen Anwesen, das von mehreren Gärtnern gepflegt wurde.
Die Herrschaften waren nicht zuhause. ER, Erwin Schmid, war geschäftlich in der Stadt und SIE, Hedwig, war bei irgendeinem Kaffeekränzchen im Ort. Das zumindest erzählte ihr Christel, als sie wieder auf dem Weg nach unten waren. Sie unterstanden beide der Köchin Maria, die wortkarg war und mürrisch dreinblickte, als Katharina schüchtern vor ihr in der Küche stand. Sie schwitzte viel und kam durch ihre massige Erscheinung fast nicht an die Töpfe, in denen sie eifrig herumrührte. Katharina entschied sich, sie nicht zu mögen. Es war ein Muster: Katharina mochte eigentlich niemanden. Sie war aber durchaus in der Lage sich zu verstellen ohne dass es aufgesetzt wirkte.
„Geh und hilf Christel mit den Betten.“, blaffte Maria sie an und scheuchte sie aus ihrer Küche. „Ich hab zu tun.“, schnaubte sie ihr hinterher und Katharina wusste nicht recht, ob sie mit ihr oder mit sich selbst sprach.
Sie drehte sich blitzschnell um und eilte aus der Küche. Christel lehnte an der Wand und wartete.
„Na?“, fragte sie Katharina. „Ein Sonnenschein, oder?“, und Katharina musste lächeln. „Aber keine Sorge: Maria ist eigentlich eine gute Seele, aber sie hat eben oft schlechte Laune.“ Christel zuckte mit den Schultern und ging davon. Katharina folgte ihr.
Noch nie zuvor war sie in einem solchen Haus gewesen. Sie gingen durch die Tür zu einem Esszimmer, das so groß war, wie die heimische Wohnung. Überall hingen Gemälde, meist von irgendwelchen seltsam dreinblickenden Menschen in alt aussehenden Roben. Die goldenen Rahmen, die dazu noch ausladend und verschnörkelt gestaltet waren, rückten die jeweilige Persönlichkeit auf den Bildern in das rechte Licht. Apropos rechtes Licht: Ein Bild des Führers fand sie im Eingangsbereich des Haupthauses. Eine geschwungene Marmortreppe führte in den nächsten Stock, in dem sie vermutlich weitere pompöse Zimmer finden würde.
„Sag mir doch als allererstes, was du kannst und nicht kannst, damit ich weiß, was ich dir als erstes zeigen soll.“
„Äh...“, stammelte Katharina wenig damenhaft.
„Sag niemals ‚Äh’. Das kann er nicht leiden. Gib klare Antworten, wenn du etwas gefragt wirst und geh den Herrschaften lieber aus dem Weg.“, begann Christel ihre Einführung. „Los, komm. Wir machen die Betten. Dabei kannst du mir alles erzählen.“
Sie gingen den langen Gang bis an sein Ende und betraten einen sonnendurchfluteten Raum mit schweren Vorhängen, einem unglaublich großen Doppelbett und einer ausladenden Palette an Schminkutensilien auf dem ausladenden Spiegeltisch. Katharina kam aus dem Staunen nicht heraus.
„Das ist ihr Schlafzimmer. Er schläft unten, neben seinem Arbeitszimmer. Wenn er denn mal hier ist.“
„Sie schlafen getrennt?“, erkundigte sich Katharina.
„Ach, ungewöhnlich ist das nicht. Sie haben sich nicht viel zu sagen. Nur bei Festen und großen Feiern sind sie ein Herz und eine Seele. Sie ist eigentlich ganz nett aber er...“ Christel begann zu flüstern als ob die Wände Ohren hätten – hatten sie vermutlich auch. „Er ist ein echter Widerling.“
Gemeinsam begannen sich um das unordentliche Bett zu kümmern. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in diesem neuen Haus, auf diesem anderen Planeten, in diesem anderen Leben hatte Katharina das Gefühl, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ein Kapitel, in dem weder ihre tote Mutter, ihre „neuen“ Geschwister und ihr Stiefvater eine Rolle spielten. Ein Kapitel, in dem sie sich etwas aufbauen könnte.
Vielleicht sogar etwas wie ein eigenes Leben.
Christel redete gern und viel während sie die diversen Zimmer in Ordnung brachten. Sie war eine echte Quasselstrippe und weihte Katharina schnell in die Gepflogenheiten der Herrschaften ein. SIE war eine Dame aus gutem Hause mit jeder Menge Geld und Immobilien in ganz Deutschland. Man munkelt, sie habe die finanziellen Mittel mit in die Ehe gebracht, so dass ER nur noch den Geschäftswillen zeigen musste. Christel arbeitete schon vier Jahre für die Schmids. Als die NSDAP an die Macht kam, war er der erste, der mit ihnen Geschäfte machte. Das war auch nach Kriegsausbruch so geblieben. Es hatte sich sogar noch verstärkt. Bei festlichen Anlässen war das Haus voll von SS und Wehrmacht. Maria hatte Christel erzählt, dass hier sogar hohe Tiere aus Nürnberg anreisten. Für Katharina waren das nur Worte. In ihr Kaff zuhause hatte sich noch keine SS verirrt. Warum auch? Es gab dort nichts zu holen und nicht zu finden.
Noch an diesem Abend lernte sie die Frau kennen, der hier alles gehörte. Es war schon weit nach Mitternacht, als Katharina den Wagen auf dem Kiesweg entlangfahren hörte. Die Lichtkegel warfen seltsame Gebilde an ihre Decke und ließen Katharina aus dem Bett steigen. Sie konnte nicht schlafen. Ihr gingen tausend Dinge durch den Kopf. Das durchdringendste Gefühl war jedoch Freude. Ihr Zimmer war direkt neben Christels im obersten Stock des Hauptgebäudes. Es war eine einfache Kammer mit einem schlichten Holzbett, ein paar Möbeln und einem kleinen Fenster. Kein Luxus wie im Rest des Hauses, aber Katharina fühlte sich gleich wie in einem Königreich. In ihrem eigenen Königreich, in dem sie, und nur sie, das Sagen hatte. Es mochte nicht viel sein, in dem sie wohnte, aber hier schien sie sicher zu sein.
Katharina legte sich wieder hin und schloss die Augen da flog die Türe auf. Katharina schreckte hoch und hatte plötzlich panische Angst. Es war Frau Schmid.„Du bist Katharina?“, begann sie, während der Lichtfall der Zimmertüre verhinderte, dass Katharina sie erkennen konnte.
„Jawohl.“, antwortete sie.„Gut. Hör zu. Ich halte nicht viel von deinem Vater.“
„Er ist nicht mein Vater.“, unterbrach Katharina sie und Frau Schmid verstummte. Katharina konnte sie noch immer nicht sehen und doch wusste sie, dass sie sie nicht hätte unterbrechen sollen.
„Ich halte nicht viel von ihm.“, begann Frau Schmid wieder ohne auf Katharinas Einspruch einzugehen. „Und deshalb wirst du es sehr schwer haben, mich davon zu überzeugen, dass du nicht so wertlos bist, wie er. Es ist nur einem guten Gefallen geschuldet und dem feinen Gemüt meines Mannes, dass du hier bist. Lass es mich nicht bereuen.“ „Jawohl.“, erwiderte Katharina und senkte den Kopf. Es war wohl klüger nun nicht mehr zu widersprechen.
„Gut. Dann wäre das geklärt. Christel wird dich in alle nötigen Hausarbeiten einweisen. Das Beste ist, wenn ich von dir nichts sehe und nichts höre.“ Sie trat in den Flur hinaus, packte den Knauf und zog die Türe zu. „Ach. Und noch etwas.“, die Tür öffnete sich wieder einen Spalt. „Unterbrich mich nie wieder.“ Dann war sie verschwunden und Katharina war allein in ihrer Kammer.
In der Kammer, in der sie zu Gast war. Das war nun eindeutig. Sie musste dafür sorgen, dass sich das nicht änderte.
Es dauerte, bis sie sich wieder auf ihr Kissen sinken ließ. Sie dachte darüber nach, was Frau Schmid gesagt hatte.
Es hat ihn also einiges gekostet, mich hier unterzubringen.
Sie hätte sich verkauft fühlen können, wie ein Stück Fleisch, das man nun doch nicht mehr essen will – oder das schon schlecht geworden war. Wäre sie in einem behüteten Zuhause aufgewachsen, es hätte ihr vermutlich etwas ausgemacht. Beschützt von inneren, ambitionierten Wächtern wusste Katharina, dass sie nichts wert war und dass es nur eine logische Konsequenz darstellte, dass man sie nicht haben wollte. Doch Katharina fühlte solche Dinge nicht, sie war sogar erleichtert darüber, dass sie nun hier war und als sie endlich einschlief, hatte sie ein Lächeln auf den Lippen, weil er, der größte Geizhals vor dem Herrn, so viel hatte geben müssen, um sie los zu werden. „Ich hoffe, es hat dir richtig weh getan.“, flüsterte sie und fiel in einen traumlosen und tiefen Schlaf.
In den folgenden Tagen nahm das hauswirtschaftliche Leben Form an. Christel wies sie in das Haushaltsleben des Alltags ein und unterwies sie in die unterschiedlichen Tätigkeiten in den vielen Zimmern, erzählte ihr Geschichten und Gerüchte über die Herrschaften und hatte ganz offensichtlich einen Drang zum Tratsch. Katharina genoss es.
Jeden einzelnen Tag.
Sie arbeitete hart, ging der Hausherrin aus dem Weg und ließ sich nur dann in den entsprechenden Stockwerken blicken, wenn sie wusste, Frau Schmid war nicht ebenfalls in der Nähe.
Von dem Herrn des Hauses war weit und breit keine Spur. Es hieß, er würde noch eine weitere Woche geschäftlich in Nürnberg bleiben. Katharina war es recht, sie hatte mit Männern sowieso kein glückliches Händchen. Sie machte sich keine Illusion, dass es hier anders sein würde.
Während sie mit Christel die Wäsche auf die Leinen hängte, spürte sie die warme Sommersonne in ihrem Nacken. Was war das plötzlich für ein Gefühl in ihr? Sie war ganz offensichtlich zufrieden.
Glücklich.
Un-einsam.
„Hörst du mir eigentlich zu?“, Christel stand neben ihr und verschränkte die Arme. „Ich rede und rede und rede und du? Du hörst nicht mal hin.“
„Doch, doch. Entschuldige.“, begann Katharina.
„Ach schon gut. Ich rede ja sowieso zu viel. Ich weiß das. Meine Mutter sagte mir das auch ständig. Aber eigentlich stört es mich nicht.“ Sie grinste frech „Es macht mich einzigartig. Und vor allem macht es mich unendlich wertvoll. Weißt du warum?“ Sie sah Katharina fragend an.
„Ich habe keine Ahnung.“, grinste Katharina
„Weil diese Gruft, die wir Haupthaus nennen, sonst nicht zu ertragen wäre.“
Beide lachten.
„Mädchen!“, schrie Maria von der Terrasse in den Garten. Katharina und Christel ließen die Wäsche in die Körbe fallen und eilten zu der Köchin. Ihr roter Kopf und ihre schwitzigen Hände zeigten deutlich Alarmsignale. Als sie bei ihr ankamen, tobte Maria los. „Heute Abend haben wir eine Gesellschaft zum Essen. Richtet das große Esszimmer her.“
„Wie viele?“, fragte Christel sofort. Es schien, als ob die beiden in einer Art Notfallsituation ihren eigens kreierten Prozessablauf abspulten.
„11. Mitsamt den Herrschaften.“
„ER kommt wieder? Schon?“
„Ja. Ihr habt nicht viel Zeit. Beeilt euch. Ich brauche euch danach in der Küche. Ich fahre in die Stadt und besorge die nötigen Dinge für das Essen.“ Maria rauschte davon und Katharina wollte schon Christel hinterhereilen.
„Nein. Mach die Wäsche fertig und sorge dafür, dass die Leinen später wieder leer sind, wenn die Gäste kommen. Manchmal gehen sie bei schönem Wetter noch auf die Terrasse. Wenn Frau Schmid dann noch Wäsche auf den Leinen sieht, macht sie uns beide einen Kopf kürzer.“, erteilte Christel Befehle. „Und ich mag meinen Kopf.“, schickte sie grinsend hinterher, als sie schon fast bei der Terrassentür war. Sie drehte sich um. „Er ist ja auch etwas ganz besonderes.“ Sie warf sich theatralisch das nicht vorhandene lange Haar nach hinten, blinzelte hektisch und stolzierte wenig grazil davon. Katharina schüttelte den Kopf und lachte. Dann eilte sie in den Garten.
Es war bereits Nachmittag, als Katharina beladen mit Wäsche den Gang entlanghetzte, um sie noch am richtigen Platz verschwinden zu lassen. Christel war mit Maria in der Küche beschäftigt und auch sie sollte ihnen gleich zur Hand gehen. Als sie die großen Laken korrekt gefaltet und ordentlich zu den anderen in den großen Schrank gelegt hatte, stürmte sie zur Tür hinaus - und stand vor den Herrschaften.
Vor beiden.
Frau Schmid stand neben ihrem Mann mit einem säuerlichen Gesichtsausruck und starrte Katharina an. Sie war ganz offensichtlich nicht auf sie böse.
„Ah. Katharina.“, begann sie. „Das ist Katharina.“ Sie deutete erklärend auf sie, was eigentlich nicht nötig war. Es war ja sonst niemand hier.
„Der Bastard des Wirts?“
„Der Wirtin, wenn schon. Er ist nur der Stiefvater. Und auch das spielt keine Rolle. Sie ist ja nun hier – dank dir.“ Sie sah ihren Mann nicht an während sie mit ihm sprach sondern sah ungewandt zu Katharina.
„Ich hätte ja auch mal Glück haben können. Doch nein, wieder eine hässliche.“ Er ging an Katharina vorbei Richtung Treppe und steckte sich dabei eine Zigarette an. Katharina stand wie vom Donner gerührt vor Frau Schmid und wusste nicht, was sie nun tun sollte.
„Du kannst gehen.“, sagte Frau Schmid und ging den Flur Richtung Schlafzimmer weiter als wäre nichts Außergewöhnliches geschehen. Christel hatte also recht gehabt. Er war tatsächlich ein Widerling.
Sie kam wenig später in der Küche an, wo dampfende Töpfe und das feine Geschirr bereitstanden. Der Nebel verhüllte den Raum und machte es Katharina kurz nicht möglich ihre Kolleginnen zu erkennen.
„Da bist du ja.“, Christel packte Katharina am Arm und stellte sie an der Arbeitsfläche am Fenster ab. „Beeil dich mit den Kartoffeln.“, und machte sich selbst wieder an ihre Arbeit. Maria war eine fantastische Köchin. Sie hätte es vermutlich niemals laut gesagt, aber man spürte, dass sie mit Leidenschaft bei der Sache war und dafür lebte. Sie schmeckte x-mal ab und war ein echtes Organisationstalent. Wenn sie derart beschäftigt war, vergaß sie sogar zu schimpfen und zu zetern. Sie war ganz bei der Sache, bei ihrem Essen.
„Wer kommt denn?“, traute sich Katharina zu fragen, als sie einigermaßen auf dem Laufenden waren. „Jemand wichtiges?“
„Spielt das eine Rolle?“, blaffte Maria „Es sind Gäste. Wichtig oder unwichtig, sie haben Hunger und wir müssen dafür sorgen, dass sie satt werden. Christel übernimmt die Bewirtung, du hilfst mir mit Anrichten und vorbereiten.“
Trotz dass Maria wieder zu alter Form auflief, fühlte sich Katharina als Teil einer Gemeinschaft. Maria akzeptierte sie anscheinend nach nur wenigen Tagen. Sie wurde nicht gelobt.
Nie.
Mehr war nicht wichtig. Maria sagte nicht, sie solle verschwinden. Ein größeres Kompliment gab es nicht, als das, dass sie sie neben sich in ihrer Küche duldete. Sie arbeiteten, richteten und kümmerten sich um die diversen Gänge. Katharina wurde es zeitweise ganz schwindelig anhand der Fülle an Essen. Zuhause gab es dank des Hofes und des Gasthauses zwar auch immer ausreichend Mahlzeiten, diese Fülle an hochwertigen Speisen jedoch? Für Katharina war das nur schwer zu fassen, welches Leben die Herrschaften hier führten. Ganz selbstverständlich und aufgesetzt fröhlich.
Während an anderen Orten Bomben fielen.
Der Abend verlief zufriedenstellend. Es kamen nur leere Teller zurück, was Maria zu geradezu euphorischem Hintern wackeln inspirierte. Sie schwebte durch die Küche, spülte und putzte. Als Christel hereinkam und weitere Teller abstellte, flüsterte sie Katharina zu: „Es fehlt noch, dass sie anfängt zu singen.“ Beide grinsten.
Es war beinahe Mitternacht, als die Gäste sich auf der Terrasse lautstark unterhielten, lachten und auf den Führer anstießen. „Heil Hitler!“, war sogar bis in die Küche zu hören. Als Katharina, die gerade das Esszimmer von nicht mehr benötigtem Geschirr befreite an der großen Fensterfront vorbeiging, spähte sie nach draußen. Sie sah Uniformierte mit ihren Frauen und ein paar Kinder, die auf dem Rasen herumtollten. Offenbar nahm man es mit den Bettzeiten bei solchen Persönlichkeiten nicht allzu genau. Die Männer trugen alle zur Seite gekämmte Scheitel und machten auch wenn sie lachten keine ausgelassene Figur. Manche sahen aus wie die Männer der SS, von denen Katharina gehört hatte. Streng, grausam und fies. Frau Schmid saß mit einigen Frauen etwas abseits und unterhielt sich angeregt. Es schien, dass sich die mitgebrachten Eheweiber über angenehmere Dinge unterhielten. Die Männer in der Runde schienen eher an niveaulosem Schalk interessiert zu sein. Sie lachten, schlugen sich gegenseitig auf die Schultern und spuckten ihr gerade getrunkenes Bier wieder auf den Boden vor lachen. Katharina wandte sich ab und eilte zurück in die Küche. Sie hatte genug gesehen.
Maria schickte sie wenig später in den Nebenraum der Küche. Hier stand der Hauptgang auf einem Tisch. Dampfend und duftend, als sei heute ein Weihnachtsmorgen in einer gänzlich anderen Zeit. Sie wusste nicht, was sie tun sollte und drehte sich zu Maria um.
„Was guckst du so?“, blaffte Maria sie an. „Iss. Es wird kalt. Christel kommt auch gleich. Warum sollen wir es wegschmeißen. Es wäre schad’ dafür!“
Katharina konnte es nicht glauben. Sie hatte nicht gewusst, wie hungrig sie war, als sie sich an den Tisch setzte und zu Essen begann. Als Christel zu ihr stieß, war Katharina schon fast fertig. „Schmeckts?“, grinste Christel. „Ich sterbe vor Hunger.“ Maria erschien und stellte auch ihr einen Teller hin. „Es riecht köstlich!“, freute sich Christel.
„Nicht nötig zu reden. Nur essen.“
Katharina sah, wie Marias Mundwinkel ein kurzes Lächeln umspielte.
Katharina legte ihr Musterverhalten kurz beiseite, das sich vor allem mit der angeborenen Distanz zu anderen Menschen zeigte.
Ich mag sie., stellte sie erstaunt fest. Ja, ich mag sie wirklich. Alle beide.
***
Katharina lebte sich im Haus der Schmids ein, behielt aber den Rat der Hausherrin stets im Kopf. Sie blieb unsichtbar und arbeitete hart um den Ruf ihrer Familie abzuschütteln. Sie war nicht wie er. Wie sie vielleicht, dagegen konnte sie nicht viel tun. Aber wie er? Niemals!
Sie kümmerte sich gerade um die Vorhänge im Arbeitszimmer des Hauses, als die Tür aufging. Der Hausherr schritt hinein ohne sie eines Blickes zu würdigen. Katharina hängte gerade den letzten Vorhang ab um ihn zu waschen, als er sie ansprach. „Wie geht es deinem Vater?“, wollte er wissen.
„Er ist nicht mein Vater.“, gab Katharina zurück. „...und ich weiß es nicht.“, schob sie schnell hinterher.
„Du magst ihn nicht.“, Er lachte anhand seiner eigenen Feststellung. „Vielleicht bist du doch nicht so dumm, wie ich dachte. Sei lieber froh, dass du von ihm weg bist. Er taugt wirklich nicht viel.“
Katharina reagierte nicht. Sie wusste nicht wie.
„Komm her.“, befahl er plötzlich.
Katharina hatte auf einmal ein ungutes Gefühl. Angst überkam sie und angesichts des geschlossenen Raumes war sie ihm auch geradezu hilflos ausgeliefert. „Ich muss mich um die Wäsche...“
„Komm her!“, brüllte er und sein Kopf wurde rot.
Katharina ließ die Vorhänge fallen und begann auf den schweren Holzschreibtisch zuzugehen, als die Tür aufging.
„Erwin?“, flötete Frau Schmid. Katharina wusste, dass sie nicht alleine war, ansonsten wäre der Ton weniger lieblich ausgefallen. „Besuch für dich.“
„Geh.“, sagte er an Katharina gewandt. Sie raffte die Vorhänge zusammen und eilte zur Nebentür hinaus, sodass sie nicht an den Herrschaften und ihrem Besuch vorbeimusste. Sie sah auch nicht, wer es war, so schnell war sie verschwunden.
Kreidebleich rannte sie in Christel hinein, die Katharina den Schrecken sofort ansah. „Was ist geschehen?“, fragte sie sofort.
„Nichts.“, versuchte sich Katharina aus dem unangenehmen Gespräch zu befreien. Auf keinen Fall wollte sie nun Schwierigkeiten verursachen – auch nicht bei Christel.
„Nun sag schon!“, Christels Frohnatur war verschwunden.
„Ich weiß es nicht. Eigentlich nichts. Ich war im Arbeitszimmer, als er reinkam. Er hat Fragen zu meinem Stiefvater gestellt und dann sollte ich zu ihm kommen.“
„Was ist dann passiert?“
„Seine Frau kam mit Besuch und ich bin rausgerannt.“
„Hör mir jetzt gut zu. Du wirst in Zukunft solche Situationen meiden. Ich übernehme das Arbeitszimmer und du gehst ihm aus dem Weg. Hast du verstanden?“
„Aber...“
„Nichts aber. Ich sagte dir, er ist ein Widerling. Er ist aber noch viel mehr als nur das. Er ist gefährlich. Halt dich von ihm fern.“
Damit war die Unterhaltung zu Ende und Christel rauschte davon. Katharina schluckte den Schrecken die trockene Kehle hinunter und versuchte die erlebte Situation zu vergessen. Es gelang ihr schnell, in dieser Hinsicht machte ihr niemand so schnell etwas vor. Sie machte sich nur noch einmal bewusst, dass sie ihn in Zukunft in jedem Fall meiden musste. Wie er sie angesehen hatte, mit welchem Ton er sie zu sich bestellt hatte, wie dunkel seine Augen gewesen waren.
Er passte perfekte in die Zeit, in der sie lebte.
Kapitel 3
Johann Wagner war ein Schelm. Bereits als Kind hörte er mehr die Bezeichnung Lausbub als seinen richtigen Namen. Dabei war eigentlich nichts an seinem Leben wirklich komisch. Als ältester Sohn mit drei älteren Schwestern und einem jüngeren Bruder trug er die Verantwortung seiner ganzen Welt auf seinen Schultern. Doch Johann war seit jeher der Meinung, dass es sich nicht lohnte den Spaß am Leben zu verlieren. Nicht, als er für alles verantwortlich war und gemacht wurde und nicht, als Hitler an die Macht kam und sich Deutschland immer wieder und immer weiter veränderte. Er bekam ohnehin nicht viel davon mit. Die Familien, denen es wirklich schlecht ging, hatten echte Probleme. Sie hatten Hunger, sie froren in kalten Wintern, sie brachen auseinander. Johann hatte diese Probleme nicht, weil sein Vater schon immer ein hart arbeitender Mann gewesen war. Er hatte einen Hof aufgebaut, der mit vielen Häusern Handel trieb. Dank der Tiere und den Feldern war die Zukunft hier in diesen vier Wänden gesichert. Johanns Vater befehligte sein Personal mit Autorität und gutem Willen. Seine Untergebenen schätzten ihn, weil er ein ehrlicher Mann war und auch diesen Ruf in der Gemeinde genoss. Und es gab noch eine weitere, weitaus wichtigere, positive Eigenschaft der Bauernfamilie: Sie war großzügig. Der Hof funktionierte und er verdiente mit den reichen Schnöseln in den Nachbarorten genug Geld, weil seine Waren einen qualitativen Wert besaßen. Und so mussten auch seine Mitarbeiter nicht hungern. Sie verdienten nicht das große Geld, sorgten aber zuhause für volle Mägen. Johanns Mutter versuchte in regelmäßigen Abständen immer wieder eine gewisse Strenge einzuführen. Sie scheiterte aber an der Starrköpfigkeit ihres Mannes und ihres Sohnes. Der hörte ihr immer gut zu, wenn sie ihm Ratschläge erteilte und machte dann doch was er wollte. Das hatte ihm sein Vater nachhaltig beigebracht: „Junge.“, hatte er gesagt „Mach, was du für richtig hältst. Und wenn ich nicht mehr bin, dann höre auf niemanden, außer auf dich selbst.“ Er mochte kein weiser Mann sein, aber er hatte das Herz am rechten Fleck. Johann verdankte seinem Vater viel, vor allem das Selbstbewusstsein, was dafür sorgte, dass sie weiterhin überlebten. Während er den Hof organisierte, mit anpackte wo gerade eine helfende Hand benötigt wurde, sorgten seine Schwestern Anna, Margareta und Marie für den Haushalt, verkauften Gemüse und Milch auf den umliegenden Märkten und hielten die Maschinerie am Laufen. Nur sein Bruder Sepp schlug in dieser Hinsicht aus der Art. Er ging bei einem Zimmermann in die Lehre und kehrte der Familie überwiegend den schweigsamen Rücken zu.
Johann selbst fuhr auch die Waren aus, was dem Ruf des Hofes nur weiter zu Gute kam. Die Hausfrauen vergötterten ihn aufgrund seines Charmes und seinen kessen Sprüchen. Er war kein Schönling und auch weit davon entfernt. Aber er spannte ein emotionales Band zwischen ihm und seinem Hof und den Frauen, die seine Waren benötigten.
Er spielte eine Rolle.
Das wusste er und das wussten vermutlich auch die Damen, die ihm die Türen öffneten. Aber es war eine dankbare und höchst einträgliche Rolle.
Seine Mutter, die in den letzten Jahren stark gealtert und schmächtig geworden war, überließ den Haushalt ihren Töchtern und kümmerte sich derweil um ihre Hühner. Damit schien sie zufrieden zu sein, doch sicher wusste es Johann nicht.
Er fragte sie nie.
Was im übrigen Deutschland vor sich ging und welche Reden welcher Politiker auch immer hielten: Mit seiner Welt hier hatte das nichts, oder sehr wenig, zu tun. Sollten sie doch Krieg führen, solange seine Familie damit nichts zu schaffen hatte, hatte er nichts dagegen. Es ging ihn ja eigentlich auch nichts an.
Dienstags und donnerstags war Auslieferung. Immer. Pünktlich fuhr Johann seine Kunden an. Doch an diesem Dienstag war etwas anders. Als er durch die Dorfstraße seines Ortes fuhr, waren weniger Menschen unterwegs, als sonst. Er beschloss, bei seinem alten Schulfreund Rudi zu halten. Als der kurz darauf die Tür öffnete, war selbst Johann nicht in der Lage, für gute Laune zu sorgen. Die Sorgenfalten standen tief in Rudis Gesicht.
„Was ist los?“, fragte er stattdessen ohne einen Gruß.
„Sie haben eingezogen.“
„Was? Hier? Wen?“
„Den Hansi von gegenüber und Paul aus der Schmidchengasse. Auch Gert und Robert.“
Johann konnte es nicht glauben. Sofort dachte er an Sepp und die drohende Gefahr, die unmittelbar in sein Leben getreten war.
„Vielleicht holen sie uns als nächstes?“, Rudi hatte offensichtlich panische Angst.
„Du bist viel zu alt.“, versuchte es Johann, merkte aber schnell, dass das nicht ankam. Rudi war schon wieder gedanklich weit weg. „Komm schon. Es wird schon alles werden.“
„Weißt du überhaupt, was das heißt?“, Plötzlich war Rudi wieder bei ihm und sein roter Kopf verriet seine Wut. „Es heißt, dass es jetzt auch uns trifft. Hier! Das kann doch alles gar nicht wahr sein.“ Er vergrub sein Gesicht in seinen Händen.
Johann war hilflos. Er wusste nicht, was er seinem Freund sagen sollte. Was ihn trösten oder aufmuntern konnte. Es gab ja im Grunde auch nichts, was die Tatsache besser machte, dass es jeden Tag Kriegspost geben könnte.
„Bist du in der Partei?“, wollte Rudi plötzlich wissen.„Nein.“, erwiderte Johann. „Du?“
„Bisher nicht. Vielleicht sollte ich reingehen. Es könnte helfen.“
„Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist.“
Rudi lachte. „Du bist immer noch unpolitisch. In dieser Zeit in der wir leben, Johann? Ich glaube nicht, dass du dir das noch lange leisten kannst.“
„Wir werden sehen. Ich muss gehen, Rudi. Versuch nicht durchzudrehen, in Ordnung?“
Johann verabschiedete sich und fuhr zu seinem ersten Kunden. Er war nicht richtig bei der Sache, was aber nicht weiter auffiel. Alle anderen auch nicht. An diesem Ort sprachen sich Neuigkeiten schnell herum und irgendwer hatte immer irgendwen in größeren Städten, der frischen Tratsch in die Gemeinde brachte. Sie wussten, wenn auch nur am Rande, dass der Krieg vor der Tür stand.
Vor jeder Tür.
Und dass Männer eingezogen, weit weg geschickt wurden, nicht wiederkamen. Doch solange es sie selbst nichts anging, waren es Fremde. Menschen, die man nicht persönlich kannte. Nun hatte der Krieg selbst an die Haustüren auf dem Land geklopft. Johann konnte diese Entwicklung nicht verstehen. Er war blind und taub wie all die anderen. Selbst die Lüge, es würde ihnen allen schon nichts geschehen, half nicht dabei, den Gedanken an den Verlust von Freunden, Familie zu verdrängen. Und so verschwand die Frohnatur Johann für diesen Tag von der Bildfläche. An seine Stelle trat ein stiller und wortkarger Mann, der, statt den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, einen stillen Händedruck verteilte oder die Frauen, die er besonders mochte, kurz drückte. „Du bist ein Guter, Johann. Such dir endlich eine Frau.“, hatte Frau Schuster ihm hinterhergerufen und zumindest kurzzeitig für Ablenkung gesorgt. Eine Frau! Darüber hatte er auch schon nachgedacht. Er war nun 30 Jahre alt und hatte im Grunde das heiratsfähige Alter schon fast hinter sich gelassen. Er stand gerade an der Schwelle zum ewigen Junggesellen, der er ja auch war. Es hatte Bekanntschaften gegeben, die aber nach kurzer Zeit meist durch ihn wieder beendet wurden. Erfahrungen hatte er genug gemacht, was daran gelegen haben könnte, dass er nun mal einen entscheidenden Joker besaß. Seinen Charme. Er ermöglichte ihm spielend einfach Zugang zu Frauen und weil ihm eine ernsthafte Beziehung nichts bedeutete und weil es bei seinen Eroberungen um nichts ging, war es nicht sonderlich schwer für ihn, sich ungezwungen und locker zu geben. Weil es nicht gespielt war. Es war ehrlich, aufrichtig.
Im Moment traf er sich mit Frieda, der Tochter des örtlichen Metzgers. Sie war blond und eigentlich ein wenig zu hübsch in Johanns Augen. Er wusste, dass es ihr ernst mit ihm war, dass sie im Grunde nur darauf wartete, bis er sie zu einem romantischen Spaziergang ausführte um sie zu fragen, ob sie ihn heiraten würde. Doch Johann spielte nicht einmal mit dem Gedanken, auch nicht, wenn er in Situationen kam, in denen er dazu aufgefordert wurde, endlich zu heiraten. Seine Eltern hatten es ebenfalls ein paar wenige Male versucht, seine unverheiratete Stellung anzusprechen. Sie scheiterten wie gewohnt souverän und gaben es irgendwann ganz auf. Sie konzentrierten sich gerade darauf ihrer Tochter Anna eine gute Partie zu besorgen, was sich als ebenso schwierige Herausforderung herausstellte, wie bei Johann. Sie hatten eben alle die gleichen Gene – die eines harten Schädels mit einschlossen. Nur Margareta und Marie hatten bereits geheiratet. Margareta hatte mit ihrem Mann Hans drei Kinder. Engelbert war neun, Rosa acht und Josef sechs.
Die Tour dieses Tages dauerte länger, als normalerweise. Das lag nicht an den Kunden, der Fahrt oder der Menge der Waren, sondern an den Ereignissen, die unwirsch an die Pforten ihres Lebens geklopft hatten. Johann beschloss die Geschichten zuhause für sich zu behalten, doch es war zu spät. Sein Vater, stets gut informiert, wusste bereits, was geschehen war und sprach Johann natürlich sofort darauf an, als er zur Tür hereinkam.
„Hast du gehört?“, begann er. „Sie haben eingezogen.“
„Ja, Rudi hat es mir erzählt.“, Er setzte sich an den Küchentisch und blickte in die sorgenvollen Augen seiner Vaters, der bereits den Ersten Weltkrieg mitgemacht hatte.
„Es wird schon alles gut werden. Rudi will beitreten. Vielleicht ändert das ja was.“
„Ach.“, sein Vater winkte ab „Was soll das schon ändern? Wenn sie Männer brauchen ist die politische Einstellung doch egal. Und wenn sie merken, dass wir vom Land mehr aushalten, als die aus der Stadt, werden sie noch mehr holen.“, er unterbrach sich und sah zum Fenster hinaus, wo Sepp gerade über den Hof ging. „...und es gibt nichts, was wir dagegen tun können.“
***
Es war spät geworden. Johann schloss gerade das Scheunentor und ging in Richtung Haus, als er ein Fahrrad um die Ecke kommen sah.
„Johann.“
„Frieda?“
„Ich musste dich sehen. Hast du gehört, was passiert ist?“Langsam reichte es ihm die gleiche Sache immer wieder zu diskutieren. Er hatte auch Angst. Es gab niemanden, der sie ihm nehmen konnte, warum also sollte er in der Lage sein?
„Ja, ich hab es gehört.“
„Es ist schlimm. Wir müssen beten, dass es nicht noch mehr trifft.“
„Beten? Wozu?“, Johann ging an ihr vorbei weiter in Richtung Eingangstüre, Frieda kam hinter ihm her.
„Was meinst du wozu?“
Johann drehte sich zu ihr um.„Es ist besser, wenn du jetzt nach Hause fährst, Frieda. Ich habe heute genug darüber gesprochen und weiß gerade auch nicht, was ich sagen soll. Und ehrlich gesagt bin ich es auch leid. Es war ja auch dumm von uns zu denken, der Krieg würde nicht bis zu uns kommen.“
„Aber es wird sich lohnen. Er ist sicher bald vorbei und dann wird sich alles für uns ändern.“
„Meinst du? Ich will gar nicht, dass sich alles ändert. Es geht uns gut. Kein Mensch weiß, wozu wir diesen Krieg führen und ich will es auch nicht wissen.“
„Vater sagt, es sei klug, in die Partei einzu...“, weiter kam sie nicht.
„Hör zu Frieda. Verzeih mir, wenn ich jetzt nicht weiter darüber sprechen will. Sei vorsichtig und komm gut nach Hause.“, damit verschwand er im Haus und ließ Frieda auf dem Hof im Dunkel zurück. Er stand noch eine Weile an der Tür gelehnt da, bis er nach einigen Minuten endlich hörte, wie sie sich auf den Sattel setzte und davon fuhr. Es war ihm bewusst, dass er sie verletzt hatte. Und genau hier, in diesem Moment, an dieser Tür und in dieser Nacht fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Er war wie alle anderen. Genauso engstirnig und egoistisch. Er wollte sich nicht damit befassen, was geschehen würde, sollten tatsächlich seine Freunde der Wehrmacht beitreten müssen.
Oder der SS.
Sollten meine Freunde fallen...
Den Krieg auszublenden und so weiterzumachen wie zuvor, war für ihn ein guter Weg. Für ihn und für alle anderen auch. Doch das ging jetzt nicht mehr. Es war vorbei mit Frieden in Kriegszeiten und der Idee, es ginge ihn nichts an. Johann musste erwachsen werden und sich schleunigst einen Weg einfallen lassen, wie er seine Familie schützen konnte. Er musste Frieda loswerden und sich nur noch um den Hof kümmern. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn wieder dazu drängen würde, einzutreten und der Nazi-Ideologie zu folgen. Johann war vieles, aber er war nicht gewaltbereit und auch kein Patriot, der freiwillig für sein Land sterben wollte. Er schloss die Augen und atmete tief ein und wieder aus. Es würde eine lange Nacht werden, eine Nacht, in der an Schlaf nicht zu denken sein würde.
Als er am nächsten Morgen von den ersten Sonnenstrahlen geweckt wurde, hatte er gerade ein paar Stunden geschlafen. Er war nicht in der Lage gewesen, sich einen Schlachtplan für die kommenden Wochen, vielleicht sogar die kommenden Monate zurecht zu legen. Er hatte nicht einmal Ideen. Das war das Schlimmste überhaupt: Hilflos der gegebenen Situation entgegensehen zu müssen. Wie ein sich frei fühlendes Spiegelbild, das dem Original, gefesselt und geknebelt, beim Strampeln zusehen muss. Er konnte nichts tun und er hasste es. Er hasste es mitansehen zu müssen, wie alles vor die Hunde ging.
Als er sich im Bad für den anstehenden Tag zurecht machte, legte er nicht nur seine schlechte Laune und seine Unzufriedenheit ab, sondern auch seine Wut. Wie einen alten Hut, den man einfach vergisst aufzusetzen. Er hatte einen Beruf, nein: Er hatte eine Berufung und zwar solange es eben ging dafür zu sorgen, dass seine Freunde, Nachbarn und Kunden zumindest eine kleine Weile lang die anstehenden Schrecken vergaßen. Man musste sich manchmal auf seine Talente besinnen und nicht auf seine Ängste.
Und so schlug er als letztes Zeichen seines Unmutes die Zimmertür fest ins Schloss und trampelte so laut er konnte in die Küche hinunter. Seine Mutter saß am Küchentisch und lächelte, als sie ihn sah. Margareta stand bereits am Herd und bereitete den Tag vor. Er gab ihr einen Klapps auf den Hintern, nahm ihre gespielte Entrüstung zur Kenntnis und küsste sie auf die Wange, bevor er zur Tür hinaus war. „Du musst was essen, Bub!“, schrie seine Mutter ihm hinterher.
„Keine Zeit.“, blökte er grinsend zurück und war sich der Lüge bewusst.
Er hatte Zeit, aber keinen Appetit.
Nachdem er sich um die Kühe und den Stall gekümmert und seine Männer gemeinsam mit seinem Vater auf den Weg in Richtung Arbeit geschickt hatte, legte er sich seine heutige Route fest. Seine Kundinnen im Nachbarort mussten heute mit seinen Waren ausgestattet werden. Es war der anstrengendste Tag der Woche, auch, weil er zu vielen seiner dortigen Kundschaft einen weniger guten Draht hatte. Viele sahen ihn nicht als Johann, sondern als Bauernjungen, der zu mehr eben nicht taugte. Nicht, dass ihm das in irgendeiner Art und Weise etwas ausgemacht hätte, es machte nur nicht soviel Freude, wie zuhause.
Er zählte gerade die Lieferscheine, als Anna in den Stall gerannt kam.
„Johann, komm’ schnell.“, stieß sie schnellatmend heraus.
„Was ist?“
„Sepp...“, keuchte sie „Er ist verrückt geworden.“
Johann rannte seiner Schwester hinterher in die Stube. Seine Eltern saßen am Tisch, die Köpfe feuerrot und erstarrt vor Angst.
Er war die Wut. Sie die Verzweiflung.
Für Johann normalerweise ein sicheres Zeichen, das Weite zu suchen. Doch er blieb – Natürlich blieb er.
„Was ist los?“, fragte er. Er ging schon einmal innerlich in Deckung.
„Ich habe keine Ahnung, was passiert ist.“, flüsterte seine Mutter. „Ich weiß es einfach nicht.“ Sie sah Johann an und ihre Augen waren feucht. Es schien jedoch, als würden sich selbst ihre Tränen nicht trauen, über die Wangen zu laufen.
„Er ist fort. Gegangen.“, sagte sein Vater.
„Gegangen? Wohin denn?“, langsam nervte ihn die bruchstückhafte Berichterstattung seiner Eltern. „Würde mir bitte jemand sagen, was hier los ist?“
„Er ist in die Stadt gefahren und will sich freiwillig melden.“, seine Mutter sah zum Fenster hinaus „Er will kämpfen.“ Sie sah Johann an und die Tränen waren fort. Er blickte an eine wütende, sich gefährlich an sich haltende Mauer, hinter der eine aufbrausende Wut lauerte, die ihre Fratze zeigte. „Geh, Johann. Geh und verhindere es.“
Und Johann ging.
Keine Diskussion, keine Wiederworte, keine Zeit, sich eine Meinung zu bilden oder sich darüber aufzuregen. Auf dem Weg in die Stadt machte er sich Gedanken darüber, wie es auf einmal dazu gekommen war. Bisher dachte er immer, Sepp sei, wie er und seine Schwestern, unpolitisch, resistent gegenüber der Propaganda. Er fragte sich, was geschehen war und warum sich sein 20jähriger Bruder gerade aufmachte, sich in ein NSDAP-Büro zu begeben.
Johann trat in die Pedale, der Schweiß ließ ihm über das Gesicht und er atmete schwer. Er war kein Sportler und auch nicht daran interessiert einer zu werden. Er hatte für diesen Auftritt also nicht trainiert, sich nicht vorbereiten können. Er bog auf die Hauptstraße ein und wurde schneller. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn er zu spät käme. Er fuhr die leichte Linkskurve entlang, an deren Ecke der Bäcker wohnte, und sah Sepp auf dem Bürgersteig laufen. Er ging schnell, schneller als normal. Vielleicht, so hoffte Johann, ging er so schnell, um nicht darüber nachdenken zu müssen, was er da gerade tat – und warum er es tat. Johann kam neben ihm zum Stehen und ließ sein Fahrrad auf den Bürgersteig fallen. Es machte einen lauten Krach, als der Rahmen auf den Boden aufschlug. Sepp fuhr herum, erkannte seinen Bruder und seine Augen wurden groß. Er drehte sich um und lief schneller. Das Büro war nur noch wenige Häuserecken entfernt, Johann konnte schon die Soldaten sehen, die davor standen und rauchten. Bitte, lass es keine SS sein, schoss es ihm durch den Kopf.
Er rannte hinter seinem Bruder her, es sollte nicht zu aufgeregt wirken, er durfte unter keinen Umständen die Aufmerksamkeit der Soldaten erregen, sonst war alles aus. Sepp drehte sich immer wieder um und bemerkte, dass der Abstand weniger wurde, Johann holte alles aus seinem wenig sportlichen Körper heraus und holte Sepp schließlich ein. Er packte ihn am Arm und riss ihn zurück. An die Hauswand eines Nähgeschäfts gedrückt, war der Ton gedämpft, aber scharf.
„Was tust du denn?“, pfiff er Sepp an „Bist du verrückt geworden?“
„Lass mich!“, Sepp versuchte sich loszureißen. Sein dunkles, lang gewordenes Haar flog hin und her, Johann ließ nicht locker.
„Du kommst sofort mit nach Hause.“
„Nein.“
„Was soll das denn, Sepp?“, Johann sah sich um und versicherte sich, dass niemand ihn belauschte. Die Soldaten lachten und schlugen sich auf die Schulter. Wahrscheinlich erzählten sie sich dreckige Witze. „Was ist nur in dich gefahren?
Sepp sah ihn aus wütenden Augen an und riss sich los. Er zog sich seine dünne Jacke zurecht.
„Also?“, Johann wurde ungeduldig. „Bin ich keine Antwort wert?“.
„Was willst du denn von mir?“, schrie Sepp ihn an.
„Nicht so laut!“, unterbrach ihn Johann schnell und sah sich um. Ein Soldat schaute neugierig in seine Richtung. „Bist du wahnsinnig?“
„Ich bin nicht wie du.“, sagte Sepp nun ruhiger. Auch er hatte die Soldaten bemerkt. „Ich bin kein Feigling. Ich will für mein Land kämpfen, weil ich daran glaube, dass es richtig ist.“, Sepps Augen waren kalt und Johann ging einen Schritt zurück.
Da war keine Angst.
Keine Panik.
Es war Entschlossenheit.
„Alles in Ordnung hier?“ Ein junger, blonder Soldat in Wehrmachtsuniform stand plötzlich neben Johann. Von einem Moment auf den anderen entglitt ihm jegliche Kontrolle über die Situation. Er wäre nicht in der Lage einzugreifen ohne sofort verhaftet zu werden, wenn Sepp nun einfach weiterging. Vaterlandsverrat beging schon, wer derart offensichtlich nicht an den Krieg glaubte.
„Alles in Ordnung, danke.“, erwiderte Johann schnell und sah zu seinem Bruder. Sein Blick war flehend. „Mein Bruder und ich haben nur schlechte Nachrichten bekommen.“ Der Soldat schaute beide abwechselnd an.
„Aha.“, kommentierte er.
„Wir gehen. Vielen Dank.“, versuchte sich Johann zu verabschieden und sich zwischen ihm und seinem Bruder zu platzieren.
„Heil, Hitler.“
„Ja. Heil, Hitler.“, gaben die Brüder zurück und der Soldat ging zu seinen Kameraden zurück. Johann schnappte sich sein Fahrrad ohne seinen Bruder loszulassen und ging die Hauptstraße weiter, ohne sich noch einmal umzusehen.
„Was glaubst du, hast du jetzt gewonnen?“, fragte Sepp ihn ohne stehenzubleiben.
Nichts. Nur Zeit.
Johann antwortete ihm nicht und ging weiter. Um ein Haar hätte er seinen Bruder an den Krieg verloren. Um ein Haar wäre alles aus gewesen.
Kapitel 4
Katharinas Hoffnung stieg, dass sich ihr Leben entscheidend ändern würde. Der Herr des Hauses war erstaunlich wenig zu Hause seit der seltsame Besuch gegangen war. Wichtige Geschäfte hielten ihn wohl davon ab, das heimische Bett zu beanspruchen. Katharina war es recht. Zu Frau Schmid bekam sie ein immer besseres Verhältnis, was wohl vor allem daran lag, dass sich Maria nicht über sie beklagte. Das höchste Lob der Köchin war, wenn sie nichts sagte und das wusste auch die Dame des Hauses. Die Feste blieben klein und beschaulich oder blieben ganz aus. Ab und an verirrten sich ein paar Freundinnen in das große Anwesen oder ein befreundeter Geschäftsmann schaute vorbei. Es blieb ruhig und Katharina kannte nun fast schon alle Räume des Anwesens. Heute war sie damit beschäftigt sämtliche Betten frisch zu beziehen, was ihr im Grunde die meiste Freude machte. Hier war sie ganz allein und sie konnte an dem herrlichen Stoff riechen und sich vorstellen, wie sie darin schlafen würde. Sie wusste, dass das nie der Fall sein würde, aber es hatte etwas Unbeschwertes, sich in einem viel zu großen Schlafzimmer von seinen Gedanken fortspülen zu lassen. Sie schüttelte gerade das zweite Kopfkissen auf, als Christel ins Zimmer spickte.
„Da bist du ja.“, rief sie aufgeregt. „Mein Gott, manchmal hasse ich dieses riesige Haus. Wenn du sagst du gehst die Betten beziehen, brauche ich in Zukunft noch die Zimmerangabe, sonst irre ich auch das nächste Mal wie eine Blöde durchs Haus. Aber egal. Hör zu.“, Ihr Tonfall wurde verschwörerisch und Katharina wusste, dass es nichts Gutes zu bedeuten hatte. „Heute Abend gehen wir auf das Stadtfest. Du. Ich.“, sie unterbrach sich „Und ein paar Freunde.“, sagte sie schnell. „Das wird sicher lustig.“, Erwartungsvoll sah sie Katharina in die Augen und erwartete vermutlich Freudentaumel. Der blieb aus – Katharina war schließlich immer noch Katharina und kein vollkommen neuer Mensch geworden.
„Ich glaube nicht, dass ...“, weiter kam sie nicht.
„Ah. Ah. Ah.“, Christel schloss die Augen und winkte ab „Nichts da. Du gehst mit. Ich habe den anderen schon gesagt, dass du auch mitkommst. Es interessiert mich eigentlich auch nicht, wie du das findest. Du kommst mit. Fertig.“
Katharina ließ sich auf den Stuhl sinken. Sie war erschöpft und musste sich eingestehen, dass sie gegen Christel nicht ankam. So gar nicht. Eine Idee hatte sie noch.
„Ich habe nichts anzuziehen.“, versuchte sie es kleinlaut und obwohl es stimmte, wusste sie schon, wie die Lösung für dieses Problem aussah.
„Kein Problem. Ich leih dir was.“
Problem gelöst.
Verdammt.
Frau Schmid verließ bereits am späten Nachmittag das Haus und hatte Maria gesagt, dass es heute später werden würde. Optimale Voraussetzungen also, um die Sperrstunde zu umgehen. Trotz dass die Mädchen auch Feierabend hatten, waren sie doch angehalten, auf die Hausregeln zu achten. Und die waren nicht verhandelbar. Deswegen war es Katharina auch mehr als unrecht, diese Regeln absichtlich zu verletzen. Als sie aus ihrer Kammer kam, trug sie ein blaues Kleid mit weißen Margeriten darauf. Es war hübsch. Zu hübsch für Katharinas Geschmack. Doch als Christels Blick auf sie fiel wusste sie, dass sie sich die anstehende Diskussion auch durchaus sparen konnte. Gut, dann sieht das Kleid eben hübsch an mir aus.
Die Sonne schien noch hell, als Christel und Katharina das Festgelände betraten. Hätte man die Szenerie in eine andere Zeit versetzt, man würde nicht glauben, dass sich die Menschen hier im Krieg befanden. Es war eine bunte Masse an Einheimischen – Fremde verirrten sich nicht hierher. Viel zu stark geschminkte Frauen, die Christel schnell und unwiderruflich als „leichte Mädchen“ abstempelte, mischten sich unter Soldaten und einfache Bauern. Katharina wusste immer noch nicht, was zur Hölle sie hier eigentlich tat.
„Schau nicht so grimmig drein, Herr Gott.“, Christel hakte sich bei ihr unter und zerrte sie in Mitten der Festgemeinde. Die Musik war laut, ganz so, als könne man dadurch den Krieg aussperren, dabei war er schon unter ihnen allen. Aufmerksame Beobachter konnten ihn sogar sehen, wie er sich an die Schultern einer alten Frau heftete, die gerade an einem Bierkrug nippte. Oder am Revers eines Soldaten, der einen winzigen Moment verpasste, seine Erlebnisse auszublenden. Oder am gelben Kleid eines kleinen Mädchens, das seinen Vater vermisste. Doch aufmerksame Beobachter waren selten hier an diesem Ort. Hier, wo man krampfhaft versuchte die Realität zu ignorieren. Auch Katharina bemerkte es nicht. Sie war damit beschäftigt, sich vorzustellen, wie sie zuhause im Bett lag und damit, eine möglichst unkomplizierte, aber effiziente Lüge zu spinnen, die sie von all dem hier befreite.
„Christel.“, Katharina blieb stehen. „Was sollen wir denn hier?“
„Einen Mann finden, was denn wohl sonst?“, sie sah ihre Freundin an, als hätte Katharina einen Knall, den alle außer ihr selbst hören konnten.
„Einen Mann? Was soll ich denn mit einem Mann?“ Doch bevor Christel ihren entsetzten und verwirrten Blick ablegen konnte, um zu einer Erwiderung anzusetzen, kamen zwei junge Frauen auf sie zu. Christel war abgelenkt und dadurch war Katharina vor einer echten Auseinandersetzung sicher. Vorerst.
„Guten Abend, Mädels“, begrüßte Christel die beiden Fremden.
„Wir dachten schon, ihr kommt nicht mehr.“, gab die Blonde zurück. Sie hatte sich ihre langen Haare zu einem Zopf geflochten und sah in Katharinas Augen eine Spur zu lieblich aus.
„Kathi? Das sind Lisbeth und Ruth. Das ist Kathi.“
Es war das erste Mal, dass Christel sie Kathi nannte. Niemand nannte sie Kathi. Warum auch? Katharina war verwirrt.
Die beiden lächelten Katharina an. Lisbeth, der Blondine, waren aber offenbar andere Dinge sehr viel wichtiger, als Begrüßungsfloskeln und so wechselte sie schnell von höflich-erfreut hin zu tratschend-neugierig. „Habt ihr gesehen? Heute sind sogar einige von der SS da. Von der SS!“, Sie freute sich wie ein Schulmädchen und hüpfte auch etwas, als sie es sagte.
Ruth, rothaarig und etwas untersetzt, schüchtern und unsicher, hatte bisher noch kein Ton gesprochen und wie sich herausstellte, würde sich das so schnell auch nicht ändern. Katharina war also nicht die einzige hier, die ein wenig seltsam war. Doch andererseits: Wer war hier schon normal?