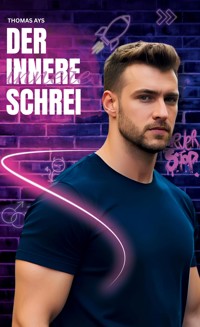Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
11 Autoren des Himmelstürmer Verlags haben ihre ganz persönlichen Weihnachtsgeschichten geschrieben.Herausgekommen ist eine bunte Mischung, voller Romantik, Erotik, und auch mit durchaus kritischen Betrachtungen.-Punk Weihnachten mit coming-out- Pink Weihnachtsmann mit Anhalter- Pink Weihnachten am Bahnhof- Pink Weihnachten im Altersheim- Pink Weihnachten im Hörsaal- Pink Weihnachten in Köln- Pink Pink Weihnachten auf einer Betriebsfeier- Pink Weihnachten am Strand- Pink Weihnachten in Moskau- Pink Weihnachten unter Indianern- Pink Weihnachten. ein neuer Anfang Spannend, mitfühlend oder auch hoch erotisch!Das ideale Weihnachtsgeschenk für Leser des Besonderen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Himmelstürmer Verlag, 20099 Hamburg, Kirchenweg 12
www.himmelstuermer-verlag.de
E-mail: [email protected]
Originalausgabe, Oktober 2011
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage
Coverfoto copyright PRO-FUN MEDIA GmbH - Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
Das Modell auf dem Coverfoto steht in keinen Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches und der Inhalt des Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Modells aus.
Alle Charaktere, Orte und Handlungen sind frei erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig
ISNB Print 978-3-86361-076-0
ISBN ePub 978-3-86361-086-9
ISBN PDF 978-3-86361-071-5
ISBN PRC 978-3-86361-087-6
Thomas Ays
A. Bauer
Alexandros Chakiris
J. Dankert
Marc Förster
M. Hart
Florian Höltgen
A. Leunig
Justin C. Skylark
Kai Steiner
S.A. Urban
PINK CHRISTMAS
Etwas andere Weihnachtsgeschichten
Florian Höltgen Weihnachtsfieber
Henri sieht richtig maulig aus. Irgendwie lustig, weil er sich doch sonst als konservativer Bänker immer gut unter Kontrolle hat. Jetzt würgt er den Wagen ab, nachdem er ihn mühsam zwischen zwei gigantische Schneehaufen mehr schlecht als recht eingeparkt hat. Seine Miene verdüstert sich noch mehr.
„Was ist?“, frage ich und lege behutsam meine Hand auf sein Knie.
„Schnee ist“, antwortet er gereizt.
Ich kann ein Grinsen nicht unterdrücken. „Ach, wär mir jetzt gar nicht aufgefallen, wenn du das Unwetter nicht beispiellos auf deinem Gesicht wiedergeben würdest ...“
Henri beißt die Zähne zusammen. Ist ja auch gemein von mir, ihn jetzt auch noch auf den Arm zu nehmen. Entschlossen will er den Wagen wieder starten, aber ich halte ihn zurück.
„Wir stehen gut.“
„Wir stehen scheiße!“ Er will wieder den Zündschlüssel drehen.
„Lass das!“, sage ich bestimmt und schlage seine Hand weg. „Ich habe keine Lust, jetzt noch zwei Stunden im Schnee hin und her zu fahren, bis du endlich erschöpft bist und der Wagen im Grunde genauso steht wie jetzt.“
Henri funkelt mich böse an. „Was ist ...“
„Nix ist! Heiligabend ist, da wird wohl keiner in die Karpaten fahren, um sich für einen Strafzettel zu deinem Auto durchzugraben. Guck mal, wie die anderen stehen!“
Jetzt funkelt Henri die parkenden Autos böse an, von denen ein paar sogar noch weiter auf der Straße stehen, weil der Räumdienst die eigentlichen Parkplätze als Schneeablage missbraucht hat.
„Du bist nervös“, sage ich und streichle über sein Bein. „Lass uns lieber noch ein wenig hier sitzen und die Ruhe genießen.“
„Ich bin nicht nervös.“ Dann räuspert er sich. „Wenn wir aber noch lange hier draußen sitzen, wird es schnell kalt.“
„Das ist der Plan.“
„Hä? Was für ein Plan?“
„Schau mal, wenn wir es hier vor Kälte nicht mehr aushalten, dann ist genau der richtige Zeitpunkt, endlich hochzugehen. Dann gibt es wenigstens etwas, worüber wir uns freuen können.“
„Du machst mir echt Mut. So schlimm sind sie doch auch nicht, oder?“
„Vielleicht für dich nicht. Bei dir werden sie sich wohl Mühe geben. Aber du darfst nicht vergessen: Es ist Weihnachten!“ Jetzt sehe ich bestimmt genauso maulig aus, wie Henri noch vor wenigen Augenblicken. Weihnachten! Das Fest der scheiß Verpflichtungen. Aber immerhin, dieses Jahr bin ich zum ersten Mal nicht allein. Und auch, wenn ich alles andere als begeistert bin, dass ich gleich meiner Mutter und ihrem Oliver den lang vorenthaltenen Freund vorstellen muss, nach gut einem halben Jahr haben sie vielleicht ja wirklich irgendwie ein Recht darauf. Erst recht, wenn meine Mutter es sich zu Weihnachten wünscht!
„Was ist?“, fragt Henri.
„Nichts“, sage ich schnell.
„Warum seufzt du?“
„Ich hab nicht geseufzt!“
„Stimmt, es war eher ein Stöhnen.“
„Ich hab auch nicht gestöhnt!“
„Nein, nicht das angenehme Stöhnen“, sagt Henri und grinst anzüglich. „Ich meine das genervte ...“
„Ich hab auch nicht genervt gestöhnt“, gebe ich zurück, muss aber grinsen, weil mich Henri wieder mal ertappt hat. Er bekommt wirklich alles mit, auch Sachen, die ich selbst nicht mal bemerke.
„Du grinst“, sagt Henri auch gleich und nickt triumphierend.
„Na schön, hast gewonnen. Und jetzt?“
„Jetzt sagst du mir, was so schrecklich ist.“
„Die Frage kann ich auch gleich zurückgeben.“
„Familiengeschichten sind halt anstrengend, erst recht zu Weihnachten. Ein normales Treffen wäre da sicher ...“
„Ja-ja!“, unterbreche ich ihn. „Ich weiß, ich hätte dich schon längst mitnehmen sollen, aber, Überraschung: Ich steh auch nicht auf diese Familiengeschichten.“ Ich schnaube verächtlich. „Und ich meine es damit wirklich ernst!“
„Was soll das denn heißen?“, fragt Henri perplex.
„Dass ich dir dein Getue nicht abnehme. Ich glaube, dass du dir im Grunde eine ganz normale Familie wünscht, mit allem Drum-herum und Tri-tra-trullala ...“
Jetzt lacht Henri tatsächlich. Ich sehe ihn irritiert an.
„Trullala? Also das ...“ Er bricht wieder in Gelächter aus.
„Hallo?“, versuche ich ihn einigermaßen böse zur Räson zu rufen.
„Trullala ...“, lacht er weiter. „Was – was heißt das, bitte?“
Ich kann nicht verhindern, dass meine Mundwinkel sich langsam nach oben ziehen. Verdammt, der Kerl schafft mich. Henri stammt aus Frankreich und immer, wenn ich gerade mal in Fahrt bin, rutscht mir irgendwas heraus, was er noch nie gehört hat und damit ist dann die ernste Stimmung hin.
„Was?“, frage ich gereizt. „Kennste kein Kasperletheater?“
„Kasperle ...“ Henri kommt nicht weiter, weil der Lachanfall ihn wieder übermannt.
„Mann, du bist anstrengend“, sage ich und verbiete mir, auch nur einen Hauch Freude zu empfinden.
„Doch, doch“, kommt Henri schließlich wieder zu sich. „Ich kenne Kasperletheater.“
„Na, wie schön.“
„Ich habe nur noch nie erlebt, dass mich jemand bei Kasperletheater so böse anguckt.“
„Gewöhn dich schon mal dran.“ Ich muss mir ein Lachen mühsam verkneifen. Kaum zu glauben, dass ich eigentlich der Spaßvogel bin, während Henri normalerweise den ernsten Part gibt. Aber seit wir zusammen sind, haben wir wohl gegenseitig ein wenig abgefärbt, was dann zu solch komischen Momenten wie jetzt führt.
„Ja, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, gewöhn ich mich dran.“
Ich schaue ihn mit zusammengeschobenen Augenbrauen und fest zusammengebissenen Zähnen an. Aber meine Mundwinkel zittern wieder und ziehen sich eindeutig nach oben.
„Hallo Kasperle“, kichert Henri und bringt mich damit endgültig zum Lachen.
Als wir uns ein paar Minuten später beruhigt haben, sage ich mit feierlichem Ernst: „Du hast mich doch nur verarscht, mit deinem Trullala, oder?“
„Wie verarscht?“
„Na, wenn du Kasper kennst, kennst du auch Tri-tra-trullala.“
Ich sehe, wie Henris Wangen sich wieder heben. Er antwortet nicht, weil er sonst wohl wieder loslachen muss.
„Mann“, gebe ich nach. „Das sagt doch der Kasper immer, wenn er auf die Bühne kommt.“
„Und – warum?“, presst Henri beherrscht hervor.
„Was weiß ich warum! Ist halt so!“
„Aber ...“
„Er freut sich halt!“
„Aha“, macht Henri und nickt ernsthaft.
„Du verarschst mich, oder?“
„Möglicherweise ...“
„Whoaaa!“, schreie ich auf und boxe ihm auf die Schulter.
„Was denn? Bist du jetzt nicht viel lockerer?“
„Nein, jetzt hab ich Angst, dass du meine Mutter und Oliver mit Tri-tra-trullala begrüßt!“
„Keine gute Idee?“
„Warum verarschst du mich?“, frage ich beleidigt.
„Weil du mich nervös machst.“
„Ich mache dich nervös?“
Henris Gesicht wird jetzt wieder ernst. „Ja“, sagt er ruhig. „Eigentlich mag ich solche Familientreffen, da hast du recht. Das ist immer ein wenig wie Kasperletheater, aber das gehört zum Leben dazu. Niemand will gern allein sein, darum ist Familie wichtig. Aber du bist immer angespannt bei dem Thema. Und jetzt lerne ich deine Familie an Weihnachten kennen. Das ist ein wichtiges Fest für die meisten. Für dich angeblich nicht, aber trotzdem bist du so nervös wie noch nie und steckst mich damit an.“
Ich schweige, bis ich anfange zu zittern.
„Dir ist kalt“, sagt Henri, „lass uns endlich hochgehen.“
„Nein, noch nicht.“ Ich reibe meine Finger, teils, weil mir wirklich kalt ist, aber mehr noch, weil ich wirklich nervös bin.
„Wir können nicht ewig ...“
„Tut mir leid, dass du wegen mir nervös bist.“ Ich beuge mich zu Henri herüber. „Du hast gar keinen Grund dazu, weil du einfach nur super bist.“ Ich küsse ihn und hole mir ein wenig Wärme ab.
„Und warum bist du nervös?“
„Weil du mir so viel von deiner Familie erzählt hast.“
„Ich habe nur auf deine Fragen geantwortet.“
Ich lasse mich wieder auf meinen Sitz zurücksinken. „Ja, ich weiß. Ich bin halt neugierig.“
„Ich auch“, sagt Henri und ich höre einen leisen Vorwurf heraus.
„Weißt du, das war einfach schön, wenn du von deinen Verwandten erzählt hast, dass alle regelmäßig zusammenkommen und dann in einem großen Haus leben und sich verstehen und ... Das ist einfach ein schönes Bild.“
„Glaub mir, wenn die erst erfahren, dass ich anstatt mit einer schönen Mademoiselle mit dir ins Bett steige, hat sich das auch mit dem schönen Bild.“
„Aber trotzdem hast du mich gefragt, ob ich mal mitkomme.“
„Ja, weil du zu mir gehörst und wenn sie dich erst mal kennen, dann fällt es ihnen sicherlich auch leichter uns zu akzeptieren. Aber konservativ sind sie allesamt. Familie ist halt auch Arbeit. Und meist muss man hart arbeiten, bevor am Ende etwas Gutes rauskommt.“
„Da weiß ich einfach nicht, ob ich das wirklich kann ...“
„Wenn wir zusammen sind, wovor sollten wir Angst haben?“
Ich schaue zur Seite, weil ich Henri nicht ansehen mag, während ich meine Ängste vor Augen habe. „Weiß nicht“, sage ich schließlich. „Vielleicht davor, dass man sein Leben nicht so führen kann, wie man es möchte? Vielleicht davor, dass man ständig als nicht normal angesehen wird, egal, wie sehr man dafür arbeitet.“
Henri räuspert sich wieder. „Also arbeitest du daran, normal zu sein?“
Ich lache. „Nein, das wäre wohl aussichtslos.“ Dann füge ich ernst hinzu: „Aber vielleicht sollte man dafür arbeiten, dass man als normal akzeptiert wird.“
„Und das tun wir, indem wir zu Weihnachten deine Familie besuchen“, schließt Henri.
„Ausgerechnet Weihnachten und ausgerechnet meine Familie!“
„Was stimmt denn damit nicht?“
„Weihnachten ist einfach nur scheiße und meine Familie ... Mmh, keine Ahnung. Ich will nicht, dass du – na ja, enttäuscht bist, vielleicht ...“
Jetzt ist es Henri, der zu mir rüberrückt und mich küsst. „Wie kann deine Familie mich enttäuschen, wenn sie mir mit dir schon das Beste gegeben hat?“
„Moah!“ Ich schiebe Henri von mir weg. „Willst du mich jetzt noch mit Schnulzreden mürbe machen? Glaub mir, der ganze Weihnachtsmist sprengt meine Toleranzgrenzen mühelos allein.“
Henri lacht. „Das ist doch das Fest der Liebe! Da kann man ruhig auch mal ein wenig kitschig sein, oder nicht?“
„Nein!“, gebe ich stur zurück. „Von wegen Fest der Liebe! Fest des Kommerz und des schlechten Geschmacks!“
„Sag mal, hast du eigentlich deine grüne Unterhose an?“
Irritiert sehe ich meinen Freund an. Natürlich hat er längst mitbekommen, dass ich Lieblingsklamotten habe, die ich besonders häufig trage.
„Du willst mir jetzt nicht sagen, dass meine Lieblingspants für dich zum schlechten Geschmack gehören?“
„Nein“, sagt Henri und grinst frech. „Ich frage mich nur, warum beim Grinch dieses Jahr lediglich die Unterhose grün ist ...“
„Arsch!“, kontere ich sofort, obwohl der Grinch-Vergleich natürlich das absolute Kompliment ist.
„Tröste dich, in den Pants gibst du den absolut heißesten Grinch aller Zeiten ab.“
„Das ist tröstlich.“
„Aber du kennst ja die Geschichte vom Grinch, oder? Am Ende wird er lieb und mag Weihnachten.“
„Vergiss es!“
„Aber mal ehrlich: Warum magst du Weihnachten nicht? Du musst ja nicht auf die Konsumgeschichte einsteigen. Es reicht doch, wenn du einen schönen Abend mit deiner Familie verbringst und – na ja, nicht alle Geschenke dürften doch schlecht sein, oder?“
„Lange Geschichte“, antworte ich nur, weil alles andere zu lange dauern würde. Es stimmt ja, dass ich den Teil mit der Familie gar nicht sooo schlecht finde. Es wäre nur irgendwie schön, wenn es mehr Familie wäre, so im – ja, okay – traditionellen Sinne. Bei Familie träume ich immer genau von dem großen Haus, von dem Henri mir erzählt hat und von zahllosen Verwandten und viel Chaos, aber auch Freude und Zusammenhalt.
Gut, in den letzten Monaten bin ich meinem Bruder viel näher gekommen. Jetzt kann ich Dennis wirklich meinen Bruder nennen. Aber mit Oliver, dem Freund meiner Mutter, wird das nie was. Und dann gibt’s auch nur noch meinen Opa Kalle, den wir auch nur zu den Festtagen sehen, weil er sonst gern für sich allein ist. Ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass das alles eine ganz neudeutsche Sache ist, dass Familien immer kleiner werden und irgendwie zerbröseln. In anderen Ländern ist das doch nicht so, oder? Jedenfalls bin ich immer ein wenig neidisch, wenn ich Henri zum Erzählen bringe.
„Leon?“, fragt Henri zärtlich. „Du zitterst! Lass uns endlich hoch – oder wir fahren wieder, ganz wie du willst.“
„Nein“, sage ich entschlossen. „Küss mich noch mal, dann können wir.“
Er beugt sich zu mir rüber und gibt mir einen langen Kuss mit Mentholgeschmack.
Oliver macht uns auf. „Hallo, Leon“, sagt er ziemlich steif. Dann zögert er deutlich, reicht Henri aber doch noch die Hand. „Guten Abend.“
„Das ist mein Freund Henri. Mama hat dir ja sicher erzählt, dass ich ihn mitbringe“, komme ich meinen Pflichten nach.
„Ähm, ja – natürlich“, stottert Oliver recht verlegen.
„Henri, dass ist Oliver, der Freund meiner Mutter.“
„Schön, euch kennenzulernen“, fügt Oliver an.
„Mich kennst du schon“, gebe ich spitz zurück und ernte dafür einen kleinen Stoß von Henri.
„Ich meine, euch – beide, also zusammen ... Wir sitzen im Wohnzimmer!“ Mit diesen Worten dreht er sich um und verschwindet.
„Sei doch nicht so“, flüstert mir Henri zu, während wir uns die Schuhe ausziehen.
„Wie bin ich denn?“
„Zickig.“
„Das liegt an meiner Unterhose.“
Henri schaut mich fragend an.
„Grün“, erkläre ich. „Grinch.“
„Vielleicht ziehst du sie besser aus?“ Henri grinst wieder anzüglich.
„Reiß dich zusammen! Du sabberst ja schon.“
„Dann reiß du dich auch zusammen, dir steht nämlich schon Schaum vorm Mund.“
„Komm, so schlimm war ich nicht.“
„Es muss aber auch nicht schlimmer werden.“ Henri reicht mir seine Jacke und zieht mich an sich ran. Unsere Gesichter sind ganz kalt, aber wahrscheinlich brennt seins vom Temperaturunterschied genauso wie meins.
„Nicht hier“, hauche ich ihm zu.
„Wie war das mit der Normalität?“
„Hier ist keiner normal.“
In dem Moment kommt auch schon meine Mutter aus dem Wohnzimmer. „Leon? Wo ...“ Sie stockt kurz, als sie uns so nah beieinander sieht. Dann lächelt sie breit. „Wo bleibt ihr denn? Sie müssen Henri sein. Endlich lernen wir Sie auch mal kennen. Ich bin Verena, Leons Mutter.“
Sie stürmt geradezu auf uns zu. Fast so, als ob sie damit etwas überspielen will.
„Henri“, sagt Henri und schüttelt meiner Mutter die Hand. Dann nimmt er sie tatsächlich kurz in den Arm.
Danach bin ich dran. „Er sieht gut aus“, flüstert sie mir ins Ohr, so laut, dass Henri es natürlich mitbekommt und ich deswegen rot werde.
„Was hast du denn erwartet? Mike Krüger?“
Meine Mutter lacht ein wenig zu laut und führt uns ins Wohnzimmer.
Die Sofas sind weiter zur Wand gerückt als sonst, damit der Weihnachtsbaum genügend Platz hat. Dieses Jahr ist es eine echte Tanne. Ich will gar nicht wissen, wie Oliver deswegen geflucht hat, aber meine Mutter will sich offenbar von der christlichen Seite zeigen.
„Hallo“, sage ich ein wenig mürrisch und nicke Dennis zu und danach Opa Kalle. Und jetzt bin ich doch aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie mein Opa auf meinen Freund reagiert. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich ja nicht mal, ob Opa Kalle überhaupt Bescheid weiß. Dafür sehe ich ihn einfach zu selten, als dass ich da anrufen wollte, um ihm kurz die Neuigkeit vor den Latz zu knallen. Ob Mama es ihm irgendwie beigebracht hat? Immerhin hat sie ja auch gegenüber Dennis nicht hinterm Berg gehalten. Und was, wenn nicht? Komische Situation. Ich spüre, wie ich immer befangener werde.
„Guten Abend“, sagt Henri.
Jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, da ich ihn vorstellen muss – also, nach dem Gesetzbuch der guten Manieren. Aber dann fange ich Dennis’ Blick auf, der offenbar mein Problem erkannt hat.
„Hey, cool“, ruft er und springt auf. „Du bist Henri, richtig? Ich bin Dennis.“
Schlaff wie ein Nerd aus dem Klischeebuch reicht mein Bruder Henri die Hand.
„Hi“, antwortet Henri ein wenig reserviert.
„Kommt mit auf die Couch!“
„Rena?“, fragt Opa Kalle, als wir uns setzen. „Wer ist dieser Mann?“
Plötzlich sieht meine Mutter ganz hektisch aus. „Das ist – ein Freund von Leon.“
Im Zimmer herrscht Stille.
Ein Freund!
Super! Mir ist es jetzt total peinlich, dass meine Mutter es offenbar für besser hält, meinem Opa nicht die Wahrheit zu sagen. Und noch unangenehmer ist es mir, dass ich so feige bin und mich hinter dieser Lüge verstecke. Aber wie soll ich aus der Nummer wieder rauskommen? Wenn ich die Sache jetzt aufkläre, steht Mama ja irgendwie blöde da. Ach, Scheiße, das sind doch nur Ausflüchte! Und dass ich knallrot bin, bestätigt es noch.
„Entschuldigen Sie“, sagt Henri und erhebt sich noch mal kurz. „Ich bin Henri Baffour, Leons Lebenspartner.“
Opa Kalle ergreift entschlossen die Hand. „Karl-Heinz Vogt“, sagt er. „Sie haben einen festen Händedruck, junger Mann, das gefällt mir.“
„Ihrer ist auch nicht schlecht“, gibt Henri zurück und setzt sich wieder.
„Ach!“ Opa winkt ab. Dann räuspert er sich. „Henri Baffour, das klingt französisch.“
„Ja“, sagt Henri, „ursprünglich komme ich aus Frankreich, aber mein Vater hat einige Jahre hier in Deutschland gearbeitet. Na ja, ich bin hier geblieben.“
Ich kann nicht anders und muss meinen Freund dafür bewundern, wie selbstverständlich er die Situation gemeistert hat. Und jetzt glühen meine Wangen vor Freude. Opa und Henri unterhalten sich über Frankreich und Deutschland, Oliver nervt Dennis mit seinen Computerproblemen und ich beobachte Mama, wie sie immer wieder verstohlen zwischen mir und Henri hin und her schaut. Ich glaube, sie freut sich wirklich, auch wenn das alles noch nicht so ganz bei ihr angekommen ist. Aber wie kann ich das auch verlangen, wenn ich selbst nicht mal in der Lage bin, meinen Freund vernünftig vorzustellen. In dieser Beziehung hat mir Henri mit seiner scheinbar angeborenen Etikette was voraus. Was wäre mir denn eingefallen? Mensch Opa, ich bin schwul und das ist mein erster Stecher? Klar, ein wenig übertrieben. Aber als Trotzreaktion sicherlich nicht unmöglich.
Ganz unauffällig lehne ich mich ein bisschen zu Henri rüber, damit wir mehr Körperkontakt haben. Meiner Mutter fällt es sofort auf. Sie wird ein wenig rot, als sie feststellt, dass ihr Blick nicht unbemerkt geblieben ist. Nee, von Normalität sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Wenn mir jetzt ein Mädel auf dem Schoß rumrutschen würde, wäre das sicherlich etwas ganz anderes.
Opa und Henri reden jetzt über die Arbeit. Wirtschaft und Finanzen sind ja eh Henris Lieblingsthemen. Und wie es aussieht, interessiert sich mein Opa Kalle auch dafür. Ich bin ein wenig stolz, wie gut Henri die Sache mit meinem Opa meistert. Aber dann lässt Opa nach einem Moment des Schweigens die Bombe fallen.
„Sie scheinen ja ganz schön Ahnung zu haben.“
„Nach ein paar Jahren im Bankgeschäft bleibt das nicht aus.“
„Da hat mein Enkel ja einen guten Fang gemacht.“ Er räuspert sich. „Sie gehören doch jetzt zur Familie, oder?“
Ich glaube meinen Ohren nicht zu trauen und die Gesichter um mich herum bestätigen mir, dass ich wohl nicht allein bin mit diesem Gefühl. Also wirklich, ich hatte fast schon geglaubt, dass mein Opa vorhin das Wort Lebenspartner nicht richtig verstanden hat. Aber diese direkte Frage ...
Selbst Henri zögert einen Moment. Dann fängt er sich aber wieder: „Nun, ich habe mit Leon noch nicht darüber gesprochen, aber von meiner Seite spricht nichts dagegen.“
„Von meiner Seite auch nicht“, sagt Opa Kalle mit feierlichem Ernst.
Henri sieht mich ein wenig unsicher an.
Dennis stupst mir in die Seite. „Ist das jetzt so eine Art Heiratsantrag?“
„Was?“, platzt meine Mutter heraus. „Ihr wollt heiraten?“
Oliver prustet seinen Rotwein zurück ins Glas.
„Schatz, pass doch auf!“, tadelt meine Mutter automatisch und nimmt ihm beiläufig das Glas weg, ohne ihren Blick von mir abzuwenden.
„Niemand heiratet“, sage ich.
„Na, Gott sei Dank“, murmelt Oliver.
Ich spüre plötzlich die Wut in mir hochsteigen. „Gott brauchst du dafür nicht zu danken. Da reicht es, wenn du weiter unfähige Politiker wählst und die Kirchenpropaganda unterstützt.“
„Hey-hey“, sagt Oliver, „immer ruhig mit den jungen Pferden. Wird schon nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“
„Deine scheiß Sprüche ...“
Henri drückt mich an sich und will mir damit wohl sagen, dass ich die Klappe halten soll. Aber meine Mutter fällt mir schon ins Wort: „Wir wollen nicht streiten, immerhin ist heute Weihnachten.“
„Weihnachten ist morgen“, korrigiere ich sie patzig. „Heute ist Heiligabend.“
„Das Fest der Liebe“, steuert Dennis sarkastisch bei.
„Sag das nicht so!“, zischt meine Mutter ihm zu, einen besorgten Blick auf Henri gerichtet.
„Wie soll er es denn sonst sagen?“, frage ich.
„Weihnachten ist das Fest der Liebe!“, sagt Mama bestimmt.
„Ach komm, die Kirche kennt das Wort Liebe gar nicht, die kennt nur Macht und Geld!“
„Jetzt reicht’s aber“, springt Oliver meiner Mutter zur Seite.
Henri drückt mich noch fester. Aber Olivers blöde Fratze bringt mich zuverlässig dazu, erst recht wütend zu werden.
„Warum soll das reichen? Weil sonst auffallen könnte, was für einem verlogenen Trend ihr hier mit eurem scheiß Baum hinterherfeiert?“
„Leon!“, schreit meine Mutter. „Hör auf!“
„Warum?“, brülle ich zurück.
„Weil du uns das Fest kaputt machst.“
Einen Augenblick sitze ich schweigend da. Weil du uns das Fest kaputt machst. Plötzlich tut es mir leid. Ich will nichts kaputt machen – außer vielleicht mit meiner Faust die falschen Zähne von Oliver, der ohne Verstand zu allem einen Spruch dahinscheißt.
„Was ist das mit dir und Weihnachten?“, fragt Henri leise.
„Ich hasse Weihnachten!“
Die Aussage steht erst mal eine Weile im Raum.
„Klingt wie Hefty-Schlumpf“, sagt Dennis schließlich.
Ich lache. „Du Arschloch!“
„Könnt ihr bitte aufhören, solche Sachen zu sagen?“, fordert Mama und sieht mich dabei finster an.
„Manchmal ist es besser, die Dinge beim Namen zu nennen“, sagt Opa. Sein Gesicht ist vollkommen ernst.
„Aber nicht an Weihnachten“, beharrt meine Mutter.
„Für mich gibt es kein Weihnachten“, sage ich. „Weihnachten ist ein Kirchenfest und die Kirche ...“ Ich schlucke kurz. „... hasst Schwule.“ Da ist es raus. Schwule.
Für einen Moment ist es still. Dann kommt Oliver tatsächlich mit dem größten Schwachsinn an: „Nun ja, so ganz okay ist das ja auch nicht, immerhin steht in der Bibel, dass ... na ja, dass es verboten ist.“
Henris Arm hält mich wie ein Gurt, fast so, als müsse er befürchten, dass ich jeden Moment auf den Freund meiner Mutter losgehen könne.
Ich hole tief Luft. „Die Bibel ist ein ganz schön altes Buch, das man wahrscheinlich auf so viele Arten lesen kann, wie es Leser gibt. Was meinst du, weshalb die Kirche so ein Interesse daran hatte, dass sich nicht jeder Normalo selbst ein Bild machen kann?“
„Kann aber doch jetzt jeder.“ Oliver lächelt herausfordernd.
„Ja, darum kauft auch keiner mehr Ablassbriefe und der Laden verliert immer mehr an Macht und Einfluss.“
„Na also, worüber regst du dich auf?“
„Ich rege mich darüber auf, dass es noch immer Menschen gibt, die die Fehler der Kirche nicht als solche ansehen. Kaum einer weiß doch heutzutage, dass unser Staat die Kirche massenhaft mit Steuergeldern unterstützt, nur weil diese auf uralte Verträge besteht. Bist du in der Kirche? Nein. Aber du bezahlst trotzdem dafür. Angeblich hat man ein Recht auf Religionsfreiheit. Ein Recht, religionsfrei zu sein, gibt es aber nicht, weil man indirekt doch die Kirche unterstützt.“
„Aha“, macht Oliver gönnerhaft. „Darum hast du dich so lange vor einer Ausbildung gedrückt.“
„Ich zahle von meinem Ausbildungsgehalt keine Steuern. Gleitzone“, gebe ich zurück.
„Na dann ...“
„Das Problem ist nur, dass ihr die Kirche unterstützt. Ihr unterstützt ein System, das mir das Recht auf Liebe absprechen will. Ja, sogar Henri sorgt dafür, dass die Kirche an Geld kommt, obwohl die das Geld mitunter genau dafür einsetzt, um uns das Leben schwer zu machen.“
„Und wie sieht das aus?“
„Zum Beispiel, indem der Papst durch die Gegend fliegen kann und überall rumerzählen darf, was für eine Gefahr Homosexualität doch für die Gesellschaft ist. In manchen Ländern werden regelrecht Hetzkampagnen geführt, nur damit Schwule und Lesben nicht heiraten dürfen. In den USA droht die Kirche sogar damit, dass sie ihr Engagement für die Armen und Kinder einschränkt, wenn die Politik eine Öffnung der Ehe beschließen sollte. Kannst du dir das vorstellen? Angeblich sind schwule Ehen eine Gefahr für Kinder. Worin bitte soll denn diese Gefahr bestehen? Nur weil ich schwul bin, stehen noch lange keine Babys auf meiner Speisekarte! Aber trotzdem, um die Liebe, die ja angeblich das höchste Gut ist, zwischen zwei Männern zu unterbinden, ist die Kirche bereit, ihre eigene Nächstenliebe einzuschränken. Die Kirche droht damit, Waisenkinder auf die Straße zu setzen und Bedürftige nicht mehr zu unterstützen, wenn die Politik der Staaten gleiche Rechte für Homosexuelle beschließen sollte. Ist das nicht pervers?“ Ich schnaube. „Und dabei gibt es durchaus Rechnungen, die zeigen, dass die Kirche bei weitem nicht so gutmütig und großzügig ist. Das meiste zahlt nämlich noch immer der Staat. Und jetzt sag mir mal bitte, warum sich diejenigen, die angeblich mit göttlicher Liebe gesegnet sind, nicht darauf konzentrieren, was eigentlich ihr Amt ist, sondern lieber einen Krieg gegen unschuldige Menschen führen?“
„Na ja, unschuldig ...“, lächelt Oliver mit einem verächtlichen Blick.
„Ja, unschuldig!“, halte ich lautstark dagegen. „Bei mir wird niemand zum Sex gezwungen, ganz im Gegensatz zu so manchem Pfaffen, der vor lauter Kirchenvorschriften gar nicht mehr anders kann, als sich an Kindern zu vergehen.“
Meine Mutter schnappt nach Luft.
„Da hat er wohl recht“, stimmt Dennis zu.
Oliver guckt uns böse an. „Sieht man nicht genau daran, dass die Kirche ganz richtig liegt?“
„Was willst du damit sagen?“, fauche ich ihn an.
„Na, dass es vielleicht richtig ist, keine Schwulen in der Kirche haben zu wollen.“
Ich lache verzweifelt auf. „Das ist Diskriminierung! Kein anderer Arbeitgeber darf sich so was erlauben! Und der Papst lenkt natürlich in seinen Reden ganz bewusst auf Homosexualität, wenn er sich mal zu den Pädophilievorwürfen äußert. Damit soll ja gerade die Kirchenmeinung durchgesetzt werden, dass Schwule krank sind und sich an Kindern vergehen. Aber warum werden denn dann nicht nur Jungen missbraucht? Hier soll doch nur vom eigentlichen Skandal abgelenkt werden, indem man die Schuld einem Sündenbock zuschiebt. Eigentlich müsste man sich doch fragen, was in der Kirche selbst nicht stimmt, wenn dort überhaupt Machtpositionen ausgenutzt werden, um sich an Kindern zu vergehen. Aber an Aufklärung ist man ja nicht wirklich interessiert. Da wird lieber geschwiegen und ausgesessen. Ein Zeichen dafür, dass es doch überhaupt nicht um den Menschen geht, sondern vielmehr um bestehende Machtstrukturen, die bewahrt werden sollen, koste es was es wolle. Anstatt sich der Probleme anzunehmen, werden Kinderschänder von hier nach da versetzt, damit man wieder die Augen schließen kann. Warum behindert die Kirche denn eine staatliche Aufklärung? Warum werden solche Menschen denn gedeckt und auf Kosten von Kinderseelen solche Fälle vertuscht? Hier geht es schlicht darum, Machtstrukturen zu schützen, weil sonst vielleicht der Luxus flöten gehen könnte, den der Verein zu Unrecht genießt. Aber ich als Schwuler, ich bin eine widernatürliche Gefahr und verdiene nicht dieselben Rechte wie ein echter Mensch!“
Ich bin ganz außer Atem gekommen, weil ich mich so in die Sache hineingesteigert habe. Und das ärgerliche Gesicht von Oliver und das blasse meiner Mutter nehmen mir zusätzlich Luft. Dann merke ich, dass es Henris Arm ist, der mir den Brustkorb quetscht. Ich lass mich gegen meinen Freund sinken und versuche die Anspannung loszuwerden. Henri küsst mir auf den Hinterkopf. Ganz leicht nur. Eine Geste, die mir sagt, dass ich mich beruhigen soll.
„Was für eine Rede“, grinst Dennis nach einer Weile. „Ich wusste gar nicht, dass du so ein Temperament hast. Und woher weißt du das alles?“
„Internet“, antworte ich knapp.
„Vielleicht ...“, fängt meine Mutter an und schluckt erst mal, „... vielleicht können wir ja jetzt ...“ Dann reißt sie plötzlich erschrocken die Augen auf. „Papa!“
Sofort schauen wir alle zu Opa Kalle hinüber. Für einen Sekundenbruchteil habe ich so eine Ahnung, dass er wegen des Streits einen Herzinfarkt bekommen haben muss und nun blau angelaufen im Sessel liegt. Aber Opa Kalle sitzt ganz normal da und weint. Sein Blick ist quer über den Tisch ins Irgendwo gerichtet, so, als ob er sich an irgendwas erinnert, während ihm die Tränen über das faltige Gesicht laufen.
Mama springt auf. „Papa, was hast du denn?“
Erst als sie bei ihm ist, schreckt Opa aus seinen Erinnerungen hoch.
„Ist – ist alles in Ordnung?“
„Nichts ist in Ordnung“, sagt Opa böse und steht auf. Ich habe meinen Großvater nie als besonders gesellig oder freundlich erlebt, aber böse war er eigentlich noch nie. Jetzt aber sieht er richtig wütend aus.
„Papa ...“, fängt Mama wieder an.
Aber Opa ignoriert sie. Mit drei festen Schritten ist er beim Tannenbaum, packt durch den billigen Schmuck den Stamm und reißt alles ein Stück nach oben. Ich höre den erschrockenen Schrei meiner Mutter und auch Henri neben mir zuckt, als wolle er dem Baum kurzfristig zur Hilfe eilen. Aber alles geht so schnell. Schon liegt der Christbaum mit lautem Geklirr auf dem Boden und Opa stürmt aus dem Zimmer.
Es dauert einen Moment, bis das Weinen meiner Mutter zu mir durchdringt. Leicht gebeugt steht sie da vor dem gestürzten Weihnachtsbaum und versucht mit beiden Händen auf ihrem Mund die Schluchzer zu unterdrücken.
„Siehst du, was du angerichtet hast?“, zischt Oliver und erhebt sich unbeholfen, um meine Mutter zu trösten.
Dennis klopft mir aufs Knie und steht ebenfalls auf. „Ich verzieh mich mal in dein Zimmer, okay?“
Nur Henri bleibt ganz ruhig sitzen und hält mich noch immer. Es tut gut, jemanden an seiner Seite zu haben, wenn gerade alles um einen herum zusammenbricht.
Vorsichtig sehe ich Henri an. Ich habe ein wenig Angst, dass er einen Blick drauf hat, der mir sagt: Hab ich nicht gesagt, dass du dich zurückhalten sollst? Oder vielleicht: Vielen Dank, so habe ich mir das erste Treffen mit deiner Familie vorgestellt. Und tatsächlich fühle ich mich auch schuldig. Warum habe ich nicht einfach meine Fresse gehalten und diesen scheiß Weihnachtszirkus geschluckt? Ist ja nicht alles schlecht, was den Stempel christlich trägt. Und gerade ich wünsche mir ja irgendwie auch ein Beisammensein mit einer großen Familie. Und Weihnachten, mal losgelöst von dem Kirchengedanken oder dem Kommerz, ist nun mal traditionell ein Fest für Familien. Darum müht sich mein Opa her, darum bin ich mit Henri hier und sogar Dennis, der normalerweise auch keinen großen Bock hat, ist da. Wenn der Baum nicht wäre, wenn das dumme Geseier von Oliver nicht wäre ... Wir hätten uns einfach unterhalten können. Danach was essen bis zum Platzen, damit ein paar ordentliche Schnäpse gerechtfertigt sind oder ein bisschen mehr Wein als nötig. Wir hätten vielleicht gemeinsam über witzige Geschichten lachen können. Das alles hat doch so gut angefangen mit Henri und Opa. Vielleicht hätte die Gesprächigkeit auch auf uns andere übergegriffen und alles wäre gut gewesen.
Verdammt, ich fühle mich wirklich schuldig. Aber als ich endlich in Henris Augen schaue, sehe ich keinen Vorwurf und keine Enttäuschung. Dafür ein Leuchten, das mir bislang noch nie aufgefallen ist. Aber auch Sorge.
Er beugt sich zu mir und ich spüre seine Wange an meiner. Ganz leise flüstert er in mein Ohr: „Scheiß auf den Papst, ich liebe dich.“
Wir sitzen eine ganze Weile eng umschlungen da. Mama steht noch immer vor dem gestürzten Baum und lässt sich von Oliver umarmen. Ich beobachte die beiden ein wenig, während ich Henris Körper an meinem spüre. Ich mag Oliver nicht wirklich. Aber jetzt, da ich sehe, wie er meine Mutter tröstet, bin ich doch froh, dass er da ist.
„Ich muss mich um das Essen kümmern“, sagt Mama irgendwann und löst sich von Oliver. Sie fängt meinen Blick auf. In einem ersten Impuls will ich mich von Henri lösen, aber dann wischt sich meine Mutter die Tränen von den Wangen und lächelt.
„Henri?“
Henri küsst mich kurz noch auf die Wange, dann wendet er sich meiner Mutter zu. „Ja?“
„Es ist vielleicht nicht ganz höflich, aber – möchten Sie mir in der Küche ein wenig zur Hand gehen?“
Ich bin überrascht, aber Henri steht sofort auf. „Gern.“
„Leon? Schaust du bitte mal nach Opa? Ich glaube, er ist raus. Und Olli, kümmerst du dich um den Baum?“
Dann verschwindet sie aus dem Zimmer und Henri gleich hinterher. Oliver schaut mich düster an, während er sich daran macht, den Weihnachtsbaum wieder aufzurichten. Natürlich stöhnt er auch sofort ziemlich übertrieben, wie immer, wenn er irgendwas tun muss. Schnell flüchte ich ebenfalls aus dem Wohnzimmer, bevor er mich einspannen kann. Dabei würde ich ihm gern die Arbeit abnehmen, denn meine Aufgabe scheint mir eindeutig die unangenehmere zu sein. Was soll ich Opa denn jetzt sagen? Offenbar hat er sich wegen mir so aufgeregt, dass er gleich meine antikirchliche Rede handfest umsetzen musste. Dabei war Opa Kalle nie ein Kirchengänger. Keine Ahnung, was genau ihn so mitgenommen hat.
Mit offenen Schuhen und Jacke schleiche ich das Treppenhaus runter. Opas Jacke habe ich auch dabei. Kaum zu glauben, dass er bei diesem Wetter ohne raus ist. Noch ein Grund mehr, ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ich öffne vorsichtig die Haustür und bin erleichtert, dass Opa Kalle tatsächlich vor der Tür steht. Er raucht und zittert.
„Ähm, deine Jacke“, sage ich leise, aber Opa reagiert nicht. Also nehme ich die Jacke und lege sie ihm über die Schultern.
„Danke“, sagt er.
„Tut mir leid.“
„Was tut dir leid?“
„Das Theater eben. Ich wollte nicht, dass du – dass du dich aufregst. Willst du nicht wieder reinkommen? Du stehst doch jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde hier und ...“
„Du musst dich nicht entschuldigen“, unterbricht mich Opa Kalle. Eine Weile sagt er nichts und zieht nur lang an seiner Zigarette. Aber dann räuspert er sich. „Ich muss nur nachdenken. Und bei manchen Gedanken begibt man sich halt nach draußen in die Kälte.“
Ich will schon nachfragen, aber dann verstehe ich, dass mit der Kälte wohl nicht die winterlichen Temperaturen gemeint sind.
„Geh ruhig rein. Du musst hier nicht mit mir frieren.“
„Das macht mir nichts“, sage ich. „Aber vielleicht solltest du deine Jacke richtig anziehen.“
„Ach“, macht Opa.
„Nichts ach“, sage ich bestimmt und helfe ihm in die Jacke. Und weil er keine Anstalten macht, ziehe ich auch den Reißverschluss für ihn hoch.
„Willst du auch eine?“ Er hält mir seine Zigarettenschachtel hin.
„Ich rauche nicht.“
„Das ist gut“, lacht er. „Bei mir ist es eh nicht mehr lang hin, aber du hast noch ein gutes Stück vor dir, für das es sich lohnt, auf sich aufzupassen.“ Er räuspert sich wieder. „Du passt doch auf dich auf, oder?“
„Klar“, antworte ich, noch bevor mir durch den Kopf geht, dass damit nicht unbedingt das Rauchen gemeint sein muss.
„Du bist ein schlauer Kopf. Und dein Lebenspartner – sagt man das so? – der scheint auch schwer in Ordnung zu sein.“
„Danke“, sage ich überrascht und verwirrt gleichermaßen.
Dann schweigen wir wieder eine lange Zeit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zehn Minuten hier stehen oder schon dreißig. Irgendwann geht hinter uns die Tür auf und Mama kommt heraus. Sie hat Schals und Mützen und Handschuhe dabei, die sie wortlos verteilt.
„Das ist Familie“, sagt Opa und lacht. „Man ist niemals allein.“
„Wollt ihr nicht langsam hochkommen?“, fragt Mama. „Das Essen ist gleich fertig.“ Sie sieht mich unsicher an. „Dein – dein Henri kennt sich ja in der Küche aus.“
Ich nicke. „Er kocht gern.“
„Nimm dich vor Froschschenkeln in Acht!“, sagt Opa. „Ich habe einmal welche gehabt.“
„Er kocht keine Froschschenkel und auch keine Schnecken“, lache ich.
Mama fröstelt. „Was ist? Kommt ihr jetzt hoch?“
„Einen Moment noch“, sagt Opa. „Ich muss noch etwas erzählen.“
„Soll ich euch allein lassen?“
„Nein.“ Opa zieht noch mal kräftig an der Zigarette. „Ich will mich bei dir entschuldigen.“
„Mmh“, macht Mama.
„Leon hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich – die ich sehr gut – verdrängt habe. Ich hätte meine Wut nicht an dem Baum auslassen sollen. Aber manchmal macht man halt ...“
„Schon gut.“ Meine Mutter legt ihren Arm um Opa.
„Ich wollte ...“, fange ich an, weil ich mir wieder blöd vorkomme, weil ich so ein Palaver gemacht habe.
„Pscht!“, macht Opa. Plötzlich zittert er am ganzen Körper so stark, dass ich schon befürchte, er fällt jeden Moment in den Schnee.
„Paps?“, fragt Mama besorgt.
Aber Opa ignoriert sie. „Ich – ich habe mich lange gefragt, was Gott bedeutet und die Kirche. Als Kind mussten wir alle in die Kirche, wir mussten beten und viel auswendig lernen und es war ein Privileg, den Gottesdienst mit vorzubereiten.“ Opa hustet. „Ich habe das immer gern gemacht, auch wenn ich mir nie sicher war, ob es Gott überhaupt gibt. Und eines Tages wusste ich es dann.“
„Was?“, fragt meine Mutter.
„Dass es keinen Gott gibt.“ Opa nickt, als wolle er sich selbst bestätigen. „Mit zwölf war ich fest eingebunden als Messdiener, über zwei Jahre lang. Und in dieser Zeit habe ich gelernt, dass Gott überall ist, nur nicht in der Kirche.“
„Ich verstehe das nicht“, sagt Mama, aber ich sehe ihrem Gesicht an, dass sie sehr wohl versteht, es nur nicht wahr haben will.
„Diese ganzen Missbrauchsfälle, die in den letzten Jahren immer stärker öffentlich werden“, sagt Opa mit sehr leiser Stimme, „ich bin einer davon.“
„O Gott!“ Meine Mutter hält sich wieder die Hände vor den Mund und fängt zu weinen an.
„O Gott!“, wiederholt Opa und schnippt den Zigarettenstummel in den Schneehaufen ein paar Meter weiter. Das ist jetzt sicher der vierte oder fünfte.
Ich habe das Bedürfnis, meinen Opa in den Arm zu nehmen, ihn zu trösten. Aber völlig absurd traue ich mich nicht.
Plötzlich fällt die Haustür zu. Mama ist hoch. Wortlos. Genauso fühle ich mich jetzt auch: wortlos und zum Weglaufen. Aber ich bleibe.
„Darum habe ich geweint, weil ich wütend bin, Leon.“
„Das verstehe ich. Ich bin auch wütend.“
„Ja, sicherlich auch zurecht. Aber ich bin wütend auf mich selbst, weil ich nicht zu denjenigen gehöre, die den Mund aufmachen. Ich bin einer der vielen, die schweigsam schlucken und wegsehen. Und wenn ich ein Weihnachtsgeschenk heute bekomme, das ich wirklich gebrauchen kann, dann bist das du, ein Enkel, der die Welt nicht einfach so hinnimmt, sondern aufsteht und kämpft.“
„Ich ...“ Meine Stimme versagt.
„Ich habe nicht die Kraft, mich in eine Fernsehshow zu setzen und über mein Leben zu reden. Ich habe nicht mal die Kraft, eine solche Sendung anzusehen, wenn jemand anderes über ein ähnliches Schicksal spricht. Ich wünsche mir nur eine bessere Welt, bin aber zu schwach, etwas dafür zu tun. Und ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass andere diese Kraft für mich aufbringen. Als ich dich vorhin reden gehört habe, wusste ich, dass ich gar keine Hoffnung mehr brauche, weil ich jetzt Gewissheit habe. Du, Leon, du hast Kraft.“ Opa fasst mich an der Schulter und rüttelt an mir. „Ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, was du gesagt hast. Aber ich weiß, dass es richtig ist, dass du was gesagt hast.“
Ich will tausend Sachen sagen, aber ich bin wie gelähmt.
„Was ist? Sollen wir langsam mal wieder hoch?“, fragt Opa schließlich.
„Ich ... Warte!“ Ich schlucke. „Willst – willst du mit mir über – also, reden?“
„Ganz ehrlich, ich mag nicht reden, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber wenn, dann mit dir. Vielleicht sollte ich das sogar. Aber nicht heute und morgen auch nicht.“
„Ist gut“, sage ich.
Bevor Opa etwas erwidern kann, poltert es im Hausflur. Es klirrt und scheppert. Und dann wird die Haustür aufgerissen und meine Mutter steht wie eine Furie da, ein rundes Plastikteil unter dem Arm.
„Platz da!“, keucht sie und zerrt mit einem Ruck den Weihnachtsbaum am Ständer hinter sich her nach draußen.
„Mama!“, platzt es überrascht aus mir heraus und Opa lacht.
„Dieses Weihnachten ist beschissen!“, schimpft Mama.
„Weihnachten war schon immer beschissen“, sagt Opa.
Ich sage nichts, weil schon alles gesagt ist.
Wir sehen alle ein wenig mitgenommen aus, als wir endlich am Tisch sitzen und uns gegenseitig das Essen reichen. Oliver zieht ganz besonders ein Gesicht, weil er das Treppenhaus fegen musste. Da ist meine Mutter ganz rigoros. Soll ja niemand denken, dass hier die Hottentotten leben. Aber der ermordete Christbaum vor der Tür ist ihr egal.
„Moment!“, sagt Dennis mit einem breiten Grinsen, bevor wir essen. „Kein Tischgebet?“
Meine Mutter guckt ihn ernst an und antwortet: „Dennis, halt endlich mal die Fresse!“
Ich habe natürlich schon einen Schluck Wein im Mund und verschlucke mich. Hustend und lachend drücke ich mir meine Serviette vors Gesicht. Erst jetzt lachen die anderen mit. Nur mir ist gar nicht mehr zum Lachen, weil mir der Rotwein in der Nase brennt.
„Brauchst du ärztlichen Beistand, Junge?“, fragt Opa und alle lachen erneut.
Als ich mich wieder erholt habe, sitzen wir dann doch noch einigermaßen feierlich da.
„Wenn wir schon nicht beten, dann können wir zumindest auf was trinken, oder?“, sagt Dennis und hebt sein Weinglas an. „Ich trinke auf meinen Humor.“