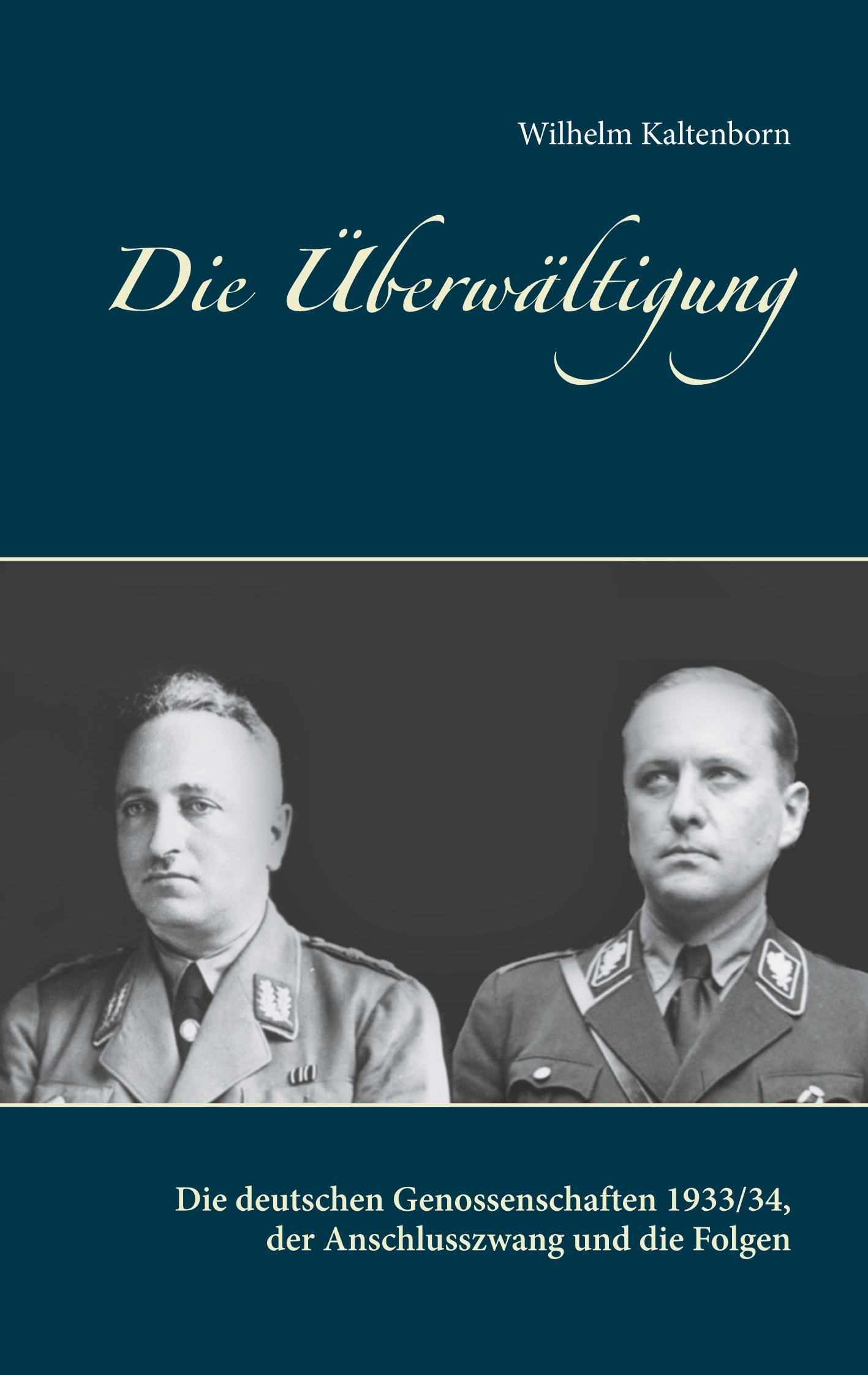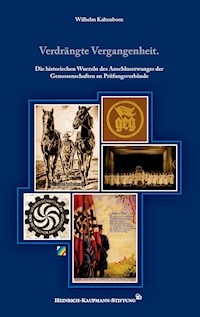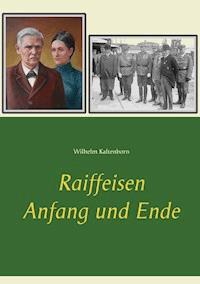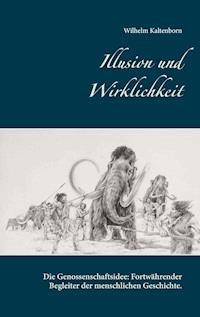
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das hierzulande etablierte Genossenschaftswesen hält Deutschland für den Nabel der weltweiten Genossenschaftsbewegung. Es glaubt sogar daran, dass die Orte Delitzsch, Flammersfeld und Weyerbusch, weil sie zu den Wirkungsstätten von Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen zählen, die Geburtsstätten der Genossenschaftsidee überhaupt sind. Dass diese Einschätzung grundfalsch ist, weist Kaltenborn anhand vielfältiger Belege nach. Die Genossenschaftsidee und ihre praktische Umsetzung begleiten die Entwicklung und die Geschichte des Menschen von Anbeginn an. Kooperatives, also genossenschaftliches Wirken haben schon die Neandertaler bei der Großwildjagd bewiesen. Das europäische Altertum und das Mittelalter kannten Genossenschaften in allen möglichen Formen, die auch Schulze-Delitzsch bekannt waren. Seit den Anfängen der Neuzeit nahm dann die literarische und theoretische Beschäftigung mit der Genossenschaftsidee in Europa immer stärker zu. Auch die genossenschaftliche Praxis zeigte die vielfältigsten Formen. Unübersehbarer Höhepunkt dieser Entwicklung war die Gründung einer Konsumgenossenschaft im englischen Rochdale 1844 durch die „Rochdale Society of Equitable Pioneers“. Die damals formulierten Grundsätze finden sich auch heute noch in den Prinzipien des Internationalen Genossenschaftsbundes wieder. Schulze-Delitzsch und Raiffeisen bildeten wenig später aus den Elementen der genossenschaftlichen Diskussion und Praxis ihrer Zeit jeweils ihr eigenes genossenschaftliches Konzept. Beide verfolgten aber darüber hinaus weitaus umfassendere gesellschaftspolitische Zielsetzungen, bei denen das kooperative Zusammenspiel nur einen Bestandteil darstellte. Auf deutschen Antrag hin soll nun die UNESCO in Paris die Genossenschaftsidee zum immateriellen Kulturerbe erklären. Dagegen ist nichts zu sagen, wenn denn die Begründung nicht vortäuschen würde, die Genossenschaftsidee sei ein deutscher Einfall gewesen und von Schulze-Delitzsch und Raiffeisen zum ersten Mal umgesetzt. Tatsächlich ist die Genossenschaftsidee eine Menschheitsidee – und deshalb gehört sie auch unabhängig von allen Erklärungen der UNESCO so oder so zum immateriellen Weltkulturerbe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Illusion und WirklichkeitDie Genossenschaftsidee: Fortwährender Begleiter der menschlichen Geschichte.
Das hierzulande etablierte Genossenschaftswesen hält Deutschland für den Nabel der weltweiten Genossenschaftsbewegung. Es glaubt sogar daran, dass die Orte Delitzsch, Flammersfeld und Weyerbusch, weil sie zu den Wirkungsstätten von Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen zählen, die Geburtsstätten der Genossenschaftsidee überhaupt sind. Dass diese Einschätzung grundfalsch ist, weist Kaltenborn anhand vielfältiger Belege nach. Die Genossenschaftsidee und ihre praktische Umsetzung begleiten die Entwicklung und die Geschichte des Menschen von Anbeginn an. Kooperatives, also genossenschaftliches Wirken haben schon die Neandertaler bei der Großwildjagd bewiesen. Das europäische Altertum und das Mittelalter kannten Genossenschaften in allen möglichen Formen, die auch Schulze-Delitzsch bekannt waren.
Seit den Anfängen der Neuzeit nahm dann die literarische und theoretische Beschäftigung mit der Genossenschaftsidee in Europa immer stärker zu. Auch die genossenschaftliche Praxis zeigte die vielfältigsten Formen. Unübersehbarer Höhepunkt dieser Entwicklung war die Gründung einer Konsumgenossenschaft im englischen Rochdale 1844 durch die „Rochdale Society of Equitable Pioneers“. Die damals formulierten Grundsätze finden sich auch heute noch in den Prinzipien des Internationalen Genossenschaftsbundes wieder.
Schulze-Delitzsch und Raiffeisen bildeten wenig später aus den Elementen der genossenschaftlichen Diskussion und Praxis ihrer Zeit jeweils ihr eigenes genossenschaftliches Konzept. Beide verfolgten aber darüber hinaus weitaus umfassendere gesellschaftspolitische Zielsetzungen, bei denen das kooperative Zusammenspiel nur einen Bestandteil darstellte.
Auf deutschen Antrag hin soll nun die UNESCO in Paris die Genossenschaftsidee zum immateriellen Kulturerbe erklären. Dagegen ist nichts zu sagen, wenn denn die Begründung nicht vortäuschen würde, die Genossenschaftsidee sei ein deutscher Einfall gewesen und von Schulze-Delitzsch und Raiffeisen zum ersten Mal umgesetzt. Tatsächlich ist die Genossenschaftsidee eine Menschheitsidee – und deshalb gehört sie auch unabhängig von allen Erklärungen der UNESCO so oder so zum immateriellen Weltkulturerbe.
Martin Bergner
Dieses Buch sei allen gewidmet,
ob bekannt oder unbekannt,
die seit Jahrtausenden überall auf der Welt
das kooperative, genossenschaftliche Zusammenwirken der
Menschen entwickelt und gelebt haben.
Inhalt
Worum es geht
Genossenschaftsidee als Menschheitsidee
Anthropologische Befunde zur Kooperation
Kooperation in der Vorgeschichte
Genossenschaften in der geschriebenen Geschichte
Genossenschaften im Altertum
Genossenschaften im Mittelalter
Historische Genossenschaftsformen in Deutschland – früher und heute
Drei Jahrhunderte Genossenschaftsgeschichte in der Neuzeit: Der Beginn
Chronologie der weiteren Genossenschaftsgeschichte
Hermann Schulze-Delitzsch
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Schulze-Delitzsch und Raiffeisen in den Urteilen der frühen Genossenschaftsgeschichte
Die Weite des Genossenschaftsbegriffs vor 1933
Die gesellschaftspolitische Dimension von Genossenschaften
Die tiefgehenden Mängel der Bewerbung
Resümee
Literaturverzeichnis
Worum es geht
Im Frühjahr 2015 hat die Deutsche UNESCO-Kommission bei der UNESCO in Paris den Antrag gestellt, die „Genossenschaftsidee“ in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufzunehmen (vgl. Deutsche UNESCO 2015a). Im deutschen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes steht sie schon seit 2014, neben dem rheinischen Karneval, dem Rattenfänger von Hameln, der deutschen Brotkultur und anderen, meist regionalen Sitten und Bräuchen. Warum also nicht auch die Genossenschaftsidee? Und warum sie nicht auch zum Kulturerbe der Menschheit erklären? Man müsste nur darüber nachdenken, warum das geschehen sollte. Was besagt eigentlich die Genossenschaftsidee und woher stammt sie überhaupt? Nun gibt es durchaus eine Begründung der Deutschen UNESCO-Kommission für ihren Antrag. Darin steht u. a. allen Ernstes, von Delitzsch, Weyerbusch und Flammersfeld (als den frühen Wirkungsorten der deutschen Genossenschafter Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen) hätten sich Idee und Praxis der Genossenschaften über andere Teile Deutschlands und darüber hinaus ausgebreitet. Heute würden sie fast weltweit praktiziert: “The idea and practice spread to other parts of Germany and beyond. Today it is practiced nearly world-wide.” (Deutsche UNESCO 2015a).
Das ist schlicht falsch und unseriös und so bietet schon diese Behauptung Anlass genug, fundierter der Frage nachzugehen, wie haben sich Idee und Praxis der Genossenschaften eigentlich entwickelt? Das soll im Folgenden geschehen, aber notgedrungen unvollkommen und ziemlich knapp. Im Resümee sind dann die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.
Die englische Übersetzung des deutschen Wortes „Genossenschaftsidee“ im Antrag der Deutschen UNESCO-Kommission lautet „the idea and practice of organizing shared interests in cooperatives“, was wiederum ins Deutsche so rückübersetzt wurde: „Idee und Praxis der Organisation von gemeinsamen Interessen in Genossenschaften“ (vgl. Deutsche UNESCO 2015b). Bleiben wir erst einmal bei der bloßen Idee. Kein geringerer als Hermann Schulze-Delitzsch kennzeichnete die Idee der Genossenschaft, der „Cooperation“ als die „Vereinigung atomistisch vereinzelter kleiner Kräfte zur Erreichung gemeinschaftlicher Zwecke“ (Schulze-Delitzsch 1858: 68). In der Tat: Diese Definition deckt alle Formen menschlichen Zusammenwirkens ab, die von der Bezeichnung als Genossenschaft erfasst werden könnten. In dieser Allgemeinheit geht es nicht nur um wirtschaftliche Ziele. Schulze-Delitzsch jedenfalls bezeichnete konsequenterweise auch die von ihm initiierten und geförderten Arbeitervereine mit dem Ziel der Teilhabe an Bildung als Genossenschaften, unabhängig von ihrer Rechtsform.
Die Genossenschaftsidee als Menschheitsidee
Es sei aber noch ein anderer großer Genossenschafter zitiert, dieses Mal aus unserem Jahrhundert: Ivano Barberini, Präsident der International Co-operative Alliance von 2001 bis zu seinem Tod 2009, stellte fest, das Genossenschaftliche finde man in der DNA der Menschen; seine Spuren seien in der Erfahrung jedes Einzelnen von uns enthalten. Man könne schon Kindern wie ein Märchen erzählen und erklären, wie die Menschen der Vorzeit, nachdem sie begonnen hatten zu jagen, zu fischen und allmählich den Boden zu bearbeiten, auch entdeckt haben, dass das gemeinsame Agieren, das Kooperieren bessere Resultate hervor bringe (vgl. Barberini 2009: 16f.). In der neueren Zeit schließlich hätten „Generationen von Denkern, Politikern, Religionsführern und Genossenschaftern […] auf der Grundlage ihrer jeweiligen Überzeugungen die Idee des Genossenschaftlichen erarbeitet.“ (Barberini 2009: 42). Mit anderen Worten, die Genossenschaftsidee ist eine allgemeine Menschheitsidee.
Ein deutscher Genossenschaftstheoretiker, Richard Sigmund Schultze, behauptete schon 1867 in lakonischer Kürze „die Geschichte der Menschheit ist zugleich die Geschichte der Assoziation.“ (Schultze 1867: 5). Oder, ebenso knapp ein anderer, aktuellerer Autor, der eher konservative Rechtshistoriker Bernd-Rüdiger Kern: „Die ursprünglichste und bis heute wichtigste Erscheinungsform des menschlichen Verbandes ist die Genossenschaft.“ (Kern 1998: 82). Die renommierte Universität von Michigan in Ann Arbor stellt in einem Internet-Text unter der Überschrift „The Cooperative Movement“ fest, die Menschen hätten schon vor Zeitaltern gelernt, dass sie durch gemeinsames Arbeiten mehr leisten könnten, als die Summe der Anstrengungen der Einzelnen erbringt. Die Geschichte der menschlichen ökonomischen Kooperation sei wahrscheinlich älter als die Geschichte des Wettbewerbs (vgl. University of Michigan 2015). Ähnlich sagte es schon vor hundert Jahren der deutsche Nationalökonom und Genossenschaftstheoretiker Willy Wygodzinsiki: „Soweit wir in der Geschichte des wirtschaftenden Menschen zurückblicken können, so weit sehen wir auch genossenschaftliche Bildungen, ja, wir können sagen, daß Genossenschaftswirtschaft am Anfange der Wirtschaftsgeschichte steht und die Einzelwirtschaft erst eine spätere Form ist.“ (Wygodzinski 1911: 6).
Anthropologische Befunde zur Kooperation
Das sind alles klare Feststellungen. Sie werden durch die wissenschaftliche Anthropologie untermauert, etwa durch folgende, etwas sperrig formulierte Erkenntnis: „Menschen sind die unbestrittenen Weltmeister im Kooperieren. […] In Experimenten, in sog. Public good games, verteilen Versuchspersonen eigene Güter ‚fair’, also zu ihrem eigenen Nachteil, und ohne einen ersichtlichen Vorteil durch den altruistischen Akt für sich herauszuziehen. Sie gehen sogar einen Schritt weiter, sie bestrafen Mitspieler, die sich unkooperativ verhalten, auch wenn die Bestrafung sie selbst etwas kostet. […] Das menschliche Verhalten entwickelte sich in Situationen von starker Konkurrenz zwischen benachbarten Gruppen. In einer solchen Situation kann es für die Gruppe vorteilhafter sein, wenn sie aus kooperativen Mitgliedern besteht.“ Kooperation basiere auf Gegenseitigkeit in der Form, dass die heutige Hilfe einem anderen gegenüber morgen von ihm oder einem Dritten erwidert wird. (Ostner 2009: 240f.). Oder, die gleiche Erkenntnis in anderen Worten: „Kooperation beruht auf empathischer Identifikation: Die Teilhabe an den Absichten eines Anderen ist notwendig, um effektiv zusammenarbeiten zu können; dabei lässt man das Ziel des Anderen zur eigenen Angelegenheit werden.“ (Bischof-Köhler 2009: 315). „Der Schrecken der Wirklichkeit“, so sagen es sehr plastisch zwei Anthropologen in einem gemeinsamen Beitrag, lasse sich „gerade in sozialer Gemeinschaft, durch Verständigung und Kooperation, erheblich mindern.“ (Großheim 2009: 214). Unvorstellbar oft ist der Schrecken der Wirklichkeit etwa durch Konsumgenossenschaften, die nicht umsonst im 19. Jahrhundert „Kinder der Not“ genannt wurden, gemildert worden.
Schon in den ersten anthropologisch relevanten Aussagen, noch nicht eigentlich wissenschaftlich, sondern philosophisch unterlegt, werden solche Erkenntnisse formuliert. Das geschieht etwa bei Platon, dessen Sichtweise in einer modernen Zusammenfassung so lautet: Jeder einzelne von uns genüge sich nicht selbst, sondern bedürfe vieler. Der Mensch sei also auf die Hilfe seiner Artgenossen, auf Kooperationsbeziehungen angewiesen (vgl. Jörke 2009: 442f.). Auch für Aristoteles sei der Mensch ein soziales Wesen und benötige Kooperationsbeziehungen (vgl. Jörke 2009: 444). Es handelt sich dabei um die berühmte Kennzeichnung des Menschen als „zoon politikon“, zu der Aristoteles hinzufügt, wer nicht in Gemeinschaft leben könne oder ihrer in seiner Autarkie nicht bedürfe, der sei entweder ein wildes Tier oder aber Gott (vgl. Aristoteles 1971: 65ff.), bewegt sich also nicht in menschlichen Sphären.
Kooperation in der Vorgeschichte
Diese Fähigkeit des Menschen zu kooperativen Verhalten oder vielmehr die Notwendigkeit dazu wird auch durch die Forschungen zur Vorgeschichte sichtbar. Vor rund zwei Millionen Jahren Zeit