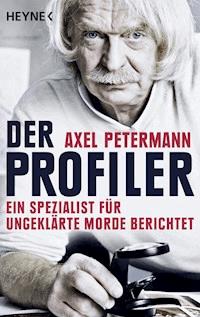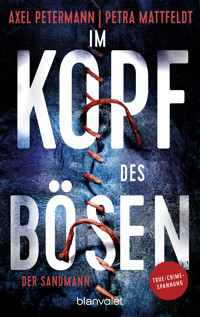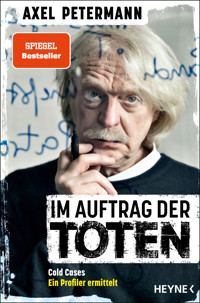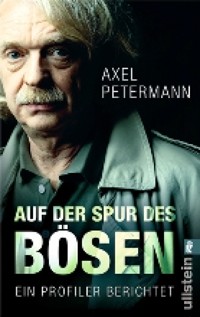Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Verlag München
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Axel Petermann ist Deutschlands bekanntester Profiler. Sie kommen ins Spiel, wenn die Aufklärung eines Falles ins Stocken gerät oder ein besonders bizarres Verbrechen vorliegt. Ungeklärte Fälle, sogenannte Cold Cases, sind ihr Metier. Egal, was das Motiv für einen Mord ist, der Profiler entschlüsselt die Handschrift des Täters. Bei jedem Verbrechen sind es die Fragen nach dem «Wie» und dem «Warum», die ihn antreiben, er muss den Mord verstehen, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dieses Buch zeigt nicht nur die kriminalistische Arbeit bei Mordfällen, es ist mehr. Der Leser blickt dem Profiler über die Schulter und taucht tief in die Ermittlungsarbeit der Mordkommission und die Entwicklung von Fallanalysen ein. Er lernt Untersuchungsmethoden kennen, erfährt, wie Tatortermittler denken und was Spuren über Psyche und Motive eines Täters verraten. Außerdem begleiten wir den Kommissar bei späteren Gesprächen mit den Tätern. Axel Petermann berichtet auf fesselnde Weise über die oft ebenso schwierige wie verblüffende Aufklärung mancher Taten, wahre Geschichten, die unter die Haut gehen und uns tiefe Einblicke in sonst verschlossene Welten geben. Abgründig und spannender als jeder Krimi!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Petermann
Im Angesicht des Bösen
Ungewöhnliche Fallberichte eines Profilers
Über dieses Buch
Axel Petermann ist Deutschlands bekanntester Profiler. Sie kommen ins Spiel, wenn die Aufklärung eines Falles ins Stocken gerät oder ein besonders bizarres Verbrechen vorliegt. Ungeklärte Fälle, sogenannte Cold Cases, sind ihr Metier. Egal, was das Motiv für einen Mord ist, der Profiler entschlüsselt die Handschrift des Täters. Bei jedem Verbrechen sind es die Fragen nach dem «Wie» und dem «Warum», die ihn antreiben, er muss den Mord verstehen, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dieses Buch zeigt nicht nur die kriminalistische Arbeit bei Mordfällen, es ist mehr. Der Leser blickt dem Profiler über die Schulter und taucht tief in die Ermittlungsarbeit der Mordkommission und die Entwicklung von Fallanalysen ein. Er lernt Untersuchungsmethoden kennen, erfährt, wie Tatortermittler denken und was Spuren über Psyche und Motive eines Täters verraten. Außerdem begleiten wir den Kommissar bei späteren Gesprächen mit den Tätern. Axel Petermann berichtet auf fesselnde Weise über die oft ebenso schwierige wie verblüffende Aufklärung mancher Taten, wahre Geschichten, die unter die Haut gehen und uns tiefe Einblicke in sonst verschlossene Welten geben. Abgründig und spannender als jeder Krimi!
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München, nach einem Entwurf von any.way, Hamburg
(Foto: Toma Babovic)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-62783-5 (1. Auflage 2013)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-30761-2
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Hinweis
Einleitung
Ohne Erbarmen
Das Ohr
Kaltblütig
«Ich bin doch kein Monster!»
Epilog
Dank
Ich danke Martin Knobbe für seine Mitarbeit am Buch.
Die in diesem Buch geschilderten Fälle entsprechen den Tatsachen. Alle Namen der genannten Personen und Orte des Geschehens wurden anonymisiert. Etwaige Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten wären rein zufällig. Außerdem sind alle Dialoge und Äußerungen Dritter nicht wortgetreu zitiert, sondern ihrem Sinn und Inhalt nach wiedergegeben.
Einleitung
Ein Blick hinter den Vorhang
Irgendwo in Deutschland in einem historischen Saal. Es ist kurz vor 19 Uhr. Bis zu meiner Lesung dauert es noch fast eine halbe Stunde. Trotzdem sind schon einige Menschen gekommen und haben auf ihren Stühlen Platz genommen. Am Ende werden es fast dreihundert Zuhörer sein, denen ich aus meinem ersten Buch wahre Geschichten über den Tod, menschliche Abgründe, Tragödien und Schuld vortragen werde. Wieder einmal ist es ein sehr gemischtes Publikum: Frauen und Männer, jung und alt, modern und konservativ, allein oder zu zweit. Unterschiedliche Menschen, die eines zu einen scheint: die Faszination des Bösen. Während ich in die Gesichter der Besucher schaue, frage ich mich, ob nicht der eine oder andere Hauptperson in einer meiner Geschichten sein könnte, sei es als Opfer oder als Täter. Der gewaltsame Tod zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten, Milieus und Kulturkreise. Das Böse ist allgegenwärtig, sicher auch in dieser Runde.
Die Vielfalt des Bösen hat für mich schon immer den Reiz ausgemacht, als Mordermittler und Profiler zu arbeiten: Ich habe ständig mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun, werde mit neuen Sachverhalten konfrontiert, mit bis dahin unbekannten Rätseln. Ich bin überzeugt davon, dass meine Zuhörer ebenfalls diesen Anspruch haben und sich fragen: Was gibt es außerhalb meines Kosmos an weiteren Lebensformen? Wo sind die Grenzen zivilisatorischen Lebens? Wer wagt, sie zu durchbrechen? Wann und warum wandelt sich das Leben in den gewaltsam erzwungenen Tod? Und die Frage über allem: Warum gibt es das Böse überhaupt? Und warum hört es nie auf?
Dass ich die Gesichter meiner Zuhörer beobachte, bleibt nicht unbemerkt. Manch einer beantwortet meinen fragenden Blick mit einem Lächeln, andere scheuen den direkten Kontakt. So als fühlten sie sich ertappt, dass auch sie zumindest an diesem Abend tief in die menschlichen Abgründe eintauchen wollen. Es ist nicht einfach, sich selbst einzugestehen, welch große Anziehungskraft das Böse hat.
Ich beginne zu lesen, und das leise Murmeln im Hintergrund geht in eine gespannte Stille über. Ich weiß, dass sie bis zum Ende der Lesung anhalten und nur ab und an von einem entspannten Aufatmen unterbrochen werden wird, wenn ich Anekdotisches über mich und meine Arbeit berichte. Und ich ahne, welche Fragen mir am Ende der Lesung gestellt werden: «Was fasziniert Sie am Bösen?», «Kann jeder Mensch zum Mörder werden?», «Was macht den Reiz Ihrer Arbeit aus?», «Wie halten Sie diese psychischen Belastungen aus?»
Antworten auf diese Fragen zu finden fällt mir immer noch schwer, auch nach den vielen Jahren, in denen ich dem Bösen und dem Tod oft sehr nahe war. Ich weiß noch nicht einmal, das Böse zufriedenstellend zu definieren. Bedeutet es die Freiheit, Grenzen zu überschreiten und sich wissentlich und bei vollem Bewusstsein gegen das Gute zu entscheiden? Menschen zu malträtieren, vielleicht zu töten und daran manchmal sogar Spaß zu empfinden? Oder ist es dem Menschen immanent? Verkörpert der Mensch nicht selbst das Böse? Ist er der Abgrund, vor dem einem schwindelt, wie es Georg Büchner einmal beschrieb?
Ich kann auch nicht erklären, warum uns das Böse so in seinen Bann zieht. Warum wir uns freiwillig vor Hannibal Lecter gruseln und uns Filme mit Vampiren und Zombies ansehen. Wollen wir von uns selbst erfahren, wie nahe uns das Böse kommen darf? Wie viel Brutalität und Gewalt wir aushalten? Wann wir weggucken müssen? Um am Ende immer wieder aufs Neue Genugtuung darüber zu erfahren, dass doch alles nur Fiktion und nicht Realität ist. Wohl wissend, dass Protagonisten, wie etwa der Kommissar, uns als moralische Saubermacher dabei begleiten und dem Bösen schlussendlich Einhalt gebieten? Aber reicht das für die Faszination? Ist das Böse in Wahrheit nicht sehr oberflächlich und langweilig, da es in seiner zerstörerischen Wirkung nie so kreativ und unerwartbar wie das Leben mit seinen zahlreichen Facetten sein kann? Warum also werden wir des Bösen nie müde?
Ich habe mehr Fragen als Antworten zu bieten und denke schon, dass der Mensch an sich sowohl Anteile des Bösen wie des Guten in sich trägt. Er ist stets dem ewigen Wechselspiel dieser beiden Pole ausgesetzt. So kann derselbe Mensch auf der einen Seite Gutes, auf der anderen Seite Schreckliches tun. Wir kennen beide Seiten aus unserem Alltag. Erschrecken wir uns manchmal nicht vor uns selbst, wenn unser Wort einen Tick zu laut geraten ist, unsere Gedanken schäbig, ja manchmal abgründig sind, unsere Argumente unsachlich und aggressiv? Erkennen wir dann nicht immer wieder, wie unmöglich es ist, ein rein guter Mensch zu sein? Aber heißt das zugleich, dass in jedem von uns ein potenzieller Mörder steckt? Kann eine bestimmte Situation auch uns so stark beeinflussen, dass wir zum tötenden Täter werden?
Die Forschung streitet seit Jahrzehnten darüber, woher das Böse kommt. Liegt es in den Genen, oder wird ein Mensch zum Verbrecher sozialisiert? Ist also die Natur die Ursache des Bösen oder die Gesellschaft, in der ein Mensch aufwächst, seine Erziehung, sein erworbenes Wertesystem? Ist es die genetische Disposition oder die Frage, ob ein Mensch gelernt hat, sich in andere hineinzuversetzen, mitleiden zu können, Empathie zu entwickeln? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen, obwohl ich der These des «geborenen Mörders» bis heute höchst skeptisch gegenüberstehe. Am Ende entscheiden die Kraft der Situation und die Fähigkeit, mit extremen Gefühlen wie Wut, Hass, Ärger, Enttäuschung, Verzweiflung und Liebe umzugehen. Wie oft habe ich von Mördern gehört, dass sie sich im Augenblick der Tat selbst nicht mehr wiedererkannt haben, dass sie ein gänzlich fremder Mensch gewesen seien.
Ein Konglomerat verschiedener Faktoren befähigt einen Menschen dazu, sich in bedrängenden Situationen zu beherrschen und seinen spontanen Gefühlen eben keinen freien Lauf zu lassen. Sich stattdessen zu entscheiden, etwas anderes zu tun als das, was er vielleicht im ersten Moment gerne tun würde. Diese Fähigkeit bewahrt ihn davor, dem Reiz des Bösen zu erliegen.
All diese Gedanken sind die Grundlage meiner Arbeit. Meine Aufgabe ist es zu verstehen, wie und warum ein Mensch eine Tat begangen hat. Ich nähere mich ihm wie ein Wissenschaftler seinem zu untersuchenden Objekt. Deshalb muss ich mich davor hüten, einen Täter moralisch zu bewerten, egal wie schrecklich seine Tat auch ist. Ich will den Menschen hinter der Tat erkennen, dafür muss ich den Vorhang des Schreckens durchschreiten. Manchmal ist es sogar notwendig, für diesen Menschen ein gewisses Maß an Verständnis aufzubringen. Denn niemand ist per se ein Monster.
Ich vermeide deshalb bewusst bei meiner Arbeit Worte wie «grausam», «brutal» oder «krank». Sie werden sie auch in diesem Buch nicht finden. Sie wären eine Wertung, die mir nicht zusteht. Meine Aufgabe besteht alleine darin herauszufinden, was geschehen ist und welche Motivation der Täter hatte. Diese Aufgabe kann ich nur unvoreingenommen erfüllen, subjektive Einflüsse würden mich beim Ermitteln ablenken. Es ist außerdem das verbriefte Recht eines Beschuldigten, eine objektive Aufklärung der Tat zu beanspruchen.
Ein Täter hat auch das Recht, seine Aussage zu verweigern. Er muss nicht zur Strafaufklärung beitragen, wenn er das nicht will. Ich hoffe natürlich trotzdem immer, dass er sich mit mir unterhält und im Idealfall auch aussagt. Dazu wird er aber nur dann bereit sein, wenn ich eine gute Gesprächsatmosphäre schaffe. Der Täter muss sich und seine Motive verstanden wissen. Das bedeutet nicht, dass ich sein kriminelles Verhalten akzeptiere. Aber ich darf ihm keine Antipathie entgegenbringen und nicht unbeherrscht vorgehen. In diesem Moment müsste ich den Fall abgeben. Mir ist das zum Glück noch nie passiert.
Natürlich gibt es Taten, deren Details bei mir fast Übelkeit auslösen. Natürlich bin auch ich nicht davor gefeit, zeitweise Wut gegenüber dem Täter zu spüren, gerade am Anfang, wenn einem nach und nach die Ausmaße einer Tat langsam bewusst werden. Und natürlich erschien schon manchmal ein Monster vor meinem geistigen Auge, wenn ich lange genug die Ermittlungsakten gelesen hatte. Wenig später aber stand mir dann ein Mann gegenüber, der so normal wirkte wie jeder andere, mit dem ich mich ganz ungezwungen unterhalten konnte. Ich vergesse in solchen Momenten nicht, was dieser Mensch getan hat. Aber ich habe gelernt, meine Abscheu bei der Tat zu belassen und nicht auf den Täter zu projizieren. Ich empfinde deshalb keine Wut auf die Täter, aber auch kein Mitleid für sie. Nur manchmal macht es mich traurig, wenn ich mir ihre Schicksale ansehe und mir bewusst wird, wie grundsätzlich sie am Leben gescheitert sind.
Die Frage, warum sich manche Menschen in bedrängenden Situationen beherrschen können, andere hingegen nicht, ist für mich die entscheidende. Ich suche die Antwort seit Jahren in meiner Arbeit, aber zum Beispiel auch durch das Schreiben dieses Buches. Ich suche sie, indem ich die Spuren einer Tat zu lesen versuche, mich über eine Rekonstruktion des Geschehens dem Motiv des Täters nähere und damit die facettenreiche Natur des Bösen mehr und mehr begreife.
Am Ende einer Lesung werde ich oft gefragt, wie ich den Umgang mit dem Bösen und dem Tod aushalten kann. Ich glaube, es geht nur dadurch, dass ich mich wie ein Zuschauer verhalte. Und das Schicksal des Opfers nicht an mich heranlasse. Natürlich will und muss ich alles über die Tat erfahren. Ich möchte auch verstehen, warum und wie ein Mensch getötet wurde. Ob er von seinem Mörder gezielt ausgesucht wurde oder ein Zufallsopfer war. Auch möchte ich wissen, wer das Opfer ist, wie es gelebt hat, mit wem es befreundet war und welche Aktivitäten es am liebsten unternahm. Dafür arbeite ich mich in die Biographie des Opfers ein, lese Tagebuchaufzeichnungen und Dokumente auf dem Rechner und befrage viele Menschen: Eltern, Partner, Freunde, Arbeitskollegen. Am Ende meiner Recherchen weiß ich so viel über das Opfer wie kaum ein anderer. Ich bin ihm dann sehr nahegekommen und kann deshalb vielleicht die Frage beantworten, wo das Motiv des Täters lag und welches die Gründe für den Mord waren.
Doch damit hört mein Interesse an dem Opfer auch schon auf, spätestens dann, wenn sich doch Gefühle einschleichen. Ich war schon immer sehr sensibel und bin es in gewisser Weise immer noch. Ich habe mir früher sehr viele Gedanken über die Taten, die Leiden der Opfer und die Trauer der Hinterbliebenen gemacht. Nach und nach aber wurde mir die Nähe zum Leid zu viel. Ich wollte nicht mehr hinterfragen, welche Verzweiflung der Mensch empfand, als er merkte, dass er sterben würde. Ich wollte mir nicht vorstellen, wie sein Leben noch einmal im Zeitraffer vor seinem geistigen Auge abgelaufen war, bevor er seinen Tod akzeptieren musste. Ich wollte mich so wenig wie möglich in das Opfer einfühlen.
Wenn ich diese Sätze schreibe, klingen sie auch für mich sehr hart. Und diese professionelle Einstellung zum Verbrechen und seinen Opfern zu gewinnen ist mir nicht leichtgefallen. Es begann ganz subtil: Ich hörte damit auf, mir die Namen der Toten zu merken, und schrieb sie stattdessen auf meinen Notizblock. Auch wollte ich nicht mehr genau wissen, wo die Opfer gelebt oder gearbeitet hatten, außer es war für die Ermittlung des Täters entscheidend. Ich wollte wieder frei durch meine Stadt laufen können, ohne an jeder Straßenecke an Tod und Verbrechen erinnert zu werden. Ich hätte sonst hier nicht mehr wohnen wollen.
Natürlich funktionierte diese Strategie nur in Teilen. Manche Ereignisse vergisst man sein ganzes Leben nicht, trotz aller Versuche und Wege, sie zu verdrängen: Mein erster Einsatz als Polizist in der Ausbildung war ein Unfall mit viel Blut. Ich kollabierte und wurde mit dem schwerverletzten Opfer zusammen ins Krankenhaus gefahren. Der erste Tote in meinem Polizeidienst war ein Autofahrer, der mit Vollgas gegen einen Brückenpfeiler gerast war und nur noch tot aus dem völlig zerstörten Wagen geborgen werden konnte. Die verstümmelte Leiche wurde in die Pathologie gebracht, um zu klären, ob es ein alkoholbedingter Fahrfehler oder ein Suizid war.
Ich kann mich noch gut an die Leichenhalle erinnern. Hinter einer hohen Mauer und immergrünen Koniferen versteckt, verbarg sich ein Raum, der mit der Sterilität und Sauberkeit heutiger Pathologien nichts gemein hatte. Die Fliesen waren in schmutzigem Beige und nur nachlässig von den Spuren der Vergänglichkeit gesäubert. Es gab lediglich neun Kühlfächer und drei separate Boxen zum Einfrieren von stark verwesten Leichen, so dass gerade an den Wochenenden weitere Tote ungekühlt und oft nackt auf Metallbahren oder gleich auf dem Fußboden lagen. Ich kann nicht behaupten, dass mich meine Ausbildung auf diese beklemmende Atmosphäre gut vorbereitet hätte.
Und so dauerte es tatsächlich lange, bis ich mich an den Anblick des Todes in all seinen Facetten gewöhnt hatte. Es fiel mir erst leichter, als ich lernte, den Toten am Tatort oder auf dem Obduktionstisch nicht als Menschen zu sehen, sondern als ein kriminalistisches Untersuchungsobjekt, das mir viel über den Täter und dessen Motivation verrät. Auch das klingt kalt und unmenschlich. Es ist aber der einzige Weg, wie man als Ermittler mit dem Tod umgehen kann, ohne selbst daran zugrunde zu gehen. Immerhin habe ich es in einem «normalen» Jahr mit ca. 75 Todesfällen zu tun.
Als ich gelernt hatte, Distanz zwischen mich und ein Opfer zu bringen, wurde meine Arbeit viel interessanter, denn auf einmal sah ich Spuren des Todes, die mir bis dahin verborgen geblieben waren. Ich wollte mehr wissen und hospitierte mehrfach in rechtsmedizinischen Instituten. So wurde ich vertraut mit den Methoden der Leichenöffnung und der Sektion. Ich lernte, Verletzungen zu erkennen und zu interpretieren. Das Gesicht des Todes verlor so ein wenig seinen Schrecken.
Ich werde es wohl aber nie schaffen, den Tod als Selbstverständlichkeit wahrzunehmen. Selbst wenn ich weiterhin versuche, meine Eindrücke sorgsam in gedanklichen Schubladen abzulegen und mich hinter Schutzwällen zu verbergen. Ich sehe an vielen Menschen, die ich bei meiner Arbeit kennenlernte, dass es auch ihnen nicht ganz gelingt. Manche kompensieren ihre Gefühle mit extremen Verhaltensweisen: Die scheinbar harte Staatsanwältin aus dem Bremer Umland zum Beispiel, die während einer Exhumierung aus ihrer Louis-Vuitton-Handtasche ihr Frühstücksbrot auspackte und mit vollen Backen ihren größten Geburtstagswunsch verriet: morgens die Meldung der Kriminalbereitschaft über einen Mord, emsige Ermittlungen am Tage und zum Abend die Festnahme und das Geständnis des Täters. Oder der nekrophile Mitarbeiter der Pathologie, von dem es hieß, dass er den respektvollen Umgang mit dem Tod vollkommen vergessen hatte, sich stattdessen an Leichen verging und darüber hinaus keine Gelegenheit ausließ, bei Obduktionen oder Totenschauen Zoten zu reißen und junge Polizisten mit schaurigen Details zu erschrecken. Oder der Mordermittler, der sich angeblich nur einen kleinen Schluck genehmigte, um den Geschmack des Todes aus Mund und Nase zu verbannen und irgendwie trotzdem zum Alkoholiker wurde. Oder die Kollegen, die die Nähe des Todes und das Leid der Opfer nicht länger ertragen konnten, sich in psychotherapeutische Behandlung begeben mussten, die Dienststelle wechselten oder sich manchmal auch selbst töteten. Der Tod und das Böse haben manchmal eine allumgreifende Macht.
Bis heute sind für mich die schlimmsten Momente die, wenn ich mit den Angehörigen der Opfer zu tun habe. Es hilft dann nicht mehr, für sich selbst Distanz zum Opfer zu schaffen, wenn man auf tiefste und unmittelbare Trauer trifft. Es ist ja oft die Aufgabe des Ermittlers, die Angehörigen vom Todesfall zu informieren. Man ist der Bote der schlimmsten Nachricht, die man einem Menschen überbringen kann. Und oft ist man dabei ganz auf sich alleine gestellt. Nicht nur junge und unerfahrene Beamte trifft diese Belastung ganz besonders.
Deshalb haben bis heute zwei Todesfälle noch nicht ihren Platz in einer meiner gedanklichen Schubladen gefunden. Als sei es erst gestern gewesen, sind mir die Bilder vom Unfalltod eines gerade einmal 17 Jahre jungen Deutschrussen präsent. Sein Kopf war bei der Erneuerung einer Außentreppe zwischen zwei Mauern eingequetscht worden. Da der Tote erst nach einer schier endlosen Zeit geborgen werden konnte, musste ich in dieser Zeit versuchen, die überforderten und hysterischen Verwandten zu beruhigen. Als schließlich der Tote in die Pathologie überführt worden war und ich von dort gerade nach Hause fahren wollte, erreichte mich der Anruf des Pastors, der die Betreuung der Familie übernommen hatte. Er werde mit der Mutter zu mir in die Rechtsmedizin kommen, damit sie von ihrem Sohn Abschied nehmen könne. Nur so könne sie annehmen, dass er auch tatsächlich tot war. Ich versuchte dem Geistlichen klarzumachen, dass das nicht gehe, der Junge sei zu sehr verletzt. Doch alle Einwände fruchteten nicht. Ich begann in meiner Not, das Blut vom Kopf des Jungen zu waschen und die Wunden mit weißen Binden und Laken abzudecken. Ich war gerade einigermaßen fertig, als die Mutter den Raum betrat.
Auch in dem anderen Fall stammte das Opfer aus einer deutschrussischen Familie. An einem Sonntag hatte sich ein dreijähriges Mädchen beim Spielen mit ihrem Bruder hinter einem Sofa verstecken wollen. Dabei war es mit dem Kopf zwischen Lehne und Dachschräge des Zimmers geraten und hatte sich so versehentlich erhängt. Als ich den Unfallort erreichte, traf ich auf eine verzweifelte Mutter, einen betrunkenen Vater, einen orthodoxen Geistlichen und eine Trauergemeinde von Deutschrussen. Alles Argumentieren, dass ich das Kind zur Untersuchung in die Rechtsmedizin bringen müsse, half nichts. Der Vater weigerte sich standhaft, seine Tochter von einem Bestatter aus dem Raum tragen zu lassen. Er trank ein Glas nach dem anderen und wurde von Minute zu Minute betrunkener. Was sollte ich tun? Den hünenhaften Mann mit mehreren Polizeibeamten zu überwältigen wäre eine Lösung gewesen, doch sicher die schlechteste. So rauchte ich mit ihm einige Zigaretten und trank dazu Wodka; ein Akt der Menschlichkeit, wie es der Geistliche formulierte, auch wenn es nicht vorschriftskonform war. Dann hatte ich eine Idee und schlug dem Vater vor, er solle sein totes Kind selbst zum Leichenwagen tragen. Der Mann willigte ein. Die Mutter wickelte das Kind in ein weißes Laken, und der Betrunkene schritt geradezu majestätisch mit seiner toten Tochter in seinen Armen voran zum Leichenwagen. Gefolgt von der Mutter, dem Priester, der andächtigen Trauergemeinde und mir. Noch heute habe ich die Gesänge in den Ohren, sehe die alten Frauen mit erhobenen Heiligenbildern und den Vater, wie er sein totes Kind in den offenen Sarg legte, ehe er zu seiner weinenden Frau ging. Dieser Film kommt in regelmäßigen Abständen immer wieder in meinen Kopf zurück.
Trotz all dieser belastenden Momente liebe ich meine Arbeit. Ich kann mir kaum einen kreativeren Beruf vorstellen und keinen mit einer so einfachen, aber unglaublichen Herausforderung: Dinge, die zunächst keinen Zusammenhang zeigen, zueinanderzubringen. Aber es ist nicht nur die Vielfalt der unterschiedlichen Aufgaben und das Eintauchen in mannigfache Lebensformen, es sind der Reiz und die Faszination des Bösen, die Frage nach dem «Whodunit» («wer hat’s getan?»), das Rätsel über das Warum. Es ist vor allem auch die Gewissheit, die Aufklärung des Verbrechens dem Opfer und seinen Angehörigen schuldig zu sein. Und der Anspruch, die Gesellschaft vor gefährlichen Tätern zu schützen.
Ich möchte Sie auf den nächsten 300 Seiten einladen, mir bei meiner Arbeit über die Schulter zu schauen und mich bei der Suche nach dem Bösen zu begleiten. Und auch Ihnen wird es sicher am Ende schwerfallen, anderen zu erklären, was genau das eigentlich ist und warum es uns so fasziniert, das ganz normale Böse.
Ohne Erbarmen
Ein Verbrechen, wie es im Buche steht
Der Regen prasselt heftig gegen die Windschutzscheibe meines Dienstwagens, als ich die Packhäuser an der Weser erreiche. Ich schlage den Kragen meines Trenchcoats hoch und haste dem Neubau entgegen. Leben am Fluss heißt die neue Wohnphilosophie in diesem Quartier. Für mich gewinnt der Satz eine völlig neue Bedeutung. Ich bin pitschnass, als ich die ehemalige Lagerhalle erreiche. Seitdem sich der geschäftige Hafenbetrieb in die Schwesterstadt Bremerhaven verlagert hat, wo genügend Platz ist, um die modernen Containerriesen zu löschen und zu beladen, werden die leerstehenden Lager- oder Industrieräume im Bremer Hafen nach und nach zu Wohn- und Lebensraum umfunktioniert. Die Anlage mit den aufwändig renovierten Loftwohnungen, exklusiven Boutiquen, Büroräumen und Anwaltspraxen ist nach neuesten bautechnischen Erfordernissen gestaltet; weiß getünchte Wände, hellgrau gestrichener Betonboden, verglaste Oberlichter und zahlreiche Deckenstrahler sorgen für eine taghelle Atmosphäre. Doch diese Helligkeit steht im krassen Gegensatz zu der etwa einen Meter langen und fast 40 Zentimeter breiten Lache auf dem Beton. Dunkelrot ist sie, das Blut ist bereits eingetrocknet. Als Michelle Reuter hier ermordet wurde, war ich noch im Urlaub in Schweden. Nach meiner Rückkehr war ich sofort ins Büro gefahren. Es war ein Fall, der mich eine lange Zeit beschäftigen würde.
Michelle Reuter war an jenem Abend nach 20 Uhr nach Hause zurückgekehrt, nachdem sie Freundinnen besucht hatte. Sie hatte ihr weißes Cabriolet im Parkhaus abgestellt und war mit Handtasche und zwei großen Umhängetaschen zum Fahrstuhl gegangen. Allem Anschein nach hatte der Täter in dem kleinen Gang vor dem Aufzug auf sie gewartet und sie sofort mit Messerstichen attackiert. Ihre gellenden, Todesangst signalisierenden Hilfeschreie hatten die wenigen Bewohner der Anlage aus ihrer Hitzelethargie gerissen. Trotzdem waren mehrere Minuten vergangen, bis sich einer von ihnen endlich aufraffte, nach dem Grund für das Geschrei zu sehen. Er war zu seinem Entsetzen auf ein wahres «Blutmeer» gestoßen und hatte – so die Annahme der Ermittler – vermutlich den Täter gestört, der daraufhin geflüchtet war.
Die alarmierten Polizeibeamten folgten den Blutspuren und fanden Michelle Reuter in einem kleinen Raum unterhalb einer Treppe, dem sogenannten«Luftschacht». Sie lebte nicht mehr. Trotz vieler Hinweise und engagierter Ermittlungen der Mordkommission konnte das Verbrechen nicht geklärt werden. Wegen der extremen Verletzungen der Toten schlossen die Kollegen ein Beziehungsdelikt nicht aus und hatten bereits zahlreiche Freunde, Nachbarn und flüchtige Bekannte des Opfers überprüft. Es gab keine ernstzunehmende Spur.
Der Täter aber war möglicherweise vor dem Verbrechen von mehreren Bewohnern der Anlage gesehen worden. Eine Zeugin war am Vortag des Mordes gegen 21 Uhr zu einem Fremden in den Fahrstuhl gestiegen und hatte in einem kurzen Gespräch erwähnt, gerade von der Arbeit gekommen zu sein. Einen Tag später war ihr der Fremde erneut aufgefallen. Dieses Mal war es gegen 18 Uhr, als sie das Haus verließ und plötzlich dem Mann aus dem Fahrstuhl gegenüberstand. Sie hatte ihm noch die Haustür aufgehalten, und der Unbekannte hatte das Haus betreten.
In der nächsten Stunde war der Mann noch drei anderen Bewohnern aufgefallen: Einer jungen Frau war er fast bis zu ihrem Auto gefolgt, die beiden anderen Zeugen hatten sich darüber gewundert, wie er scheinbar ohne Ziel im Keller der Anlage herumstreunte, ehe er sie fragte, wo die Müllcontainer stünden. Das war gegen 19.15 Uhr gewesen, eine knappe Stunde bevor Michelle Reuter starb. Auch wenn es nicht erwiesen war, dass es sich bei dem Fremden um den Täter handelte, schienen die Zeugen doch ein und dieselbe Person beschrieben zu haben: ein Mann Ende 20, schlank und klein, helle Haare, Brille, Jeans und weißes T-Shirt. Keine besonderen Merkmale.
Das Verhalten des Täters ist ungewöhnlich, sein Motiv ist zu diesem Zeitpunkt unerklärlich. Ich entschließe mich daher, von der üblichen Methode einer Mordermittlung abzuweichen und stattdessen eine sogenannte Tatort- oder Fallanalyse durchzuführen. Der Begriff aus dem Amerikanischen ist den meisten geläufiger: Profiling. Obwohl ich schon seit über 20 Jahren Erfahrungen als Mordermittler gesammelt habe, beschäftige ich mich mit dem neuen analytischen Ansatz erst seit gut einem Jahr und hatte erst ein paar der zahlreichen Schulungen absolviert. Bis zur Zertifizierung zum Fallanalytiker lag noch ein weiter Weg vor mir.
Ich kann heute gar nicht mehr genau sagen, weshalb mich die Methoden des Profilings so fesselten: Waren es die beeindruckenden Fallstudien aus den USA über Serienmörder wie Ed Gein, Jeffrey Dahmer und Ted Bundy? War es die generelle Faszination des Bösen, die jeder kennt, der gerne Krimis liest oder sieht? Oder war es die Hoffnung, endlich Erklärungen für das Verhalten mancher Täter zu finden, das wir bislang als absurd, bizarr oder schlicht nicht nachvollziehbar bezeichnen mussten? Vermutlich war es eine Mischung aus allem.
Ich wusste jedenfalls, dass ich mich nicht mehr damit zufriedengeben wollte, Täter zu fangen und zu Geständnissen zu bewegen, ohne die echten Gründe herauszufinden, weshalb sie auf diese oder jene Weise getötet hatten. Ich hoffte, mehr über das einzelne Verbrechen und den Täter zu erfahren und damit auch über die unerschöpfliche Vielfalt der menschlichen Psyche. So wurde der Mord an Michelle Reuter meine erste richtige Analyse als angehender Profiler. Damals allerdings noch als Leiter der Mordkommission, das Kommissariat «Operative Fallanalyse» sollte ich erst später gründen.
Ich musste ganz anders vorgehen als bis dahin. Den bekannten Weg zu verlassen war eine ungewohnte Herausforderung. Die Fallanalyse fußt auf drei Säulen: Spuren am Tatort, Spuren an der Leiche und Persönlichkeit des Opfers. Aussagen von Zeugen und Hinweise auf den Täter außerhalb des Tatorts, die in einer üblichen Mordermittlung oft den Kern bilden, interessieren den Fallanalytiker wegen der ihnen innewohnenden Subjektivität kaum. Außer es geht um die Festlegung zeitlicher Abfolgen und um die Charakterisierung des Opfers. Hierzu benötige ich sogar möglichst viele Meinungen, um ein einigermaßen authentisches Bild zu bekommen: Welche Wesensmerkmale hatte der Mensch? Wie vertrauensselig war er, wie verhielt er sich in gefährlichen Situationen? Das Zentrum der Fallanlyse aber ist der Tatort: Die Spuren der Tat können erzählen, welchen Bedürfnissen der Täter nachgegangen ist, wie detailliert er seine Tat geplant hat und was ihn überhaupt motiviert hat, das Verbrechen zu verüben.
Um darauf eine Antwort zu finden, stelle ich mir am Tatort sehr viele Fragen, bei denen es immer um die Bewertung des Täterverhaltens geht: Wie erfolgte die Kontaktaufnahme zum Opfer? Wie sehr hatte er sich und seine Impulse unter Kontrolle? Wie gewalttätig war sein Verhalten? War es lediglich funktionell, also erforderlich, um den Widerstand des Opfers zu überwinden? Oder war es bedürfnisorientiert? Welche Waffen setzte der Täter ein – die eigenen Hände, Stich- oder Schlagwerkzeuge? Brachte er Waffen zum Tatort mit, oder hat er sie dort zufällig gefunden, was man als «Waffen der Gelegenheit» bezeichnet? Wann hat er das Opfer verletzt: vor oder nach dem Tod? Oder während des Sterbens? Wie tötete der Täter? Würgte oder drosselte er zunächst und stach dann auf das Opfer ein? Oder tötete er in umgekehrter Reihenfolge? Wie war das sexuelle Verhalten? Gab es dies überhaupt? Wenn ja, deutete es auf ungewöhnliche sexuelle Bedürfnisse hin, wie Fetischismus oder Sadismus? Verging sich der Täter an dem Mordopfer? Und was machte er mit der Leiche? Ließ er sie einfach liegen, versteckte er sie, oder brachte er sie an einen anderen Ort? Versuchte der Täter, Spuren wie Fingerabdrücke oder Sperma zu vermeiden, die ihn identifizieren könnten? Trug er also Handschuhe oder benutzte er ein Kondom? Es ist eine Menge von Fragen, die ich beantworten muss, um den Ablauf des Verbrechens möglichst realitätsnah rekonstruieren zu können. Dies bringt mich dann hoffentlich dazu, das Tatmotiv zu verstehen, die Bedürfnisse des Täters zu beschreiben und sein persönliches Profil zu bestimmen.
In dem getrockneten Blut ist das grobe und rautenförmige Profil eines Arbeitsschuhs zu erkennen, wie Stempel sind die Abdrücke der Sohle in regelmäßigen Abständen auf dem Boden zu erkennen, bis sie sich in der Tiefe des Raumes verlieren. Um die Lache sind dicke Blutstropfen verteilt, die strahlenförmig auslaufen. Eine schmale Wischspur führt von hier zu der grauen Stahltür einer Schleuse, dem Zugang zum Fahrstuhl, den Abstellräumen und dem Raum für Fahrräder.
Ich öffne die feuerhemmende Schleusentür und betrete den knapp acht Quadratmeter großen fensterlosen Vorraum. Das fahle Licht von Neonröhren beleuchtet ihn gespenstisch, zwei Stahltüren führen zu weiteren Räumen. Der Raum erinnert mich an ein Verlies.
Auf dem Boden und an den Wänden entdecke ich ebenfalls Blutspuren. Obwohl ich im Büro bereits die Fotos des Tatortes und der Leichenobduktion aufmerksam betrachtet habe, erschreckt mich das Ausmaß dieser stummen Tatzeugen. Einen solchen Ausdruck brutaler Gewalt habe ich noch nie an einem Tatort erlebt.
Um das Verbrechen rekonstruieren und verstehen zu können, muss ich das blutige Spurenbild interpretieren. Eine bedrückende Aufgabe, die hier nach unbeschwerten Urlaubstagen auf mich wartet. Der modrige Verwesungsgeruch des Blutes macht sie nicht gerade attraktiver. Es sind solche Momente, in denen es mir schwerfällt, die professionelle Distanz zur Tat und zum Opfer zu wahren. Ich kann die Vorstellung nicht verdrängen, dass hier vor wenigen Tagen ein junges Leben voller Zukunftserwartungen und mit vermutlich großen Plänen gewaltsam sein Ende gefunden hat. Ich mag mir erst recht nicht vorstellen, welche Todesängste und Qualen die junge Frau erlitten haben muss, bevor sie trotz aller Widerwehr elendig starb.
Ich versuche, so gut wie möglich diesen Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen und mich wieder auf meine Aufgabe zu konzentrieren. Der Tatort sieht nun nicht mehr so aus, wie ihn die Kollegen vorgefunden hatten. Viel ist bewegt und verändert worden, die Spurensicherer, Ermittler, Rettungssanitäter oder Träger des Sarges haben ihre eigenen Spuren hinzugefügt. Dennoch bin ich mir sicher, dass ich trotzdem Hinweise auf den Ablauf des Verbrechens ableiten kann, indem ich noch mal alles genau betrachte.
Es gibt eine Szene in der Verfilmung des Thrillers «Roter Drache» von Thomas Harris, die ganz gut zeigt, wie ein Profiler arbeitet. Der junge FBI-Ermittler Will Graham (Edward Norton) betritt den Tatort, an dem der Serienmörder Francis Dolarhyde Tage zuvor das Leben einer ganzen Familie ausgelöscht hatte. Der Zuschauer sieht mit den Augen des Profilers im Schlafzimmer Blutspuren an den Wänden und auf dem Bett. Will Graham lässt diese Spuren auf sich wirken, um dann seine Gedanken über ihre Ursache und die Dynamik am Tatort in ein Diktaphon zu sprechen. So ähnlich sieht auch meine Tätigkeit aus, nur dass ich meine Überlegungen nicht aufs Band spreche, sondern sie in meinen Stenoblock notiere. Ich komme mit der altmodischen Methode immer noch am besten klar.
Dieser fast schon meditative Aufenthalt am Tatort war schon ein fester Bestandteil meiner Ermittlungen, bevor ich mich der Fallanalyse zugewandt habe. Immer wieder war ich zu den Orten der Verbrechen gefahren und hatte die Spuren auf mich wirken lassen, manchmal verharrte ich so mehrere Stunden lang. Häufig waren mir auf diese Weise die Abläufe des Verbrechens bewusst geworden. Wissen, das ich dann in die Vernehmungen mit Tatverdächtigen einbringen konnte. Bei einem Geständnis konnte ich dann auch sehen, inwieweit der Täter das Tatgeschehen in seiner Darstellung verfälschte.
Direkt hinter der Schleusentür erkenne ich den großen Blutsee, der den Zeugen verschreckt hatte. Vereinzelte Spritzer an der Wand zeigen mir, dass durch die schnellen Bewegungen beim Stechen Blut von einem Messer abgeschleudert wurde. Die sehr schwer verletzte Michelle Reuter lag hier offenbar für längere Zeit auf dem Boden. Bevor ihr Blut gerinnen oder trocknen konnte, war sie allerdings über mehrere Meter durch den Raum gezogen worden, darauf deutet eine Spur hin, die ohne Unterbrechung bis zu einer zweiten Tür führt. Blut gerinnt innerhalb von drei bis sechs Minuten und trocknet nach zehn bis fünfzehn Minuten. Der Täter hat die Frau durch den Raum gezogen, kurz nachdem er auf sie eingestochen hat.
Auch an dieser Tür hat sich auf dem Boden ein etwa eineinhalb Quadratmeter großer Blutsee gebildet, aus dem langgezogene Blutspritzer förmlich herausplatzen und bis zum etwa 50 Zentimeter entfernten Türblatt reichen. Ich lasse dieses Bild lange auf mich wirken, denn es war ein besonderer Moment im Tatablauf: Hier hat der Täter beim Zustechen nicht nur eine oder mehrere Arterien verletzt, sodass das Blut mit hohem Druck aus der Wunde spritzte, hier hat er Michelle Reuter getötet.
Ich sehe mich in dem Raum um und versuche, ein Muster in die zahlreichen Schuhabdrücke mit dem groben Profil zu bringen. Der Täter ist scheinbar rastlos in dem Raum hin und her gegangen. Aber warum?
Ich ziehe die Mappe mit den Tatortfotos aus meiner Aktentasche. Als ich mir die Aufnahmen aus der Schleuse ansehe, habe ich eine Idee: Wollte der Täter den Tatort aufräumen? Hatte er deshalb bereits die beiden Umhängetaschen des Opfers auf der blutigen Schleifspur abgestellt, ehe er von dem aufgeschreckten Mieter gestört wurde? Auf den Fotos kann ich erkennen, dass der Täter auch die Taschen durchsucht hat: Eine Plastiktüte mit dem Label von «En Vogue» ragt aus der offenen Umhängetasche heraus. In einem Abstand von gut einem Meter liegen ein Schlüsselbund mit einem Fotoanhänger, ein einzelner Autoschlüssel, eine angebrochene Schachtel Light-Zigaretten, ein silbernes Feuerzeug sowie drei Kunstzeitschriften auf dem Boden. Ich folge der mäanderartig verlaufenden Schleifspur, verlasse die Schleuse und betrete einen kleinen Flur, der zum Fahrstuhl und den Abstellräumen führt.
Ich erkenne an den durchgängigen Schleifspuren, dass der Täter zielstrebig und ohne Stopp sein Opfer über zwanzig Meter bis in den Fahrradkeller gezogen hat, ehe er es vor einer kleinen Schachttür ablegte. Ich muss an ein erlegtes Stück Wild denken, eine Trophäe, die vom Jäger abtransportiert wird, um sie vor den Raubtieren zu schützen. Der Täter hat die tote Frau wie ein Stück Vieh behandelt.
Die Blutspuren an der Wand zeigen mir, dass der Mörder hier die Tote anlehnte, dann ihren Körper anhob und ihn in den dahinterliegenden Schacht zog. Ich blättere in der Fotomappe weiter und sehe eine weitere Besonderheit des Tatortes: In der Schleifspur liegen mehrere blutbefleckte Kunstzeitschriften sowie vier spitz gefaltete Hochglanzpapiere. Die Zeitschriften haben vermutlich während des Transports auf der Leiche gelegen und die Wunden abgedeckt. Beim schnellen Ziehen des Körpers sind sie dann von ihm heruntergefallen. Die Bedeutung der gefalteten Papiere erschließt sich mir allerdings nicht. Während zwei Blätter vollkommen blutdurchtränkt sind, weisen die beiden anderen lediglich blutige Spitzen auf. Hat der Täter die spitzen Enden in die Halswunde der Toten gesteckt und versucht, sie so zu verschließen? Oder wollte er auf diese Weise weitere Messerstiche symbolisieren? Einen dritten ungewöhnlichen Umstand entdecke ich auf den Fotos: Wenige Meter von der Schachttür entfernt liegt das etwa zwanzig Zentimeter lange Ende eines daumendicken medizinischen Pflasters. An ihm kleben zwei streichholzlange schwarze Haare. Es sind vermutlich Haare von Michelle Reuter. Noch ein Rätsel, das sich mir hier stellt: Welche Funktion hatte der Pflasterstreifen? Sollte er einen Knebel fixieren, um die Frau am Schreien zu hindern? Doch dann wäre dem Täter auch dieses Vorhaben gänzlich missglückt.
Die Fotos zeigen mir auch, dass der Platz, an dem Michelle Reuter gefunden wurde, anders aussah als jetzt. Links neben der Tür zum Schacht stand ein Fahrrad, das an die Wand gelehnt war. Die Spurensucher hat es bei der Arbeit gestört, sie haben es weggestellt. Den Täter aber hat es offenbar nicht behindert. Dann öffne ich die nur 120 Zentimeter hohe Tür, die zum «Luftschacht» führt. Auf der Tür sind neben der Klinke noch vier verwischte, blutige Abdrücke von Fingern zu sehen. Ich kann erkennen, dass sie von Handschuhen stammen.
Ich steige über einen knapp 60 Zentimeter hohen Sims und leuchte mit meiner Taschenlampe in den dunklen Raum hinein. Es dauert eine Weile, bis sich meine Augen an das Halbdunkel gewöhnen. Der Raum ist gerade einmal 80 Zentimeter breit und gut vier Meter lang. Ich kann allerdings darin stehen, ohne an die Decke zu stoßen. Vorsichtig taste ich mich nach links vor und komme am Ende des Ganges zu einer Öffnung in der Mauer, die zu einem weiteren Raum um die Ecke führt. Meine Augen fangen zu tränen an, es riecht plötzlich beißend nach Lösungsmittel. Als ich den Boden ableuchte, sehe ich dort zwei Dosen stehen: Ein «Zweikomponenten-Epoxidharzsystem», man verwendet es zum Streichen von Betonböden. Eine der Dosen war umgefallen, ihr Inhalt hatte sich auf den Boden ergossen. Direkt neben dem angetrockneten Kunstharz erkenne ich Blutspuren, auf dem Boden und an den unverputzten Gasbetonsteinen direkt unterhalb des Einstiegs. Hier also lag die Leiche von Michelle Reuter, als sie gefunden wurde.
Der ätzende Gestank ist nicht lange zu ertragen, ich flüchte aus der Enge. Draußen im Fahrradkeller nehme ich wieder die Fotos zur Hand. Ich versuche in Gedanken zu rekonstruieren, wie genau der Täter die Leiche in dem Raum abgelegt hat. Auf den Bildern sind Michelle Reuters Gesicht und ihre Haare blutverschmiert. Die Abrinnspuren am Kopf verlaufen in unterschiedlichen Richtungen und zeigen, dass Michelle Reuter sich noch bewegte, nachdem sie mit den Stichen malträtiert wurde. Oder aber der Täter hat die Position ihres Körpers verändert. Auch ihre rahmenlose Brille ist verbogen und in Richtung der Stirn verrutscht. Das alles zeugt von einer großen Dynamik dieses Verbrechens.
Die Tote liegt auf dem Rücken, die rechte Schulter und der Kopf sind leicht erhöht und an die Wand angelehnt, der rechte Arm ruht auf dem Bauch. Die Beine sind gespreizt, jedoch in den Knien angebeugt, sodass die Füße an den Fersen zusammenstoßen. Die nackten Füße stecken in leichten Mokassins. Neben dem rechten Fuß liegt eine abgerissene Armbanduhr mit zersplittertem Glas.
Michelle Reuter trägt eine cremefarbene und weitgeschnittene Hose, deren Naht im Schritt einige Zentimeter weit aufgerissen ist, sodass ein weißer Slip zu sehen ist. Beide Knöpfe im Bund sind geschlossen, der Reißverschluss ist hochgezogen. Zwischen den Beinen liegt eine weiße Strickjacke mit auf links gezogenen Ärmeln. Das vormals beigefarbene langärmelige T-Shirt ist vollkommen blutdurchtränkt und bis über die Brüste hochgeschoben.
Die nackten Brüste sind blutverschmiert. Dennoch sieht man auf dem Foto mehrere Stiche in der linken Brust und im Oberbauch, auch im rechten Halsbereich klafft ein langer Schnitt. Mit der Lupe betrachte ich mir das Bild genauer: Eine feingliedrige silberne Kette der Toten liegt straffgezogen zwischen den beiden Wundwinkeln. Ist sie zufällig beim Hereinziehen der Leiche dorthin gerutscht? Oder hat sie der Täter bewusst so drapiert?
Auf einem der letzten Fotos entdecke ich, dass im Raum auf dem Sims der Schachttür ein Schlüssel liegt, mit einem dicken Bart, ein einfacher Schlüssel für Zimmertüren. Er könnte in das Schloss zur Tür des Luftschachts passen. Wollte der Täter den kleinen Raum abschließen, um sich hier an einem wehrlosen Opfer zu vergehen? Als ich mir ein paar Tage später bei den Spurensuchern den Schlüssel ausleihe und zum Tatort zurückfahre, stelle ich fest, dass der Schlüssel tatsächlich passt.
Nun folge ich den blutigen Schuhabdrücken, die vom Luftschacht zum Erdgeschoss führen. Mit gleichmäßigen Schritten ging der Täter am Gepäck von Michelle Reuter vorbei, passierte auf seinem Weg vom Tatort weg verschiedene Einstellplätze für Autos und Abstellräume, ehe er das Nachbarhaus erreichte und dort den Fahrstuhl betrat, wie ein letzter blutiger Teilabdruck der Sohle zeigte. Ich nehme den Fahrstuhl und fahre in den dritten Stock, zu einer unverschlossenen und leeren Wohnung. An der Türklinke hatten die Spurensucher ebenfalls Blut von Michelle Reuter gesichert, das nur der Täter hier hinterlassen haben konnte. Was aber wollte er hier? Hatte er sich in der Wohnung gewaschen oder umgezogen? Ein weiteres Rätsel in diesem ungewöhnlichen Fall.
Fürs Erste habe ich genug gesehen. Es sind nun mehrere Stunden vergangen, seitdem ich pitschnass den Tatort betreten hatte. Der Regen hat mittlerweile aufgehört, der Asphalt aber ist von Pfützen übersät. Ich schlendere zum nahegelegenen Hafenbecken, setze mich auf einen Poller und lasse die Eindrücke auf mich wirken. Ich überlege, ob Michelle Reuter den Täter kannte oder ob es zufällig zu dem tragischen Zusammentreffen gekommen war. Die Verletzungen deuten nicht darauf hin, dass sich die beiden kannten. Schläge ins Gesicht, Würgen oder Drosseln sind typische Gewaltakte einer Beziehungstat. Auch wie sich der Täter nach dem Mord verhalten hat, spricht eher für eine zufällige Auswahl des Opfers. Häufig ist die Flucht die erste Reaktion eines Beziehungstäters, manchmal inszeniert er auch den Tatort, das heißt, er ordnet Gegenstände oder die Leiche selbst so an, dass sie etwas aussagen sollen, z.B. um von sich als Täter abzulenken oder als eine letzte Botschaft an den einst geliebten Partner. Doch hier ist alles anders: das Schleifen der Toten in den Luftschacht, das Zusammenstellen der Umhängetaschen, die gefalteten Papiere, das medizinische Klebeband mit den Haaren der Toten in der Schleifspur. Wer so handelt, hat den Mord geplant. Die Frage ist nur: Warum? In der Terminologie des FBI spricht man von einem unspecific motive killing: ein Mord, dessen Bedeutung allein der Täter kennt und mit dessen Realisierung er sich sehr lange beschäftigt hat.
Dies sind erste Überlegungen, wild gesponnen an einem Hafenbecken unter wolkenverhangenem Himmel. Um daraus eine ernsthafte These zu machen, benötige ich zunächst jedwede Information über das Opfer: Wie waren die familiären, persönlichen und finanziellen Verhältnisse von Michelle Reuter? Wie verbrachte sie ihre Freizeit? Verkehrte sie in Subkulturen? Wann und wo war sie zuletzt gesehen worden – alleine oder in Begleitung? Wie wählte sie ihre Sexualpartner aus? Gab es Kontakte in Internetforen?
Um auf all diese Fragen eine Antwort zu finden, müssen Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen vernommen werden. Je mehr, desto besser, damit nicht die subjektive Meinung eines Einzelnen das Opferbild prägt. Es geht um ein ganzheitliches Bild der Persönlichkeit. Weiterhin können private Aufzeichnungen des Opfers in Terminkalendern, Tagebüchern, Briefen oder E-Mails zu diesem Bild beitragen. Ihre Auswertung ist enorm zeit- und personalaufwendig, doch sie lohnt sich. Gerade in der Intimität zeigt der Mensch sein wahres Wesen. Es ist meine Aufgabe, möglichst auch die tiefsten Geheimnisse des Opfers zu entdecken. Am Ende weiß ich vielleicht mehr als die Mutter, ein Freund, der Ehemann. Es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
In den vergangenen Tagen hatten sich meine Kollegen der Mordkommission bereits sehr intensiv mit dem Leben von Michelle Reuter und ihrer Biographie beschäftigt. Sie haben alles in einem separaten Aktenordner mit der Aufschrift «Opferbild Michelle Reuter» abgelegt. Michelle Reuter ist als Tochter eines Kaufmanns und einer französischen Mutter im Ausland aufgewachsen und hat dort verschiedene internationale Schulen besucht. Sie hat recht früh ihre Liebe zur eigenen Kreativität und Kunst entdeckt. Nach dem Schulabschluss studierte sie in verschiedenen europäischen Metropolen Modedesign und Malerei. Vor einem Dreivierteljahr kehrte sie in ihre Heimatstadt Bremen zurück und wohnte vorübergehend bei einer Freundin. Die Gründe dieser Entscheidung werden mir beim Lesen der Unterlagen nicht deutlich, doch vermutlich plante Michelle Reuter einen Neuanfang. In ihrer Vernehmung hat ihre Freundin jedenfalls so etwas für möglich gehalten.
Auf ihrer Suche nach einer repräsentativen Wohnung wurde Michelle Reuter auf das Bauvorhaben am Wasser aufmerksam und verliebte sich sofort in die frühere Hafenidylle. Seit einem knappen Vierteljahr lebte sie als eine der wenigen Mieterinnen in ihrem Loft mit Blick auf das Wasser und richtete sich gleichzeitig eine Galerie mit Werken zeitgenössischer Op-Art-Künstler der 60er Jahre ein, von Bridget Riley bis Victor Vasarely.
Die Anonymität der Wohnanlage, in der noch immer viele Wohnungen leerstehen, ängstigte sie offenbar nicht. Gegenüber einer Freundin erklärte sie, sich über die Ruhe im Haus zu freuen. Sie genieße es, für ihr Cabriolet immer einen Parkplatz zu finden. Den Rat, sich eine Spraydose Reizgas anzuschaffen, lehnte sie ab. Sie hatte so etwas in ihrem Leben noch nie gebraucht. Sie trat anderen gegenüber immer freundlich und offen auf und glaubte an das Gute im Menschen. «Ich bin doch die Letzte, der etwas passieren wird», sagte sie gern zu ihren Freundinnen.
Zu ihren in Berlin lebenden Eltern sowie zu ihrem fünf Jahre älteren Bruder hatte sie ein ausgesprochen herzliches und offenes Verhältnis; ebenso zu früheren Kommilitonen und Künstlerkollegen, mit denen sie oft telefonierte oder sich E-Mails schrieb. Seit ihrer Rückkehr nach Bremen ging sie abends häufiger im Szeneviertel der Innenstadt mit seinen Boutiquen, Kneipen und gemütlichen Restaurants aus. Dort schloss sie schnell neue Bekanntschaften und gab manchmal wohl ein wenig unbedarft und freizügig ihre Telefonnummer weiter. Da sich Michelle Reuter über die Kontaktversuche wunderte, riet ihre Freundin, etwas vorsichtiger mit der Telefonnummer umzugehen. Schließlich «trug auch ihr attraktives Äußeres zu ihrem Begehrtsein bei», wie sie in ihrer Vernehmung sagte.
Ein befreundeter Fotograf hatte eine Bilderserie von Michelle Reuter geschossen. Als ich die Fotos betrachte, verstehe ich, was die Freundin meinte: Ich sehe eine gut aussehende, zierliche und schon ein wenig extravagante Erscheinung mit kurzen schwarzen Haaren, die sich ihrer Wirkung bewusst zu sein scheint. Ihr Blick ist freundlich und offen, manchmal kokettierend und dann wieder nachdenklich. Die Fotos sind erst vor fünf Wochen aufgenommen worden: Michelle Reuter beim Aufhängen der Op-Art-Bilder in der Galerie, vor der Staffelei, hinter dem Steuer ihres Sportwagens und mit zerzausten Haaren am Hafenbecken, fröhlich in die Kamera winkend.
Mit diesen Eindrücken fahre ich in das Institut der Rechtsmedizin, um mir die Leiche der bereits obduzierten jungen Frau anzusehen. Ich muss mich beeilen, denn inzwischen hat die Staatsanwaltschaft die Leiche zur Bestattung freigegeben. Am Nachmittag will ein Bestatter die Tote in sein Beerdigungsinstitut überführen. Der Obduzent wartet bereits auf mich. Er soll mir das Sektionsprotokoll erklären, die versachlichte Dokumentation des Todes.
Die Interpretation von Verletzungen und der Todesursache ist die zweite wichtige Säule in der Fallanalyse. Je ungewöhnlicher die Verletzungen an der Leiche sind, desto mehr verraten sie über das Motiv des Täters und geben Einblicke in seine Psyche.
Den Rechtsmediziner kenne ich seit über zehn Jahren, schon oft habe ich mit ihm an Tatorten oder am Obduktionstisch gestanden, um über Todesart, Verletzungsmuster und Sterbezeitpunkt zu diskutieren. Manchmal waren wir unterschiedlicher Meinung, oft aber teilten wir die gleiche Einschätzung. Ich mag diesen Mann, der trotz seiner Nähe zum Tod immer gut gelaunt und hoch engagiert bei seiner Arbeit ist.
Eine fast drei Meter hohe Mauer verhindert neugierige Blicke auf den Eingang der über hundert Jahre alten Pathologie. Die Leiche von Michelle Reuter befindet sich jetzt nicht mehr im Obduktionssaal, sondern in einem kleinen Nebenraum. Hier ruhen bei 8 Grad Celsius die sogenannten «Polizeileichen». Menschen, die unter unklaren Umständen oder nicht natürlich gestorben sind. Die Todesermittler der Polizei müssen nun die Todesursache finden. Bis zur Klärung wird die Leiche nicht zur Beerdigung freigegeben.
Zu dritt betreten wir den gekühlten Raum: der Rechtsmediziner, ein Sektionsgehilfe und ich. Der hell geflieste Raum mit Tischen und Schränken aus Edelstahl strahlt kühle Funktionalität aus. In einer Ecke stehen einige blaue Boxen sowie Eimer mit Organteilen, die den Leichen für feingewebliche Untersuchungen zur Klärung der Todesursache entnommen wurden. Wir ziehen uns die dünnen OP-Handschuhe an. Nach der Untersuchung der Ermordeten werde ich meine Hände zusätzlich noch desinfizieren, das ist ein wichtiger Reinigungsakt für die Psyche. Der Sektionsgehilfe – auch Präparator genannt – öffnet die Kühlbox, schiebt eine fahrbare Hebebühne unter die Öffnung, zieht die Bahre mit der Toten auf das Gestell und nimmt das weiße Laken vom toten Körper herunter. An der gewaschenen nackten Leiche kann ich die Spuren des Verbrechens und der Obduktion gut erkennen: der mächtige Halsschnitt, der vom Sektionsgehilfen zugenäht worden ist; die Messerstiche in der Brust; der bei der Sektion entstandene «Y-Schnitt» des Obduzenten. Er hatte mit dem Skalpell von beiden Schultern aus bis zum Brustbein und von dort senkrecht bis zur Scham die Haut aufgeschnitten, um den Brustkorb zu öffnen und die Organe zu entnehmen.
Ich packe die Fotomappe aus und vergleiche die Aufnahmen mit den Verletzungen, die ich jetzt an der Leiche erkennen kann. Der Plan ist, alle Verletzungen vom Kopf bis zu den Füßen zu thematisieren. Der Rechtsmediziner deutet auf den linken Ohransatz der Leiche, wo er eine frische Schwellung feststellen konnte. Er zeigt mir sogleich auch am Hinterkopf eine genähte Platzwunde. Die Verletzung liegt oberhalb einer imaginären «Hutkrempenlinie». Dieser fast hundert Jahre alte Begriff stammt aus der Zeit, als die Männer noch Hüte trugen. Er wird seitdem von Rechtsmedizinern und Ermittlern noch immer herangezogen, um die Ursache der Verletzungen zu bestimmen: Liegen sie oberhalb einer gedachten Hutkrempe, sind sie wahrscheinlich durch Schläge mit einem Gegenstand entstanden. Entdeckt man sie unterhalb dieser Linie, ist wahrscheinlich ein Sturz die Ursache. Bei Michelle Reuter ist der Fall eindeutig: Der Täter wollte sie mit einem Gegenstand niederschlagen.
Im Gesicht der Toten sehe ich Platzwunden an der linken Augenbraue, am rechten Jochbein und an der Lippe. Sie beweisen, dass der Täter Michelle Reuter offenbar zwei-, dreimal brutal ins Gesicht geschlagen hat. Auch an den Armen kann ich Verletzungen erkennen: Die Ellen beider Unterarme sind voller Hämatome, ebenso der rechte Handrücken. Mit den beiden Experten aus der Rechtsmedizin bin ich einig, dass die Frau ihre Arme schützend vor ihren Kopf gehalten hat, um die Schläge abzuwehren. In der Sprache der forensischen Traumatologie spricht man von «defensiven Abwehrverletzungen». Die zerschnittenen Hände sind ein eindeutiger Beweis für die verzweifelten Versuche, sich vor der Messerattacke des Täters zu schützen. Wer mehrmals offensiv in die scharfe Klinge greift, um dem Täter das Messer zu entwinden, handelt aus höchster Not: Michelle Reuter war in größter Todesangst.
Der Rechtsmediziner liest aus seinem vorläufigen Obduktionsprotokoll noch mal alle Befunde vor. Ich muss über seine spezielle Sprache schmunzeln und komme kaum nach, alles in meinem Stenoblock zu schreiben: