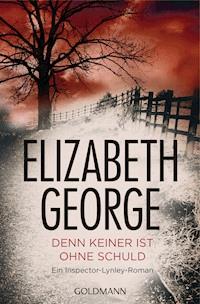9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
Die zehnjährige Charlotte ist verschwunden, und ihre Mutter, die Politikerin Eve Bowen, wittert ein abgekartetes Spiel.
Schließlich ist Leo, der Vater ihrer unehelichen Tochter, der Chef einer Boulevardzeitung, die nach Sensationen und Großauflagen giert. Erst als Charlotte tot aufgefunden wird, erfährt Inspector Lynley von dem Fall...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1068
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Die zehnjährige Charlotte ist spurlos verschwunden. Und sofort hat ihre Mutter, die konservative Politikerin Eve Bowen, einen Verdacht. Für sie kommt nur Dennis Luxford als Täter infrage. Denn er ist nicht nur der Vater der kleinen Charlotte, dem sie jeglichen Kontakt mit ihrer Tochter untersagt hatte, sondern auch der Chef einer berüchtigten Boulevardzeitung. Eves Verdacht erhärtet sich, als Luxford einen Erpresserbrief erhält: Um Charlottes Leben zu retten, müsse er sich zu seiner Erstgeborenen bekennen und zwar in seinem eigenen Blatt. Eve Bowen erscheint dies alles als abgekartetes Spiel, das ihre Karriere ruinieren und Luxford riesige Auflagen verschaffen soll. Rigoros lehnt sie jede Zusammenarbeit mit der Polizei ab und untersagt Luxford, den Forderungen des Erpressers Folge zu leisten. Schließlich einigen sich die beiden darauf, dass Luxford einen Bekannten, den Gerichtsmediziner Simon St. James, mit verdeckten Nachforschungen betraut. So kommt Inspector Lynley erst zum Einsatz, als Charlotte tot aufgefunden wird. Doch dann geschieht das Unfassbare: Ein weiteres Kind wird entführt – Leo, Luxfords ehelicher Sohn. Nach und nach taucht hinter Politaffären und Presseskandalen ein düsteres Geheimnis auf, das tief in der Vergangenheit begraben war – in einer grausamen verwirrten Seele …
Weitere Informationen zu Elizabeth George sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elizabeth George
Im Angesicht des Feindes
Ein Inspector-Lynley-Roman
Deutsch von
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »In the Presence of the Enemy« bei Bantam Books, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 1996 by Susan Elizabeth George
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1996
by Blanvalet Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: Getty Images (Design Pics / John Short)
KN · Herstellung: Str.
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-12029-0V012
www.goldmann-verlag.de
Zum Gedenken an Freddie La Chapelle 1948–1994 Ich schenke dir Unsterblichkeit auf die einzige bescheidene Weise, die mir zu Gebote steht.
Denn weder Mensch noch Engel auch vermag Die Heuchelei mit hellem Blick zu schauen, Das einz’ge Laster, das nur Gott allein Erkennen kann –
ERSTER TEIL
1
Charlotte Bowen dachte, sie sei tot. Sie öffnete die Augen in Kälte und Dunkelheit. Die Kälte war unter ihr und fühlte sich an wie die Erde in der Gartenurne ihrer Mutter, in der sich unter dem unablässigen Tropfen des Wasserhahns außen am Haus eine feuchte Stelle gebildet hatte, die grün war und muffig roch. Die Dunkelheit war überall. Drückend wie eine schwere Decke lag die Schwärze auf ihr, und sie kämpfte mit den Augen gegen sie an, um aus dem endlosen Nichts eine Form herauszuschälen, die ihr sagen würde, dass sie nicht in einem Grab lag. Anfangs rührte sie sich nicht. Sie streckte weder Finger noch Zehen aus, weil sie die Wände des Sarges nicht fühlen wollte, weil sie nicht wissen wollte, dass der Todsowar, während sie doch geglaubt hatte, er käme mit Heiligen und Sonnenglanz und schaukelnden und Harfe spielenden Engeln.
Sie lauschte angespannt, hörte jedoch keinen Laut. Sie schnupperte, aber es war nichts zu riechen außer dem Moder feuchter alter Mauern. Sie schluckte und nahm das flüchtige Aroma von Apfelsaft wahr. Der Nachgeschmack reichte, um die Erinnerung zu wecken.
Ja, er hatte ihr Apfelsaft gegeben. Er hatte ihr eine Flasche gereicht, mit aufgeschraubtem Deckel und feucht glänzenden Tröpfchen auf dem Glas. Er hatte gelächelt und einmal kurz ihre Schulter getätschelt. »Du brauchst keine Angst zu haben, Lottie«, hatte er gesagt. »Das würde deine Mama nicht wollen.«
Mama. Sie war es, um die es ging. Aber wo war sie? Was war mit ihr geschehen? Und Lottie? Was war mit Lottie geschehen?
»Es hat einen Unfall gegeben«, hatte er gesagt. »Ich soll dich zu deiner Mama bringen.«
»Wohin?«, hatte sie gefragt. »Wo ist Mama?« Und dann, lauter, weil sich ihr Magen plötzlich ängstlich verkrampft hatte und ihr die Art, wie er sie ansah, gar nicht gefallen hatte: »Sagen Sie mir, wo meine Mama ist. Sagen Sie es mir. Auf der Stelle!«
»Ist ja gut«, hatte er hastig versichert und sich dabei umgesehen. Genau wie ihrer Mama war ihr lautes Benehmen auch ihm peinlich. »Beruhig dich, Lottie. Sie ist in einem Gästehaus der Regierung. Du weißt doch, was das ist?«
Charlotte hatte den Kopf geschüttelt. Sie war ja erst zehn Jahre alt und hatte wenig Ahnung, was die Regierung eigentlich tat. Für sie bedeutete »in der Regierung sein« nur, dass ihre Mutter jeden Morgen vor sieben aus dem Haus ging und meistens erst nach Hause kam, wenn sie selbst längst schlief. Ihre Mutter fuhr in ihr Büro am Parliament Square. Sie ging zu Besprechungen im Innenministerium. Sie ging ins Unterhaus. Freitagnachmittags hielt sie Sprechstunde für ihren Wahlbezirk in Marylebone, während Lottie, in ein Zimmer mit gelben Wänden abgeschoben, in dem gewöhnlich der Exekutivausschuss des Wahlbezirks tagte, ihre Schularbeiten machte.
»Benimm dich«, pflegte ihre Mutter zu sagen, wenn Charlotte am Freitagnachmittag nach der Schule eintraf, und mit vielsagender Kopfbewegung auf das gelbe Zimmer zu weisen. »Ich möchte keinen Mucks von dir hören, solange wir hier sind, verstanden?«
»Ja, Mama.«
Darauf pflegte ihre Mutter zu lächeln und zu sagen: »Schön, jetzt gib mir einen Kuss und drück mich einmal ganz fest.« Ihr Gespräch mit dem Gemeindepfarrer oder dem Pakistani aus dem Lebensmittelgeschäft in der Edgware Road oder dem Grundschullehrer oder jedem anderen, der gerade zehn Minuten der kostbaren Zeit seiner Abgeordneten für sich abzweigen wollte, unterbrechend, drückte sie Lottie in einer steifen, schmerzhaften Umarmung an sich, gab ihr einen Klaps auf den Po und sagte: »Ab mit dir.« Dann wandte sie sich mit einem Lächeln – »Kinder!« – wieder ihrem Gesprächspartner zu.
Die Freitage waren die schönsten Tage. Nach der Sprechstunde fuhr Lottie mit ihrer Mutter zusammen nach Hause und erzählte ihr, was sie die Woche über getrieben hatte. Ihre Mutter hörte zu. Sie pflegte zu nicken, Lottie ab und zu das Knie zu tätscheln, dabei aber, knapp am Kopf des Chauffeurs vorbei, unverwandt zur Straße hinauszublicken.
»Mama«, sagte Lottie dann wohl nach einer Weile mit einem gequälten Seufzer, weil es ihr nicht gelang, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter von der Marylebone High Street auf sich selbst zu lenken. Mama brauchte doch gar nicht auf die Straße zu schauen. Sie fuhr doch gar nicht selbst. »Ichredemit dir. Wonach schaust du dauernd?«
»Ich gebe Obacht, Charlotte. Und ich würde dir raten, das auch zu tun.«
Aber anscheinend hatte sie nicht genug Obacht gegeben. Doch ein Gästehaus der Regierung? Was war das? So was wie ein Ferienhaus?
»Fahren wir jetzt zu dem Gästehaus?« Lottie hatte den Apfelsaft schnell hinuntergespült. Er schmeckte ein bisschen merkwürdig – gar nicht richtig süß –, aber sie trank ihn, weil sie wusste, dass es unhöflich gewesen wäre, einem Erwachsenen gegenüber undankbar zu erscheinen.
»Ja, da fahren wir jetzt hin«, hatte er gesagt. »Deine Mama wartet dort.«
Das war alles, woran sie sich mit Klarheit erinnern konnte. Danach war alles verschwommen. Die Augen waren ihr schwer geworden, während sie durch London fuhren, und innerhalb von Minuten, wie ihr schien, war sie nicht mehr fähig gewesen, ihren Kopf hochzuhalten. Undeutlich meinte sie sich erinnern zu können, dass jemand in freundlichem Ton gesagt hatte: »So ist es recht, Lottie. Mach ein kleines Nickerchen«, und eine Hand ihr behutsam die Brille abgenommen hatte.
Als ihr das einfiel, schob Lottie in der Dunkelheit ihre Hände zu ihrem Gesicht hinauf, die Arme dabei so dicht wie möglich an ihren Körper gedrückt, damit sie nicht die Wände des Sarges streiften, in dem sie lag. Ihre Finger berührten ihr Kinn und kletterten langsam ihre Wangen hinauf. Sie tasteten sich zu ihrem Nasenrücken. Ihre Brille war weg.
Das machte in der Dunkelheit natürlich nichts. Aber wenn das Licht anging … Doch wie sollte in einem Sarg Licht angehen?
Lottie holte einmal vorsichtig Luft. Dann noch einmal. Und noch einmal. Wie viel Luft?, dachte sie. Wie lange, ehe … Und warum? Warum?
Die Kehle wurde ihr eng, und in ihrer Brust stieg es heiß auf. Ihre Augen brannten. Ich darf nicht weinen, dachte sie, nur nicht weinen. Keiner darf sehen … Aber hier konnte man ja nichts sehen. Hier war nichts als undurchdringliches Schwarz auf Schwarz. Das ihr die Kehle zudrückte, es in der Brust heiß aufsteigen ließ und die Augen brennen machte. Nicht weinen, dachte Lottie. Bloß nicht weinen.
Rodney Aronson lehnte sich mit seinem Pferdehintern an das Fensterbrett im Büro des Chefredakteurs. Er spürte, wie sich die Lamellen der alten Sonnenjalousie in seinen Rücken drückten, während er aus einer Tasche seiner Safarijacke den Rest Nussschokolade herauskramte, den er sich aufgehoben hatte, und ihn mit der Hingabe eines Paläontologen, der gewissenhaft jedes Bröckchen Erde von den ausgegrabenen Überresten eines prähistorischen Menschen entfernt, aus der Silberfolie schälte.
Drüben, am Konferenztisch, saß locker und entspannt Dennis Luxford im Hochsitz, wie Rodney den Chefsessel zu nennen pflegte. Mit einem breiten Lächeln, das sein Koboldgesicht zu einem Dreieck verzog, hörte sich der Chefredakteur den letzten Bericht des Tages über die Strichjungen-Sause an, wie die Fleet Street den Vorgang in der letzten Woche getauft hatte. Der Bericht wurde vom besten Reporter ihrer ZeitungThe Sourcemit beträchtlichem Feuer vorgetragen. Mitchell Corsico war dreiundzwanzig Jahre alt, ein junger Mann mit einer närrischen Vorliebe für Cowboykleidung, der über den Instinkt eines Bluthunds und die Sensibilität eines Barrakudas verfügte. Er war genau der Mann, den sie in dem gegenwärtigen, von parlamentarischen Seitensprüngen, öffentlicher Entrüstung und Sexskandalen angereicherten Klima brauchten.
»In seiner Erklärung von heute Nachmittag«, sagte Corsico gerade, »hat unser hochgeschätzter Herr Abgeordneter von East Norfolk behauptet, seine Wählerschaft stehe wie ein Mann hinter ihm. Er sei unschuldig, solange seine Schuld nicht erwiesen sei, et cetera und tralala. Der loyale Parteivorsitzende versichert, der ganze Aufruhr sei allein die Schuld der Sensationspresse, die wieder einmal versuche, der Regierung das Wasser abzugraben.« Corsico blätterte auf der Suche nach dem dazugehörigen Zitat in seinen Notizen. Nachdem er es gefunden hatte, schob er seinen geliebten Stetson auf den Hinterkopf, warf sich in Pose und zitierte: »›Es ist kein Geheimnis, dass die Medien entschlossen sind, die Regierung zu stürzen. Die Strichjungen-Affäre ist lediglich ein weiterer Versuch, die Richtung der parlamentarischen Auseinandersetzung zu bestimmen. Aber wenn die Medien im Sinn haben sollten, die Regierung zu vernichten, werden sie auf würdige Gegner treffen, die, sei es nun in der Downing Street, in Whitehall oder in Westminster, nur darauf warten, den Kampf aufzunehmen.‹« Corsico klappte seinen Block zu und schob ihn in die Hüfttasche seiner abgetragenen Jeans. »Nobel geht die Welt zugrunde«, sagte er abschließend.
Luxford kippte seinen Sessel nach hinten und faltete seine Hände auf seinem beneidenswert flachen Bauch. Sechsundvierzig Jahre alt, mit dem Körper eines jungen Mannes und vollem aschblondem Haar dazu. Man sollte ihn abmurksen, dachte Rodney finster. Es wäre eine Erlösung für seine Mitarbeiter im Allgemeinen und Rodney im Besonderen, aus seinem eleganten Schatten heraustreten zu können.
»Wir brauchen die Regierung gar nicht zu stürzen«, sagte Luxford. »Wir brauchen nur in aller Ruhe zuzusehen, wie sie sich selbst den Garaus macht.« Zerstreut spielte er an seinen Hosenträgern aus Paisleyseide. »Hält Mr. Larnsey immer noch an seiner ursprünglichen Geschichte fest?«
»Wie ein Klammeraffe«, sagte Corsico. »Unser ehrenwerter Herr Abgeordneter von East Norfolk hat sein früheres Statement über das, wie er es nennt, ›unglückselige Missverständnis, das daraus entstand, dass ich letzten Donnerstagabend in einem Auto hinter dem Bahnhof Paddington saß‹, noch einmal bekräftigt. Er habe Informationen für den Ausschuss für Drogenmissbrauch und Prostitution gesammelt, behauptet er.«
»Gibt es denn einen Ausschuss für Drogenmissbrauch und Prostitution?«, fragte Luxford.
»Wenn nicht, können Sie sich darauf verlassen, dass die Regierungsoforteinen einsetzen wird.«
Luxford verschränkte seine Hände im Nacken und kippte seinen Sessel noch eine Spur weiter zurück. Er hätte nicht zufriedener aussehen können über die Entwicklung der Dinge. In der laufenden Regierungsperiode der Konservativen hatten die Sensationsblätter des Landes bereits alle möglichen Geschichten aufgedeckt: von Abgeordneten, die Geliebte hatten, die uneheliche Kinder hatten, die mit Callgirls verkehrten, die autoerotischen Neigungen frönten, die zwielichtige Immobiliengeschäfte machten, die fragwürdige Verbindungen zur Industrie unterhielten. Dies jedoch war eine Premiere: ein konservativer Abgeordneter, der soin flagrantiwie überhaupt möglich ertappt worden war – in inniger Umarmung mit einem sechzehnjährigen Strichjungen hinter dem Bahnhof Paddington. Das war der Stoff, aus dem Auflagenträume gemacht waren, und Rodney sah Luxford an, dass er im Geist schon die nächste Gehaltserhöhung ausrechnete, die man ihm wahrscheinlich geben würde, wenn die Bücher abgeschlossen und der Gewinn eingestrichen war. Der gegenwärtige Lauf der Ereignisse machte es ihm leicht, sein Versprechen, dieSourcezum meistgelesenen Blatt des Landes zu machen, zu erfüllen. Der verdammte Kerl hatte wirklich Schwein. Aber nach Rodneys Meinung war er nicht der einzige Journalist in London, der das Talent besaß, eine unerwartete Gelegenheit beim Schlafittchen zu packen wie der Jagdhund den Hasen und einen Knüller aus ihr herauszuschlagen. Er war weiß Gott nicht der einzige Krieger der Fleet Street.
»In spätestens drei Tagen lässt der Premierminister ihn fallen«, prophezeite Luxford. Er warf Rodney einen Blick zu. »Was meinen Sie?«
»Ich würde sagen, drei Tage sind ein bisschen lang, Den.« Rodney grinste im Stillen über Luxfords Gesicht. Der Chefredakteur hasste es, wenn man seinen Namen abkürzte.
Luxford bedachte Rodneys Antwort mit zusammengekniffenen Augen. Kein Dummkopf, unser guter Dennis, dachte Rodney. Aber er hätte es ja auch nicht so weit gebracht, wenn er sich der in seinem Rücken gezückten Dolche nicht stets bewusst gewesen wäre.
Luxford wandte seine Aufmerksamkeit wieder Corsico zu. »Was gibt’s sonst noch?«
Corsico hakte die einzelnen Punkte an seinen Fingern ab. »Larnseys Frau hat gestern erklärt, sie stehe voll hinter ihrem Mann. Ich habe aber aus guter Quelle gehört, dass sie heute Abend aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Dafür brauche ich einen Fotografen.«
»Rod wird sich darum kümmern«, sagte Luxford ohne einen weiteren Blick zu Rodney. »Weiter?«
»Die Konservativen von East Norfolk treffen sich heute Abend, um die ›politische Lebensfähigkeit‹ ihres Abgeordneten zu erörtern. Ich habe einen Anruf von einem Insider bekommen, der sagt, dass man Larnsey um den Rücktritt bitten wird.«
»Sonst noch etwas?«
»Wir warten auf einen Kommentar des Premierministers. Ach ja. Eins noch. Ein anonymer Anruf. Angeblich hätte Larnsey schon immer ein Faible für halbwüchsige Knaben gehabt, auch schon in der Schule. Die Ehefrau sei vom Tag der Hochzeit an nur Fassade gewesen.«
»Was ist mit dem Strichjungen?«
»Der hält sich im Moment versteckt. In der Wohnung seiner Eltern in South Lambeth.«
»Wird er reden? Kann man von den Eltern etwas erwarten?«
»Daran arbeite ich noch.«
Luxford senkte seinen Sessel nach vorn. »Gut dann«, sagte er und fügte mit seinem dreieckigen Lächeln hinzu: »Machen Sie weiter so, Mitch.«
Corsico tippte kurz an seinen Stetson und ging zur Tür, durch die in diesem Moment Luxfords Sekretärin eintrat, eine Frau von sechzig Jahren, die mit zwei Briefstapeln zum Konferenztisch ging. Stapel eins bestand aus geöffneten Briefen und wurde links vom Chefredakteur deponiert. Stapel zwei enthielt ungeöffnete Briefe mit dem VermerkVertraulichoderPersönlichund wanderte auf Luxfords rechte Seite. Dann holte die Sekretärin den Brieföffner aus dem Schreibtisch ihres Chefs und legte ihn genau fünf Zentimeter von den ungeöffneten Briefen entfernt auf den Tisch. Sie brachte den Papierkorb und stellte ihn neben Luxfords Sessel. »Sonst noch etwas, Mr. Luxford?«, fragte sie ehrerbietig wie jeden Abend, bevor sie ging. Ein Flötensolo, Miss Wallace, antwortete Rodney im Stillen. Auf die Knie, Weib! Und stöhnen Sie gefälligst dabei. Er musste unwillkürlich lachen bei der Vorstellung, wie Miss Wallace – wie immer in Tweedrock, Twinset und Perlenkette – zwischen Luxfords Schenkeln kniete. Um seine Erheiterung zu verbergen, senkte er hastig den Kopf und betrachtete den Überrest seiner Schokolade.
Luxford war dabei, die ungeöffneten Briefe durchzusehen. »Rufen Sie meine Frau an, bevor Sie gehen«, sagte er zu seiner Sekretärin. »Ich werde wahrscheinlich spätestens um acht zu Hause sein.«
Miss Wallace nickte und marschierte in ihren soliden Schuhen mit den Kreppsohlen lautlos zur Tür. Zum ersten Mal an diesem Tag allein mit dem Chefredakteur, rutschte Rodney vom Fensterbrett, als Luxford nach dem Brieföffner griff und sich die Korrespondenz zu seiner Rechten vornahm. Rodney hatte Luxfords Vorliebe, an ihn persönlich gerichtete Briefe eigenhändig zu öffnen, nie verstehen können. In Anbetracht der politischen Richtung der Zeitung – so weit links von der Mitte wie möglich, ohne rot oder kommunistisch genannt oder mit einem weitaus unliebenswürdigeren Etikett versehen werden zu können – konnte ein mitpersönlichgekennzeichneter Brief leicht eine Bombe enthalten. Da wäre es doch klüger, ein Fingerchen oder Äuglein von Miss Wallace zu riskieren, anstatt sich selbst einem Verrückten als Zielscheibe anzubieten. Aber Luxford war natürlich nicht gewillt, es so zu sehen. Nicht, dass er sich Miss Wallaces wegen Sorgen gemacht hätte. Vielmehr pflegte er zu erklären, es sei die Aufgabe des Chefredakteurs einer Zeitung, höchstpersönlich das Ohr am Puls der Öffentlichkeit zu haben.The Source,pflegte er zu erklären, würde die begehrte Spitzenreiterposition im Kampf um die Auflagenzahlen ganz sicher nicht erreichen, wenn der Chefredakteur seine Truppen von der Etappe aus dirigierte. Kein Chefredakteur, der sein Geld wert sei, verliere je den Kontakt zu seiner Leserschaft.
Rodney beobachtete Luxford bei der Lektüre des ersten Briefes. Der prustete verächtlich, knüllte das Blatt zusammen und warf es in den Papierkorb. Er öffnete das zweite Schreiben und überflog es. Mit einem leisen Lachen sandte er es dem ersten nach. Er hatte den dritten, vierten und fünften Brief gelesen und war dabei, den sechsten zu öffnen, als er in zerstreutem Ton, der, wie Rodney wusste, beabsichtigt war, sagte: »Ja, Rod? Haben Sie etwas auf dem Herzen?«
Was Rodney auf dem Herzen hatte, war die Wut darüber, dass man ihn um den Posten gebracht hatte, den Luxford nun innehatte: Herr der Mächtigen, Imprimatur-Geber, Erster vom Dienst, Obermacker, kurz: der ehrwürdige Chefredakteur derSource.Man hatte ihm vor sechs Monaten die sauer verdiente Beförderung versagt und Luxford vorgezogen. Ihm fehlten »die erforderlichen Instinkte«, um bei derSourcejene Veränderungen vorzunehmen, die das Blatt auf Erfolgskurs bringen würden, hatte der schweinsköpfige Aufsichtsratsvorsitzende ihm mit sonorer Stimme erklärt. »Was für Instinkte?«, hatte er höflich gefragt. »Die Killerinstinkte«, hatte der Mann erwidert. »Luxford besitzt sie im Übermaß. Sie brauchen sich nur anzusehen, was er für denGlobegetan hat.«
Gewiss, er hatte denGlobe,ein Blatt, das sich nur noch müde mit Filmklatsch und schwülstigen Geschichten über die königliche Familie dahinschleppte, zur meistgelesenen Zeitung des Landes gemacht. Aber er hatte es nicht getan, indem er das Niveau anhob. Dazu hatte er, wie schon gesagt, das Ohr zu dicht am Puls der Öffentlichkeit. Er hatte es getan, indem er an die niedrigen Instinkte der Leser appellierte. Und wie damals beimGlobebot er ihnen auch jetzt ein tägliches Menü aus Skandalgeschichten, von den sexuellen Eskapaden diverser Politiker bis zur Heuchelei in der anglikanischen Kirche, die er mit Berichten über die scheinbare und höchst seltene Ritterlichkeit des kleinen Mannes würzte. Das Resultat war ein echter Festschmaus für Luxfords Leser, die jeden Morgen millionenfach ihre fünfunddreißig Pence auf den Tisch legten, als wäre es der Chefredakteur derSourceallein – und nicht auch sein Mitarbeiterstab, nicht auch Rodney Aronson, der genauso auf Draht war und fünf Jahre mehr Erfahrung hatte als Luxford –, der den Schlüssel zu ihrer Seligkeit in der Hand hielt. Und während der Schlaumeier sich in seinem Erfolg sonnte, plagten sich die übrigen Londoner Blätter damit ab, Schritt zu halten. Alle gemeinsam drehten sie der Regierung eine lange Nase und sagten: »Leckt uns doch mal hochachtungsvoll am Arsch«, wenn diese wieder einmal drohte, ihnen irgendwelche Kontrollen aufzuzwingen. Auf die Stimme des Volkes konnte man sich in Westminster nicht mehr stützen, solange die Presse den Premierminister jedes Mal runterputzte, wenn ein konservativer Abgeordneter sein Teil dazu beitrug, die, wie sich immer deutlicher zu zeigen schien, grundlegende Heuchelei der Tories offenkundig zu machen.
Nicht, dass Rodney Aronson es als schmerzlich empfunden hätte, das Schifflein der Konservativen sinken zu sehen. Er hatte, seit er zum ersten Mal zur Wahl gegangen war, stets Labour gewählt oder schlimmstenfalls die Liberalen. Den Gedanken, dass die Labour-Partei vom derzeitigen Klima politischer Unruhe profitieren könnte, fand er äußerst befriedigend. Unter anderen Umständen hätte Rodney also das tägliche Spektakel von Pressekonferenzen, empörten Telefonanrufen, Forderungen nach einer Sonderwahl und Unkenrufen über den Ausgang der in den nächsten Wochen anstehenden Kommunalwahlen genießen können. Unter den gegebenen Umständen jedoch, mit Luxford am Ruder, wo er wahrscheinlich auf unabsehbare Zeit bleiben und Rodneys eigenen Aufstieg verhindern würde, verspürte Rodney nur Wut. Er versuchte sich einzureden, sein Zorn komme nur daher, dass er der bessere Journalist sei. In Wahrheit war er eifersüchtig.
Er war seit seinem sechzehnten Lebensjahr bei derSource,hatte sich vom Laufjungen zu seiner gegenwärtigen Stellung als stellvertretender Chefredakteur dank reiner Willenskraft, Charakterstärke und Begabung hochgearbeitet. Die Spitzenposition stand ihm zu, und alle wussten es. Auch Luxford. Genau das war der Grund, weshalb ihn der Chefredakteur jetzt so scharf beobachtete und ihm, Fuchs, der er war, die Gedanken vom Gesicht ablas, während er auf eine Antwort wartete. Ihnen fehlt der Killerinstinkt, hatte man ihm gesagt. Ja. Gut. Sie würden die Wahrheit noch bald genug erkennen.
»Haben Sie noch was auf dem Herzen, Rod?«, wiederholte Luxford, ehe er wieder auf seinen Briefstapel hinuntersah.
Ja, deinen Job, dachte Rodney. Doch er sagte: »Diese Strichergeschichte – ich denke, es wäre besser, da eine Pause einzulegen.«
»Warum?«
»Sie wird schal. Wir bringen die Sache seit Freitag als Aufmacher. Gestern und heute war es nicht mehr als Aufgewärmtes von Sonntag und Montag. Ich weiß, dass Mitch Corsico neuen Entwicklungen auf der Fährte ist, aber solange er die nicht hat, sollten wir eine Kampfpause einlegen, finde ich.«
Luxford legte Brief Nummer sechs auf die Seite und strich die überlangen Koteletten, die seine persönliche Note waren; eine Geste, die, wie Rodney wusste, ausdrücken sollte: »Chef denkt über die Meinung eines Untergebenen nach.« Dann nahm er Brief Nummer sieben und schob den Brieföffner unter die Klappe des Kuverts. In dieser Pose verharrte er, während er antwortete.
»Die Regierung hat sich selbst in diese Situation gebracht. Der Premierminister hat uns seine ›Rückbesinnung auf britische Grundwerte‹ als Teil des Parteiprogramms beschert, richtig? Das ist gerade mal zwei Jahre her. Wir fühlen den Tories nur auf den Zahn, um herauszufinden, was diese Rückbesinnung auf britische Grundwerte ihnen wirklich bedeutet. Die einfachen Leute glauben alle, damit sei eine Rückkehr zu menschlicher Anständigkeit und dem Abspielen der Nationalhymne nach dem Kino gemeint. Unsere Herren und Damen Abgeordneten sehen es offenbar anders.«
»Das ist richtig«, pflichtete Rodney bei. »Aber soll es denn aussehen, als wollten wir die Regierung mit einer unendlichen Geschichte darüber zu Fall bringen, was ein schwachsinniger Abgeordneter in seiner Freizeit mit seinem Schwanz treibt? Zum Teufel, wir haben genug andere Munition, die wir gegen die Tories einsetzen können. Warum greifen wir also nicht –«
»Sollten Sie in elfter Stunde moralische Skrupel entwickeln?« Luxford zog spöttisch eine Augenbraue hoch und wandte sich wieder seinem Brief zu. Er schlitzte den Umschlag auf und zog das gefaltete Blatt Papier heraus. »Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut, Rod.«
Rodney bekam heiße Wangen. »Ich sage ja nur, wenn wir die Regierung mit schwerer Artillerie unter Beschuss nehmen wollen, dann sollten wir vielleicht darüber nachdenken, ob wir das Feuer nicht auf wesentlichere Ziele als auf kleine Abgeordnete und ihr Freizeitvergnügen richten wollen. Das tut die Presse doch seit Jahren, und was haben wir damit erreicht? Die Kerle sind immer noch an der Macht.«
»Ich denke, unsere Leser sind der Meinung, dass ihren Interessen wohl gedient ist. Wie hoch, sagten Sie, waren unsere letzten Auflagenzahlen?« Das war Luxfords alter Trick. Er stellte solche Fragen nie, ohne die Antwort bereits zu wissen. Wie um das zu betonen, richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf das Schreiben in seiner Hand.
»Ich sage ja gar nicht, dass wir diese außerehelichen Sexspielchen ignorieren sollen. Ich weiß, dass das unser tägliches Brot ist. Aber wenn wir die Geschichte so drehen, dass es aussieht, als hätte die Regierung …« Rodney merkte, dass Luxford gar nicht zuhörte. Vielmehr blickte er stirnrunzelnd auf den Brief in seiner Hand. Wieder strich er über seine Koteletten, aber diesmal war es keine leere Geste, diesmal war die Nachdenklichkeit echt. Rodney war sicher. Er sagte mit steigender Hoffnung, die er sich bemühte nicht zu zeigen: »Ist was, Den?«
Luxford knüllte den Brief in seiner Hand zusammen. »Quatsch«, sagte er und warf das Papier zu den anderen in den Korb. Er griff nach dem nächsten Brief und schlitzte ihn auf. »So ein absoluter Bockmist«, sagte er. »Die große hirnlose Masse spricht.« Er überflog das nächste Schreiben und sagte dann zu Rodney: »Das ist der Punkt, in dem wir uns unterscheiden. Sie betrachten unsere Leser anscheinend als erziehbar, Rod. Während ich sie so sehe, wie sie sind. Das große Heer der Ungewaschenen und Unbelesenen. Denen man ihre Meinung füttern muss wie lauwarmen Haferbrei.« Luxford schob seinen Sessel vom Tisch weg. »Gibt es heute Abend sonst noch was? Ich habe nämlich noch einen Haufen Anrufe zu erledigen, und zu Hause wartet eine Familie auf mich.«
Ja, es gibt noch was, dachte Rodney. Deinen Job. Der mir zusteht, nachdem ich diesem verdammten Käseblatt zweiundzwanzig Jahre lang die Treue gehalten habe. Laut sagte er: »Nein, Den, nichts. Jedenfalls im Moment nicht.«
Er ließ sein Schokoladenpapier zwischen die weggeworfenen Briefe des Chefredakteurs fallen und ging zur Tür.
»Rod«, sagte Luxford, als er sie aufzog. Und als er sich umdrehte: »Sie haben Schokolade am Bart.«
Luxford lächelte, als Rodney hinausging.
Doch das Lächeln erlosch, sobald der andere verschwunden war. Dennis Luxford drehte seinen Sessel zum Papierkorb. Er zog den Brief heraus. Er glättete ihn auf dem Konferenztisch und las ihn von Neuem. Er bestand nur aus der Anrede und einem einzigen Satz, und er hatte nichts mit Strichjungen, Autos oder dem Abgeordneten Sinclair Larnsey zu tun.
»Luxford –
Verwenden Sie die Titelseite, um Ihr erstgeborenes Kind anzuerkennen, und Charlotte wird freigelassen.«
Luxford starrte auf das Blatt hinunter. Das Pochen seines Blutes klang ihm hell und schnell in den Ohren. Rasch erwog er eine Handvoll Möglichkeiten, wer der Absender sein könnte, doch sie waren alle so unwahrscheinlich, dass er nur eine einzige, simple Lösung sah: Der Brief musste ein Bluff sein. Dennoch griff er, vorsichtig, um die Reihenfolge, in der er die Korrespondenz weggeworfen hatte, nicht durcheinanderzubringen, in den Papierkorb und fischte den Umschlag heraus, der das Schreiben enthalten hatte. Ein Teil des kreisrunden Poststempels neben der Briefmarke, ein Viertel etwa, fehlte. Er war blass, doch immerhin so deutlich, dass Luxford erkennen konnte, dass der Brief in London aufgegeben worden war.
Luxford lehnte sich in seinem Sessel zurück und las die ersten neun Wörter noch einmal. »Verwenden Sie die Titelseite, um Ihr erstgeborenes Kind anzuerkennen.« Charlotte, dachte er.
Seit zehn Jahren gestattete er sich höchstens einmal im Monat, an Charlotte zu denken, sich eine Viertelstunde lang zu der Vaterschaft zu bekennen, die er vor aller Welt erfolgreich geheim gehalten hatte. Den Rest der Zeit verdrängte er die Existenz des Kindes aus seiner Erinnerung. Nie hatte er mit einem Menschen über es gesprochen. Manchmal schaffte er es sogar, völlig zu vergessen, dass er mehr als ein Kind hatte.
Er nahm Brief und Umschlag und ging damit zum Fenster. Schweigend sah er zur Farrington Street hinunter, von der gedämpfter Verkehrslärm heraufdrang.
Jemand, den er kannte, jemand aus seiner nächsten Nähe, aus der Fleet Street vielleicht oder aus Wapping oder aus dem gigantischen Glasturm drüben auf der Isle of Dogs, wartete nur darauf, dass er einen falschen Schritt tun würde. Jemand da draußen, der aus Erfahrung wusste, wie eine Story, die mit den aktuellen Ereignissen überhaupt nichts zu tun hatte, sich in der Presse aufblähen und die Gier der Öffentlichkeit nach einem spektakulären Sündenfall wachkitzeln konnte, rechnete damit, dass er in Reaktion auf diesen Brief unüberlegt eine Spur legen und dadurch eine Verbindung zwischen sich und Charlottes Mutter herstellen würde. Und sobald das geschehen war, würde die Presse zuschlagen. Ein Blatt würde die Geschichte aufdecken. Die anderen würden folgen. Und Charlottes Mutter und er würden für ihren Fehltritt bezahlen. Sie würde mit öffentlicher Brandmarkung und politischer Entmachtung bestraft werden. Er durch einen Verlust mehr persönlicher Natur.
Mit einer gewissen bitteren Belustigung vermerkte er, wie er da mit seinen eigenen Waffen angegriffen wurde. Wäre nicht gewiss gewesen, dass der Regierung weitaus mehr Schaden drohte als ihm selbst, wenn die Wahrheit über Charlotte publik wurde, so hätte Luxford vermutet, dass ihm der Brief aus der Downing Street Nummer zehn zugesandt worden war, etwa nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Doch die Regierung hatte mindestens genauso viel Interesse daran, die Wahrheit über Charlotte ruhen zu lassen, wie er selbst. Und wenn die Regierung nichts mit diesem Schreiben und der versteckten Drohung, die es enthielt, zu tun hatte, dann musste irgendein anderer Feind dahinterstecken.
Und Feinde gab es wie Sand am Meer. Aus jedem Lebensbereich. Feinde, die begierig warteten. Die hofften, dass er sich verraten würde.
Dennis Luxford war zu geübt in der Kunst, den Konkurrenten immer um eine journalistische Nasenlänge voraus zu sein, um einen falschen Schritt zu tun. Eben weil er mit den Methoden der Presse, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, bestens vertraut war, hatte er es geschafft, die Talfahrt derSourcezu bremsen und das Steuer herumzureißen. Er beschloss darum, den Brief wegzuwerfen und zu vergessen. Sollten seine Feinde sehen, was sie damit anfangen konnten. Und wenn er einen zweiten erhalten sollte, würde auch der in den Papierkorb wandern.
Er knüllte das Schreiben ein zweites Mal zusammen und ging vom Fenster weg, um das Papier zu den anderen zu werfen. Doch da fiel sein Blick auf die Korrespondenz, die bereits geöffnet auf dem Konferenztisch lag. Was, wenn tatsächlich ein weiterer Brief eintreffen würde, diesmal nicht ausdrücklich an ihn persönlich gerichtet, sondern ohne Vermerk auf dem Umschlag, so dass jeder ihn öffnen konnte, oder mit dem Namen Mitch Corsico oder eines der anderen Reporter versehen, die derzeit das Lotterleben der Politiker unter die Lupe nahmen? Der Brief würde in diesem Fall gewiss nicht so verschlüsselt formuliert sein. Er würde Namen, Daten und Ortsangaben enthalten, und was als Bluff begonnen hatte, würde sich zu einem vielstimmigen Schrei nach der Wahrheit auswachsen.
Das konnte er verhindern. Es bedurfte nur eines Anrufs und einer Antwort auf die einzige Frage, die im Moment zählte: Hast du es jemandem gesagt, Eve? Irgendjemandem? Irgendwann während der letzten zehn Jahre? Über uns? Hast du es jemandem erzählt?
Wenn sie es nicht getan hatte, war der Brief nichts als ein Versuch, ihn zu erschrecken. Das war leicht wegzustecken. Wenn doch, musste sie erfahren, dass ihnen beiden eine Belagerung mit schwerem Geschütz bevorstand.
2
Nachdem Deborah St. James ihr Publikum gebührend vorbereitet hatte, legte sie drei große Schwarzweißfotografien auf einen der Arbeitstische im Labor ihres Mannes. Sie stellte die Leuchtstofflampen ein und trat zurück, um das Urteil ihres Mannes und seiner Mitarbeiterin, Lady Helen Clyde, abzuwarten. Seit vier Monaten experimentierte sie mit dieser neuen Fotoserie, und wenn sie auch mit den Ergebnissen recht zufrieden war, so fühlte sie sich doch in letzter Zeit zunehmend unter Druck, einen echten finanziellen Beitrag zum gemeinsamen Haushalt zu leisten. Es sollte ein regelmäßiger Beitrag sein, nicht wie bisher abhängig von den Zufallsaufträgen, die sie ergatterte, indem sie bei Werbeagenturen, Talentagenturen, Zeitschriften, Nachrichtenagenturen und Verlagen hausieren ging. In den Jahren seit Abschluss ihrer Ausbildung hatte Deborah immer mehr das Gefühl, drei Viertel ihrer Zeit damit zu verbringen, ihre Mappe kreuz und quer durch London zu schleppen, obwohl sie doch vom ersten Tag an nichts anderes gewollt hatte, als mit ihrem Fotografieren reine Kunst zu produzieren. Andere, von Stieglitz bis Mapplethorpe, hatten es doch auch geschafft. Warum nicht sie?
Deborah presste die Hände zusammen und wartete darauf, dass ihr Mann oder Helen Clyde etwas sagen würden. Sie waren mitten in der Auswertung eines Gutachtens über Wasser-Gel-Sprengstoffe gewesen, das Simon vor vierzehn Tagen für eine Gerichtsverhandlung erstellt hatte, und hatten danach eigentlich im Auftrag eines Strafverteidigers, der sich davon eine Entlastung seines des Mordes angeklagten Mandanten erhoffte, zu einer Analyse von Spuren übergehen wollen, die irgendein Werkzeug auf der Metallumrandung eines Türknaufs hinterlassen hatte. Doch sie hatten nichts dagegen gehabt, eine Pause einzulegen. Sie waren seit neun Uhr morgens an der Arbeit, hatten sich nur zwei kurze Unterbrechungen zum Mittag- und zum Abendessen gegönnt, und soweit Deborah sehen konnte, war zumindest Helen jetzt, um halb zehn Uhr abends, bereit, für heute Schluss zu machen.
Simon beugte sich über die Fotografie eines Skinheads von der National Front, Helen studierte eine kleine Westinderin, die einen riesigen flatternden Union Jack hochhielt. Sowohl der Skinhead als auch das Mädchen standen vor einer tragbaren Kulisse, die Deborah aus großen Dreiecken einfarbig bemalter Leinwand angefertigt hatte.
Als weder Simon noch Helen sich äußerten, sagte sie: »Die Bilder sollen persönlichkeitsspezifisch sein, versteht ihr? Ich möchte das Subjekt nicht objektivieren, wie ich das früher immer getan habe. Ich bestimme den Hintergrund – das ist die Kulisse, an der ich im letzten Februar gearbeitet habe, weißt du noch, Simon? –, aber die Person bestimmt das Bild. Sie kann sich nicht verstecken. Sie kann sich nicht verstellen, weil die Verschlussgeschwindigkeit zu gering ist und das Modell die Verstellung nicht so lange aufrechterhalten kann, wie die Belichtungszeit es verlangen würde. Also, was meint ihr?«
Sie sagte sich, es spiele keine Rolle, was die beiden dazu meinten. Sie war mit diesem neuen Ansatz auf dem richtigen Weg und entschlossen, dabei zu bleiben. Aber es täte gut, von unabhängiger Seite zu hören, dass die Arbeit gut war, wie sie glaubte, selbst wenn diese unabhängige Seite ihr eigener Mann war, der Mensch, von dem am wenigsten zu erwarten war, dass er an ihren Bemühungen etwas auszusetzen finden würde.
Er trat von dem Foto des Skinheads weg, ging um Helen herum, die noch immer die kleine Fahnenträgerin betrachtete, und sah sich das dritte Foto an, einen Rastafari mit einem eindrucksvoll mit Perlen bestickten Schal, der sein durchlöchertes T-Shirt bedeckte. Er sagte: »Wo hast du die aufgenommen, Deborah?«
»Covent Garden. In der Nähe vom Theatermuseum. Als Nächstes möchte ich zur St.-Botolph’s-Kirche. Zu den Obdachlosen. Du weißt schon.« Sie wartete gespannt, während Helen zu einem anderen Bild trat. Sie konnte es sich gerade noch verkneifen, an ihrem Daumennagel zu kauen.
Endlich sah Helen auf. »Ich finde sie großartig.«
»Wirklich? Ganz ehrlich? Ich meine, findest du … sie sind anders, nicht? Was ich wollte … ich meine … ich arbeite mit einer Polaroid, und ich habe die Abdrücke von der Transporttrommel gelassen und ebenso die Spuren der Chemikalien auf den Abzügen, weil ich möchte, dass sie sich als Bilder zu erkennen geben. Sie sind die künstliche Wirklichkeit, während die Sujets selbst die Wahrheit sind. Wenigstens … na ja, so möchte ich es gern sehen …« Deborah hob ihre Hände zu ihrem Haar und schob sich die kupferroten Locken aus dem Gesicht. Sie war nicht wortgewandt. Das war schon immer so gewesen. Sie seufzte. »Das versuche ich …«
Simon legte ihr den Arm um die Schultern und gab ihr einen herzhaften Kuss auf die Wange. »Ganz wunderbar«, sagte er. »Wie viele Aufnahmen hast du gemacht?«
»Oh, Dutzende. Hunderte. Na ja, vielleicht nicht gerade Hunderte, aber eine ganze Menge. Ich habe gerade erst angefangen, diese übergroßen Abzüge zu machen. Ich hoffe, sie sind gut genug, um ausgestellt zu werden … in einer Galerie, meine ich. Wie Kunst. Sie sind ja schließlich Kunst, und …« Sie verstummte, als sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Als sie sich der Tür zum Labor zuwandte, sah sie ihren Vater – langjähriges Mitglied des einen oder anderen St.-James-Haushalts –, der in die obere Etage des Hauses in der Cheyne Row hinaufgestiegen war.
»Mr. St. James«, sagte Joseph Cotter, an seiner eisernen Gewohnheit festhaltend, Simon niemals beim Vornamen zu nennen. Er hatte sich bis heute nicht richtig daran gewöhnen können, dass seine Tochter seinen jungen Arbeitgeber geheiratet hatte. »Sie haben Besuch. Ich habe die Herrschaften ins Arbeitszimmer geführt.«
»Besuch?«, fragte Deborah. »Ich hab gar nichts gehört. Hat es denn geläutet, Dad?«
»Dieser Besuch braucht nicht zu läuten«, antwortete Cotter. Er trat ins Labor und betrachtete stirnrunzelnd Deborahs Fotografien. »Scheußlicher Kerl«, bemerkte er über den Skinhead. Und zu Deborahs Mann sagte er: »Es ist David. Mit irgendeinem Bekannten mit seidenen Hosenträgern und schicken Schuhen.«
»David?«, fragte Deborah. »David St. James? Hier? In London?«
»Hier im Haus«, erwiderte Cotter. »Und sieht wieder mal aus wie der letzte Penner. Wo dieser Bursche sich seine Garderobe besorgt, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich bei der Heilsarmee. Soll ich Kaffee bringen? Die beiden sehen aus, als könnten sie eine Tasse gebrauchen.«
Deborah lief schon die Treppe hinunter. »David? David?«, rief sie, während oben ihr Mann sagte: »Kaffee, ja. Und wie ich meinen Bruder kenne, wird auch der Rest vom Schokoladenkuchen willkommen sein.« Er wandte sich an Helen. »Machen wir Schluss für heute. Du willst jetzt sicher gehen.«
»Lass mich erst noch David begrüßen.« Helen schaltete das Licht im Labor aus und folgte St. James zur Treppe, die dieser wegen seines geschienten linken Beines sehr langsam und vorsichtig hinuntersteigen musste. Cotter kam als Letzter.
Die Tür zum Arbeitszimmer war offen. Drinnen sagte Deborah gerade: »Was tust du denn hier, David? Warum hast du nicht angerufen? Sylvie oder den Kindern fehlt doch nichts, oder?«
David gab seiner Schwägerin einen leichten Kuss auf die Wange. »Nein, es geht ihnen gut, Deb. Alles bestens. Ich bin zu einerEG-Handelskonferenz hier. Dennis hat mich hier aufgestöbert. – Ah, da ist ja Simon. – Dennis Luxford, mein Bruder Simon. Meine Schwägerin. Und Helen Clyde. – Helen, wie schön! Wir haben uns ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.«
»Weihnachten das letzte Mal«, erwiderte Helen. »Am ersten Feiertag im Haus deiner Eltern. Aber da war so ein Getümmel, dass ich dir verzeihe, dass du es vergessen hast.«
»Ich habe wahrscheinlich den ganzen Nachmittag nur am Buffet gestanden.« David klatschte sich mit beiden Händen auf seinen runden Bauch, der so ziemlich das einzige Merkmal war, das ihn von seinem jüngeren Bruder unterschied. Er und Simon glichen sich, wie alle St.-James-Geschwister, beinahe wie ein Ei dem anderen. Sie hatten das gleiche lockige dunkle Haar, die gleiche Größe, die gleichen scharfkantigen Gesichter, die gleiche Augenfarbe, die immer zwischen Grau und Blau zu schwanken schien. Gekleidet war er, wie Cotter es beschrieben hatte: ausgefallen. Von den Birkenstocksandalen und den Rautenmustersocken bis hinauf zu Tweedjackett und Polohemd war David der Eklektizismus in Person und ein einziges modisches Desaster. Aber im Geschäft war er ein Genie und hatte den Umsatz des Familienunternehmens um das Vierfache gesteigert, seit sein Vater sich zur Ruhe gesetzt hatte.
»Ich brauche deine Hilfe.« David setzte sich in einen der beiden Klubsessel am Kamin und bedeutete den anderen mit der Selbstsicherheit eines Mannes, der es gewohnt ist, Heerscharen von Angestellten zu befehlen, sich ebenfalls zu setzen. »Oder genauer gesagt, Dennis braucht deine Hilfe. Deshalb sind wir hergekommen.«
»Hilfe inwiefern?« St. James betrachtete den Mann, der mit seinem Bruder gekommen war, er stand etwas abseits im Halbschatten in der Nähe der Wand, an der Deborah regelmäßig wechselnde Beispiele ihrer Arbeit aufzuhängen pflegte. Luxford war ein äußerst fit wirkender Mann mittleren Alters von relativ bescheidener Statur. Der elegante blaue Blazer, die Seidenkrawatte und die beigefarbene Hose schienen ihn als Dandy auszuweisen, das Gesicht jedoch zeigte einen Ausdruck feinen Misstrauens, in das sich in diesem Moment ein gerüttelt Maß an Ungläubigkeit mischte. St. James kannte den Ursprung dieser Ungläubigkeit, sie begegnete ihm immer wieder, und doch sah er sie nie ohne ein momentanes Gefühl der Niedergeschlagenheit. Dennis Luxford wollte Hilfe irgendeiner Art, aber er glaubte nicht, dass er sie von jemandem, der augenscheinlich ein Krüppel war, bekommen würde. St. James hätte am liebsten gesagt: »Es ist nur das Bein, Mr. Luxford. Mein Verstand funktioniert tadellos.« Stattdessen wartete er darauf, dass der andere das Gespräch eröffnete, während Helen und Deborah auf dem Sofa und auf dem Sitzkissen Platz nahmen.
Luxford schien nicht erfreut darüber, dass die beiden Frauen offensichtlich vorhatten, sich hier für die Dauer des Gesprächs häuslich niederzulassen. Er sagte: »Es handelt sich um eine persönliche Angelegenheit, die streng vertraulich behandelt werden muss. Ich bin nicht bereit –«
David St. James unterbrach ihn. »Das sind die drei Menschen in ganz England, von denen du am wenigsten befürchten musst, dass sie deine Geschichte an die Medien verkaufen, Dennis. Ich vermute, sie wissen nicht einmal, wer du bist.« Und dann zu den anderen: »Wisst ihr es? Schon gut. Ich seh’s euch an, dass ihr keine Ahnung habt.«
Dann erklärte er. Er und Luxford, sagte er, hatten zusammen an der Universität Lancaster studiert, waren im Debattierklub hitzige Gegner gewesen und hatten nach dem Examen gemeinsam gefeiert. Sie waren nach Abschluss des Studiums miteinander in Verbindung geblieben, jeder hatte mit Interesse die erfolgreiche Karriere des anderen verfolgt. »Dennis schreibt«, fuhr David fort. »Und er schreibt verdammt gut, wenn ihr’s genau wissen wollt.« Eigentlich war er nach London gekommen, um sich einen Platz in der schöngeistigen Literatur zu erobern, wie David berichtete, aber irgendwie war er an den Journalismus geraten und dabei geblieben. Er hatte als politischer Korrespondent für denGuardianangefangen. Heute war er Chefredakteur.
»DesGuardian?«, fragte Simon.
»DerSource.« Luxford sagte es mit herausforderndem Blick. BeimGuardiananzufangen und bei derSourcezu enden konnte vielleicht nicht gerade als himmelstürmender Aufstieg betrachtet werden, doch Luxford war offensichtlich nicht in Stimmung, sich kritisieren zu lassen.
David schien den Blick gar nicht zu bemerken. Mit einer Kopfbewegung in Luxfords Richtung sagte er: »Er hat dieSourcevor sechs Monaten übernommen, Simon, nachdem er denGlobezur Nummer eins gemacht hatte. Er war der jüngste Chefredakteur in der Geschichte der Fleet Street, als er denGlobeleitete, und der erfolgreichste. Und der ist er immer noch. Sogar dieSunday Timeshat das zugegeben. Sie hat in ihrem Magazin einen großen Artikel über ihn gebracht. Wann war das, Dennis?«
Luxford überhörte die Frage. Er schien sich unter Davids Lobgesängen zu winden. Einen Moment strich er nachdenklich über seine überlangen Koteletten. »Nein«, sagte er schließlich zu David. »Das hat keinen Sinn so. Es ist viel zu riskant. Ich hätte nicht herkommen sollen.«
Deborah machte Anstalten aufzustehen. »Wir gehen«, sagte sie. »Helen, kommst du?«
Doch St. James, der den Journalisten aufmerksam musterte, fühlte sich durch irgendetwas an ihm – vielleicht die Gewandtheit, mit der er die Situation manipulierte? – getrieben zu sagen: »Helen Clyde ist meine Mitarbeiterin, Mr. Luxford. Wenn Sie meine Hilfe brauchen, werden Sie um die ihre nicht herumkommen, selbst wenn es im Moment nicht so aussieht. Und meine Frau nimmt an all meiner Arbeit Anteil.«
»Das wär’s dann«, sagte Luxford und wandte sich schon zum Gehen.
David St. James hielt ihn zurück. »Irgendjemandem musst du vertrauen«, sagte er und wandte sich wieder an seinen Bruder. »Das Problem ist, dass hier eine Tory-Karriere auf dem Spiel steht.«
»Das müsste Sie doch eigentlich freuen«, sagte St. James zu Luxford. »DieSourcehat aus ihrer politischen Linie nie ein Geheimnis gemacht.«
»Hier handelt es sich um eine besondere Karriere«, erklärte David. »Erzähl es ihm, Dennis. Er kann dir helfen. Entweder du hältst dich an ihn oder an einen Fremden, der vielleicht nicht Simons ethische Grundsätze hat. Du kannst natürlich auch zur Polizei gehen. Aber wohin das führen wird, weißt du ja.«
Während Dennis Luxford über die Möglichkeiten nachdachte, brachte Cotter den Kaffee und den Schokoladenkuchen herein. Er stellte das Tablett auf den Couchtisch vor Helen und sah zur Tür, wo ein kleiner Langhaardackel sein Tun hoffnungsvoll beobachtete. »Hör mal, Peach«, sagte Cotter. »Hab ich dir nicht gesagt, du sollst in der Küche bleiben?« Der Hund bellte schwanzwedelnd. »Er hat eine Vorliebe für Schokolade«, erklärte Cotter.
»Er hat eine Vorliebe für alles«, korrigierte Deborah. Sie stand auf, um Helen, die den Kaffee einschenkte, die Tassen abzunehmen. Cotter hob den Hund hoch und begab sich in den rückwärtigen Teil des Hauses. Gleich darauf hörten sie ihn die Treppe hinaufgehen.
»Milch und Zucker, Mr. Luxford?«, fragte Deborah so liebenswürdig, als hätte Luxford nicht vor einem Augenblick noch ihre Integrität in Frage gestellt. »Möchten Sie ein Stück Kuchen? Mein Vater hat ihn gebacken. Er bäckt vorzüglich.«
Luxford sah aus, als wüsste er genau, dass er mit dem Entschluss, das Brot mit ihnen zu brechen – oder in diesem Fall den Kuchen –, eine Linie überschreiten würde, die er lieber nicht überschritten hätte. Dennoch nahm er an. Er ging zum Sofa, setzte sich ganz vorn auf die Kante und blieb einen Moment in Nachdenken versunken, während Deborah und Helen Kaffee und Kuchen herumreichten. Dann sagte er schließlich: »Also gut, mir ist klar, dass ich kaum eine Wahl habe.« Er griff in die Innentasche seines Blazers – wobei er die seidenen Hosenträger enthüllte, die Cotter so beeindruckt hatten – und zog einen Brief heraus, den er mit der Bemerkung an Simon weitergab, er habe ihn am Nachmittag mit der Post erhalten.
Simon betrachtete das Kuvert, ehe er das Schreiben selbst herauszog. Er las den kurzen Text und ging sofort zu seinem Schreibtisch, wo er einen Moment in einer Seitenschublade kramte, bis er einen Plastikumschlag gefunden hatte, in den er das Blatt Papier hineinsteckte. »Hat sonst noch jemand dieses Schreiben in der Hand gehabt?«, fragte er.
»Nein. Nur Sie und ich.«
»Gut.« Simon reichte die Plastikhülle an Helen weiter, dann sagte er zu Luxford: »Wer ist Charlotte? Und wer ist Ihr erstgeborenes Kind?«
»Charlotte. Sie ist mein erstgeborenes Kind. Sie ist entführt worden.«
»Sie haben die Polizei nicht informiert?«
»Wir können die Polizei nicht hinzuziehen. Wir können es nicht riskieren, dass das publik wird.«
»Es wird nicht publik werden«, entgegnete Simon. »Bei Entführungen ist absolute Geheimhaltung Vorschrift. Das wissen Sie doch genau. Ich würde annehmen, ein Journalist –«
»Ich weiß genau, dass die Polizei die Presse täglich auf dem Laufenden hält, wenn sie mit einer Entführung zu tun hat«, fiel Luxford ihm scharf ins Wort. »Unter der Bedingung, dass nichts davon gedruckt wird, bevor das Opfer zu seiner Familie zurückgekehrt ist.«
»Wo liegt dann das Problem, Mr. Luxford?«
»In der Person des Opfers.«
»Wieso? Sie ist Ihre Tochter.«
»Ja. Und die Tochter Eve Bowens.«
Helen sah Simon in die Augen, als sie ihm das Schreiben des Kidnappers zurückreichte. Sie zog die Brauen hoch.
Deborah sagte: »Eve Bowen? Ich verstehe nicht – Simon, weißt du …«
Eve Bowen, erklärte ihr David, sei die Staatssekretärin im Innenministerium und bekleide damit einen der exponiertesten Posten der konservativen Regierung. Sie habe den Aufstieg in dieses Amt mit beeindruckender Geschwindigkeit geschafft und schicke sich an, die nächste Margaret Thatcher zu werden. Ihr Wahlkreis sei Marylebone, und eben aus Marylebone sei ihre Tochter offenbar entführt worden.
»Als ich diesen Brief bekam«, warf Luxford ein, »habe ich sofort mit Eve telefoniert. Ich glaubte, ehrlich gesagt, es handele sich um einen Bluff. Ich dachte, irgendjemand hätte irgendwie unsere Namen in Verbindung gebracht und wollte mich jetzt zu einer Reaktion herausfordern, die verraten würde, dass früher eine Beziehung zwischen uns bestanden hat. Ich dachte, da sei jemand auf einen Beweis dafür aus, dass durch Charlotte eine Verbindung zwischen Eve und mir besteht, und die Behauptung, Charlotte sei entführt worden – und meine Reaktion darauf –, würde ihm diesen Beweis liefern.«
»Weshalb sollte jemand ein Interesse daran haben, Ihre Beziehung zu Eve Bowen aufzudecken?«, fragte Helen.
»Um die Story an die Medien zu verkaufen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie es sich in der Presse ausnehmen würde, wenn bekannt werden würde, dass ausgerechnet ich der Vater von Eve Bowens einzigem Kind bin. Besonders wenn man bedenkt, wie sie …« Er schien nach einem beschönigenden Wort zu suchen, das ihm nicht einfallen wollte.
Simon vollendete den Gedanken, ohne es freundlicher auszudrücken. »… wie sie die Tatsache, dass sie ein uneheliches Kind hat, in der Vergangenheit für ihre eigenen Ziele ausgeschlachtet hat?«
»Sie hat es ja praktisch zu ihrem Markenzeichen gemacht«, gab Luxford zu. »Sie können sich wohl vorstellen, wie die Presse mit ihr umspringen würde, wenn bekannt werden sollte, dass Eve Bowen ihre große Sünde aus Leidenschaft mit jemandem wie mir beging.«
O ja, das konnte Simon sich gut vorstellen. Die Abgeordnete von Marylebone pflegte seit Langem das Image der Frau, die einen Fehltritt gemacht und Wiedergutmachung geleistet hatte, die einen Schwangerschaftsabbruch mit der Begründung verworfen hatte, eine solche Lösung spiegele nur den Verfall der Werte in dieser Gesellschaft, die gut und recht an ihrem Kind gehandelt hatte. Dass sie die uneheliche Geburt ihrer Tochter nie verheimlicht hatte, hatte ebenso wie die Tatsache, dass sie noblerweise den Namen des Vaters nie preisgegeben hatte, zumindest teilweise dazu beigetragen, dass sie überhaupt ins Parlament gewählt worden war. Sie machte sich öffentlich für moralische Werte, Religion, Familiensolidarität und Treue zu König und Vaterland stark. Sie stand für alles, was dieSourcebei den konservativen Politikern verhöhnte.
»Ihre Geschichte hat ihr gute Dienste geleistet«, stellte Simon fest. »Eine Politikerin, die sich öffentlich zu ihren Fehlern bekennt! Da kann der Wähler schwer widerstehen. Ganz zu schweigen von einem Premierminister, dem daran liegt, seine Regierung zu stärken, indem er Frauen in wichtige Ämter beruft. Weiß er übrigens, dass das Kind entführt worden ist?«
»Niemand in der Regierung weiß etwas davon.«
»Und Sie sind sicher, dass es entführt wurde?« Simon deutete auf den Brief, den er auf den Knien liegen hatte. »Der Text ist in einer Art Blockschrift geschrieben. Das könnte leicht ein Kind getan haben. Besteht eine Möglichkeit, dass Charlotte selbst hinter dieser Sache steckt? Weiß sie von Ihnen? Könnte das ein Versuch von ihr sein, ihre Mutter unter Druck zu setzen?«
»Nie im Leben. Mein Gott, sie ist knapp zehn Jahre alt. Eve hat ihr nie etwas gesagt.«
»Können Sie da ganz sicher sein?«
»Natürlich kann ich nicht sicher sein. Ich kann mich nur auf das verlassen, was Eve mir gesagt hat.«
»Und Sie selbst haben auch mit niemandem gesprochen? Sind Sie verheiratet? Haben Sie es Ihrer Frau gesagt?«
»Ich habe es keinem Menschen erzählt«, erklärte er entschieden, ohne auf die anderen beiden Fragen einzugehen. »Und Eve sagt, dass auch sie mit niemandem darüber gesprochen hat, aber sie muss bei irgendeiner Gelegenheit etwas verraten haben – durch eine unbedachte Bemerkung oder eine Anspielung. Sie muss zu irgendjemandem was gesagt haben, der etwas gegen sie hat.«
»Gibt es niemanden, der etwas gegen Sie hat?« Helens dunkle Augen waren unschuldig, ihr Gesicht höflich interessiert, als hätte sie keine Ahnung, dass die ganze Philosophie derSourcedarin bestand, jedes schmutzige Geheimnis auszugraben und als Erste an die Öffentlichkeit zu bringen.
»Das halbe Land wahrscheinlich«, bekannte Luxford. »Aber meine berufliche Laufbahn wird es kaum ruinieren, wenn herauskommt, dass ich der Vater von Eve Bowens unehelicher Tochter bin. Ich werde in Anbetracht meiner politischen Ansichten eine Weile zum allgemeinen Gespött werden, aber mehr nicht. Eve, nicht ich, ist in der angreifbaren Position.«
»Warum hat man den Brief dann an Sie geschickt?«, fragte St. James.
»Wir haben beide einen bekommen. Meiner kam mit der Post. Der ihre wartete zu Hause. Der Haushälterin zufolge war er irgendwann im Lauf des Tages durch einen Boten gebracht worden.«
St. James musterte noch einmal den Umschlag des Schreibens. Er war am Tag zuvor abgestempelt worden.
»Wann ist Charlotte verschwunden?«, fragte er.
»Heute Nachmittag. Irgendwo zwischen der Blandford Street und der Devonshire Place Mews.«
»Liegt eine Lösegeldforderung vor?«
»Nein. Nur die Forderung an mich, die Vaterschaft öffentlich anzuerkennen.«
»Wozu Sie nicht bereit sind.«
»O doch, ich bin bereit dazu. Ich täte es lieber nicht, weil es mir natürlich Unannehmlichkeiten bescheren wird, aber ich bin dazu bereit. Eve ist diejenige, die nichts davon hören will.«
»Sie haben sie gesehen?«
»Mit ihr gesprochen. Danach habe ich David angerufen. Ich erinnerte mich, dass er einen Bruder hat … Ich wusste, dass Sie irgendwie mit gerichtlicher Ermittlungsarbeit zu tun haben oder hatten. Ich dachte, Sie könnten vielleicht helfen.«
St. James schüttelte den Kopf und reichte Luxford Brief und Umschlag zurück. »Nein, darauf kann ich mich nicht einlassen. Die Sache kann in aller Diskretion von der –«
»Hören Sie mir zu.« Luxford hatte weder seinen Kaffee noch seinen Kuchen angerührt, doch jetzt griff er nach seiner Tasse. Er nahm einen Schluck Kaffee und stellte die Tasse wieder hin. Ein wenig Kaffee schwappte über und rann über seine Finger. Er versuchte nicht, sie zu trocknen. »Sie wissen nicht, wie Zeitungen wirklich arbeiten. Die Polizei wird als Erstes Eve aufsuchen, und niemand wird davon erfahren. So weit, so gut. Aber die Ermittlungsbeamten werden mehr als einmal mit ihr sprechen wollen, und sie werden nicht bereit sein, auf einen Moment zu warten, wo sie unbeachtet zu Hause sitzt. Sie werden sie in ihrem Büro im Innenministerium aufsuchen, weil das von Scotland Yard aus bequemer ist – und dass diese Entführung zu einer Angelegenheit von Scotland Yard wird, wenn wir nicht jetzt etwas tun, um das abzubiegen, ist wohl klar.«
»Scotland Yard und das Innenministerium halten enge Verbindung«, erklärte St. James. »Das wissen Sie doch. Und selbst wenn dem nicht so wäre, würden sie die Beamten kaum in Uniform aufsuchen.«
»Glauben Sie im Ernst, sie müssten in Uniform kommen?«, fragte Luxford scharf. »Es gibt nicht einen einzigen Journalisten, der es nicht merkt, wenn er einen Polizeibeamten vor sich hat. Da kreuzt also ein Polizeibeamter im Innenministerium auf und fragt nach der Staatssekretärin. Ein Korrespondent einer der Zeitungen sieht ihn. Jemand im Innenministerium ist bereit zu quatschen – ein Sekretär, eine Sachbearbeiterin, ein Hausmeister, ein fünftrangiger Beamter, der Schulden und ein ausgeprägtes Interesse an Geld hat. Ganz gleich, wie es passiert, es passiert. Jemand quasselt also mit dem Korrespondenten. Und sofort richtet sich die Aufmerksamkeit seiner Zeitung auf Eve Bowen. Wer ist diese Frau, fragt die Zeitung. Was will die Polizei von ihr? Wer ist übrigens der Vater ihres Kindes? Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis sie über Charlotte zu mir finden.«
»Wenn Sie niemandem etwas gesagt haben, ist das unwahrscheinlich«, meinte St. James.
»Es spielt keine Rolle, was ich gesagt oder nicht gesagt habe«, entgegnete Luxford. »Der springende Punkt ist doch, dass Eve geredet hat. Sie behauptet, es nicht getan zu haben, aber sie muss geredet haben. Jemand weiß Bescheid. Jemand wartet. Wenn wir die Polizei hinzuziehen – also genau das tun, was der Entführer von uns erwartet –, kommt die Geschichte unweigerlich in die Presse. Und wenn das geschieht, ist Eve erledigt. Sie wird von ihrem Posten als Staatssekretärin zurücktreten müssen, und ich vermute, sie wird auch ihr Mandat verlieren. Wenn nicht sofort, dann bei der nächsten Wahl.«
»Es sei denn, sie wird zum Mittelpunkt öffentlicher Anteilnahme. Dann wäre diese Angelegenheit ihren Interessen äußerst dienlich.«
»Das«, sagte Luxford, »ist eine ganz besonders bösartige Bemerkung. Was wollen Sie unterstellen? Sie ist Charlottes Mutter, Herrgott noch mal!«
Deborah wandte sich ihrem Mann zu. Sie hatte auf dem Sitzkissen vor seinem Sessel gesessen. Mit leichter Hand berührte sie sein gesundes Bein und stand auf. »Kann ich mal mit dir sprechen, Simon?«, fragte sie.
St. James sah, wie erhitzt sie wirkte, und bedauerte sofort, dass er nichts unternommen hatte, um ihr dieses Gespräch zu ersparen. Sobald er gehört hatte, dass es sich um ein Kind handelte, hätte er sie unter irgendeinem Vorwand hinausschicken sollen. Kinder – und ihre eigene Kinderlosigkeit – waren ein wunder Punkt.
Er folgte ihr ins Speisezimmer auf der anderen Seite des Korridors. Die Hände hinter sich auf das glänzende Holz des Tisches gestützt, blieb sie stehen. »Ich weiß, was du denkst«, sagte sie, »aber das ist es nicht. Du brauchst mich nicht zu schützen.«
»Ich möchte mit dieser Sache nichts zu tun haben, Deborah. Das Risiko ist zu groß. Ich möchte es nicht auf dem Gewissen haben, wenn dem Kind etwas zustößt.«
»Aber das ist doch anscheinend keine typische Entführung, oder? Keine Lösegeldforderung, nur die Forderung nach öffentlicher Anerkennung. Und keine Todesdrohung. Wenn du ihnen nicht hilfst, werden sie nur zu jemand anders gehen, das weißt du doch.«
»Oder sie gehen zur Polizei, was sie im Übrigen gleich hätten tun sollen.«
»Aber du hast doch so etwas schon gemacht. Und Helen auch. In letzter Zeit natürlich nicht mehr. Aber früher. Und du warst gut.«
St. James antwortete nicht. Er wusste, was er tun sollte – das, was er bereits getan hatte: Luxford sagen, dass er die Finger von dieser Sache lassen würde. Aber Deborah sah ihn an, und ihr Gesicht spiegelte das rückhaltlose Vertrauen, das sie stets in ihn gehabt hatte. Das Vertrauen darauf, dass er das Richtige tun, eine weise Entscheidung treffen würde.
»Du kannst ja eine zeitliche Grenze setzen«, sagte sie vernünftig. »Wie wär’s, wenn du sagst, du gibst der Sache … äh … einen Tag? Oder zwei? Um vielleicht eine Spur aufzunehmen. Um mit Leuten zu sprechen, die das kleine Mädchen kennen. Um… ach, ich weiß auch nicht. Um etwas zu tun. Dann weißt du wenigstens, dass die Ermittlungen ordentlich geführt werden. Darum geht es dir doch, nicht wahr? Du möchtest sicher sein, dass alles richtig gehandhabt wird, oder?«
St. James berührte ihre Wange. Ihre Haut war heiß. Ihre Augen wirkten zu groß. Sie schien trotz ihrer fünfundzwanzig Jahre selbst noch ein halbes Kind zu sein. Er hätte sie Luxfords Geschichte nicht hören lassen dürfen, dachte er wieder. Er hätte sie zurück zu ihren Fotografien schicken sollen. Er hätte darauf bestehen sollen. Er hätte … St. James schüttelte die Gedanken ab. Deborah hatte recht. Immer wollte er sie schützen. Und dieser Drang, sie zu beschützen, war Gift für ihre Ehe, der größte Nachteil daran, dass er elf Jahre älter war als sie und sie seit ihrer Geburt kannte.
»Sie brauchen dich«, sagte sie. »Ich finde, du solltest ihnen helfen. Sprich wenigstens mit der Mutter. Hör dir an, was sie zu sagen hat. Das könntest du heute Abend noch tun. Du kannst mit Helen zu ihr fahren. Jetzt gleich.« Sie ergriff seine Hand, die immer noch auf ihrer Wange lag.
»Ich kann keine zwei Tage versprechen«, sagte er.
»Das macht nichts, Hauptsache, du kümmerst dich erst mal darum. Also – tust du es? Ich weiß, es wird dir nicht leidtun.«
Es tut mir jetzt schon leid, dachte St. James. Aber er nickte. Dennis Luxford hatte genug Zeit, sich zu sammeln, während er nach Hause fuhr. Er wohnte in Highgate, eine beträchtliche Strecke vom Haus der St. James’ in Chelsea entfernt, und während er seinen Porsche durch den Verkehr lenkte, ordnete er seine Gedanken und baute eine Fassade auf, von der er hoffte, seine Frau würde sie nicht durchdringen können.
Er hatte sie nach dem Gespräch mit Eve angerufen. Er würde nun leider doch später als erwartet heimkommen, erklärte er. »Sei mir nicht böse, Liebling. Hier hat sich einiges getan. In South Lambeth wartet einer meiner Fotografen darauf, dass Larnseys Strichjunge sich aus dem Haus seiner Eltern herauswagt, ein Reporter steht auch schon bereit, um die Aussage des Jungen aufzunehmen, wenn er eine machen sollte, und wir warten mit dem Druck so lange wie möglich, um es noch in der Ausgabe von morgen bringen zu können. Ich muss hier verfügbar sein. Vermassele ich dir deine Pläne für heute Abend?«
Fiona sagte nein. Sie hatte Leo gerade vorgelesen, als das Telefon läutete, oder genauer gesagt, sie hattemitLeo gelesen, weil niemand Leo vorlas, wenn Leo selbst wollte. Er hatte Giotto gewählt, gestand Fiona mit einem Seufzer. Schon wieder. Ich wollte, er würde mal anfangen, sich für eine andere Epoche zu interessieren. Lektüre über religiöse Gemälde schläfert mich ein.
Aber sie ist gut für deine Seele, hatte Luxford erwidert. Er hatte sich bemüht, freundlich-ironisch zu klingen, obwohl er dabei dachte: Sollte er sich in seinem Alter nicht für Dinosaurier interessieren? Für das Weltall? Großwildjäger? Schlangen und Frösche?
Wie, zum Teufel, kam ein Achtjähriger dazu, über einen Maler des vierzehnten Jahrhunderts nachzulesen? Und warum ermutigt ihn seine Mutter noch dazu?
Die beiden standen einander zu nahe, dachte Luxford nicht zum ersten Mal. Leo und seine Mutter waren seelisch zu stark miteinander verbunden. Es würde dem Jungen ungeheuer guttun, wenn er im Herbst nach Baverstock ins Internat kam. Leo fand die Aussicht gar nicht verlockend, Fiona noch weniger, aber Luxford wusste, es konnte für beide nur gesund sein. Hatte Baverstock nicht auch ihm geholfen? Ihn zum Mann gemacht? Ihm Richtung und Ziel gegeben? Hatte nicht der Besuch einer guten Privatschule ihn dahin gebracht, wo er heute stand?
Er verdrängte den Gedanken daran, wo er heute stand, heute Abend, in dieser Minute. Er musste die Erinnerung an den Brief und alles, was sich daraus ergeben hatte, auslöschen. Nur dann konnte er die Fassade aufrechterhalten.